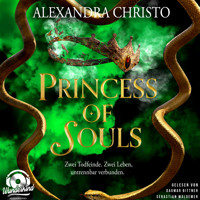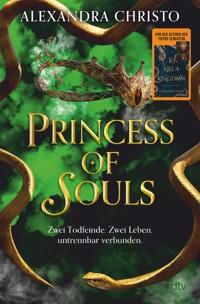
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Ich bin keine Prinzessin. Ich bin etwas viel Tödlicheres.« Selestras Bestimmung ist es, das Erbe ihrer Mutter anzutreten und als Hexe des Königs beim Schicksalsfest den Tod der Gäste vorherzusagen. Wer diesem Schicksal entkommt, hat einen Wunsch frei. Wer jedoch stirbt, dessen Seele raubt der König, um seine Unsterblichkeit zu sichern. Als der junge Elitesoldat Nox am Schicksalsfest teilnimmt, hat er nur ein Ziel: In einem Rachefeldzug die königliche Familie auszulöschen, angefangen mit Selestra. Doch eine Prophezeiung zwingt Selestra, Nox das Leben zu retten – und damit Hochverrat zu begehen. Nun machen der König selbst und Selestras machthungrige Mutter Jagd auf sie beide. Wenn sie überleben wollen, müssen Selestra und Nox zusammenarbeiten. Und dabei entwickeln sie Gefühle füreinander, die nicht sein dürfen … »Ein fesselnder Schreibstil, Figuren, die man sofort ins Herz schließt, und jede Menge humorvolle Passagen. Ich liebe dieses Buch!« Dilayra Verbrugh auf goodreads.com - Eine süchtig machende Enemies-to-Lovers-Romantasy um Liebe und Rache, Leben und Tod - Von der TikTok-Bestsellerautorin von ›To Kill a Kingdom‹ (deutsche Ausgabe: ›Elian und Lira – Das wilde Herz der See‹) Von Alexandra Christo außerdem erschienen bei dtv: ›Elian und Lira – Das wilde Herz der See‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
»Ich bin keine Prinzessin. Ich bin etwas viel Tödlicheres.«
Selestras Bestimmung ist es, das Erbe ihrer Mutter anzutreten und als Hexe des Königs beim Schicksalsfest den Tod der Gäste vorherzusagen. Wer diesem Schicksal entkommt, hat einen Wunsch frei. Wer jedoch stirbt, dessen Seele raubt der König, um seine Unsterblichkeit zu sichern.
Als der junge Elitesoldat Nox am Schicksalsfest teilnimmt, hat er nur ein Ziel: In einem Rachefeldzug die königliche Familie auszulöschen, angefangen mit Selestra. Doch eine Prophezeiung zwingt Selestra, Nox das Leben zu retten – und damit Hochverrat zu begehen.
Nun machen der König selbst und Selestras machthungrige Mutter Jagd auf sie beide. Wenn sie überleben wollen, müssen Selestra und Nox zusammenarbeiten. Und dabei entwickeln sie Gefühle füreinander, die nicht sein dürfen …
Eine süchtig machende Enemies-to-Lovers-Romantasy der TikTok-Bestsellerautorin
Von Alexandra Christo ist bei dtv außerdem lieferbar:
Elian und Lira – Das wilde Herz der See
Alexandra Christo
Princess of Souls
Roman
Aus dem Englischen von Petra Koob-Pawis
Für Mum und Dad, die immer wieder Magie in mein Leben gebracht haben
1
Selestra
Ich kann vorhersagen, wann jemand sterben wird. Ich brauche dazu nur eine Haarlocke dieses Menschen. Und seine Seele.
Nur für den Fall.
Das ist die Aufgabe einer Somniatis-Hexe, die dem König durch eine todbringende Magie auf ewig verpflichtet ist. Ich bin das, wozu ich erzogen wurde: eine Dienerin des Königreichs und Erbin der Macht meiner Familie.
Eine Hexe, durch Magie an die Sechs Inseln gebunden.
Deshalb habe ich noch nie einen Blick auf die Welt jenseits des Schwebenden Berges geworfen, auf dem dieses Schloss steht.
Was nicht heißt, dass ich eine Gefangene bin.
Ich bin das Mündel von König Seryth und eines Tages werde ich seine vertrauenswürdigste Beraterin sein. Die rechte Hand des Königs, frei zu gehen, wohin ich will, und zu tun, was ich will, ohne erst um Erlaubnis bitten zu müssen.
Und zwar an dem Tag, an dem meine Mutter stirbt.
Ich gehe durch die steinernen Schlosshallen, meine elfenbeinfarbenen Handschuhe schlängeln sich bis zu den Schultern hinauf, wo sie auf mein schimmerndes Kleid treffen. Sie sollen ein Schutzschild für meine Visionen sein, aber manchmal kommen sie mir eher wie Fesseln vor, die verhindern sollen, dass meine Wildheit ausbricht.
Die meine Magie in Schach halten sollen, bis die Zeit reif ist.
Ich bin keine Gefangene, sage ich mir.
Ich darf nur niemanden berühren.
Vor der Großen Halle warten Menschen, eine lange Reihe zukünftiger Leichen. Die meisten sind in Lumpen gekleidet – schmutzige Fetzen, die für sie wie eine zweite Haut sind –, aber einige wenige sind mit Juwelen behängt. Eine Mischung aus Arm und Reich und denen dazwischen.
Sie alle wollen verzweifelt den Tod überlisten.
Einmal im Jahr, im Monat des Roten Mondes, findet das Schicksalsfest statt, bei dem die Bewohner der Sechs Inseln eine Vorhersage von der königlichen Hexe erbitten können.
Die Warteschlange erstreckt sich bis um die nächste Ecke, daher sehe ich nicht, wie weit sie reicht, aber ich weiß ohnehin, wie viele Leute da sind. So viele wie jedes Jahr: zweihundert Seelen, die bereit sind, einen Handel einzugehen.
Ich versuche möglichst schnell an den Wartenden vorbeizuhuschen – nur ein Schatten, der kurz ihr Blickfeld streift. Aber sie bemerken mich trotzdem.
Und wenn sie mich sehen, schauen sie schnell weg.
Sie können den Anblick meiner grünen Haare und meiner Schlangenaugen nicht ertragen. All das, worin ich mich von ihnen unterscheide. Sie starren auf den Boden, als wären die Fliesen plötzlich so faszinierend, dass sie alle Blicke auf sich zögen.
Sie sehen nichts anderes in mir als eine Hexe, vor der man sich fürchten muss.
Ich frage mich, warum das so ist. Bisher habe ich nicht allzu viel Magie in mir. Mit sechzehn bin ich nur die zukünftige Trägerin der wahren Macht und warte auf den Tag, an dem die Magie meiner Familie auf mich übergeht.
»Jetzt warte doch einen Moment!«, ruft Irenya.
Die Schneidergehilfin – und meine einzige Freundin in diesem Schloss – ist mir im Laufschritt gefolgt und als ich draußen vor der Großen Halle innehalte, bleibt sie nach Luft schnappend neben mir stehen.
Dann streicht sie mein Kleid glatt, damit es keine Falten wirft. Wenn es um ihre Kreationen geht, ist Irenya mit nichts Geringerem als Perfektion zufrieden.
»Zapple nicht so herum, Selestra«, schimpft sie.
»Ich zapple nicht«, erwidere ich. »Ich atme nur.«
»Gut, dann hör auf damit.«
Ich strecke ihr die Zunge heraus und zupfe an den Fingerspitzen meiner Handschuhe, sodass der Stoff an meiner Haut reibt.
Die wiederholte Bewegung hat eine beruhigende Wirkung auf mich.
Und hält mich davon ab, zu sehr über alles nachzudenken, was gleich passieren wird.
Inzwischen sollte ich mich eigentlich daran gewöhnt haben. Ich sollte dankbar dafür sein, dass ich zwei Jahre lang an der Seite von König Seryth stehen durfte, um Haarlocken einzusammeln und mitzuerleben, wie die Menschen von allen Inseln herbeiströmen, um ihr Schicksal zu besiegeln.
Ich sollte mich auf das Fest freuen und auf all die Seelen, die wir ernten werden. Und darauf, wie meine Mutter von den Geheimnissen des Todes erzählt, als wäre er ein alter Freund.
Ich sollte nicht an all die Menschen denken, die sterben werden.
»Wir wollen doch nicht, dass du schon bei der ersten Vorhersage derangiert aussiehst«, sagt Irenya. Sie schnürt mein Kleid fester und ich weiß genau, dass sie dabei lächelt. »Stell dir vor, du beugst dich nach vorn, um eine Haarlocke abzuschneiden, und dein Ausschnitt klafft auseinander.«
»Glaub mir«, stoße ich keuchend hervor. »In diesem Ding werde ich mich ganz sicher nicht vorbeugen können.«
Irenya verdreht die Augen. »Ach, sei still«, sagt sie. »Du siehst aus wie eine Prinzessin.«
Das bringt mich fast zum Lachen.
Als ich klein war – und bevor meine Mutter eine Fremde wurde –, hat sie mir immer Geschichten von Prinzessinnen vorgelesen. Märchen von sittsamen Frauen, die machtlos in Türmen eingesperrt waren und darauf warteten, von einem schönen Prinzen gerettet zu werden, der sie in die Liebe und ins Abenteuer entführt.
»Ich bin keine Prinzessin«, sage ich zu Irenya.
Ich bin etwas viel Tödlicheres. Und niemand rettet mich aus meinem Turm.
Widerstrebend stoße ich die schweren Eisentüren der Großen Halle auf. Der Raum ist leer geräumt.
Verschwunden sind die Holztische, die in seiner Mitte standen, an denen der Wein in Strömen floss und hemmungsloses Gelächter erklang. Die Musikkapelle wurde weggeschickt und der Saal ist nur noch ein ausgehöhlter Raum zwischen vier Wänden.
Ein Außenstehender ahnt nicht, dass noch vor wenigen Stunden die wohlhabendsten Menschen des Königreichs den Beginn des jährlichen Festes gefeiert haben. Von meinem Turm aus konnte ich das Anschwellen der Musik hören. Ich konnte den Duft von Branntweinkuchen und Honig riechen, der durch die Ritzen meines Fensters hereinwehte.
Es riecht auch jetzt noch so. Kuchen und Kerzenwachs, verkohlte Dochte und süßschwere, rauchige Luft.
Am anderen Ende des Saals sitzt der König auf einem großen schwarzen Thron aus Knochen. Eine Liebesgabe meiner Ururgroßmutter.
Unsere Blicke begegnen sich kurz, als könnte er meine Anwesenheit spüren, und er winkt mich mit einem Fingerzeig zu sich heran.
Ich atme tief ein und gehe auf ihn zu.
Der Umhang meines Gewands weht hinter mir.
Es ist ein grässliches, im Kerzenlicht funkelndes Glitzerteil, das sich über meinen Körper ergießt, als hätte man alle Sterne vom Himmel geholt. Schwarzblau, dunkel wie die Unendliche See, kräuselt es sich um meinen Hals und tropft wie Wasser über meine blasse Haut. Den Rücken bedeckt ein bodenlanges, von kunstvollen Bändern gehaltenes Cape.
Auch wenn es Irenyas Kreation ist, so hat es doch vor allem die Farbe des Königs.
Wenn ich es trage, bin ich seine Trophäe.
»Mein König«, sage ich, als ich ihn erreiche.
»Selestra«, erwidert er beinahe gurrend. »Schön, dass du dich uns endlich anschließt.«
Er lehnt sich auf seinem Thron zurück.
König Seryth ist ebenso Krieger wie Herrscher, mit langen schwarzen Haaren und Ohrringen aus Schlangenzähnen. Die zischenden Vipern, die auch sein Wappen zieren, schlängeln sich als Tattoo auf seinem Gesicht und die Tierfelle, in die er gehüllt ist, geben den Blick auf seine ausgeprägten Brustmuskeln frei.
All das soll ihn bedrohlich aussehen lassen, aber ich fand sein ewig jugendliches Gesicht schon immer eher schön als beängstigend.
Die wahre Gefahr offenbart sich in seinen Augen, die dunkler sind als die Nacht und in denen nur der Tod lauert.
»Du siehst prachtvoll aus«, sagt er.
»Danke.«
Ich streiche mir eine Strähne meiner dunkelgrünen Haare hinter die Ohren.
Man hat mir nie erlaubt sie zu schneiden, daher reichen sie, wie auch die meiner Mutter, bis über die Taille. Mit dem Unterschied, dass sich meine Haare an den Enden kräuseln, während ihre so scharfkantig wie eine Klippe sind.
Alles an ihr ist kantig und spitz, darauf ausgelegt, zu verwunden.
»Guten Abend, Mutter«, sage ich und verbeuge mich vor ihr.
Theola Somniatis, schön wie immer, sitzt neben dem König auf einem Thron, dem die aufgemalten Chrim-Münzen einen besonderen Glanz verleihen. Schwarze Spitze umschließt ihren Körper in einem raffinierten Spiel aus Stoff und frei liegender Haut.
Sie wirkt stilvoll und bedrohlich zugleich.
Ein Messer, das der König stets mit sich führt.
Im Gegensatz zu mir braucht sie keine Handschuhe, die ihre Magie in Schach halten.
Sie schürzt ihre Lippen. »Du wärst fast zu spät gekommen.«
»Ich bin so schnell gelaufen, wie ich konnte, in diesen Schuhen«, sage ich und hebe den Saum meines Kleides an, um die gefährlich hohen Absätze zu zeigen.
Meine Füße sind bereits wund gerieben.
Der König lächelt amüsiert. »Jetzt, wo du hier bist, können wir anfangen.«
Er hebt die Hand, ein Zeichen für die Wachen an der Tür.
»Lasst den Ersten herein.«
Ich hole zittrig Luft.
Und so nimmt es seinen Lauf.
Ich frage mich, welche Schicksalsflüche der Tod uns heute zeigen wird.
2
Selestra
Die Wachen öffnen die Türen zur Großen Halle und ich sehe die erste Frau hereintreten.
Von zwei Soldaten flankiert, nähert sie sich zögernd dem Thron, kommt mit langsamen, schlurfenden Schritten auf uns zu. Ihr dunkelroter Rock ist am Saum vom Schlamm durchnässt.
Mein Nacken fängt an zu kribbeln, als sie näher kommt.
Tod liegt in der Luft.
Ich kann ihn praktisch schmecken.
Ich rieche ihn an den Knochen der Frau.
Als sie vor uns tritt, mit einem Rock in der Farbe von getrocknetem Blut und verwesenden Rosenblättern, weiß ich, dass sie diese Woche nicht überleben wird.
Ich spüre es.
Dann wird meine Mutter ihre Seele an sich nehmen und König Seryth wird sie verschlingen, wie er es schon seit über hundert Jahren tut, um seine Unsterblichkeit zu nähren.
»Eure Hoheiten«, sagt die Frau, als sie die Stufen zu den beiden Thronen erreicht hat.
Sie macht einen so tiefen Knicks, dass ihre Knie den Boden berühren und ihre Knöchel vor Anstrengung zittern.
Sie wirft einen Blick auf meine Mutter und ich sehe das Aufflackern von Panik in ihren Augen, bevor sie den Kopf senkt.
Sie fürchten uns. Sie hassen uns.
Und sie haben recht damit.
Ich recke das Kinn und sage mir, dass ich mich freuen sollte.
Dies ist die einzige Zeit im Jahr, in der ich von Magie umgeben bin. In der ich spüren kann, wie sie das Schloss einhüllt, wie die Macht meiner Vorfahren durch die Hallen weht wie der Duft süßen Weins.
Die einzige Zeit, in der ich nicht in meinem Turm bleiben muss.
Ich greife nach der Schere und steige die Stufen hinunter.
»Mit dieser Schere nehme ich dir eine Locke deines Haares und gewähre dir einen Platz beim Schicksalsfest«, sage ich zu der Frau. »In diesem Monat des Roten Mondes wirst du auf der Liste des Todes stehen. Er wird in der ersten Woche einmal und in der zweiten Woche zweimal zu dir kommen, um dich zu holen, und die Vorhersage, die wir dir heute geben, wird deine einzige Chance zum Überleben sein.«
Ich rezitiere die Zeilen mühelos, wie ich es seit meinem vierzehnten Lebensjahr tue.
»Wenn du stirbst, fällt deine Seele an den König. Aber wenn du die erste Hälfte dieses Monats überlebst, wirst du mit einem Wunsch deiner Wahl belohnt und von dem eingegangenen Handel entbunden werden.«
Die Frau nickt eifrig.
Die Aussicht auf die Erfüllung eines Wunsches versetzt das ganze Reich während des Schicksalsfests in Feierlaune. Ich habe gehört, dass die Bewohner der Stadt sogar Wetten abschließen und ihre Chrim daraufsetzen, wer es wohl schaffen wird, um danach bis in die frühen Morgenstunden zu feiern und zu zechen.
Die Menschen lassen sich nur auf diesen Handel ein, um einen Wunsch erfüllt zu bekommen.
Für die Armen und Verzweifelten ist es eine Chance, goldene Chrim oder Heilelixiere zu erbitten. Für die Reichen und Arroganten ist es eine Chance, ihre Feinde zu verfluchen und noch mehr Reichtum anzuhäufen.
Und alle sind der Meinung, dass es sich lohnt, dafür die eigene Seele zu riskieren.
Es sind nur drei Tode, sagen sie sich. Das kann ich schaffen. Und manchen gelingt es auch. Jedes Jahr kann eine Handvoll Menschen ihr Leben mit einem erfüllten Wunsch fortsetzen und andere dazu verlocken, es im nächsten Jahr selbst zu versuchen.
Aber jedes Jahr schaffen es mindestens hundert andere nicht.
Seltsam, dass man sich an sie weit weniger erinnert.
»Wenn du dich entscheidest, über die Halbzeit hinaus an dem Handel festzuhalten, dann sei gewarnt«, sage ich mit bedeutungsschwerer Stimme. »Denn anstelle des Todes wird der König selbst das Recht haben, dich bis zum Ende des Monats zu jagen. Solltest du jedoch den Roten Mond überleben, wird seine Unsterblichkeit auf dich übergehen.«
Ich spüre Seryths Lächeln in meinem Nacken.
Er hat keine Angst.
Er macht sich keine Sorgen, dass er seinen Thron jemals an einen dieser Menschen verlieren könnte.
»Dieser Handel kann mit deinem Tod enden oder dir unvergleichlichen Ruhm bescheren«, sage ich.
Es wird Ersteres sein. So ist es immer.
Der Tod hat die seltsame Angewohnheit, stets seinen Willen zu bekommen, und der König ebenso. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen.
Außerdem versucht niemand, der die Halbzeit erreicht hat, weiterzumachen. Vom Tod gejagt zu werden ist das eine, aber vom König selbst?
Schon bevor er die tödlichste Armee aller Zeiten aufstellte, war der König der gefährlichste Krieger auf den Sechs Inseln. Er hat über ein Jahrhundert überlebt, geschützt durch verfluchte Magie.
Es wäre Wahnsinn, auch nur zu versuchen ihn zu töten.
Am besten begnügt man sich mit dem Wunsch und kehrt schleunigst in die Sicherheit des eigenen Zuhauses zurück.
»Willigst du ein?«, frage ich die Frau.
Sie schluckt laut.
»Ja«, erwidert sie mit zittriger Stimme. »Bitte nimm einfach die Locke.«
Mit Händen, die ebenso unsicher sind wie ihre Stimme, deutet sie auf ihr Haar.
Ich greife nach einer Strähne und schneide ein Stück ab. Die Frau holt tief Luft, ihre Augen werden klarer.
Ich frage mich, ob sie etwas spürt. Dieses kleine Stück von ihr wird nun aufbewahrt, damit bei ihrem Tod ihre Seele in dieser Welt festgehalten wird.
Damit meine Mutter das Ritual vollziehen kann.
Damit sie auf immer dem König gehört.
»Es ist vollbracht«, sage ich.
Ich wende mich von ihr ab und lege das Haarbüschel in eines der zweihundert Glasgefäße, die die Thronstufen säumen.
»Tritt vor«, sagt Theola. »Streck den Arm aus.«
Ich höre die abgehackten Atemzüge der Frau, als sie die ersten beiden Stufen hinaufsteigt und niederkniet.
Theola streicht mit den Fingern federleicht über die Handfläche der Frau.
Sie schließt die Augen, lächelt langsam und Unheil verkündend.
Wir Somniatis-Hexen saugen Energie auf und lassen sie durch uns hindurchfließen. Energie wie die des Todes, die wir in unsere Adern rufen und die unsere Lippen benetzt. Sie gibt uns unsere Visionen und erlaubt es uns, die Seelen der Verlorenen zu nehmen, damit der König sie sich einverleiben kann.
Es ist verfluchte Magie, aber es ist die einzige Magie, die es auf den Sechs Inseln noch gibt.
Dafür hat meine Familie gesorgt.
Theola beißt sich auf die Lippe, als sie in die Zukunft der Frau blickt.
Ein Teil von mir möchte unbedingt sehen, was sie sieht. Ich möchte die Macht spüren, wenn ich in die Zukunft blicke, wenn ich die Geheimnisse des Schicksals enthülle und meine Magie von ihren Fesseln befreie.
Wenn ich jemanden berühre, zum ersten Mal seit Jahren.
Aber dann muss ich an Asden denken, meinen alten Mentor. Und daran, was passierte, als ich das letzte Mal jemanden berührte.
Ich weiß noch, wie er geschrien hat.
Der bloße Gedanke daran trifft mich wie ein Faustschlag. Schnell richte ich mich auf und verdränge die Erinnerung, bevor der König das kurze Erlöschen meines Lächelns bemerken kann.
Meine Mutter zieht ihre Hand zurück und blickt auf die kniende Frau, in deren Handfläche jetzt ein Brandmal mit König Seryths Wappen zu sehen ist: eine rauchschwarze Schlange, die in ihren Schwanz beißt.
Dieses Brandmal markiert alle, die den Tod suchen, und ist ein Zeichen für den Vertrag, den sie geschlossen haben.
»In der nächsten Woche wird deine jüngste Tochter einer Krankheit erliegen«, verkündet Theola.
Ihre Stimme ist eisig, kalt und glatt, als würde sie über das Wetter sprechen und nicht über den Tod.
Das war nicht immer so.
Früher war sie warm.
»Sie wird sterben«, fährt Theola fort. »Und einige Tage später, wenn du ihre Lieblingsblumen pflücken gehst, wirst du von einer Kreatur des Waldes angegriffen werden. Um dort zwischen den Bäumen zu verrotten.«
Die Frau schnappt nach Luft und ihre Hände hören auf zu zittern, als wäre sie vor Schreck wie erstarrt.
»Nein, meine Tochter darf nicht sterben.« Sie schüttelt den Kopf, kümmert sich überhaupt nicht um ihr eigenes Leben und den Tod, den meine Mutter für sie vorausgesehen hat. »Es muss einen anderen Weg geben. Wenn ich die erste Hälfte des Monats hinter mich bringe, kann ich mir ein Heilelixier wünschen und …«
»So lange wird sie gar nicht mehr leben.«
Meine Mutter spannt die Kiefermuskeln an, dann schließt sie ihre Faust und öffnet sie wieder, um eine goldene Chrim-Münze zum Vorschein zu bringen, die Sekunden zuvor noch nicht da war.
Sie drückt sie der schluchzenden Frau in die Hand.
»Für deine Mühen«, sagt sie. »Verbringe Zeit mit deinem Kind, solange du kannst. Wenn du überlebst, sehen wir dich vielleicht für einen neuen Wunsch wieder. Wenn du stirbst, denk daran, was du uns schuldest.«
Die Frau blinzelt und öffnet den Mund, als wolle sie schreien oder weinen oder versuchen gegen ihre Zukunft anzukämpfen. Aber alles, was herauskommt, ist ein Wimmern, bevor sie schließlich ihren Blick auf mich richtet.
Ich kann die Anschuldigung in ihren Augen sehen, als die Wachen sie hochziehen und aus dem Saal schleifen. Den Vorwurf, dass ich mich schämen sollte für meine monströse Familie und das Böse, das wir in die Welt haben eindringen lassen.
Aber sie weiß es nicht.
Sie versteht nicht, was es bedeutet, eine Somniatis-Hexe zu sein, die durch einen alten Blutschwur an den König gebunden ist. Vor die Wahl gestellt, Gefangene oder Königin der Magie zu sein, würde sich diese Frau wohl kaum anders entscheiden als ich. Sie versteht nicht, was passieren könnte, sollte ich es versuchen.
Und dennoch wende ich mich, sobald sie hinter den Eisentüren verschwunden ist, an meine Mutter.
»Glaubst du, die Frau wird den Wald meiden und auf die Blumen ihrer Tochter verzichten?«, frage ich sie.
Es ist eine dumme Frage und in dem Moment, in dem ich sie ausspreche, wünschte ich, ich könnte sie zurücknehmen.
»Was macht das schon?«, erwidert Theola mit einem tadelnden Unterton. »Solange wir die nötige Menge an Seelen bekommen, kann es uns egal sein, welche es sind.«
Ich weiß, dass sie recht hat.
Wichtig ist, dass wir bis zum Ende des Monats mindestens hundert Seelen haben. Genug, damit der König seine Unsterblichkeit aufrechterhalten und seine Herrschaft bis in alle Zeiten fortsetzen kann.
»Meinst du nicht auch, Selestra?«, fragt meine Mutter, als ich stumm bleibe.
Sie sieht mich warnend an, fordert mich wortlos auf schnell zu nicken.
»Natürlich«, sage ich.
Eine gut eingeübte Lüge.
»Meine Hexen beschäftigen sich nicht mit solchen Fragen.«
Der König sieht mich eindringlich an.
Seine Augen sind schwarz, schwarz, schwarz.
»Merk dir das, Selestra«, sagt er. »Vorausgesetzt, du schaffst es, eine Hexe zu werden, anstatt nur die Erbin zu sein.«
Ich neige den Kopf, wenn auch zähneknirschend.
Er nennt mich Erbin, als wäre das eine Beleidigung, denn mehr als das bin ich für ihn und die anderen nicht, bis ich irgendwann die nächste Somniatis-Hexe werde.
Erbinnen der Magie sind nutzlos, bis sie ihren achtzehnten Geburtstag erreichen und durch den Blutschwur an den König gebunden werden. Erst dann sind sie bereit, das wahre Wesen der Magie zu erfahren und ausgebildet zu werden, um die Nachfolge anzutreten, wenn die alte Hexe stirbt. Bis dahin bin ich völlig unerheblich.
Manchmal fühle ich mich wie ein Unkraut, das in einem seltsamen Garten wächst und sich nie ganz zwischen die anderen Pflanzen einfügen kann.
Der Rest des Abends verläuft nach dem gleichen Muster.
Die Menschen werden von den Wachen herein- und wieder hinausbegleitet, knien vor dem Thron, während Theola ihnen mit kaum verhohlener Langeweile ihre neuen Schicksale offenbart: von vertrauten Freunden verraten werden, im örtlichen Fluss ertrinken oder in einer Gasse vor der Taverne, die sie jeden Abend aufsuchen, aus dem Hinterhalt erstochen werden.
Sie alle haben denselben entsetzten Blick, wenn sie von ihrem Tod erfahren. Sie tun so, als sei es ein Fluch, der ihnen auferlegt wurde, und nicht etwas, das sie sich selbst ausgesucht haben.
Die ganze Zeit über schweige ich, spreche nur, um die Regeln des Festes zu rezitieren. Dutzende Male sammle ich Haarlocken ein, steige die Stufen hinunter und beobachte, wie der König jeden, der sich auf seinen Handel einlässt, gierig ansieht.
Jede neue Seele, die er mithilfe der Magie meiner Familie verschlingen wird.
Nur eine Handvoll von ihnen wird bis zur Hälfte des Monats durchhalten und einen Wunsch erfüllt bekommen.
Und kein Einziger von ihnen könnte jemals die zweite Hälfte des Weges schaffen, selbst wenn er die Kühnheit hätte, es zu versuchen.
3
Nox
Ich bin in vielen Dingen gut, aber am besten bin ich, wenn es darum geht, zu überleben.
Es fällt mir fast schon zu leicht – ich habe ein so ausgeprägtes Talent dafür, dass ich in all den Jahren kaum eine Narbe davongetragen habe, obwohl es mehr als einmal ziemlich knapp war. Ich weiß, wie man kämpft, aber das allein ist es nicht.
Die größte Fähigkeit, die mein Vater mir beigebracht hat, ist, wie man einen Raum betritt und alle sofort für sich einnimmt. Wie ich andere so beeinflussen kann, dass sie mich unbedingt in ihrer Nähe haben wollen.
Dass sie überzeugt sind, ich habe etwas Besonderes an mir.
Es gibt viele Dinge, die ihre Grenzen haben, aber Charme gehört selten dazu.
Und diesen Charme werde ich jetzt mehr denn je brauchen.
Wir nähern uns dem Schwebenden Berg, bereit, uns auf den Weg nach oben zu machen.
»Auf der Liste aller dummen Ideen, die du jemals hattest, steht diese an erster Stelle«, sagt Micah.
Ich sehe meinen besten Freund und Kameraden aus der Letzten Armee grinsend an. Er rückt die Klinge auf seinem Rücken zurecht und behält die Menschenmenge hinter uns im Auge.
Micah ist immer misstrauisch gegenüber allen und jedem außer mir.
»Du führst eine Liste mit all meinen schlechten Ideen?«, frage ich ihn.
Wir betreten die verzauberte Plattform, eine schmale, kunstvoll gefertigte Goldplatte vor einem Baum, der so hoch ist, dass er bis zu den Sternen reichen könnte.
Es ist der schnellste Weg auf den Berg, zum Schloss des Königs.
Micah nickt. »Es ist eine verdammt lange Liste.«
Ich zucke mit den Schultern. Er hat nicht ganz unrecht.
»An erster Stelle? Das kann nicht sein«, entgegne ich. »Was ist mit damals, als wir zum Abschluss der Rekrutenausbildung beschlossen haben, wir schleichen uns in die Kabine des Sergeants und stehlen sein –«
»Ja, schon gut«, sagt Micah schnell, weil er nicht will, dass ich die Geschichte laut wiederhole. »Das ist die zweitdümmste Idee, die du je hattest.«
Das kann gut sein, aber nur weil etwas gefährlich ist, heißt das nicht, dass es sich nicht lohnt. Manchmal bringen die riskantesten Dinge den größten Nutzen.
»Es ist noch nicht zu spät, deine Meinung zu ändern«, sagt Micah.
Die verzauberte Plattform setzt sich nach oben in Bewegung und der Himmel zieht an uns vorbei, während sie immer mehr an Geschwindigkeit gewinnt. Ich schaue auf die Welt unter uns, auf die Menschen, die so klein sind, dass man sie kaum noch erkennen kann.
Auf die Insel Vasiliádes, um die der König sein Reich errichtet hat.
Von hier oben sieht sie friedlich aus, fast so schön wie die Südinsel Polemistés.
Aber der Schein trügt.
Ich höre immer noch die Unendliche See, die Brandung, die gegen die Boote und das zerklüftete Ufer kracht wie ein Eindringling, der sich seinen Weg bahnen will. Das schwarze Wasser brodelt und weigert sich zuzufrieren, selbst im tiefsten Winter, wenn Schnee die Straßen bedeckt. Es verschlingt jegliches Eis und lässt es sofort wieder schmelzen. Und an Sommertagen wie heute, wenn die Sonne selbst abends noch auf die Stadt herunterbrennt, kräuselt sich das Wasser, schäumt von all der verfluchten Magie, die der König in die See hineinfließen ließ.
»Wenn du Angst hast, musst du nicht mitkommen«, sage ich zu Micah.
Die Plattform ist am Ziel angelangt. Ich steige schnell aus und eile mit großen Schritten an den Wachen der Haltestation vorbei.
Das Schloss ist wunderschön, umgeben von endlosem Grün und Hecken, an denen die süßesten Früchte reifen. Sogar die Felsen glänzen so silbern, dass man sagt, sie seien aus Sternschnuppen gemeißelt.
Was für eine Schönheit, um solche Monster zu beherbergen.
Micah läuft jetzt schneller, um mit mir Schritt zu halten.
»Ich habe keine Angst«, beteuert er. »Und ich werde dich nicht den Wölfen überlassen.«
Ich verdrehe die Augen. »Seryth ist kein Wolf. Er ist nur ein Mann.«
»Und was ist mit den Hexen?«, entgegnet Micah mit gedämpfter Stimme. »Sie sind keine Menschen und können nicht so leicht getötet werden wie du oder ich. Ihre Magie schützt sie, sogar vor dem Tod. Die Zeit kann ihnen genauso wenig anhaben wie dem König selbst.«
»Hexe«, korrigiere ich ihn, während wir den von Wachen gesäumten Weg entlanggehen.
Dieser ganze Ort ist eine Festung.
Für jemanden, der unsterblich ist, macht sich der König ziemlich viele Sorgen wegen seiner Feinde.
»Es gibt nur eine echte Hexe«, erinnere ich Micah. »Theolas Tochter wird erst in einigen Jahren ihre wahren Kräfte entfalten. Sie wird uns keinen Ärger machen.«
Micah wirft hastig einen Blick auf die Schlosswachen, um sicherzugehen, dass keiner von ihnen mich gehört hat.
»Du könntest zumindest versuchen leiser zu sprechen, wenn du schon über Verrat redest«, sagt er. »Geheimhaltung, Nox. Geheimhaltung.«
Kopfschüttelnd halte ich inne. »Du solltest wirklich hierbleiben.«
Micah könnte zur Belastung werden, wenn er sich so viele Sorgen macht, und das ist das Letzte, was ich im Moment brauche.
Er richtet sich auf, seine Hand wandert zu seinem Schwert. »Ich habe gesagt, dass ich dich da nicht allein reingehen lasse«, entgegnet er stur.
Das ist wirklich nett von ihm, aber völlig unnötig.
Ich drücke seine erhobene Hand wieder nach unten. »Entspann dich, Soldat«, sage ich betont locker, um ihm zu zeigen, dass ich unbesorgt bin. »Genieße den Sonnenuntergang, umwirb eine hübsche Wache, und warte hier auf mich.«
Micah kneift die Augen zusammen, während er abzuwägen versucht, ob er auf mich hören soll oder nicht.
»Wenn du in zehn Minuten nicht zurück bist, komme ich dich holen«, sagt er.
Ich grinse ihn an. »Wenn ich in zehn Minuten nicht zurück bin, gibt es nichts mehr zu holen.«
Das Schloss des Königs zu betreten fühlt sich an, als wäre man in einem Gefängnis gelandet.
Die Wände sind schwarz, dunkel wie die Augen des Königs, und hoch wie Wolken, durchwirkt mit Goldfäden in feinen Mustern, als hätte der Wind sie verweht.
Die Marmorböden ahmen die Wellen der Unendlichen See so täuschend echt nach, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn meine Füße durch die Fliesen gesunken und vom Wasser umspült worden wären.
Stattdessen klingen meine Schritte wie eine Uhr.
Wie die Zeiger der Taschenuhr meines Vaters, die fast genauso laut getickt haben.
Ticktack.
Komm schon, Nox! Noch ein bisschen schneller!
Ticktack.
So ist’s gut! Bei der Abschlussprüfung wirst du Klassenbester sein, Junge!
Ich habe seit Jahren nicht mehr auf diese Uhr geschaut. Sie liegt in einer Schublade in der Kaserne und zieht Staub und Spinnweben an, versteckt zwischen alten Papieren und meinem Lieblingsmesser.
Während meine Schritte in diesem Rhythmus widerhallen, höre ich nicht mehr die jubelnde Stimme meines Vaters. Ich höre nur noch die des Königs.
Ticktack. Ticktack.
Bereit zu sterben, Nox?
Ich gehe auf einen Wachtrupp vor der Großen Halle zu, der darauf wartet, den letzten Schicksalssucher einzulassen.
Jedes Jahr dürfen nur zweihundert eintreten und ihre Seelen aufs Spiel setzen. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht langweilen sich Seryth und seine Hexe, wenn es zu viele sind.
»Ich muss den König sprechen«, sage ich zu dem Soldaten direkt neben der Tür.
Der Mann trägt eine Uniform in demselben Gewitterblau wie ich. Sie hängt locker an ihm und lässt ihn jung erscheinen, als müsse er erst noch hineinwachsen.
»Name?«, fragt er.
»Offizier Nox Laederic«, antworte ich. »Vom Thánatos-Regiment.«
Als meine Antwort zu ihm durchgedrungen ist, fällt seine Kinnlade herunter.
Ich schätze, wir haben einen gewissen Ruf, aber daran bin ich nur zum Teil schuld.
»Du … du …«
»Ich weiß, in Person sehe ich noch besser aus. Darf ich vorbei?«
»Erwartet dich der König?«, fragt der Soldat, dessen Stimme jetzt einen Ton höher klingt.
»Natürlich, ich habe einen Termin in seinem Tagesplan eingetragen und ein kleines Herz daneben gemalt«, sage ich.
Der Wachmann erwidert mein Grinsen nicht, sondern fummelt an dem großen Kragen seines Hemdes herum. »Das darf ich nicht …« Er bricht ab. »Wir warten noch auf einen Schicksalssucher. Wie wär’s, wenn du später wiederkommst?«
Ich kann mir das Lachen nicht verkneifen.
Jahrelang habe ich mich vorbereitet und mir heute den ganzen Tag gesagt, dass es jetzt oder nie heißt, nur um dann an der Tür abgewiesen zu werden?
Wenn Micah hier wäre, würde er sich darüber aufregen. Oder er würde denken, es sei ein Zeichen, dass ich umkehren und die ganze Sache vergessen sollte.
Aber das ist völlig ausgeschlossen.
»Ich schätze, ich bin dieser eine«, sage ich zu dem Wachmann.
Ich gehe an ihm vorbei, lege meine Hand auf die Tür und drücke sie einen Spalt auf.
Niemand würde versuchen einen Soldaten der Letzten Armee aufzuhalten.
Schon gar nicht, wenn er mit einem Schwert bewaffnet ist.
»Wünsch mir Glück«, sage ich.
Die Wache blinzelt verdattert und starrt mich mit offenem Mund an, als ich in die Große Halle schlendere.
Ich mache mir nicht die Mühe, die dort postierten Wachen zu zählen. Eigentlich bin ich darauf trainiert, so etwas zu wissen und immer vorbereitet zu sein, aber heute Abend kann ich mich nur auf eine Sache konzentrieren.
Besser gesagt auf drei.
Seryth, König der Sechs Inseln, dem mein Vater jahrelang gedient hat. Dem meine gesamte Familie seit Generationen gedient hat. Seine Lippen verziehen sich zu einem Lächeln, während er mich von seinem gestohlenen Thron aus beobachtet.
Seine Hexe, mit ihren Schlangenaugen und Fingernägeln, die lang genug sind, um Blut zu vergießen.
Und die Erbin.
Selestra Somniatis.
Ich kann nicht anders, als sie anzuschauen.
Ihre Haut ist so blass, dass sie beinahe leuchtend wirkt. Ihr Haar, das die Farbe von Kleeblättern hat, ergießt sich über ihren Rücken bis zur Taille und reflektiert das hereinfallende Licht wie ein spiegelnder Fluss.
Es ist so lang, dass man fast Türme damit erklimmen könnte.
Ihre großen gelben Augen beobachten mich neugierig und auf ihren blutroten Lippen zeigt sich die Andeutung eines Lächelns.
Sie ist wirklich wunderschön.
Es ist eine Schande, dass sie sterben muss.
4
Selestra
Als der letzte Schicksalssucher die Große Halle betritt, fällt mir als Erstes auf, dass er nicht von Wachen eskortiert wird.
Im Gegensatz zu den anderen ist er allein, als er auf uns zuschreitet. Er blickt nicht zu Boden oder fuchtelt nervös mit den Händen, während er sich darauf vorbereitet, seine Seele gegen Magie oder Ruhm einzutauschen.
Mein Herz klopft schneller, als er auf uns zukommt, ohne auch nur zu blinzeln.
Er gehört nicht zu den Verzweifelten oder Leichtsinnigen, das weiß ich.
Er ist ein Soldat. Ein Krieger in König Seryths Armee.
Und er geht nicht nur – er stolziert.
Der Junge sieht umwerfend gut aus: hellbraune Haut, mitternachtsdunkles Haar, das sich an den Ohren kräuselt, und Augen in der Farbe von Winterlaub. Sein Blick hält meinen kurz fest und scheint dann durch mich hindurchzugehen.
Theola und der König lächeln, als er sich nähert, ihre Haltung ist nun wieder aufmerksam und neugierig.
Er trägt die Uniform der Letzten Armee, den langen schwarzen Mantel, der mit blauen Fäden durchwirkt ist. Das Schwert auf seinem Rücken ist halb unter seiner Kapuze verborgen und schimmert im zunehmenden Mondlicht.
Die Art, wie er sich bewegt, so schnell und anmutig, und dass er nicht einmal zusammenzuckt, wenn er meine Augen sieht – das alles erinnert mich an jemanden.
An die letzte Person, die ich berührt habe. An Asden und seine traurigen, traurigen Augen.
Ich bete, dass das Schicksal dieses Jungen nicht so tragisch sein wird.
»Mein König«, sagt er, als er die Treppe erreicht hat.
Er verbeugt sich und wendet sich an Theola.
»Mylady. Wie immer ein Vergnügen.«
Sein Lächeln sieht fast echt aus, als er ihre Hand ergreift und einen Kuss neben ihren Ring haucht.
Fast.
Ich habe Übung darin, ein vollkommenes Lächeln auf meine Lippen zu zaubern, und ich erkenne ein falsches schon aus einer Meile Entfernung. Aber Theola und der König bemerken es entweder nicht oder es ist ihnen egal. Sie sind beide entzückt von dem jungen Krieger und schauen ihn an, als wäre er etwas ganz Besonderes.
Es ist lange her, dass meine Mutter mich so angesehen hat. Alle Magie der Welt wartet nur darauf, an mich weitergegeben zu werden, aber irgendein dahergelaufener Soldat der Letzten Armee kommt in den Genuss ihres Lächelns.
»Nox.« Theolas Stimme ist seidig. »Was im Namen der Seelen tust du hier?«
»Gibt es Neuigkeiten von der Südinsel?«, fragt der König und setzt sich aufrechter hin. »Zeigen die Rebellen sich zur Kapitulation bereit?«
Der Junge – Nox – schüttelt den Kopf. »Polemistés ist nicht gefallen, mein König«, sagt er. »Die Entschlossenheit der Bevölkerung wächst so stetig wie ihre Zahl.«
»Was für Narren.« Der König spricht leise, aber seine Stimme dringt bis in die letzte Ecke des Saals. »Begreifen sie denn nicht, dass sie mich als ihren Anführer akzeptieren müssen? Die Sechs Inseln gehören mir.«
Seine Worte sind wie Gift.
Er schließt seine Hand langsam um einen Schädel, der den schwarzen Thron ziert und der jetzt unter dem Druck seiner Berührung zersplittert.
Seit ich denken kann, versucht König Seryth, die Südinsel zu erobern. Und auch schon lange vor meiner Geburt. Seit dem Wahren Krieg, in dem er als Erstes die Hexenkönigin von Thavma absetzte. Polemistés ist die einzige der Sechs Inseln, die sich ihm nicht unterworfen hat, auch dann nicht, als er ihren König tötete.
Ich weiß, dass er sie mehr will als alle anderen.
Polemistés ist die Insel, die er einst seine Heimat nannte und die er sich bis zuletzt aufgespart hat – so lange, dass sich eine Schar Rebellen zusammenfinden konnte, was ihn am meisten erzürnt. Sein Wunsch, sie zu besiegen, ist im Laufe der Jahre immer stärker und zerstörerischer geworden.
»Welche Neuigkeiten bringt mein treuer Hoffnungsträger dann?« Der König blickt Nox abwartend an.
»Keine Neuigkeiten«, sagt Nox mit einem leichten Schulterzucken. »Ich bin nur wegen einer Vorhersage hier.«
Ich starre ihn an.
Ich kann nicht anders.
Das Fest ist für Zivilisten. Für die Verzweifelten oder die Gelangweilten, aber kaum für die Mitglieder der Letzten Armee, die viel zu sehr damit beschäftigt sind, mit ihren Schwertern zu spielen.
Doch der König sieht nicht verärgert aus.
Er hat seine Lieblinge und Nox steht unverkennbar ganz oben auf der Liste. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, kommt mir sein Name bekannt vor. Ein Gesprächsfetzen, den ich vor Monaten bei Hofe aufgeschnappt habe, nimmt in meinem Kopf Gestalt an: Der Hoffnungsträger. Sein Vater hat vor ihm gedient. Seine ganze Familie. Einer der Besten und Klügsten des Königs, ich schwöre es. Der jüngste Soldat, der je ein eigenes Regiment erhalten hat.
Am liebsten würde ich die Augen verdrehen, halte mich jedoch gerade noch zurück. Ich wette, Nox hat mehr Belobigungen im Futter seiner Uniform eingearbeitet als so manch andere Soldaten, die doppelt so alt sind wie er.
Was für ein Wichtigtuer.
»Bist du dir sicher, Nox?«, fragt ihn der König. Seine tiefe Stimme schallt durch den Raum, während er sich gespannt nach vorne lehnt. »Einen solchen Handel kann man nicht rückgängig machen. Denk daran, wer du bist. Wie wertvoll du für mich bist.«
Nox lächelt und etwas daran irritiert mich.
»Ich weiß, wer ich bin«, sagt er und lässt sich auf ein Knie sinken. »Und ich bin bereit.«
»Nun gut.« Der König fährt sich mit der Zunge über die Lippen. »Dann sollten wir fortfahren.«
Mit einer Geste bedeutet er mir eine Strähne von Nox’ Haar abzuschneiden und damit sein Schicksal zu besiegeln.
Ich greife nach meiner Schere.
Es ist lange her, dass ich einem Jungen in meinem Alter nahe war – oder überhaupt jemandem in meinem Alter, außer Irenya.
Als ich noch klein war, wurden alle Kinder aus dem Schloss verbannt, weil man anderen Menschen nicht trauen kann und der König befürchtete, sie könnten mich ausnutzen. Es war besser, ich blieb bei ihm und meiner Mutter. Besser, ich blieb in meinem Turm, wo ich geschützt war.
Die Sicherheit der Erbin der Somniatis-Magie muss gewährleistet sein, sagte er immer. Um jeden Preis.
Selbst jetzt ist es mir nicht erlaubt mit Menschen am Hof zu sprechen. Wenn ich – was selten der Fall ist – an Feierlichkeiten teilnehmen darf, kann ich alles nur von außen beobachten. Man zwingt mich neben den Thronen zu stehen, umgeben von Wachen. Unberührbar.
Wie eine zur Schau gestellte Trophäe.
Und wenn die Feierlichkeiten vorbei sind, werde ich wieder in meine Schatulle gesperrt.
Ich kann zuschauen und ihre Geschichten anhören, aber ich bin nie ein Teil von ihnen.
Ich gehe auf Nox zu.
»Du hast Glück«, sagt er, als ich vor ihn hintrete. »Viele Mädchen würden sich darum reißen, meine Locke in einem Medaillon an ihren Herzen zu tragen.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Wie schade, dass sie in so jungen Jahren den Verstand verloren haben.«
Nox’ Lippen kräuseln sich. »Ich bin dafür bekannt, dass ich Frauen verrückt mache.«
Ich verdrehe die Augen.
Nur ein Soldat der Letzten Armee kann so nonchalant sein und gleichzeitig seine Seele verkaufen.
Eine Vorhersage über das eigene Schicksal zu hören mag für die Leute in der Stadt eine amüsante Idee sein, wenn sie in einer Taverne im hellen Schein der Fackeln sitzen und ihre Fantasie mit ihnen durchgeht, aber wenn sie in diese Halle treten und eine Haarlocke – ein Stück ihrer Seele – hergeben müssen, sieht die Sache für gewöhnlich ganz anders aus.
Normalerweise verlässt sie jeder Hochmut und ihre Angst verpestet die Luft.
Nicht so dieser Soldat. Nox sieht überhaupt nicht ängstlich aus.
Umso mehr ist er ein Narr.
»Mit dieser Schere nehme ich dir eine Locke deines Haares und gewähre dir einen Platz beim Schicksalsfest«, sage ich die Worte auf, wie ich es immer tue.
Sie fallen mir inzwischen so leicht, dass ich kaum noch nachdenken muss, bevor ich sie laut ausspreche. Sie sind mir so vertraut wie mein eigener Name.
»Willigst du ein?«, frage ich schließlich.
»Ja«, sagt Nox.
Dummkopf, denke ich.
Er ist so nah, dass ich nicht auf ihn zugehen muss, um ihm eine Haarsträhne abzuschneiden. Mein Kleid fließt wie Wasser die Stufen hinab, als ich mich vorbeuge und Nox’ Haar durch meine Finger gleiten lasse.
Als ich ein Stück abschneide, durchfährt es mich wie ein Blitz.
Es ist, als würde ich zurückgestoßen. Ich stolpere, verliere fast den Halt.
Ein Gefühl steigt in mir auf, zuerst nur ganz leicht, als würden winzige Nadeln meine Arme hinauf- und an meinem Nacken wieder hinunterklettern, bevor sie sich heftig in mein Herz bohren.
Ich umklammere die Haarlocke, schweigend, wie erstarrt.
Ich habe noch nie etwas gefühlt, wenn ich eine Locke abgeschnitten habe, aber diesmal ist es, als ob der Teil von Nox’ Seele, den ich abgetrennt habe, durch mich hindurchgeschossen wäre.
Hat er es auch gespürt?
»Ich schätze, ich habe wirklich eine umwerfende Wirkung auf Frauen«, sagt Nox.
Ich starre ihn an, aber falls er einen ähnlichen Schock erlebt hat wie ich, ist davon nichts in seinem Gesicht zu lesen.
Ich verdränge das merkwürdige Gefühl und lege die Haarlocke in das letzte leere Glas zu meinen Füßen.
»Weiter«, sagt der König, nachdem ich das Gefäß verschlossen habe.
»Ich habe die Locke schon abgeschnitten«, sage ich verwirrt.
Der König lacht, und obwohl es schön klingt, weiß ich, dass etwas Schreckliches bevorsteht.
»Nein, Selestra«, sagt er leise. »Gib dem Soldaten seine Vorhersage.«
Panik befällt mich.
»Ihr wollt, dass ich es tue?«, frage ich. »Warum?«
»Betrachte es als mein Geschenk an dich«, erwidert er großmütig.
Doch ich weiß, dass der König niemals Geschenke macht, die nicht mit Gift getränkt sind.
»Nur eine kleine Vorhersage«, fordert er mich auf. »Deine Magie wird dafür reichen und es ist eine gute Übung für dich.«
Ich zupfe an meinen Handschuhen herum.
Bei dem Gedanken, sie zum ersten Mal seit Jahren vor jemandem auszuziehen, fängt meine Haut an zu jucken. Ich muss wieder an die Schreie von Asden denken.
Ich blicke zu meiner Mutter.
»Nur zu«, ermutigt sie mich. »Tu, was der König sagt, Selestra.«
Mein Herz klopft.
Ich fahre mir mit der Zunge über die Lippen.
Diesen Moment habe ich sowohl gefürchtet als auch herbeigesehnt.
Es ist eine Chance, endlich die Magie in mir freizusetzen, die ich bisher nie erforschen durfte. Eine Chance, endlich jemanden berühren zu können und zum ersten Mal seit über zwei Jahren Haut auf Haut zu spüren.
Und dabei meiner Mutter zu zeigen, dass ich der Macht unserer Familie würdig bin.
Ich streife einen Handschuh ab und lasse ihn fallen.
Mein Kleid bauscht sich auf dem Marmor, als ich mich vorbeuge und die Hand nach Nox’ Wange ausstrecke.
Bei meiner Berührung zuckt er zusammen. Ich nehme an, ich bin ein wenig kalt. Mein ganzer Körper ist es wohl.
Magie ist Feuer und meines durfte noch nie auflodern.
Mein Herz hämmert in meiner Brust wie ein Tier hinter Käfiggittern, als ich ihn berühre. All die Jahre durfte ich niemanden anfassen.
Es ist, als würde ein Hunger, den ich mir bisher nicht eingestanden habe, plötzlich gestillt werden.
Mir wird ganz flau von dem Gefühl. Da ist ein anderer Mensch, lebendig und greifbar, und er kann mich genauso fühlen wie ich ihn.
Nox ist warm und seine Haut ist unerwartet weich. Er hat eine Narbe im Gesicht, die sich in einer glatten rosafarbenen Linie von seiner Augenbraue bis zu seinem Kinn erstreckt, und als meine Hand sie streift, flackern seine Augen kurz auf, ehe er den Blick fest auf mich heftet.
Normalerweise zucken die Leute zusammen, wenn sie meine Augen sehen. Schlangenaugen, wie bei allen Somniatis-Frauen.
Doch Nox blinzelt nicht einmal.
Ich auch nicht.
Ich will nicht blinzeln, will nichts anderes tun, als diesen Moment genießen.
Ich weiß, dass ich für eine Weile – vielleicht Jahre – keine weitere Chance haben werde, und ich will diesen Moment voll ausschöpfen, solange ich kann. Aber die Zeit drängt.
Der Tod kommt schnell.
Mein Atem stockt und ich spüre einen Druck in der Brust, als würde ich ersticken. Mein Kopf wird zurückgeschleudert – und da weiß ich, dass meine Magie noch nicht bereit ist.
Es fühlt sich an wie Schläge auf den Kopf, immer und immer wieder, ohne Pause.
Ich versuche mich von Nox zu lösen, aber meine Glieder sind steif und meine Hand bleibt an seiner Wange kleben, während sich die Vision in mich hineinbrennt.
Aufblitzende Bilder von einem dunkelroten Fußboden und halb gestrichenen Wänden.
Ich kann sie mir nicht erklären und mein Kopf fühlt sich an, als würde er mit jedem neuen Bild zerspringen.
Eine Menschenmenge umgibt Nox, auf den das Mondlicht fällt. Laternen zischen wie Kugeln um ihn herum, werden heller und heller, bis die Welt in Flammen steht.
Das Feuer frisst sich über den Boden, knistert die Wände hoch und verwandelt alles in Rauch.
Ich kann die Luft riechen, schwer von Schweiß und Salz. Ich sehe das klaffende Loch in der Decke, als sie herabstürzt.
Nox verblutet auf dem Boden, inmitten der Flammen.
Der Wind heult wehklagend auf und ein Bild schießt mir durch den Kopf, so schmerzhaft, dass ich schreie. Ein metallener Griff auf dem Fußboden, zwischen zerbrochenen Flaschen.
»Hier entlang«, flüstert eine Stimme.
Eine Hand greift nach dem blutenden Nox und ich schnappe erschrocken nach Luft, als ich den Armreif an dem Handgelenk erblicke.
Ein kleiner goldener Reif mit einem einzigen Edelstein in der Mitte. Wie ein wachsames Auge.
Ich kenne diesen Armreif.
Ich trage ihn schon seit Jahren.
Mir stockt der Atem, denn nun spüre ich das Feuer auf meiner eigenen Haut, es kriecht meine Arme hinauf, erfasst meine Haarspitzen. Frisst sich durch den Armreif hindurch bis auf die Knochen.
Mit aller Kraft reiße ich mich von Nox los und katapultiere mich aus der Vision zurück in die Gegenwart.
Es geschieht so plötzlich, dass ich den Halt verliere und im Fallen eine Reihe von Gläsern umstoße, sodass sie auf den Stufen zerschellen.
Überall um uns herum liegen Glasscherben und Haarbüschel.
»Was ist?«, fragt Theola, deren gelbe Augen sich weiten. »Was ist passiert?«
Das kann nicht sein.
Zitternd umklammere ich mein Handgelenk, als die Erinnerung an die Flammen durch meine Haut dringt.
Verbrannt und verkohlt.
Das ist völlig unmöglich.
»Selestra.« Die Stimme meiner Mutter wird lauter.
Der König hebt eine Hand, um sie am Weiterreden zu hindern, und der ganze Raum wird still. Selbst die Wachen an der Tür halten den Atem an.
Langsam steigt Seryth die Stufen zu mir herunter.
Der Ausdruck auf seinem Gesicht ist der eines Mannes, der Welten zerstört hat.
»Sprich«, befiehlt er.
Ich drehe mich zu Nox um, das tiefe Braun seiner Augen durchbohrt mich.
Auf seiner Handfläche ist das Brandzeichen der Schlange, und als ich hinunterschaue, sehe ich es auch auf meiner eigenen.
Schnell balle ich meine Hand zu einer Faust und greife nach meinem heruntergefallenen Handschuh, bevor jemand es bemerkt.
»Und?«, fragt Nox.
In Erwartung dessen, was ich gesehen habe, beißt er die Zähne so fest zusammen, dass sein Kiefer pulsiert.
Ich schlucke. Schaue weg.
Ich kann es ihm nicht sagen. Ich kann es nicht aussprechen.
Denn was ich gesehen habe, war nicht nur sein Tod, sondern auch mein eigener.
5
Nox
Die Hexe hat Angst und das verheißt nichts Gutes.
»Lass mich raten«, sage ich. »Ich werde sterben?«
Selestra, die immer noch auf dem Boden kauert, kann offenbar nicht darüber lachen.
Sie schüttelt den Kopf, ein Ausdruck von Fassungslosigkeit spiegelt sich in ihren weichen Zügen. Man könnte meinen, sie hätte noch nie eine Vorhersage gemacht.
Ich hoffe nur, dass das, was sie in meiner Zukunft gesehen hat, nicht so schrecklich ist wie ihre Miene.
Ich könnte fast schwören, dass sie schluchzen oder schreien will, aber das ist unmöglich, denn sie ist eine Somniatis-Hexe, und die kommen ohne Herz auf die Welt.
Innerlich wie ausgehöhlt.
»Solltest du mir jetzt nicht endlich meine Zukunft verkünden?«, frage ich sie. »Ich habe meine Seele dafür verschachert. Das Mindeste, was ich bekommen könnte, ist eine Vorhersage.«
»I-ich weiß nicht …« Selestra bricht ab.
Ihre Augen fixieren meine Hand.
Ich schaue auf die Stelle, an der Seryths Wappen sich über meine Handfläche schlängelt und mich als Schicksalssucher kennzeichnet. Als jemanden, der jetzt ihm gehört.
Ich balle meine Faust so fest, dass die Knochen knacken.
»Sag es ihm.«
Der König steht drohend über Selestra, die immer noch auf dem Boden kauert und nach Atem ringt.
»Mach mich nicht zum Narren, Selestra«, warnt er.
Sein Ton ist so kalt, dass ein Schauder sie erfasst. Selestra sieht zum König auf, ihre Blicke treffen sich. Sie presst die Lippen aufeinander und einen Moment lang denke ich, sie könnte anfangen zu weinen.
Stattdessen fährt sie sich übers Gesicht und wischt die Unsicherheit weg.
Ihr Zittern verschwindet und der stockende Atem wird ruhig. Sie hebt ihr Kinn so hoch, dass ich geradezu sehen kann, wie sie hinunterschluckt, was immer sie eben noch gefühlt hat.
Dann steht sie auf. Unsicher, aber dennoch entschlossen.
»Der Tod wird dich das erste Mal in drei Tagen holen«, verkündet sie. Ihre Stimme ist brüchig. »Es wird einen Kampf geben. Da ist eine wütende Menge. Ein Feuer. Ich habe das Gebäude nicht erkannt, aber es hatte einen roten Boden. Es könnte einer der Schlafsäle in der Kaserne der Letzten Armee gewesen sein.«
Ich warte, aber als sie nichts mehr hinzufügt, ziehe ich eine Augenbraue hoch.
»Das war’s?«, frage ich. »Ein Kampf, mehr nicht?«
So einfach, so leicht.
Und so eindeutig nicht einmal die halbe Wahrheit.
Ich sehe, wie Selestra ihren Kiefer zusammenpresst, während sie ihre Antwort so sorgfältig überlegt wie ein Soldat, der in der Schlacht eine Strategie zu entwickeln versucht.
»Das war’s«, bestätigt sie.
»Warum hast du das nicht gleich gesagt?«
»Ich habe eine Weile gebraucht, um mich zurechtzufinden«, verteidigt sie sich. »Ich bin es nicht gewohntVorhersagen zu machen.«
Sie ist keine schlechte Lügnerin, das muss ich ihr lassen. Es ist fast überzeugend, wie sie plötzlich mit einer süßlichen Stimme spricht und sich mit der Hand über ihr waldgrünes Haar streicht.
Das Bild reinster Unschuld und Verwirrung.
Nur hat sie nicht so viel Übung in der Kunst der Täuschung wie ich.
Wenn man in der Letzten Armee dient, weiß man, wie man einen Lügner erkennt und die Geschichten entschlüsselt, die Gefangene erzählen, um ihren eigenen Hals zu retten.
Selestra Somniatis ist nicht so gerissen, wie sie glauben mag.
Aber der Erbin der Somniatis-Magie so etwas zu unterstellen ist Hochverrat und damit komme nicht einmal ich durch.
»Du besudelst den Boden mit deinem Blut, Selestra.«
Theola erhebt sich langsam von ihrem Thron.
Selestra blickt auf ihren Ellbogen. Bei ihrem Sturz hat sie sich eine Schnittwunde zugezogen, doch sie scheint erst jetzt zu bemerken, dass sie verletzt ist.
Ich hatte es bisher auch nicht gesehen. Beim Anblick ihres Blutes, vermischt mit den verfilzten Haarsträhnen aus den zerbrochenen Gläsern, zuckt meine Hand und mich überkommt der lächerliche Drang, ihre Wunde zu untersuchen.
Ich ignoriere ihn.
Selestra ist nicht irgendein hilfloses kleines Mädchen, das gerettet werden muss.
Sie ist eine Hexe.
Ich wende mich von ihr ab und rücke die Klinge zurecht, die ich auf meinem Rücken trage.
Es ist das Schwert meines Vaters.
»Vielleicht sollten wir sie bluten lassen«, überlegt der König. »Für eine so schlampige Vision darf sie ruhig ein bisschen leiden.«
Theola starrt auf den verletzten Arm ihrer Tochter. »Ja, aber der Boden sollte nicht darunter leiden«, erwidert sie trocken. »Ich werde es in Ordnung bringen.«
Sie schließt die Augen und atmet lang und tief ein.
Ich spüre die Veränderung in der Luft, die Kälte, die mir in die Knochen kriecht, als ihre Magie die Stufen hinunter- und über die Fliesen gleitet.
Schon im nächsten Moment ist Selestras Verletzung verheilt und von der klaffenden Wunde an ihrem Ellbogen ist nichts mehr zu sehen. Die Glasgefäße liegen noch immer auf dem Boden, aber jetzt tropft kein Blut mehr darauf.
Somniatis-Hexen sind Schlangen.
Sie häuten und erneuern sich.
»Also ist es wirklich nur eine Schlägerei unter Soldaten?«
König Seryth scheint darüber nachzudenken, während er sich wieder auf seinem Thron niederlässt.
»Damit dürftest du fertigwerden, Nox.« Seine Mundwinkel heben sich betont langsam. »Immerhin bist du der Sohn deines Vaters. Der wahre Hoffnungsträger meiner Armee.«
Er beobachtet mich genau. Er will, dass ich darauf reagiere.
Er will sehen, wie ich bei der Erwähnung meines Vaters zusammenzucke. Er will mich auf die Probe stellen, wie er es im Laufe der Jahre schon so oft getan hat.
König Seryth will immer etwas von mir und es ist nie etwas, das ich ihm geben will.
Ich antworte betont unbekümmert.
»Sorgt Euch nicht. Ich werde meinen Vater stolz machen.«
Seryth neigt seinen Kopf zur Seite. »In der Tat.«
»Danke für die Vorhersage«, sage ich. »Bekomme ich jetzt mein Goldstück?«
Theola schließt ihre Hand zu einer Faust, und als sie sie wieder öffnet, liegt in der Mitte eine Chrim-Münze. Sie funkelt, als sich das Licht darin fängt, bevor die Hexe sie langsam in die Brusttasche meiner Uniform steckt.
Theola tätschelt die Stelle direkt über meinem Herzen und sagt: »Bis wir uns wiedersehen, Nox Laederic.«
Ich verbeuge mich hastig, anstatt mein Schwert in die Brust des Königs zu rammen. Das scheint mir die höflichere Variante zu sein und ein Schwertstoß wäre bei einem Unsterblichen ohnehin vergebens.
Ich drehe mich um und will den Saal bereits verlassen, da sehe ich Selestra vor mir. Unsere Blicke treffen sich.
Es ist nur kurz und flüchtig, ein gestohlener Moment, in dem ihre Augen mich fixieren und ein Ausdruck darin aufscheint, den ich nicht ganz verstehe.
Aber ich verweigere mich diesem Moment.
Ich muss die Hexe nicht verstehen. Ich muss nur eines: diesen Monat und alles, was der Tod an Schicksalsflüchen für mich bereithält, überleben, bis ich das bekomme, was ich will.
Bis ich dem König seine Unsterblichkeit geraubt und diese Familie in die Knie gezwungen habe.
Wenn es so weit ist, werde ich sie alle töten.
Und anfangen werde ich mit der Erbin.
6
Selestra
In dieser Nacht träume ich nur von Nox Laederic.
Ich sehe ihn tausendmal sterben, Flammen schwirren auf seiner Haut wie Fliegen, und als meine Hand nach der Glut greifen will, trifft sie nur auf Asche und Dunkelheit.
Ich kann nicht schlafen, ohne diese Bilder zu sehen, weshalb ich so gut wie gar nicht schlafe.
Dieser Junge wird mich umbringen.
Ich weiß es, so wie ich weiß, dass der Himmel blau ist und das Meer schwarz. Der Handel ist unumkehrbar. Sobald die Haarlocke übergeben ist, wirkt unsere Magie, drückt den Schicksalssuchern ihren Stempel auf und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Tod kommt.
Das sind die Regeln des Zaubers meiner Ururgroßmutter.
Als der Morgen anbricht, bin ich bereits seit Stunden wach, denn allein die Vorstellung, wieder zu träumen, ist viel zu schrecklich, um den Schlaf zu suchen.
Ich tauche meinen Pinsel ins Wasser und betrachte meine Hand, als könnten sich in dem Zeichen des Königs, das sich in meine Haut eingebrannt hat, Antworten verbergen.
Aber es gibt keine.
Wütend schmiere ich eine schwarze Linie quer über meine Leinwand.
Normalerweise heilt das Malen meinen Geist. Ohne meine Handschuhe fühle ich mich schwerelos und an manchen Tagen kann ich stundenlang malen – neue Welten und neue Gesichter – und dabei vergessen, dass ich die Handschuhe jemals wieder tragen muss.
Dieses Mal hilft es nicht.
Verflucht sei dieser Soldat, bis zum Fluss der Erinnerung und wieder zurück.
»Das ist … hübsch«, sagt Irenya und betrachtet mein Bild mit einem Blick, der das Gegenteil sagt.
Verstohlen schiebe ich meine Hand in die Tasche, damit sie das Brandmal nicht sieht.
»Was ist das?«, fragt sie.
Ich zucke mit den Schultern.
Ich habe versucht den Raum aus meiner Vision zu rekonstruieren, um den Ort einzugrenzen, an dem ich in zwei Tagen sterben soll, aber alles ist noch sehr unklar.
Ich habe den roten Fußboden und die halb gestrichenen weißen Wände auf die Leinwand gebannt, doch an den Rest erinnere ich mich nur verschwommen. Also habe ich alles andere in eine orangefarbene Schicht von glühenden Flammen gehüllt. Sie fallen von der klaffenden Decke herab wie Sternenregen und sammeln sich auf dem Boden zu einem Feuersee.
Mitten darin liegt mein Armreif auf einem Tisch und schmilzt.
»Was ist das für ein großer schwarzer Strich in der Mitte?«, fragt Irenya.
»Meine ganz persönliche Therapie«, sage ich.
Und dann ziehe ich eine zweite große Linie für ein X.
»Wir sollten das Bild verbrennen«, sagt Irenya. »Bevor es jemand sieht.«
Ich starre auf den schmelzenden Armreif und erinnere mich daran, wie es sich angefühlt hat, als sich die Flammen in meine Haut gefressen haben.
»Wirf es rein«, stimme ich zu und deute auf den Kamin.
Wir verbrennen alle meine Bilder.
Wenn der König sie sähe, würde er mir die Pinsel für immer wegnehmen.
Als ich elf Jahre alt war, malte ich einmal ein Mädchen, das in einem Turm gefangen war und dessen Haare so lang waren, dass sie aus dem Fenster hinabfielen, wenn es auf Blumen herabschaute, die es nie pflücken durfte.
Ihr Haar war nicht grün und ihre Augen waren nicht schrecklich, aber in ihrem Lächeln steckten alle meine Wünsche. Die Sehnsucht, die Welt da draußen zu erkunden, denn damals wusste ich es noch nicht besser.
Meine Mutter sah das Bild, gerade als ich den letzten Strich setzte. Sie hielt es in das Licht und seufzte, als die Sonne durchs Fenster schien und die unberührten Blumen beleuchtete.
Als sie es auf die Staffelei zurückstellte, schimmerten ihre Augen. Sie sah wieder aus wie meine Mutter. Wie die Frau, die mir beim Wiegenlied die Haare geflochten und mir Geschichten von unserer alten Göttin erzählt hatte.
Für einen kurzen, unerlaubten Moment konnte ich den Blutschwur vergessen, der unsere Familie an den König bindet. Und als Theola meine Wange berührte, fühlte sich ihre Hand nicht kalt an.
Es war die Berührung einer Mutter, die mich seit Jahren nicht mehr liebkost hatte.
»Ach, Selestra«, seufzte sie.
Dann betrat der König den Raum. Theola nahm hastig ihre Hand von meinem Gesicht, sagte mir, ich solle mehr üben, und warf die Leinwand ins Feuer, bevor er einen Blick darauf werfen konnte.
Seit diesem Tag darf ich nur noch für den König malen, aber der Gedanke, nie etwas anderes als mit Diamanten übersäte Wolken zu malen, ist eine Qual, daher hat Irenya diese Aufgabe für mich übernommen.
Sie malt, was dem König gefällt, und ich male, was ich will. Wenn wir fertig sind, überreichen wir dem König Irenyas Bild, als wäre es meins.
Dann verbrennen wir meins zu Asche.
Das gefällt mir.
Ich banne alle meine Enttäuschungen auf die Leinwand, sehe sie lebendig und in Farbe vor mir, ehe ich dabei zuschaue, wie sie verglimmen.
Ich möchte dieses Bild mehr als alle anderen in Flammen aufgehen sehen.
»Fertig?«, fragt Irenya.
»Verbrenn es«, sage ich.
Sie wirft es in den Kamin und die Flammen lodern auf.
Ich sehe zu, wie sie höher und heller werden, bis auch die letzten Reste meines Gemäldes zu Asche zerfallen. Feuer trifft auf Feuer; mein vorhergesagter Tod wird vor meinen Augen ausgelöscht.
Das beruhigt mein Herz ein wenig. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen.
Der König sagt immer, wenn ein Mensch stirbt, ohne dass er den Handel eingegangen ist, wird seine Seele zum Fluss der Erinnerung gebracht, damit sie in einem endlosen Schlummer fließen kann.
Die Menschen werden zu Abbildern ihrer selbst, zu Aufzeichnungen von allem, was gewesen ist. Für sie scheint der Verkauf ihrer Seelen auf dem Schicksalsfest also keine schlechte Sache zu sein, wenn sie nach dem Tod sowieso schlafen werden.
Aber ich habe das nie geglaubt.
Ich erinnere mich noch an die Geschichten, die mir meine Mutter über die Göttin erzählte, von der unsere Familie abstammt: Asclepina, die von mythischen Schlangen mit der Macht des Todes und der Unsterblichkeit ausgestattet wurde, damit sie mit den Augen des Todes sehen und ihr Volk heilen konnte.
Meine Mutter flüsterte mir als Kind ihre Geschichten ins Ohr, wenn der König nicht in der Nähe war. Sie erzählte mir, wie Asclepina uns in ein wahres Leben nach dem Tod führen wird, wo wir ewig an ihrer Seite leben. Und dass jede der alten, inzwischen ausgelöschten Hexenfamilien eine Schutzgöttin hatte, die dasselbe tun konnte.
Das sind Dinge, über die meine Mutter seit Jahren nicht mehr gesprochen hat, aber ich habe sie nie vergessen. Die Geschichten kreisen in mir.
Wenn der König meine Seele verschlingt, werde ich nicht nur sterben. Ich werde auch niemals unsere Göttin oder eine der Hexen aus meiner Blutlinie treffen.
Ich werde verflucht sein.
»Komm«, sagt Irenya zu mir. Ein wissendes Lächeln huscht über ihr rundliches Gesicht. »Wenn du eine Therapie brauchst, weiß ich genau, wo du hinmusst.«
Ein paar Sekunden lang kann ich nicht atmen.
Ächzend sinke ich zu Boden, als mir die Luft aus den Lungen gepresst wird. Es fühlt sich an, als würde ich ersticken.
Mit einem Seufzer blicke ich auf meine elfenbeinfarbene Tunika hinab.
In der Mitte prangt ein Abdruck von Irenyas Stiefel.
Ich wische mit meiner behandschuhten Hand darüber und stehe wieder auf.
»Du bist nicht bei der Sache«, sagt Irenya stirnrunzelnd. »Normalerweise gelingt es mir nie, dich zu überrumpeln.«
Sie hat recht. Zwei Jahre Kampftraining, und noch nie hat sie mich besiegt.
Ich hatte einen guten Lehrer.