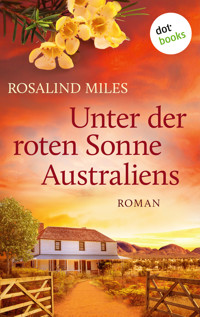1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine ganz andere Seite der ›Maiden Queen‹: Die opulente Romanbiographie »Elisabeth, Königin von England« von Rosalind Miles als eBook bei dotbooks. Wie kannst du überleben, wenn alle dir den Tod wünschen? Als Tochter der hingerichteten Anne Boleyn ist Elisabeth abhängig von der Gnade ihres Vaters – und muss von Kindesbeinen an lernen, sich gegen den Spott, das Misstrauen und die Intrigen am Hof Heinrich VIII. zu behaupten. Doch während sie in erotische Skandale verwickelt wird, Männer um sie buhlen und sie immer wieder in Gefahr gerät, wie ihre Mutter zu enden, lernt Elisabeth, hinter die Fassaden der Menschen zu schauen … und sie zu lenken. In einer Welt, die von Männern regiert und mit Kriegen überzogen wird, müssen die Waffen einer Frau schärfer sein als jedes Schwert. Aber wie sieht es hinter der Maske der »jungfräulichen Königin« wirklich aus? Der internationale Bestseller jetzt endlich wieder lieferbar: »Unverblümt, sarkastisch, sinnlich und gelegentlich töricht – diese Elisabeth ist so echt, wie eine durch Worte geschaffene Figur es sein kann.« The Library Journal Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der mitreißende historische Roman »Elisabeth, Königin von England« von Rosalind Miles wird die Fans der Reihen »Außergewöhnliche Frauen zwischen Aufbruch und Liebe« und »Bedeutende Frauen, die die Welt verändern« begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1356
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wie kannst du überleben, wenn alle dir den Tod wünschen? Als Tochter der hingerichteten Anne Boleyn ist Elisabeth abhängig von der Gnade ihres Vaters – und muss von Kindesbeinen an lernen, sich gegen den Spott, das Misstrauen und die Intrigen am Hof Heinrich VIII. zu behaupten. Doch während sie in erotische Skandale verwickelt wird, Männer um sie buhlen und sie immer wieder in Gefahr gerät, wie ihre Mutter zu enden, lernt Elisabeth, hinter die Fassaden der Menschen zu schauen … und sie zu lenken. In einer Welt, die von Männern regiert und mit Kriegen überzogen wird, müssen die Waffen einer Frau schärfer sein als jedes Schwert. Aber wie sieht es hinter der Maske der »jungfräulichen Königin« wirklich aus?
Über die Autorin:
Rosalind Miles wurde in Warwickshire geboren und studierte in Oxford, Birmingham und Leicester. Sie ist eine preisgekrönte Schriftstellerin, Journalistin, Kritikerin und Rundfunksprecherin, deren Werke in der ganzen Welt erschienen sind. Unter anderem gewann sie den Network Award für herausragende Leistungen im Schreiben für Frauen. Ihre historischen Romane wurden international gefeiert, insbesondere »Elisabeth, Königin von England«, in der sie das Leben und die Zeit der Tudor-Königin nachzeichnet. Ihr juristisches und soziales Engagement hat sie vom Buckingham Palace bis ins Weiße Haus geführt.
Die Website der Autorin: rosalind.net
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin die Romanbiographie »Elisabeth, Königin von England«, ihre historischen Romane der Guinevere-Saga »Die Herrin von Camelot« und »Die Königin des Sommerlandes« und ihre dramatischen Australienromane »Unter der roten Sonne Australiens« sowie die beiden Bände der großen Eden-Saga »Im Schatten des Akazienbaums« und »Im Land der Silbereichen«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »I, Elizabeth« bei Sidgwick & Jackson, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1993 Rosalind Miles
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 Limes Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung des Gemäles "Queen Elizabeth I, 'The Rainbow Portrait‘,“ von Isaac Oliver, (c.1565-1617)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-681-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Elisabeth, Königin von England« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Rosalind Miles
Elisabeth, Königin von England
Roman
Aus dem Englischen von Rainer Schmidt
dotbooks.
Für Helena
Vorwort
Als ich dieses Buch schrieb, sagten mir alle möglichen Leute vom Taxifahrer bis zum Kabinettsmitglied, daß Elisabeth I. ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte sei. Ohne Zweifel gibt es genauso viele Elisabeths, wie es Leute gibt, die ihre Geschichte geschrieben haben; ich hoffe, diese hier findet Gefallen.
Wie alle, die sich Elisabeth nähern, schulde ich ihren früheren Chronisten, Biographen, Bewunderern und Kritikern enorm viel, und mit Freude gebe ich meine Dankbarkeit hier zu Protokoll. Nach all den Jahren, die ich mit der Arbeit an diesem Buch verbracht habe, bin ich davon überzeugt, daß der Reichtum unserer Geschichte nur vom Genius unserer Historiker übertroffen wird.
Aber dieses Buch ist ein Roman, und mein Ziel war es, einen Eindruck von dieser außergewöhnlichen Gestalt zu vermitteln, »deren Geist«, laut Philipp II., »voller Zauber und so strahlend wie ein Meeresfeuer« war und die schließlich zu Englands berühmtester Königin wurde. Um der Übersichtlichkeit willen habe ich den einfachsten Weg durch das Labyrinth der elisabethanischen Namen und Titel und des Protokolls genommen und habe überdies versucht, Ereignisse und Personen so darzustellen, wie sie Elisabeth selbst erschienen sein dürften, nicht so, wie wir sie durch den Rückblick begünstigt wahrzunehmen gewohnt sind.
Aus jeder Perspektive aber verdient es die Geschichte des ungewollten Kindes, geboren in Bitterkeit und als Bastard stigmatisiert, das als Heranwachsende in sexuellen Skandalen den Kopf verliert und ständig davon bedroht ist, ihn überhaupt für immer zu verlieren, daß man mehr über sie erfährt. Wenn es Leser gibt, die am Ende dieses Buches das Gefühl haben, Elisabeth nun gründlicher zu kennen als vorher, dann habe ich mein höchstes Ziel erreicht.
All denen, die dieses Buch mit Liebe und Vertrauen unterstützt haben, gilt mein herzlichster Dank.
Rosalind Miles
Prolog
Im Palast zu Whitehall
24. Februar 1601
Mitternacht
Er wird einen guten Tod abgeben, heißt es. Um so besser für ihn, denn ein gutes Leben hat er nie zustande gebracht. Die Natur hat ihn zu einem König unter den Menschen gemacht, und ich habe ihm dazu das Vermögen eines Königs geboten. Aber Cecil, stets der weiseste unter meinen Ratgebern, nannte ihn »das Wildpferd«, und es stimmt: Man konnte nicht auf ihn setzen, und man konnte ihn nicht brechen.
Sie wußten, daß ich ihn liebte. Aber niemand wußte, wie sehr oder warum. Wenn er beim Kartenspiel tausend Pfund wegwarf, indem er mir alle seine Herzen in den Schoß warf, oder wenn er im Turnier meine Schleife am Ärmel trug, dann sahen sie Englands Liebling, wie die Balladen ihn priesen, und dachten, er sei mein. Aber ich wußte – so gut wie niemand sonst –, daß er dazu geboren war, sich selbst vor allen anderen zu lieben: daß er vermählt war mit seinem eigenen Willen und seiner brünftigen Gier nach Herrschaft, bis er in seiner Wut gelobte, er diene nicht länger einem Bastard und einem Weib ... Axt und Block, das ist kein schlechter Tod. Es gibt manch schlimmeren. Noch nach all den Jahren kann ich den Tod eines Verräters nicht mit Rinderbraten, Spanferkel und gebackenem Schwan feiern, wie mein Vater es tat; der Geruch von blakenden Talgkerzen und die Schreie sterbender Menschen lassen mich würgen. Mein Vollblut trifft morgen auf die Barmherzigkeit des Henkers, nicht die Höflichkeit des Metzgerbeils, trotz dieser üblen Beleidigung. Ich ein niedrig geborenes Weib? Nichts als eine Enthauptung hat mich zum Bastard gemacht, als mein Vater – Gott lasse seine Seele verfaulen! – sich der »französischen Hure«, meiner Mutter, entledigte, vor gut sechzig Jahren auf diesem selben Block.
Mein Vater ... Das Volk nannte ihn den »Guten König Heinrich« und »Great Harry« und betete seinen großen, fettgesichtigen Pascha an wie die Sonne in all ihrer Pracht. Was wußten die Leute von jenen Tagen, als er ...?
Mein Vater ...
War es mein Vater, an den er mich erinnerte, als er in jenem Wintervor so langer Zeit im Gefolge des Earl von Leicester an den Hof kam? Achtzehn war er damals und der munterste Bursche seiner Größe in ganz England – und auch der jüngste und ärmste unter all denen, die an meinem Hof zu Ruhm und Reichtum zu gelangen hofften, obwohl er der Erbe des alten und vornehmen Hauses Essex war. Leicester selbst war es, der ihn zu mir brachte, mein Robin, dessen Treue in meinen Diensten so weit ging, daß er sich selbst durch einen neueren und frischeren Kavalier ersetzte.
Und mein Blick war nicht der einzige, den der junge Essex mit den Schlingen jener vollen, wallenden Locken fing, deren Farbe halbwegs zwischen Braun und Gold lag, jener funkelnden schwarzen Augen, in denen Hoffnung und Mutwillen leuchtete, jenes strahlenden Lächelns, das noch an finstersten Tagen den Sonnenschein ins Zimmer trug. Gleichwohl war er noch jung für seine Jahre, voller Unbehagen über die Torheiten der höfischen Mode; seine feine französische Strumpfhose war zu hoch geschnitten für diese lockeren, langen Reiterbeine, und die gestärkte, gerüschte Halskrause stand zu steif um seinen zarten Hals. Auch Robins Protektion war ihm bald lästig; es gefiel ihm wenig, daß er nicht mehr war als »Mylord Leicesters Junge«. Auch schäkern und spötteln konnte er damals nicht, wie ein Gentleman es tun muß; seine helle Haut war allzu gern bereit, das brühheiße Gepräge des Errötens anzunehmen, wenn jemand sich nach dem Zustand seines Herzens erkundigte. Wie errötete er, errötete wie ein Mädchen, als meine Lady Warwick sich eines Abends bei einem Teller hübsch angerichteten Fleisches erkundigte, ob er denn überhaupt schon Fleisch gefunden habe, das er gern versuchen wolle, oder nicht? Für mich allerdings war die Röte seines Gesichts schöner als die Blässe des vornehmsten Heiligen, und mit seiner jungfräulichen Schamhaftigkeit verlor er nichts von meiner Wertschätzung.
All dies sah mein Robin und war es zufrieden – denn sein Plan war es nur gewesen, den Jungen zu erproben, zu sehen, wie gut er für den Hof geeignet war. Und nun, nachdem er mich von dem Gericht nur eben hatte kosten lassen, verstand er es wie ein Meisterkoch, den köstlichen Geschmacksgenuß hinauszuzögern. Noch im selben Jahr, als der Winter das Land mit eiserner Faust gepackt hielt und die Flüsse hart wie Straßen waren, so daß man auf ihnen fahren konnte, und als Robin nach den Niederlanden reiste, die unter der Pranke des Löwen ächzten, da war sein Gefolge um einen reicher, und den einen vor allem hätte ich gern zurückgehalten. »Sorgt Euch nicht, Madam«, waren Robins letzte, boshafte Worte, »ich nehme nur den Knaben fort – aber zurück bringe ich Euch den Mann.«
Nie ward ein wahreres Wort gesprochen. Der Mann, der an die zweieinhalb Jahre später in jenem Mai des Jahres siebenundachtzig mit Robins Gefolge in den Audienzsaal trat, war in der Tat ein Mai-Lord, und in seiner Pracht konnte ihm kein anderer Lord – nein, auch nicht Robin – das Wasser reichen. Ein Rest von seiner Knabenhaftigkeit wehte noch in diesem schnellen, hellen Blick und dem bereitwilligen Lächeln, wie es sein Leben lang geblieben ist. Aber der mädchenhafte Augenaufschlag war zum Adlerspähen geworden, und die wallenden Locken waren kurz wie Majoransprossen geschnitten und lagen rötlichbraun am Kopfe an. Nun kündete der Edelstein an seinem Ohr, daß seine Jungfernfahrt wohl hinter ihm lag und er zum ausgewachsenen Kaperkapitän geworden war, der die hohe See des ewigen Liebeshandels zwischen Frauen und Männern bereiste. Ach, pulchritudo virilis, die Mannesschönheit, von der die Weisen sangen! Ich war verloren – verloren – und gerettet.
Was es war, wovor er mich da rettete, das wußte nur ich: das nächtliche Grauen der Komplotte, die in den achtziger Jahren so dicht und schnell hereinbrachen, die Probleme mit Schottland und die rasende Torheit unserer königlichen Cousine Maria, die noch nach zwanzig Jahren geborgten Lebens den Tod mit heftigerer Leidenschaft umwarb als irgendeinen ihrer Liebhaber – all das neben den tausend und abertausend Leiden und Prüfungen, die eine Krone unweigerlich erben muß.
All das nahm er mir ab. erleichterte mir die Bürde, die ich so lange allein auf meinen Schultern getragen hatte, bis selbst meine Feinde in Spanien gezwungen waren, mir ein neues Leben, eine neue Liebe zu gewähren. Und wieder, genau wie mit Robin in jenem Sommer, fünfundzwanzig Jahre zuvor, war ich mit der Lerche auf, um durch die Felder zu reiten, um zu sehen, wie der Tau noch auf dem Grase funkelte und wie der Ehrenpreis in der Sonne die blauen Augen öffnete. Noch einmal hatte ich einen Mann gefunden, dessen Tatkraft mit der meinen Schritt halten konnte, der ganz wie ich niemals ermüdete, und sei der Galopp noch so lang und noch so scharf, der mir gewachsen war, Meile um Meile auf unseren Ritten durch die Wälder von früh bis spät und Stufe für Stufe durch nächtliches Schwelgen, bis die Sonne uns wieder hinausrief in Wald und Feld ... den ganzen Tag lang, jeden Tag, den Sommer hindurch.
Doch war er nicht bloß ein Zentaur, halb Mann, halb Pferd, sondern ein Ritter im Sattel und ein Kavalier im Hause. Er war ein beachtlicher Kartenspieler, aber es lag in der Freiheit seiner Natur, daß ihm am Gewinnen nichts gelegen war, wenn er das Spiel mit einem Lachen und einem Augenzwinkern aus der Hand werfen konnte. Er liebte die Würfel, aber sein liebster Wurf war der Einserpasch, jenes einzelne Auge, das alle anderen als schlechtes Omen und als Unglückswurf betrachten. Ein Mann schuf sich sein Geschick selbst, so glaubte er, durch die Art, wie er lebte – und das tat er am Ende auch.
Am Anfang aber liebte er mich – ich wurde einmal angebetet. Er durchwachte die Nacht bei mir, wenn ich spürte, wie der Fluch meiner Mutter mit silbernem Geisterfinger nach mir griff, die weiße Nacht, da der Schlaf nicht kommen will, und er saß an meiner Seite, schweigend in vollkommener Gefolgschaft, bewogen nur durch den schlichten Wunsch, meine Not zu lindern. Dann las er hübsche Geschichtchen vor, um mich abzulenken, oder sang leise Lieder von so süßer Melancholie, daß die bleiernen Stunden mir zu Minuten wurden und die Dunkelheit zum Tag sich wandelte. Nacht für Nacht kam er in sein eigenes Schlafgemach erst, wenn die Vögel schon sangen, doch nach kürzester Toilette, derweil er sich von seinem Kammerdiener gerade nur dazu überreden ließ, das Hemd zu wechseln oder ein frisches Wams und eine neue Hose überzustreifen, war er schon wieder an meiner Seite und erklärte, er gehöre »ganz und gar Eurer Majestät – nach Eurer Majestät Willen und Vergnügen«.
So groß war seine Liebe damals, daß er sie mit keinem anderen Manne teilen wollte und nicht erlaubte, daß mein Blick nur einmal auf einen anderen fiel. Als der junge Blount für mich im Turnier ritt und ich ihn mit einem goldenen Schachspiel belohnte, reich emailliert in Rot und Weiß, da nimmt mein kleiner Lord Anstoß an der »Herausforderung des Ritters« und fordert ihn seinerseits zu einem Duell zu meinen Ehren. Ich war empört ob dieser Anmaßung und betrübt über die Wunden, die er empfing und auch schlug: Doch in meinem Herzen frohlockte ich, frohlockte in einem Glück, das ich nie gekannt. Damals – wie es damals war, das weiß die Welt. Und jetzt?
Jetzt friere ich und brenne, wie es mein unheilvolles Schicksal war von Anfang an, ob er bei mir ist oder in weiter Ferne. Jetzt geht er hin, wie wir es alle tun müssen – wir schulden Gott einen Tod. Ich frage mich: Weiß er, daß dies sein letzter Liebesakt ist – ein Akt der Liebe zu mir, so groß, daß er ein für allemal tilgen wird, was an Eifersucht und Haß sich zwischen uns begab?
Nur eines nicht. Weiß er, kann er wissen, daß seine letzte Kränkung, dieser letzte Stachel, nicht mit ihm sterben wird, sondern in meinem Herzen weiterlebt, roh und blutig wie in jenem Augenblick, da er ihn hineinstieß? Ich ein bloßes Bastardweib? Das ist eine krasse Lüge – ich war kein einfacher Bastard, sondern ein dreifacher! Und dochkein niedrig geborenes Geschöpf in Wirklichkeit, sondern nur in den Augen und Herzen von Männern – von Bastarden.
Wie man hören wird.
Wohlgemerkt.
Oh, man kann mir meine Geschichte glauben, denn sie ist das Wort einer Königin, ja, und einer großen dazu, der größten unter allen Herrschern der Christenheit. Denn jetzt liegt das Gleichgewicht zwischen allen christlichen Königtümern und Reichen in meiner Hand, und mit dem leisesten Lächeln kann ich ihre Welt ins Wanken bringen. Jetzt fährt das kleine England mit seinen Schiffen übers Meer, und seine Armeen nehmen Länder und beherrschen sie, wo es ihm gefällt – ja, wo es mir, die ich ja England bin, gefällt.
Doch das war nicht immer so. Jetzt ist er fort, jetzt schweife ich durch den Raum der Erinnerung, denn dazu habe ich Raum genug, und auch, um mich zu fragen, welche Schritte mich hierhergeführt haben. Und ich sehne mich danach, von der Bürde meines Wissens entbunden zu werden und meine Geschichte zu erzählen.
Denn man wird viel von mir sprechen, wenn ich, wie er, nicht mehr bin. Und, wie in seinem Fall, wird herzlich wenig davon die Wahrheit sein. Was ist die Wahrheit? pflegte dieser Spaßvogel Francis Bacon, sein Jünger, immer zu fragen, und bei all seinem Witz wußte er doch nie eine Antwort darauf. Aber ich weiß, was ich weiß, und niemand weiß es wie ich. Sie sagen jetzt (ich höre jedes Wispern von ihnen), daß ich vergesse. Und vergebe, fragt man? Warum sollte ich vergeben? Jetzt, da seine Seele bebend am Abgrund steht und meine ihm am liebsten folgen würde, was habe ich da zu vergessen oder zu vergeben? Man urteile selbst – aus dem, was folgt.
Erstes Buch meiner Geschichte – Liber Primus
DER BASTARD
Mancher wird als Bastard geboren, mancher macht sich dazu, und mancher wird dazu gemacht, wie der Kerl im Theater am letzten Fastnachtssonntag sagte – und mit noch größeren Recht gesagt hätte, wenn er sich auf dieser großen Bühne der Narren verneigt hätte, wie ich es getan habe. Meine Geburt fällt unter die letzte der drei Rubriken. Mich zwang man in die Bastardschaft, ob ich wollte oder nicht, denn diejenigen, die so erpicht darauf waren, meine Mutter Anne Boleyn zur Hure zu machen, hätten sich kaum die Gelegenheit entgehen lassen, auch ihr Kind zu erniedrigen.
Anne hatte einen simplen Fehler begangen: Sie hatte die Aufmerksamkeit eines Ehemanns auf sich gezogen, der seiner Frau überdrüssig war. Denn König Heinrichs einst so zärtliches Weib hatte sich in eine Xanthippe verwandelt, die nicht in seiner Gesellschaft sein konnte, ohne ihm gleich an die Gurgel zu gehen. Königin Katharina war die erste, die ihre Rivalin Anne »die Hure« nannte – und noch mehr: die Französische Hure, die Große Hure, die Konkubine, die Dirne, die Hexe, die Metze aus des Teufels Bordell.
Ein böses Weib ist eine Geißel Gottes, sagt man. Heinrich brauchte seine Freiheit: von Katharinas – und von Gottes Wüten. Und immer nötiger brauchte er, als die Zeit verging, einen Sohn. Mit einem Sohn, einem einzigen nur, wäre Katharina in Sicherheit gewesen. Doch mit nur einer Tochter, der schmächtigen Prinzessin Maria, kaum mehr als einem kränklichen Scheibchen von Evas Fleische, drohte sie England wieder in die blutigen Kämpfe des Bürgerkriegs zurückzustürzen. Ihre Zeit war vorbei.
Aber sie hatte noch immer ihre Parteigänger.
»Die Königin hat entbunden und wieder entbunden!« erklärte der Gesandte des Heiligen Römischen Reiches verzweifelt. »Eure Majestät hat eine Tochter ...«
»Eine Tochter!« Heinrich spuckte dem Botschafter das Wort ins Gesicht.
Aber Chapuys war ein tapferer Mann. »Es scheint, Gott hat uns gezeigt, Mylord, daß die englische Thronfolge über die weibliche Linie weitergehen wird.«
Heinrich lachte verachtungsvoll. »Glaubt Ihr, Herr Botschafter? Aber ich weiß es besser!«
Denn eine Frau konnte nicht Thronerbin sein – das wußte jedermann! Eine Frau konnte nicht herrschen. Allenfalls konnte sie zum Werkzeug für die Königsmacher werden, für die Makler der Macht in einem neuen Reich, die sie nach ihrem Belieben benutzen würden, während sie den Kadaver des armen, blutenden England zerlegten. Also: einen Sohn!
Und bald, lieber Gott – bald!
Auf einmal bot sich für Heinrich die lang ersehnte Gelegenheit, als seine Mätresse Anne Boleyn ihn, bleich vor Angst und Stolz, am Ärmel zupfte und ihm zuflüsterte, sie sei schwanger. Darauf hatte Heinrich gewartet, darum hatte er gebetet. Zu lange, vielleicht: zumindest für Anne.
Denn sieben lange Jahre waren vergangen seit dem Augenblick, da er die junge, eben aus Frankreich zurückgekehrte, ganz in Grün gewandete Ehrenjungfer sah, bis zu dem Tag, da er sie in einem ungeschickten Handstreich zu seiner Frau, seiner Königin und der rechtmäßigen Mutter seines Kindes machen konnte. Kein vorübergehendes Gelüsten also, sondern eine Sehnsucht, die Wind und Wetter widerstanden hatte – und sie keine Stute für eine Nacht, sondern ein Vollblut, gut für einen König. Doch Zeit genug auch, um die faulsten Zungen zum Schwätzen zu bringen, Zeit genug für die Kolosse von Kirche und Staat, um Liebe, Leben und all das zu Knochenmehl zu zermahlen: und Zeit genug auch, daß der Dispens der päpstlichen Bulle selbst seine eigenen früheren, merde-urinösen Grenzen überschritt!
Die erste Bulle, die mich für null und nichtig erklärte, kam, als man zu tuscheln begann, daß »Madame Boleyn« enceinte sei. Wie hat Heinrich damals geschwitzt, um seinem Kind Rechtmäßigkeit zu verleihen! Mehr, als er geschwitzt hatte, um es zu machen! Aber ein Bastard wurde das Kind, noch im Mutterleib – zum Bastard erniedrigt durch eine Bulle von der höchsten Autorität im Christentum, vom Heiligen Vater.
Das war das erste Mal, daß man mich zum Bastard erklärte; und damals war der König, mein Vater, auf meiner Seite. Binnen einer Stunde sprengte ein rettender Bote vom Königlichen Palast zu Greenwich westwärts nach York Place in Westminster, wo Kardinal Wolsey wohnte.
»Eine Scheidung, Wolsey!« befahl Heinrich, beinahe ehe sein oberster Geistlicher noch vom Maultier klettern und seine raschelnden roten Seidengewänder und seine füllige Gestalt vor den König hinbewegen konnte. Denn jetzt, da der lang erwartete Prinz unterwegs war, brannte Heinrich darauf, sich zu vermählen.
»Das ist eine große Sache, Hoheit!« sagte Wolsey entsetzt, und seine nervösen Gedanken kreisten um die Feindschaft Spaniens und den Zorn des Heiligen Römischen Kaisers, der ein Neffe der Königin Katharina war und ihr entschlossen zur Seite stand. Auch vergaß er nicht seinen eigenen guten Papistenhaß auf Anne Boleyn, die in religiösen Dingen, fürchtete er, ebenso lax sein würde wie sie locker in ihren Sitten war.
»Macht nichts!« befahl der König. »Gebt Euch daran!«
Drangvoller Trieb und dynastisches Denken gingen Hand in Hand, als Heinrich nun dafür zu sorgen trachtete, daß sein Sohn mit einem echten und legitimen Anspruch auf den englischen Thron zu Welt komme. Das bedeutete: ein eheliches Kind.
»Seit dem Eroberer trug kein König mehr den Makel der Bastardschaft«, erinnerte er Wolsey.
Und Wolsey machte sich an die Arbeit. Die Kerzen seiner Schreiber brannten von früh bis spät im Kapitelhaus, als die Dokumente vorbereitet wurden. Wieder sprang der schnellste und vertrauenswürdigste der königlichen Boten aufs Pferd, und diesmal ging es südwärts, nach Rom und zum Heiligen Vater, um die Scheidung von Katharina zu erbitten, damit Heinrich frei werde, um Anne zu heiraten.
Zum Heiligen Vater? Eine seltsame Ketzerei, nicht wahr, eine kinderlose männliche Jungfrau zu unser aller Vater zu machen?
Und alles vergebens.
Denn als Kaiser Karl die Kunde erreichte, daß Heinrich seine Tante bereits ersetzt hatte und Anne ganz offen mit Katharinas Juwelen in königlichem Staat herumstolzieren ließ, da erfaßte ihn ein Heiliger Römischer Zorn. Und von London aus nährte sein Gesandter Chapuys die kaiserlichen Wut. Chapuys’ Spitzel waren überall.
»Die Dirne übergibt sich jeden Morgen«, schrieb er in verschlüsselten Sendschriften an seinen Kaiser, »wie ich von dem Bengel höre, der ihrem Stuhlknecht zur Hand geht. Auch hört man von einer Näherin in der Cheapside, daß sie ein Gewand geschickt habe, um es in der Taille auszulassen ...«
Karl handelte, und der Papst ging erneut zum Angriff über. Diese Bulle erreichte England, als Anne ins letzte Trimester eintrat.
»König Heinrich VIII. von England, Frankreich, Irland, Schottland, Wales &c, &c«, so ging die Proklamation wie ein Buschfeuer durch ganz Europa, »lebt nun in Hurerei und illegaler Kohabitation mit Mistreß Anne Boleyn, der Großen Hure von England. Das Kind, das sie unter dem Herzen trägt, wird daher als Bastard geboren und wird sein ein Bastard und nicht zu retten.«
Ein zweifacher Bastard also.
Das können nicht viele sagen.
Und kaum war bekannt geworden, daß Gott dem König Heinrich den ersehnten Sohn verweigert hatte und daß »die Große Hure« nichts weiter geworfen hatte als noch ein ungewolltes Mädchen, da ehrte man mich mit einem weiteren Titel, der sie und mich gemeinsam verhöhnte: die »kleine Hure«.
Ich gehe jetzt leichthin darüber hinweg, sagt einer? Jetzt bin ich ja sicher. Niemand wagt davon zu sprechen – und wer erinnert sich auch nur daran?
Aber damals ... damals ...
Soviel zu uns – der großen und der kleinen Hure.
Aber was ist mit dem Hurenmacher?
König Heinrich, mein Vater – der Monarch, der Gatte, der Mann – was ist mit ihm?
Kapitel I
Er war ein Mann in den besten Jahren, und das Wort »nein« war ihm fremd. Seit vierzig Jahren schaute er auf die Welt, und seit über zwanzig davon war er König. Sein hochgewachsener Körper hatte sich füllig gerundet von Alter, Ausschweifung, Vergnügen und Tat und ihm eine mächtige, kraftvolle Gestalt gegeben, die seine kostbaren Samtmantel und reichbestickten, mit geschlitzten Puffärmeln versehenen Seidenwämse mit der Majestät bekleideten, die ihm eignete.
In jeder Gruppe überragte er die anderen Männer. Rittlings saß er auf der Welt, die Beine gespreizt nach seinem Belieben, als ob sie ihm gehörte, und sein juwelenbesetzter Dolch baumelte unbekümmert neben dem Vorsprung seines mächtig gewölbten Hosenlatzes, und in Grün und Gold, Purpur und Weiß, Scharlach, Silber und Fuchs überstrahlte er sie alle.
Ich spreche wie eine Verliebte von ihm, meinem Vater, wie er in meinen ersten Erinnerungen ist? Von all seiner Pracht, seiner Gefährlichkeit, seiner Macht? Vielleicht war ich in ihn verliebt – trotz allem –, denn damals war es die ganze Welt, zumindest ein bißchen.
Nun war ich den Armen meiner Amme seit zehn Jahren entwachsen und er dem Grab um zehn Jahre näher – Jahre, die ihm ein hartes Los des Leidens, der Krankheit und des Verrats bescheren sollen. Und doch, als er am Altar stand, prachtvoll in Gold und Rubinen, mit pelzverbrämtem karmesinrotem Cape, da sah er so stattlich, so herrlich aus wie eh und je, und so fröhlich, wie jeder andere Mann angesichts dessen, was er sich anschickte zu tun.
Der Anlaß war sein sechster Vorstoß in den Ehestand, sein sechster Versuch, eine Ehe zu schließen, die Wind und Wetter überdauern würde, eine Frau zu finden, die ihm gefallen würde, ein Gefallen, das von Dauer wäre. Die Braut war Dame Katherine Parr: reich, fromm und ansehnlich in rahmweißem Brokat, die Witwe des drei Monate zuvor verstorbenen Lord Latimer und eines anderen reichen und alten Gemahls vor ihm. Ich blinzelte zwischen den Fingern hindurch zu dem Paar hin, als ich betend kniete, und rätselte über das Geheimnis der Ehe, und warum mein Vater noch immer sein Glück auf so rauher See riskierte. Es war die einzige Hochzeit meines Vaters, zu der ich eingeladen war.
Die erste – mit Katharina von Aragon, der Infantin von Kastilien und dem Stolz Spaniens – war lange vor meiner Zeit, als Heinrich selbst erst achtzehn war. Bei seiner zweiten Hochzeit – mit meiner Mutter, Anne Boleyn – war ich, wie ich zugeben muß, schon dabei, wenn auch ungebeten und ohne Erlaubnis: Tatsächlich war ich sogar der Anlaß jener hastigen, heimlichen Zeremonie, die da in jenem Januar 1533 Hals über Kopf abgehalten wurde, denn Anne hatte, wie so manche Jungfer vor ihr, unversehens ein Kind im Bauch gehabt, ehe sie noch einen Ehemann für ihr Bett gefunden hatte.
Die dritte Heirat des Königs – mit der schlichten Jane Seymour – war gleichfalls eine private Angelegenheit. Die vierte – mit der Prinzessin von Kleve (noch eine Anne) – wurde so niedrig gehängt, wie es der Anstand erlaubte, denn der König, der sie auf den ersten Blick nicht ausstehen konnte, wollte mit der Frau, die er »die flandrische Mähre« nannte, so wenig verheiratet wie möglich sein und gedachte sich so schnell wie möglich wieder zu endheiraten, was er dann auch bald tun sollte. Bei der fünften – wieder eine Katherine, seine Kindkönigin aus dem Howard-Clan – konnte der König es gar nicht erwarten, sie zu Eheweib und Bettgenossin zu machen: eine weitere, kostspielige Lektion zu dem alten Satz: In Hast gefreit, in der Muße gereut.
Erst seine Hochzeit mit Madam Parr, der mütterlichsten von allen seinen Frauen, beschloß der König zu einer Familienangelegenheit zu machen. In der Königlichen Kapelle von Hampton Court kniete an jenem Tag sein ältestes Kind neben mir, meine Schwester Maria, umgeben von ihren Damen. Nach ihren weißen Fingerknöcheln und den bleichen, murmelnden Lippen zu urteilen, betete Maria angestrengt genug, um Gott und die Menschen zufriedenzustellen – nicht aber, wie alle hier wußten, den König, denn sie klammerte sich mit der ganzen Wut ihrer Natur an den alten katholischen Glauben ihrer Mutter Katharina von Aragon. Wie würde es ihr, so fragte man sich tuschelnd am Hofe, unter der neuen Königin Katherine Parr ergehen, einer Frau, die ebenso fromm dem reformierten Glauben unseres Protestantismus anhing, wie Maria in vorbehaltloser Treue zu Rom stand?
Zu meiner anderen Seite kniete der Sohn, für den Heinrich mit Rom und dem Papst gebrochen hatte, mein Bruder Edward, dessen blasses, übermäßig feierliches Gesicht lächelnd errötete, als er mir in die Augen schaute. Seine schmächtige Gestalt rutschte vertraulich näher zu mir heran.
»Wollen wir nachher Konfekt essen, Schwester, und Zuckerwerk?« flüsterte er heiser. Sogleich brachte ihn seine Gouvernante, Lady Bryan, zum Schweigen, während die meine, die treue Kat, wiewohl ganz Ohr, doch beide Augen zudrückte und in heiterer Gelassenheit mit ihren Gebeten fortfuhr und darauf vertraute, daß ich in meinem beträchtlichen Alter von zehn Jahren zu gut erzogen sei, um in der Kirche zu schwatzen. Aber ich schenkte Edward ein verstohlenes Lächeln und nickte, denn ich wünschte mir so sehr, daß er mehr wie jedes andere Kind von sechs Sommern sein möge und weniger wie der junge Salomon, was jedermann vom Thronerben erwartete.
In der Kapelle war es kühl wie in einer Höhle, obwohl draußen der Hochsommer glühte. Hier strahlten nur die zahllosen Reihen der schweren Wachskerzen, und die einzigen, süß seufzenden Klänge kamen von einer kleinen Schar Königlicher Musiker im Schatten hinter dem Retabel. Auf ein unsichtbares Zeichen hin senkte sich Stille herab wie eine Wolke. Der Bischof von Winchester näherte sich dem Altar. Die Zeremonie begann.
»... zu verbinden diesen Mann und dieses Weib in Heiliger Ehe, diesem ehrenhaften Stande, der eingesetzt ward als ein Mittel wider die Sünde und zur Vermeidung der Unzucht und für gegenseitige Gemeinschaft, Hilfe und Trost des einen für den anderen ...«
Meine kindlichen Gedanken schweiften davon, wehten im feinen weißen Rauch der Kerzen hoch über den demütig gesenkten Köpfen der winzigen Gemeinde davon.
Wo waren die anderen Frauen meines Vaters jetzt? War ihr Geist hier bei uns, um noch einmal zu hören, wie er die gleichen Gelübde ablegte, die er schon ihnen gegeben hatte? Und warum – wenn er allmächtig war und so prächtig und weise und gut – warum hatten sie ihn dann alle im Stich gelassen?
Ich senkte die Stirn auf die Hände, und mit allem Ernst meines jungen Herzens beschwor ich Gott den Vater, Er möge diese Ehe segnen, um meines Vaters, des Königs, willen.
Hernach, in den Privatgemächern des Königs, beim Empfang für den engsten Kreis der Höflinge und Berater, gab es Konfekt und Zuckerwerk, Gelees und Quitten, Süßmilch und Träubchen und Täubchenpasteten, soviel das sechsjährige Herz meines lieben Edward begehrte. Und mehr. Seltsam, wie wenig Erwachsene ein Kind doch beachten – ein Mädchen vor allem. Ich war meiner Gouvernante Kat entschlüpft; sie hatte sich mit Lady Bryan in ein Gespräch über die Strapazen vertieft, die sich mit der Obsorge für den königlichen Nachwuchs verbanden, und ich konnte ungehindert durch den Audienzsaal wandern. Ein Besuch bei Hofe und die Gelegenheit, meinen Vater und all die Großen zu sehen, war ein seltenes Vergnügen, das ich nicht damit vertun durfte, daß ich an Kats Röcken hing.
Ich stand jetzt vor dem Wandteppich in einer Ecke des Saales bei einer Gruppe von königlichen Lords. In Wahrheit lauerte ich darauf, einen bestimmten Lord am Ärmel zupfen zu können, denn ich wußte sehr wohl, ob er nun Erzbischof von Canterbury war oder nicht, Thomas Cranmer war der freundlichste Mann bei Hofe und würde immer ein liebes Wort für mich haben. Bei ihm standen zwei Lords aus dem Geheimen Staatsrat, Sir Thomas Wriothesley und Sir William Paget, sein Sekretär.
Wriothesley war ein kleiner, wütender, gespreizter Mann, der beim Sprechen sein Gewicht rastlos von einem Fuß auf den anderen verlagerte. »So spielt unser Herr, der König, den Bauern und geht wieder einmal zum Markte!« Er lachte unangenehm. »Und er bringt keine flandrische Mähre und auch kein heißblütiges Howard-Füllen, sondern eine gute alte englische Kuh nach Hause!«
»So alt ist sie nicht, Mylord«, wandte Paget geschmeidig ein und ließ den schweren goldenen Wein nachdenklich in seinem Glase kreisen. »Unsere neue Königin hat kaum mehr als dreißig Sommer erlebt ...«
»Und wird mit Gottes Gnade noch viele erleben«, fügte Cranmer behutsam hinzu.
»Leicht mag sie noch einmal dreißig sehen, bevor sie uns bringt, was wir am dringendsten brauchen«, erklärte Wriothesley wild. »Geld und Land bringt sie, das gebe ich zu, von ihren früheren Ehegatten mit, eine Mitgift, die einer Königin zukommt. Aber kein Kind, von beiden nicht – nie hat sie Frucht getragen, obgleich der Acker zweimal gepflügt wurde! Ich fürchte, Mylord, der König wird Milch genug von dieser Kuh bekommen, aber kein Kalb – das goldene Kalb, um das wir beten, den Gott für unseren Götzendienst – noch einen Prinzen, um es genau zu sagen!«
»Wir sind mit einem Prinzen gesegnet, Mylord«, entgegnete Cranmer und schaute liebevoll durch den Audienzsaal zu Edward hinüber, der unter der Obhut seines Onkels, des Earl von Hertford, mit den Schoßhunden der Königin spielte. Der Earl sah traurig aus, fand ich – und wie sollte er nicht, wenn er sich an einem solchen Tag doch an die Hochzeit des Königs mit seiner Schwester Jane Seymour sieben Jahre zuvor erinnerte, und an ihren Tod bei der Geburt Edwards so kurz danach?
»Hertford macht saure Miene«, stellte Wriothesley sarkastisch fest; gierig stürzte er seinen Wein hinunter und winkte einem vorübergehenden Diener, er möge ihm den Becher wieder füllen. »Und dazu hat er allen Grund, wenn die Sippschaft der neuen Königin sich ebenso hastig auf die Positionen stürzt wie er und sein Bruder.«
»Wahrlich, der Earl ist nicht der einzige, dem durch diese Ehe eine Nase gedreht wird«, ergänzte Paget mit leisem Lächeln. »Ich höre, daß Bruder Tom das Augenmerk der Witwe auf sich gelenkt und sich schon ausgerechnet hatte, sie – oder ihren Reichtum – zu gewinnen, bevor dann der König unversehens zwischen ihn und seine Hoffnungen trat. Jetzt hält der Gauner es für politisch ratsam, ins Ausland zu reisen, bis ihr Herz seinen rechtmäßigen Platz am Busen ihres Gemahls eingenommen hat.«
»Und doch kann Dame Parr uns noch überraschen«, meinte Cranmer nachdenklich, und verstohlen musterte er die üppige Gestalt der neuen Königin, als sie im Saal umherging. »Auf ihrer Seite scheint es ja kein Hindernis für eine Mutterschaft zu geben. Bedenkt, daß sie zuvor nur alte Männer zu Bettgenossen hatte – ein Umstand, der dem Werk der Zeugung nicht eben förderlich ist.«
»Und jetzt? Wo ist der Unterschied?« Wriothesleys Ton war scharf und höhnisch. Alle drei Männer richteten den Blick auf den König, der in seinem Staatssessel saß und sich schwer auf den Goldknauf seines Stocks aus Ebenholz stützte, dem einzigen Holz, das sein Gewicht noch tragen konnte, wie sein Zimmermann ihm gesagt hatte. Und schon damals konnte ich ihr delikates Schweigen deuten, das in der Luft hing. Der König ist alt ... in seiner Umarmung wird Madam Parr nicht empfangen und nicht gebären ...
Und dann schauten sie Edward an, doch mit diesem prüfenden Blick wußte ich nichts anzufangen.
»Unverzagt, Mylords«, ermunterte Cranmer sie sanft. »Gott ist die Liebe. Unser Prinz ist reif für seine Jahre, und wahrscheinlich wird er gedeihen.«
Niemand antwortete. Meine Aufmerksamkeit schweifte ab. Auf der anderen Seite des Saales konferierte meine Schwester Maria mit einer Gruppe von Geistlichen rund um den Bischof, der nach der Trauung noch immer seine feierlichen Gewänder trug. Bei ihnen war der Herzog von Norfolk, ein dunkler Mann der Politik, den ich immer gefürchtet hatte, auch wenn ich wußte, daß er ein entfernter Verwandter von mir war. Auch sein Sohn war dabei, ein junger Kriegslord, der mein Haupt um eine Meile überragte: der Earl von Surrey.
»Und wenn nun, meine guten Lords«, murmelte Wriothesley hitzig, aber leise wie einer, der kaum zu sprechen wagt, »was, wenn Gott nun beschließen sollte, unserem jungen Prinzen die Prüfungen eines Lebens auf Erden zu ersparen und ihm schon früh die Krone der Ewigkeit ..?«
Paget wich zurück und warf ihm aus grauen Augen einen scharfen Blick zu. »Gefährliche Worte, Wriothesley!«
Wriothesley spuckte erbost in die frische grüne Binsenstreu auf dem Boden. »Können junge Männer denn nicht sterben – genauso wie alte?«
»Alles Leben ist in Gottes Hand«, erwiderte Cranmer streng. »Alles Schicksal, alle Zukunft. Alles wird sein, wie Gott es will!«
Als habe sie ihn gehört, drehte sich Marias schmale Gestalt zu uns um, und sie spähte kurzsichtig in meine Richtung. »Schwester?« rief sie, denn sie konnte mich nicht erkennen, sie konnte nur mein neues, leuchtend rotes Kleid sehen. »Elisabeth, komm her; ich will dich mit Mylord bekannt machen – mit Mylord Gardiner, dem Bischof von Winchester.«
Ich entfernte mich, und Wriotheleys letzte Bosheit begleitete mich. »Wenn die Papistin Maria sich jetzt an Gardiner hängt, dann wird man ihn besser im Auge behalten ...«
Eine gewichtige Gestalt überschattete die kleine Maria; ein Bischofsmantel und ein Kreuz waren Zeichen ihres Ranges. Eine ganze Schar minderer Geistlichkeit harrte, dahinter in stummen Reihen aufgefächert, der bischöflichen Befehle.
»Ist dies das Kind – die Lady Elisabeth?«
Bischof Gardiner strahlte eine unbeschreibliche Arroganz aus, als er finster in meine Richtung starrte; seine tiefliegenden Augen würdigten dabei die meinen keines Blicks. Sein Gesicht war dunkel, seine Nase krumm wie der Schnabel eines Bussards, und sein ungehobeltes Benehmen hätte eher zu einem Wirtshauswüterich denn zu einem Mann Gottes gepaßt. Seine struppig gerunzelten Brauen und die zernarbte Haut verliehen ihm eine furchterregende Häßlichkeit, aber der rote Mund unter dem stachligen Schnurrbart war weich und boshaft wie der eines Weibes.
Er mußte doch wissen, wer ich war! Weshalb also diese ungehörige Verstellung? Aber Maria starrte ihn mit einer Bewunderung an, bei der sie offenbar jedermann sonst vergaß. Mit Mühe richtete sie ihre Aufmerksamkeit jetzt auf mich. »Mylord Bischof hat mich gelehrt, Schwester ... oh, vieles gelehrt ...« Wieder dieser bewundernde Blick, den der stolze Prälat entgegennahm, als sei er ihm geschuldet, nicht mehr. »Lerne ihn kennen, Elisabeth, ich bitte dich, zum Wohle deiner Seele!«
»Seelen, Madam?« fauchte der Herzog von Norfolk, und seine linke Hand umklammerte erbost den Schwertgriff. »Alles war ganz in Ordnung, als die Sorge um die Seelen Seiner Gnaden dem Bischof hier und seinen Leuten überlassen war. Unsere Sache sind die Körper! Wenn der König die Absicht hat, diese Kriege gegen Frankreich zu führen, dann brauchen wir Männer – Männer und Geld! Sonst werden die Niederländer ...«
Langsam entfernte ich mich wieder, damit niemand mich bemerkte. Die Hochzeit meines Vaters, die Möglichkeit, daß meine neue Stiefmutter ein Kind bekäme, Marias Liebe zu Gott – oder eher zum Bischof? – ich hatte genug Nahrung für einen Tag, und mehr als genug zu verdauen für einen zehnjährigen Verstand. Einen großen Teil, muß ich gestehen, schob ich einstweilen beiseite, um später darüber nachzudenken, und vergaß es dann. Kurz darauf wurde ich wieder fortgeschickt und mußte den Hof verlassen, und so kehrte ich mit Kat und meinen Damen nach Hatfield zurück und nahm mein stilles Leben weit draußen auf dem Lande in Hertford wieder auf. Und dort ließen die Paten, die wußten, was noch kommen würde, mich den Rest meiner Kindheit verschlafen mit dem Schlaf der Unschuld, aus dem wir alle nur zu bald erwachen.
Kapitel II
Er kam an Mariä Verkündigung in jenem März des Jahres 1546. Der Frühling hatte zeitig begonnen in diesem Jahr; er wehte in die muffigen, teppichverhangenen Gemächer und in kalte, vergessene Winkel, niemals so willkommen wie jetzt nach diesem grausamen Winter. Behaglich an den Hang geschmiegt, wandte Hatfield der neugeborenen Sonne ein strahlendes Morgenantlitz zu. Nach dem Tode des Winters regte sich jetzt neues Leben, und draußen in den Ställen brüllten die Stiere Tag und Nacht nach ihren Kühen.
Auch im Hause lechzte rotes Blut nach der göttlichen Erschaffung des Menschen. Oft durchbrach jetzt dunkles Flüstern und leises Lachen den Frieden des alten Herrenhauses, und eine andere Jungfer meines Alters hätte sich wohl das Herz aus dem Leibe geseufzt vor Sehnsucht nach dem Allerliebsten oder wenigstens nach einem Traum von ihm am Abend von St. Agnes. Ich aber hatte den Kopf in anderen Wolken, da ich meinem vierzehnten Sommer entgegenreifte, und die Spiele der alten Dame Natur hatten keinen Reiz für mich.
Meine Bücher waren damals meine Liebe, und mit dem Entzücken einer Liebenden hastete ich durch den dunklen Korridor, um meinen Lehrer zu überraschen, indem ich schon vor ihm im Unterrichtszimmer war, den Kopf seit gestern vollgestopft mit neuem Wissen. »Die Macht Roms in jenen Tagen war so groß, daß viele böse Menschen sich dazu verschworen, die Oberherrschaft an sich zu reißen. Unter ihnen war Catilina, ein Mann von vielen Tugenden, aber mit einem großen, gierigen Hunger nach Macht ...«
Die schwarze Gestalt, die lautlos vor dem Fenster verharrte, sah aus wie ein Wesen aus der Unterwelt. Ich blieb auf der Schwelle stehen, geblendet von der gleitenden Morgensonne, und versuchte sie mit der Kraft meines Willens verschwinden zu lassen. Ich fürchte mich nicht vor Geistern; sie sind nicht mehr als wir, als das, was wir sein werden. Statt dessen aber streckte sich das Wesen wie eine Schlange und bewegte sich auf mich zu. Ich schloß die Augen und umklammerte meine Bücher, bis die messingbeschlagene Ecke des Psalters sich in meine Brust bohrte. Conserva me, Domine ... Bewahre mich, o Herr, denn in Dich habe ich mein Vertrauen gesetzt ...
»Mylady Elisabeth?«
Noch immer von feurigem Morgenlicht umkränzt, stand ein ganz in Schwarz gekleideter Mann vor mir. Schwarz, aber prachtvoll: ein Höfling, und zwar einer von Rang, nach dem Glanz des golddurchwirkten Satins und dem Schimmer seiner seidenen Hose zu urteilen. Die schwarzen Augen hatten das gleiche kalte Funkeln, ganz wie die Oberfläche eines stehenden Gewässers.
»Sir?«
Ich kannte ihn nicht. Aber es war jetzt eine ganze Weile her, daß ich bei Hofe gewesen war; dort gab es immer neue Leute. Diese Elster hier hätte in jeder Gesellschaft geglitzert. Um den Hals trug er eine Brillantenschnur, und ein Tafeldiamant, so groß wie ein kleiner Finger, blitzte an dem Hut, den er jetzt schwungvoll vom Kopfe nahm. Seine Verbeugung war übertrieben tief, aber auch irgendwie achtlos. Seine Stimme war an der Universität geschult, aber ihre Bosheit hatte sie dort nicht gelernt. Ein Paar Eidechsenaugen in einem alt-jungen Gesicht ließen mich nicht los.
»Man schickt mich, Euch zum Hofe zu bitten, Madam. Ihr sollt sogleich aufbrechen.«
»Zum Hofe? Aber meine Gouvernante, Mistreß Kat, weiß davon nichts. Mein Haushalt kann sich nicht im Handumdrehen losmachen. Meine Zofen ...«
»Mistreß Ashley ist in Kenntnis gesetzt – sie ist schon bei der Arbeit. Das gleiche gilt für Eure Damen und die Gentlemen Eures Haushalts.« Er machte eine Pause und schaute mich wieder mit jener seltsamen Andeutung von Unverschämtheit und Bosheit an.
Ich spürte, wie mir das Blut zu Kopfe stieg. »Sir, ich protestiere ...« Seine Antwort ließ all meinen Trotz erlöschen. »Ihr würdet Euren Willen doch nicht über den des Königs, Eures Vaters, stellen?«
»Der König ...?«
»... hat ausdrücklich Eile befohlen. Und wenn die Großen befehlen« – er schenkte mir ein schwermütiges Lächeln – »dann müssen die Kleinen gehorchen. Und Ihr, Mistreß Elisabeth, wäret – in Eurer Situation – nicht gut beraten, die Wünsche des Königs zu mißachten.«
Etwas schnürte mir die Kehle zu. »In meiner Situation ...?«
Er zuckte die Achseln. »Madam, wer wollte so unhöflich sein, den Makel des Verrats, den Eure Mutter beging, zu erwähnen – und die Form, die dieser Verrat annahm?« Wieder eine Pause. »Und doch sind auch die Könige und Großen den Ereignissen unterworfen, einer Macht, der niemand sich widersetzen kann ...«
Um ihn herum tanzten sonnenhelle Stäubchen in der Luft, und die Sonne erwärmte die alte Eichenholztäfelung in goldenem Glanz und hauchte den süßen Honigduft von Bienenwachs ins Zimmer. Angst drehte mir den Magen um. Am Fenster, vor der Sonne schwarz wie mein Besucher, summte hilflos eine kleine Fliege vor der grünlichen Scheibe. Draußen flutete das Licht des frühen Morgens durch den Park; es ließ die Fenster der großen Ostgalerie golden erstrahlen und setzte den Knospen im Obstgarten dahinter Feuerflammen auf. Auf den Feldern brachen die ersten Sprößlinge aus der lehmigen Erde, und die Wegränder waren von Schellkraut gesprenkelt, hell wie herabgefallene Sterne.
In einer Ecke des Fensterrahmens hockte eine große schwarze Spinne in ihrem neugesponnenen glänzenden Netz und lauerte auf Beute. Die Fliege spürte die Gefahr und schwirrte in wachsender Panik gegen das Glas, bis sie sich durch die eigene Angst in die tödlichen Fäden verstrickte. Und jetzt spreizte die Spinne die langen, schwarzen, behaarten Beine und setzte sich in Bewegung, um ihr den Todesstoß zu versetzen.
Domine, conserva me ...
Ich streckte die Hand nach dem Fenster aus, zerriß das Netz und befreite die kleine Fliege. Ich öffnete das Fenster und sah ihr nach, als sie in den klaren blauen Himmel davonflog. Dann wandte ich mich meinem schwarzgekleideten Besucher zu, und unter Anspannung aller meiner Nerven schenkte ich ihm ein Lächeln, das dem seinen gleichkam.
»Wir alle sind Diener Seiner Majestät«, sagte ich fromm und faltete die Hände in jungfräulicher Ergebenheit. »›Wenn ich meinen Kaiser vergesse, so soll Gott mich vergessen!‹ lehrt uns die Bibel. Es soll geschehen, wie mein Herr, der König, es verlangt.« Und ich fügte noch einen tiefen Knicks hinzu, um die Wirkung zu vervollständigen.
Er blinzelte verwirrt, gewann die Fassung aber sofort wieder. Sein Hut beschrieb eine vollkommene schwarze Parabel, als er sich verneigte.
»Dann werde ich Euch zum Hofe folgen, Mylady.«
»Euer Name, Sir? Damit ich Euch gebührend anreden kann?«
»Mein Name, Madam, ist ohne Bedeutung. Ich bin nichts als ein Bote zwischen Größeren – und Myladys stets demütiger, stets ergebener Diener.«
Da war er wieder, dieser vieldeutige Unterton, dieser vertraulich verharrende Blick. Die Wasser meiner Seele gefroren. Er wagte es, sich über mich zu erheben, über die Tochter des Königs? Was wußte er, was ich noch erst erfahren mußte?
»Lebt wohl, Mistreß.« Er wandte sich zum Gehen.
»Sir –« Ich bemühte mich, mein Lachen unbekümmert klingen zu lassen. »Was gibt es Neues bei Hofe? Wie geht es meinem Vater, dem König? Und Madame, seiner Königin?«
Noch einmal huschte ein falsches Lächeln über sein dunkles Gesicht.
»Das werdet Ihr sehen, Mylady.«
Ich hätte ihn umbringen können. »Aber bringt Ihr uns denn keinen Hoftratsch, Sir, die wir hier auf dem Lande begraben sind?«
Mit unendlicher Sorgfalt rückte er sich den Hut schräg auf den Kopf und warf die glänzenden schwarzen Locken zurück. »Begraben nicht länger, weder Ihr noch die Euren.« Er streifte die goldgestickten Handschuhe über und schnippte die perlenbesetzten Fransen an ihren Platz. »Und was die Neuigkeiten angeht, Madam Elisabeth« – plötzlich war das Zimmer erfüllt von seiner Bedrohlichkeit – »die werden sein, wie Ihr sie vorfindet – oder macht!«
Er machte auf dem lackierten Absatz kehrt und war verschwunden. Die Luft um mich herum war kalt und leer, als sei eben der Teufel hindurchgegangen. Ich umklammerte die Tischkante, als das Geräusch seiner Schritte im dunklen Flur verhallte, und versuchte die Angst niederzukämpfen, die in meinem Herzen wütete.
Der Verrat meiner Mutter ... und die Form, die dieser Verrat annahm ...?
Die Absätze klapperten hohl, und lange Stille folgte. Ein paar Augenblicke später kam meine vertraute Kat hereingerauscht. Mein Lehrer, Master Grindal, folgte ihr mit flatterndem Gewande. Beide schienen mir nicht in die Augen schauen zu wollen.
»Wie konnte es sein, Kat«, fragte ich fordernd und mit fester Stimme, »daß dieser – dieser Höfling mir hier allein und unangemeldet entgegentreten konnte, ohne meine Anstandsdame oder sonst eine von meinen Zofen?«
Kats liebes, rundes Gesicht verriet Angst und Zorn, und ihre kleine Gestalt zitterte vor Empörung. »Madam, er wollte es so!«
Ich konnte meine Wut nicht länger zügeln. »Er wollte es so! Und wer ist er, Kat, daß sein Wille meinem Haushalt Befehl ist?«
»Madam, er hatte ein Beglaubigungsschreiben vom König.«
»Von des Königs eigener Hand?«
»Gestattet, Lady Elisabeth.« Master Grindals hochgewachsene, schmale Gestalt tat einen Schritt nach vorn und verbeugte sich steif vor mir. »Mistreß Ashley und auch ich selbst« – er deutete mit dem Kopf auf Kat – »haben das Sendschreiben dieses Boten im Morgengrauen begutachtet. Es war ganz zweifelsfrei beglaubigt – und trug das Siegel des Königs.«
Es stimmte also. Niemand konnte dieses Beglaubigungsschreiben unterzeichnet haben außer dem König oder einem seiner engsten Ratgeber.
»Oh, Mylady!« Kat rang die rundlichen Hände und war totenbleich. Ich konnte sie nicht leiden lassen. Tausendfach hatte sie mir ihre Treue bewiesen in den zehn Jahren, da sie mir Gouvernante, Lehrerin und mehr als eine Mutter gewesen war. Erst vor einem Jahr hatte sie sich noch enger an mich gebunden, indem sie einen Vetter meiner Mutter, meinen obersten Kammerherrn John Ashley, geheiratet hatte. In letzter Zeit war ich an Bein und Körper länger geworden und tat es darin meinem Vater nach; erschrocken und in diesem Augenblick kein bißchen glücklich, stellte ich fest, daß ich auf sie hinabschaute.
Aber niemals hätte ich mich freiwillig über sie gestellt oder ihre Autorität bestritten.
»Nun denn«, sagte ich so munter, wie ich konnte, »wir haben das Beglaubigungsschreiben des Königs und damit seinen Willen. Also zum Hofe! Wann können wir reisen?«
Kats bange Sorge nahm sogleich eine neue Richtung, und ihre Seufzer ließen das enggeschnürte Mieder von neuem an seinen Verankerungen zerren. »Er sagt, sofort!« Ihre Hand flog zum Schlüsselbund an ihrem Gürtel. »Aber ich muß mich vorher noch um hundert Dinge kümmern! Heute muß ich mit Master Parry die Rechnungen durchsehen, und danach –«
»Dann sag ihm das, Kat.« Ich hörte überrascht, wie ruhig meine Stimme klang. »Du bist hier die Haushälterin, nicht er. Wir reisen, wenn du es sagst, nicht auf sein Kommando. Das ist mein Wunsch. Also, sag es ihm.«
Kats jammervolle Miene hellte sich sogleich auf.
»Sag ihm ...« Ich überlegte kurz. »Sag ihm: Ich bin meines Vaters Tochter in allen Dingen. Und sag ihm weiter: Wie mein Vater mich nicht vergißt, so möge dieser Bursche sich auch nicht vergessen – auf seine eigene Gefahr, jetzt und in Zukunft. Sag ihm das.«
Kat nickte. Ihre Augen funkelten von rechtschaffenem Zorn.
»Und zuletzt sagst du ihm« – und dabei lächelte ich Grindal trotzig zu – »daß ich meinen Unterricht nicht versäumen werde! – und bis dahin werden Master Grindal und ich mit Cicero und dem bösen Catilina durch das antike Rom streifen.«
Kat knickste und verschwand. Grindal trat vor und legte seine Büchertasche auf den Tisch. Das Sonnenlicht spielte auf seinem abgetragenen Gelehrtenmantel, seiner staubigen Mütze und seinem Haar, das nach geistesabwesender Toilette auf der einen Seite glattgestrichen, auf der anderen aber, zumindest heute, ganz unberührt von Kamm und Bürste geblieben war.
Aber im Vergleich mit der anderen schwarzgewendeten Gestalt, die hier zuletzt gestanden hatte, war er in meinen Augen von der Schönheit eines Engels. So wie er für mich immer schon ein Engel gewesen war: Denn mit großer Sorgfalt und Hingabe hatte er in den letzten drei Jahren meine Studien geleitet und durch sie die Schritte meines Geistes gelenkt. Er lehrte mich zu denken, und zwar mit forschendem Geist. Ein Greuel war ihm der blinde Glaube, der mit Gewalt eingetrichtert wurde, wie sie meine Schwester Maria heimsuchte, die nach spanischer Art erzogen und jeden Tag gepeitscht wurde. Dame Katherine Parr erwählte ihn für mich, als sie Königin wurde. Sie schrieb ihm und teilte ihm mit, was ich lesen oder studieren sollte, wie er seinerseits mit seinem eigenen Lehrer aus der Zeit in Cambridge, mit Master Ascham, korrespondierte. Zusammen mit Kat war er ein Teil meiner Seele – mehr noch, er war gleichsam einer ihrer Wagenlenker. Ich hätte ihm mein Leben anvertraut.
Jetzt allerdings wirkte er seltsam gedankenverloren, als er seine Tasche aufklappte und sorgfältig ein Paket Briefe in sein Wams schob. Dann legte er all die Paraphernalien unseres Arbeitstags im Schulzimmer zusammen: Gänsekiele, Tintenfässer, Alphabettafeln und sogar meine alte Schiefertafel, die für unwichtige Notizen immer noch aufgehoben wurde. Ich setzte mich, schlug mein Buch vom vergangenen Abend auf und begann eifrig.
»Wie Sallust uns erzählt, erhob sich zu der Zeit, da der große Cicero Konsul von Rom war, ein eitler und böser Mann namens Catilina. Dieser Catilina hatte keine Achtung vor Gesetz und guter Regierung, und er gierte nur nach Macht, die er durch List, Gewalt oder Blut zu erringen trachtete. Er umwarb das gemeine Volk und unternahm dann einen Angriff auf die Souveränität Roms. Sein abscheulicher Ehrgeiz ...«
»Macht wirkt immer anziehen«, unterbrach mich mein Lehrer in leisem, eindringlichem Ton. »Leuchtender als das röteste Gold, zarter als die Verlockungen einer Frau – immer – überall!«
Für ein junges Mädchen, das so viel Geschichte gelesen hatte wie ich, war das kein Geheimnis. »Master?«
»Immer! – streben eitle, gierige, ehrgeizige Männer nach der Macht!« Abwesend kämmte er sich mit einer Hand das Haar. »Um jeden Thron versammeln sie sich. Sogar hier!«
Hier? Meinte er jetzt unseren seltsamen Besucher? Oder sprach er vom Hof? Von wem?
Er las die Fragen in meinem Blick. »Genug von Sallust«, sagte er hastig. »Ihr habt Eure Fabeln, Mylady? Die Fabeln des Äsop?«
Meine Finger tasteten nach dem vertrauten kleinen, in Leder gebundenen Buch.
»Die Fabel vom alten Löwen, dem König der Tiere, der dem Sterben nahe ist ...«
Der König ... alt ... dem Sterben nahe ...
Ich konnte die Seite nicht finden. Plötzlich legte sich Grindals dürre Hand auf die meine, und seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Gesetzt den Fall, Madam, daß der alte Löwe, der sterbende König, nur eine kleine Nachkommenschaft hinterläßt. Und jetzt wartet das ganze Königreich der Tiere darauf, wie er seinen Thron vererben wird.«
Draußen vor dem Fenster kamen und gingen die sanften Laute des Morgens. Eine Lerche zwitscherte hoch oben am klaren Himmel. Aber im hellen Schulzimmer war die Stille tief wie ein Wasser.
»Die erste aus seiner Brut, eine junge Löwin, hatte er in die Wildnis hinausgeschickt, weil er ihre Mutter nicht länger ertragen konnte. Aber als sie dort draußen so viele Jahre lang allein war, fand sie Freunde und sammelte etliche um sich, die Mitleid hatten mit ihrem Schicksal. Nun hat sie eine starke Partei, und sie schickt sich an, ihre Rechte zu beanspruchen.«
Maria. Meine ältere Schwester Maria. Mein Vater hatte sich von ihrer Mutter scheiden lassen und sie weggeschickt.
Maria wird stark – gegen mich?
Grindal warf einen furchtsamen Blick über die Schulter. Der Winterteppich hinter der Tür hing noch zurückgeschlagen an der Wand; wie ich von den Weihnachtsspielen wußte, konnte sich dahinter leicht eine menschliche Gestalt verbergen.
Als ich noch hinschaute, schien der Teppich sich zu bewegen. Ich wandte mich Grindal zu, aber er hielt den Blick starr auf den Tisch gerichtet, auf die fedrig getupften Goldschuppen der Maserung im Eichenholz, und sprach murmelnd weiter. »Sagen wir, der alte Löwe hat noch ein weibliches Junges, jünger noch als das erste, dem Vater auch lieber und ihm ähnlicher.«
Ich selbst.
Es gibt keine andere.
»Auch sie hat ihre Anhänger, denen sie und der Neue Glaube am Herzen liegt. Aber als ihre Schwester stärker wird, versetzt man ihre Freunde in Angst und Schrecken. Man liest ihre Briefe; man wendet ihre eigenen Worte gegen sie.« Seine Hand hob sich flatternd zu dem Paket an seinem Busen. »So sehen sie nun wie durch einen dunklen Spiegel, unwissend und verwirrt. Es ergeht der Befehl, die Freunde der kleinen Löwin müßten sie ... verlassen ... oder sie verraten.«
Grindals leises Murmeln erstarb. Da kam wieder ein Geräusch hinter dem Wandteppich hervor. Ich stand auf und strich mir mein Kleid glatt; meine feuchten Hände raschelten auf dem rauhen Samt, als ich mich auf die Tür zubewegte.
Verraten ...
Zitternd verharrte ich an der Tür, aber meine Hand streckte sich dennoch zum Teppich aus. Wer es auch sein mochte, der mich verriet, ich wollte es wissen, und wenn es mich das Leben kostete.
Jeder sein eigener Ödipus, sagt Sophokles, geboren, die eigene Verwirrung zu enträtseln.
Närrin, die ich war! Der Zwischenraum hinter dem Teppich war leer. Eine kleine graue Maus lief raschelnd vorbei; das war das Geräusch gewesen, das meine von Angst infizierten Ohren gehört hatten. Ich kehrte zu Grindal an den Tisch zurück und nahm meinen Äsop mit immer noch zitternden Händen wieder auf.
»Sprecht weiter, Sir. Die kleine Löwin. Wird man sie verraten?«
Schweigen. Grindal beugte sich seufzend vor, schob die mit silbernem Filigran verzierte ABC-Tafel beiseite, die Kat mir als erste Fibel geschenkt hatte, und nahm ein Buch mit Maximen zur Hand.
»Wir wollen übersetzen, Mylady.« Sein Knochenfinger stach nach einem lateinischen Vers.
SILABATFORTUNA, ITIDEMAMICICOLLABASCUNT: FORTUNAAMICOSINVENIT.
»Plautus«, riet ich ins Blaue und begann zu übersetzen. »›Fällt das Glück von uns ab, so tun es auch die Freunde: Aber das Glück findet auch Freunde.‹«
War das Grindals Botschaft an mich – daß er mein Freund nur so lange war, wie Dame Fortuna lächelte? Bei anderen käme es nicht darauf an. Aber bei Grindal ...?
»Noch eine Lektion, Lady Elisabeth.« Er griff nach Tafel und Kreide und schrieb grob, ja, zornig in römischen Lettern drei Worte, die ich noch nie zuvor gesehen hatte:
VIDE AMPLIUSQUE ETIAM
So simples Latein war ich nicht mehr gewohnt, seit ich die Sprache zehn Jahre zuvor mit Kat zu lernen begonnen hatte. Ich wandte den Satz einmal im Geiste hin und her und spulte eine hastige Übersetzung herunter. »›Vide ampliusque etiam‹? Nun, Sir: Sieh, und sieh wieder.«
»Falsch! Falsch! Wiederholen! Wiederholen! Noch einmal!«
Die fieberhafte Gebärde, mit der er auf den in Frage stehenden Satz deutete, ließ mich nicht im Zweifel über seine Wichtigkeit. Angestrengt versuchte ich es noch einmal.
»›Sieh, und sieh noch einmal mehr‹?«
»Jaaa. Jaaa! Genau so!« Er schloß die Augen und murmelte noch einmal vor sich hin: »Vergeßt es nicht, Mylady – sieh, und sieh noch einmal mehr.« Plötzlich öffnete er die Augen wieder. »Und jetzt das letzte für heute.«
Er knüllte den weit herabhängenden Ärmel zusammen und wischte die Tafel sauber, ohne sich darum zu kümmern, daß der weiße Kreidestaub den fadenscheinigen schwarzen Stoff streifig machte. In wilder Konzentration zeichnete er zwei Figuren, eine neben der anderen. Ich packte die Schiefertafel mit beiden Händen und starrte sie an.
Ein Herz – und ein Fluß – oder ein Bach?
Behutsam beugte mein Lehrer sich vor und legte einen Finger an die Lippen. »Vergeßt es nicht, Mylady.« Und eindringlich machte er mit dem Finger eine verbindende Bewegung zwischen dem Herzen und dem Wasser. »Vergeßt es nicht!« Seine Stimme klang jetzt ruhiger. »Und prägt Euch auch die Worte des großen Cicero ein, die er sprach, als er darauf wartete, daß die Catilinarische Verschwörung sich offenbare – daß das Gift sich sammele wie in einer Eiterbeule, die man schließlich aufstechen könne.«
»Ich erinnere mich, Master«, sagte ich mit rauher Stimme. »Ich habe es gestern abend studiert. ›Vide: Tace‹, ermahnte Cicero seine Freunde. ›Sieh, und schweige.‹ Nun, Sir, dann soll Video et Taceo die Parole für mich sein: Ich werde sehen und schweigen. Keine Angst!«
Er verbeugte sich, stand auf, raffte seine Bücher zusammen und ging. Die Turmuhr draußen im Torhaus schlug die Stunde. Elf Uhr! Nicht später?
Oh, Grindal.
Er hatte mir praktisch gesagt, daß er mich hatte verraten müssen.
Et tu, Brute. Auch du?
Die Stunde des Mittagessens kam und ging, die Sonne verschwand aus dem Zimmer, und ich blieb wie erstarrt sitzen, erfaßt von einer Kälte, die mich außen und innen durchdrang.
Kapitel III
Es war eine Todeskälte, die ich fühlte, das Geburtsrecht eines jeden mutterlosen Kindes: Wenn eine Mutter stirbt, erfaßt eine ewige Kälte das Kind. Das Leben meiner Mutter war kurz – so kurz, daß es das meine kaum berührte. Aber wenn das Böse, das Menschen tun, nach ihnen weiterlebt – nun, wir alle wissen, daß die Frauen Evas Töchter sind, zur Sünde geboren, Kinder des göttlichen Zorns.