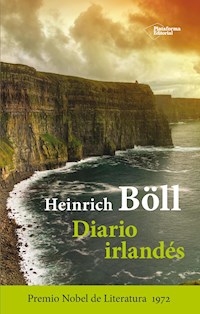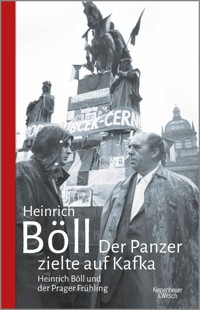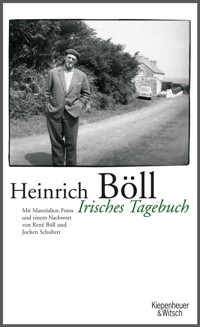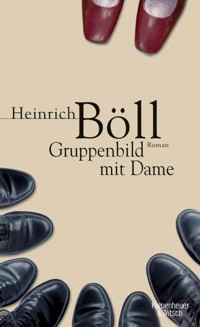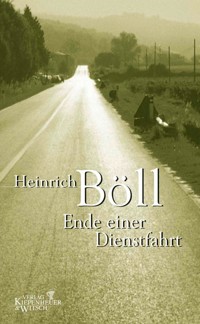
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem kleinen rheinischen Amtsgericht wird ein kurioser Fall verhandelt. Der Sachverhalt ist klar, die Begleitumstände dagegen sind höchst sonderbar. Und sonderbar ist auch, dass die Presse kein Interesse an diesem Prozess zeigt.Angeklagt sind zwei Handwerker, Vater und Sohn, äußerst eigenwillige Gesellen. Sie tischlern nicht nur, sie denken auch, und sie sind von einer geradezu provozierenden Unabhängigkeit. Sie wurden ertappt, als sie – seelenruhig ihre Zigaretten rauchend – mit großer Genugtuung einen brennenden Jeep der Bundeswehr betrachteten, den sie offenbar vorher präpariert und in Brand gesteckt hatten. Der Prozess könnte also Schlagzeilen machen, wird aber – vermutlich im Staatsinteresse – klein gehalten. Das Geschehen im Gerichtssaal trägt familiäre Züge. Man bleibt unter sich, und so wird die Verhandlung zu einer Art intimer Sozialpsychologie der kleinen Stadt. In der ironischen, oft zärtlich genauen Darstellung der Figuren zeigen sich die Eigentümlichkeiten von Heinrich Bölls Erzählweise. Etwas, das als Aufruhr gemeint ist, trägt Züge der Idylle. Eine Akt, der darauf zielt, gesellschaftliche Konventionen zu sprengen, wird in die soziale Form eines liebenswürdigen Kleinstadtprozesses gebannt. Dieser Widerspruch ist das Thema von »Ende einer Dienstfahrt«. Informieren Sie sich auch über das größte editorische Unternehmen in der Geschichte des Verlags Kiepenheuer & Witsch: Heinrich Böll, Werke 1 - 27 Kölner Ausgabe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
» Buch lesen
» Informationen zum Autor (Klappentext)
» Lieferbare Titel / Lesetipps
» Impressum
[Menü]
Ende einer Dienstfahrt
(1966)
[Menü]
I
Vor dem Amtsgericht in Birglar fand im Frühherbst des vorigen Jahres eine Verhandlung statt, über deren Verlauf die Öffentlichkeit sehr wenig erfuhr. Die drei im Kreise Birglar verbreiteten Zeitungen, die »Rheinische Rundschau«, das »Rheinische Tagblatt« und der »Duhrtalbote«, die unter den Rubriken »Aus dem Gerichtssaal«, »Im Gerichtssaal« und »Neues aus den Gerichtssälen« gelegentlich, etwa bei Viehdiebstählen, größeren Verkehrsdelikten, Kirmesschlägereien umfangreiche Reportagen veröffentlichten, brachten über diesen Fall nur eine kleinere Notiz, die überraschenderweise in allen drei Zeitungen gleich lautete: »Vater und Sohn Gruhl fanden einen milden Richter. Eine der beliebtesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in unserer Kreisstadt, Amtsgerichtsdirektor Dr. Stollfuss, der an dieser Stelle noch gebührend gewürdigt werden wird, leitete als letzte Verhandlung vor seiner Pensionierung den Prozeß gegen Johann und Georg Gruhl aus Huskirchen, deren unverständliche Tat im Juni einige Gemüter erregt hatte. Die beiden Gruhl wurden nach eintägiger Verhandlung zu vollem Schadenersatz und sechs Wochen Haft verurteilt. Sie nahmen nach kurzer Beratung mit ihrem Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Hermes aus Birglar das milde Urteil an. Da ihnen die Untersuchungshaft angerechnet wurde, konnten sie sofort auf freien Fuß gesetzt werden.«
Die Lokalredaktionen der »Rheinischen Rundschau« und des »Rheinischen Tagblattes« waren schon einige Wochen vor Prozeßbeginn übereingekommen, einander in dieser Sache keine Konkurrenz zu machen, den Fall Gruhl nicht »hochzuspielen«, es sei »zu wenig drin«. Wenn - was nicht zu befürchten war - Leser sich über die fehlende Information über den Prozeß Gruhl beklagen sollten, so hatten beide Redaktionen eine Ausrede bereit, die, wie der »Rundschau«-Redakteur Krichel sagte, »besser saß als die Schlittschuhe einer Eiskunstweltmeisterin«: der gleichzeitig beginnende Prozeß gegen den Kindermörder Schewen in der nahe gelegenen Großstadt, der mehr Leser interessiere. Ein Versuch dieser beiden Redaktionen, mit dem Chefredakteur, Verleger und Drucker des »Duhrtalboten«, Herrn Dr. Hollweg, die gleiche Vereinbarung zu treffen, war gescheitert. Dr. Hollweg, der im Kreise Birglar eine Art liberaler Opposition betrieb, witterte - nicht zu Unrecht - eine »klerikal-sozialistische« Verschwörung und beauftragte seinen derzeitigen Reporter, den ehemaligen Studenten der evangelischen Theologie Wolfgang Brehsel, sich die Sache vorzumerken. Brehsel, der Gerichtsreportagen allen anderen Reportagen vorzog, war auf den überraschend angesetzten Verhandlungstermin durch die Frau des Verteidigers Dr. Hermes aufmerksam gemacht worden, die ihm auch, als sie nach einem Vortrag über »Das Konzil und die Nichtchristen« bei einem Glas Bier mit dem Referenten, einem Prälaten Dr. Kerb, zusammensaßen, erklärt hatte, was am Fall Gruhl wirklich berichtenswert sei: das volle Geständnis der Angeklagten, deren Tat, deren Persönlichkeiten, vor allem aber die Tatsache, daß der Ankläger das merkwürdige Vergehen der beiden Gruhl nun lediglich als »Sachbeschädigung und groben Unfug« verurteilt zu sehen wünsche und den offenbaren Tatbestand der Brandstiftung ignoriere. Außerdem erschien der Hermes, die selbst cum laude in juribus promoviert hatte, bemerkenswert: die rasche Anberaumung der Verhandlung, die Unterbringung der Angeklagten in dem provisorisch mit ein paar Zellen ausgestatteten Gerichtsgebäude, wo sie, wie in Birglar bekannt sei, wie die Vögel im Hanfsamen lebten; ganz besonders bemerkenswert erschien der Hermes, daß man diesen Prozeß vor einem Amtsgericht ablaufen ließ, unter dem Vorsitz des zur Pensionierung anstehenden Dr. Stollfuss, der seiner humanen Vergangenheit und Gegenwart wegen berühmt und berüchtigt war. Auch dem Brehsel, obwohl er sich gerade in den Anfangsgründen der Rechtsprechung zurechtzufinden begann, schien für ein solches Vergehen mindestens ein Schöffengericht, kein Einzelrichter, zuständig; die Hermes bestätigte das, wandte sich dann dem Referenten des Abends, Prälat Dr. Kerb, zu und bat ihn, der sich angesichts dieser Birglarer Lokalschwätzereien schon zu langweilen begann, doch dem ökumenisch sehr interessierten Nichtkatholiken Brehsel ein paar Stichworte für seinen Artikel über das Referat zu geben.
Noch am gleichen Abend hatte Brehsel in der Redaktion mit seinem Chef Dr. Hollweg über diese juristischen Finessen im Falle Gruhl gesprochen, während er Hollweg, der gern bewies, daß er auch die Berufe des Druckers und Setzers »von der Pike auf« gelernt hatte, den Artikel über das abendliche Referat in die Setzmaschine diktierte. Hollweg, dem der Enthusiasmus des Brehsel gefiel, gelegentlich aber, wie er sagte, »auf die Nerven drückte«, veränderte in dessen Artikel den Ausdruck »sehr optimistisch« in »mit einer gewissen Hoffnung«, den Ausdruck »prächtige Liberalität« in »mit einem gewissen Freimut« und beauftragte den Brehsel, über den Prozeß Gruhl für den »Duhrtalboten« zu berichten. Dann wusch er sich die Hände mit jener kindlichen Freude, die ihn jedesmal überkam, wenn er sich durch wirkliche und wahre Arbeit die Hände schmutzig gemacht hatte, und fuhr mit seinem Auto die wenigen Kilometer nach Kireskirchen zu seinem Parteifreund, einem Abgeordneten, der ihn zum Essen eingeladen hatte. Hollweg, ein jovialer, sehr liebenswürdiger, wenn auch ein wenig zur Indolenz neigender Mensch Anfang Fünfzig, ahnte nicht, daß er seinem Parteifreund erheblichen Kummer ersparte, indem er selbst auf den merkwürdigen Fall Gruhl zu sprechen kam. Er äußerte sich erstaunt darüber, daß die Staatsmacht, deren Härte, wo sie sich zeigte, er anzuprangern nicht aufhören wolle, der man auf die Finger sehen müsse, sich in diesem Fall so milde zeige; ein solches Entgegenkommen der Staatsmacht sei ihm genauso verdächtig wie übermäßige Härte; als Liberaler fühle er sich verpflichtet, auch in einem solchen Fall den Finger auf die Wunde zu legen. Hollweg, der gelegentlich ins Schwätzen verfiel, wurde von seinem Parteifreund in der bewährten liebenswürdigen Weise ermahnt, doch die Vorgänge im Kreise Birglar nicht zu überschätzen, wie es ihm oft unterlaufen sei, zum Beispiel im Falle des Heinrich Grabel aus Dulbenweiler, in dem er sofort einen Märtyrer der Freiheit gesehen, der sich aber als ganz kleiner Schwindler erwiesen habe, als mieser Gernegroß mit einer »ziemlich offenen Hand für Gelder aus der falschen Himmelsrichtung«. Hollweg wurde nicht gern an den Fall Heinrich Grabel erinnert; für den hatte er sich ins Zeug gelegt, ihm Publicity verschafft, ihn auswärtigen Kollegen ans Herz gelegt, sogar den Korrespondenten einer überregionalen Zeitung hatte er für ihn interessiert. Er küßte der Frau des Abgeordneten, die gähnend um Entschuldigung und die Erlaubnis sich zurückziehen zu dürfen bat - sie habe die ganze Nacht am Bett ihrer kleinen Tochter gewacht -, er küßte ihr die Hand, widmete sich eine Weile dem Nachtisch, mit Paprika und Zwiebeln garniertem Camembert, zu dem ein gutes Glas Rotwein serviert wurde. Der Abgeordnete goß ihm nach und sagte: »Laß doch die Finger von diesen Gruhls.« Aber Hollweg erwiderte, eine solche Aufforderung, hinter der er - so dumm sei er denn doch nicht - eine Absicht wittere - eine solche Mahnung sei für ihn, einen leidenschaftlichen Liberalen und Journalisten, geradezu ein Ansporn, sich der Sache anzunehmen. Sein Gastgeber wurde ernst und sagte: »Du, Herbert, hab ich dich je um einen Gefallen gebeten, was deine Zeitung betrifft?« Hollweg, jetzt verdutzt, sagte nein, das habe er nie. Jetzt, sagte der Gastgeber, bäte er ihn zum erstenmal um etwas, »und zwar um deinetwillen«. Hollweg, der wegen seines Birglarer Lokalpatriotismus genug gehänselt wurde, sich auch seiner Provinzialität schämte, versprach, seinen Reporter zurückzupfeifen, aber unter der Bedingung, daß der Abgeordnete ihm die Hintergründe erkläre. Es gebe keine Hintergründe, sagte der; Hollweg könne ja hingehen, an der Verhandlung teilnehmen, dann entscheiden, ob sie eines Berichtes wert sei; es sei eben nur töricht, wenn irgendein Reporter die Sache aufbausche. Hollweg überfiel schon ein Gähnen, wenn er sich den Gerichtssaal vorstellte: dieses muffige, immer noch nach Schule riechende Gebäude neben der Kirche; der alte Stollfuss, dessen Kusine Agnes Hall als obligatorische Zuschauerin, und außerdem: war es nicht wünschenswert, wenn die beiden Gruhl einen milden Richter fanden und von Publicity verschont wurden? Im übrigen würde es ein Segen für alle Liebhaber alter Möbel im Kreis Birglar und darüber hinaus sein, wenn Gruhl sen. wieder frei war, seine geschickten Hände, sein untrüglicher Geschmack der Gesellschaft wieder zu Diensten standen.
Beim Kaffee, den der Abgeordnete im Herrenzimmer aus einer Thermoskanne eingoß, fragte er Hollweg, ob er sich an eine gewisse Betty Hall aus Kireskirchen erinnere, die später Schauspielerin geworden sei. Nein, sagte Hollweg, er, der Abgeordnete, vergesse wohl den Altersunterschied zwischen ihnen, der immerhin fünfzehn Jahre betrage; was denn mit dieser Hall los sei; sie trete, sagte der Abgeordnete, in der nahe gelegenen Großstadt in einem polnischen Theaterstück auf und habe eine glänzende Presse. Hollweg nahm die Einladung ins Theater an.
Morgens gegen siebeneinhalb Uhr wurde Brehsel von Hollweg angerufen und aufgefordert, nicht über den Fall Gruhl in Birglar zu berichten, sondern in die nahe gelegene Großstadt zu fahren, wo zur gleichen Stunde der Sensationsprozeß gegen den Kindermörder Schewen begann. Brehsel kam es einige Augenblicke lang seltsam vor, daß sein Chef, der als Langschläfer galt, ihn so früh am Morgen anrief, bis ihm einfiel, daß Langschläfer meistens spät ins Bett gehen und Hollweg möglicherweise gerade erst nach Hause gekommen sei. Hollwegs Stimme kam ihm auch eine Spur zu energisch, fast befehlend vor, beides Nuancen, die ihn überraschten; Hollweg war sonst ein nachgiebiger, wenig energischer Mensch, der sich nur zu erregen pflegte, wenn an einem einzigen Tag drei oder vier Abbestellungen einliefen. Brehsel dachte nicht sehr lange über diese minimalen Abweichungen vom Gewöhnlichen nach, rasierte sich, frühstückte und fuhr mit seinem Kleinauto in die nahe gelegene Großstadt; er war ein wenig nervös wegen der Parkschwierigkeiten, die ihm bevorstanden, auch weil er sich vor den großen internationalen Reportage-Löwen fürchtete, die sich aus aller Welt angesagt hatten. Eine Pressekarte lag, wie Hollweg versichert hatte, für ihn bereit; durch frühe Morgentelefonate eine Karte zu besorgen, hatte sich der Abgeordnete, der Mitglied des Wehr- und des Presseausschusses war, stark gemacht.
Der Prozeß Gruhl fand im kleinsten der drei zur Verfügung stehenden Säle vor zehn Zuschauern statt, die fast alle mit den Angeklagten, Zeugen, Gutachtern, Gerichtspersonen oder anderen mit dem Prozeß befaßten Personen verwandt waren. Lediglich einer der Anwesenden war ortsfremd, ein schlanker, unauffällig, jedoch gediegen gekleideter Herr mittleren Alters, der nur dem Vorsitzenden, dem Staatsanwalt und dem Verteidiger als Amtsgerichtsrat Bergnolte aus der nahe gelegenen Großstadt bekannt war.
Im Zeugen-, dem ehemaligen Lehrerzimmer der Schule, die als vierklassige in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erbaut, zur sechsklassigen um die Jahrhundertwende erweitert, in den späten fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts durch einen Neubau ersetzt und der sprichwörtlich armen Justizbehörde übergeben worden war, die bis dahin in einer ehemaligen Unteroffiziersschule die Rechtspflege betrieben hatte; im Zeugenzimmer, das für sechs, höchstens acht Personen berechnet war, drängten sich vierzehn Personen verschiedener sozialer und moralischer Qualität: der alte Pfarrer Kolb aus Huskirchen, zwei Frauen aus dessen Gemeinde, von denen die eine den Ruf sagenhafter Biederkeit und Kirchentreue, die andere den Ruf einer übersinnlichen Person genoß, wobei über als Steigerung von sinnlich, nicht im Sinne von metasinnlich gemeint war; außerdem: je ein Offizier, Feldwebel und Gefreiter der Bundeswehr, ein Wirtschaftsprüfer, ein Gerichtsvollzieher, ein Finanzbeamter aus dem mittleren gehobenen Dienst, ein Reisevertreter, ein Kreisbevollmächtigter für Verkehrsfragen, der Obermeister der Tischlerinnung, ein Polizeimeister, eine Barbesitzerin. Als die Verhandlung begann, mußte Justizwachtmeister Sterck, der eigens zu diesem Zweck aus der nahe gelegenen Großstadt abkommandiert worden war, den Zeugen das Ambulieren auf dem Flur untersagen; wenn im Gerichtssaal laut gesprochen wurde, konnte man auf dem Flur die Verhandlung mithören. Dieser Umstand hatte schon zu mancher ergebnislosen Kontroverse zwischen dem Amtsgerichtsdirektor und seiner vorgesetzten Behörde geführt. Da bei Diebstählen, Erbschaftsstreitigkeiten, Verkehrsdelikten des Gerichts einzige Chance bei der Wahrheitsfindung darin bestand, Widersprüche in den Zeugenaussagen aufzudecken, mußte meistens ein Wachtmeister als Zeugenbewacher angefordert werden, der oft mit den Zeugen weitaus strenger verfahren mußte als sein Kollege drinnen im Saal mit den Angeklagten. Es kam auch gelegentlich im Zeugenzimmer zu Handgreiflichkeiten, wüsten Schimpfereien, Verleumdungen und Verdächtigungen. Der einzige Vorteil der ausgedienten Schule bestand, wie es ironisch in den entsprechenden Eingaben immer wieder hieß, in der Tatsache, »daß an Toiletten kein Mangel bestehe«. In der nahe gelegenen Großstadt, bei der dem Amtsgericht Birglar vorgesetzten Behörde, die in einem Neubau mit offenbar zuwenig Toiletten untergebracht war, gehörte es zu den Standardwitzen, jedem, der sich über Toilettenmangel beklagte, den Rat zu geben, er möge doch per Taxi in das nur fünfundzwanzig Kilometer entfernte Birglar fahren, wo notorischer Überfluß an justizeigenen Toiletten herrsche.
Im Verhandlungssaal herrschte unter den Zuschauern eine Stimmung, wie vor den Aufführungen von Liebhabertheatern, die ein klassisches Repertoirestück angekündigt haben; eine gewisse wohlwollende Spannung, die ihre Wohltemperiertheit aus der Risikolosigkeit des Unternehmens bezieht: man kennt die Handlung, kennt die Rollen, deren Besetzung, erwartet keine Überraschungen und ist dennoch gespannt; geht's schief, so ist nicht viel verloren, höchstens ein wenig liebenswürdiger Eifer verschwendet; geht's gut: desto besser. Allen Anwesenden waren die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens und der Voruntersuchung auf dem Umweg über direkte oder indirekte Indiskretionen, wie sie in kleinen Ortschaften unvermeidlich sind, bekannt. Jeder wußte, daß die beiden Angeklagten voll geständig waren, sie waren sogar, wie der Staatsanwalt vor wenigen Tagen im vertrauten Kreis gesagt hatte, »nicht nur geständiger« als alle Angeklagten, die er je gesehen hatte, nein, sie waren »die geständigsten«; sie hatten weder während des Ermittlungsverfahrens noch während der Voruntersuchung den Zeugen oder Gutachtern widersprochen. Es werde, so hatte der Staatsanwalt geäußert, eines jener reibungslosen Verfahren, wie sie jedem erfahrenen Juristen unheimlich seien.
Nur drei im Zuschauerraum anwesende Personen wußten, was gewiß auch »andernorts« - so nannte man in solchen Fällen die nahe gelegene Großstadt - bekannt war: daß die Staatsmacht, indem sie sich darauf beschränkte, den Angeklagten lediglich Sachbeschädigung und groben Unfug und nicht Brandstiftung zur Last zu legen, indem sie außerdem einen Einzelrichter als ausreichende Instanz mit der Durchführung des Verfahrens befaßte, auf eine überraschende Weise tiefstapelte.
Die beiden Personen, die Einblick in solche Zusammenhänge hatten, waren die Frau des Staatsanwalts Dr. Kugl-Egger, die erst vor wenigen Tagen, nachdem ihr Mann endlich eine Wohnung gefunden hatte, nach Birglar übergesiedelt war, und die Frau des Verteidigers Dr. Hermes, eine Kaufmannstochter aus Birglar, die, was sie wußte, schon dem Reporter Brehsel am Vorabend erzählt hatte: daß man »andernorts« entschieden habe, weder ein Schöffengericht noch - was durchaus »drin« gewesen wäre - eine große Strafkammer zu befassen; da man aber wisse, daß kein Verteidiger so pervers reagiere, wenn er die Möglichkeit habe, seine Angeklagten von einem müden alten Humanitätslöwen wie Stollfuss abgeurteilt zu sehen, ihn vor die kleine Strafkammer, den »miesen Köter« Prell zu schleppen: habe man »andernorts« entschieden, den Fall Gruhl kleinzuhalten; darin müsse ein unausgesprochenes, aber spürbares Entgegenkommen erblickt werden und gleichzeitig eine Bitte um Entgegenkommen; Hermes, ihr Mann, behalte sich aber vor, je nachdem, wie der Fall verliefe, beides, Entgegenkommen und Bitte um Entgegenkommen, abzulehnen und auf einer neuen Verhandlung, mindestens vor einem Schöffengericht, zu bestehen.
Die dritte im Zuschauerraum anwesende Person, die über solche Zusammenhänge informiert war, Amtsgerichtsrat Bergnolte, wäre außerstande gewesen, sich solche Überlegungen bewußt zu machen; als Mensch von hoher Wahrnehmungsintelligenz, einer sprichwörtlichen Kenntnis der Gesetzestexte begriff er zwar den Vorgang: daß die zur Wiederherstellung des Rechtes vorhandene, mit Macht ausgestattete Justiz hier, wie ein Kollege es genannt hatte, »unter den Strich ging«; doch Begriffe wie »Entgegenkommen« oder gar »Bitte um Entgegenkommen« hätte er in diesem Zusammenhang als unzulässig bezeichnet.
Als Richter und Staatsanwalt eintraten und sich auf ihre Plätze begaben, die Zuschauer sich erhoben, zeigte sich in der Art, wie sie aufstanden, sich wieder hinsetzten, jene familiäre Lässigkeit, wie man sie nur in Klostergemeinschaften kennt, wo das Ritual zur freundlichen Gebärde unter Vertrauten geworden ist. Auch als die Angeklagten hereingeführt wurden, war die Bewegung nicht heftiger; fast alle Anwesenden kannten sie, wußten auch, daß sie während ihrer zehn Wochen dauernden Untersuchungshaft Frühstück, Mittagessen und Abendbrot aus dem besten Haus am Platz gebracht bekamen, von einer jungen Dame, einem der hübschesten Mädchen, die je im Kreis Birglar aufgewachsen waren; so gut, wie sie während der Untersuchungshaft versorgt wurden, waren die beiden seit zweiundzwanzig Jahren, seit dem Tode ihrer Frau und Mutter, nie versorgt worden; es wurde sogar gemunkelt, sie würden gelegentlich, wenn nicht gerade andere Häftlinge einsaßen, deren Indiskretion zu fürchten gewesen wäre, zu besonders populären Fernsehsendungen in das Wohnzimmer des Justizwachtmeisters Schroer eingelassen; Schroer und seine Frau widersprachen zwar diesen Gerüchten, aber nicht allzu heftig.
Lediglich der Frau des Staatsanwalts und dem Bergnolte waren die Angeklagten nicht bekannt; die Frau des Staatsanwalts gestand beim Mittagessen ihrem Mann, sie habe sofort eine starke Sympathie für beide empfunden. Bergnolte bezeichnete am Abend den Eindruck, den er gewann, als »wider meinen Willen positiv«. Die beiden wirkten gesund, waren gut gekleidet, sauber und ruhig; sie wirkten nicht nur gefaßt, sondern heiter.
Die Vernehmungen zur Person verliefen fast reibungslos; sieht man davon ab, daß Dr. Stollfuss tun mußte, was er gewöhnlich tun mußte: die Angeklagten auffordern, lauter, artikulierter zu sprechen und nicht zu sehr in den zungenschweren Dialekt der Landschaft zu verfallen; sieht man davon ab, daß dem Staatsanwalt, einem Orts- und Landschaftsfremden, gelegentlich Dialektausdrücke ins Hochdeutsche übersetzt werden mußten, geschah nicht viel Erwähnenswertes, wurde auch nicht viel Neues zur Sprache gebracht. Der Angeklagte Gruhl sen., der seine Vornamen mit Johann Heinrich Georg angab, sein Alter mit fünfzig, ein schmaler, fast zarter mittelgroßer Mensch, dessen Kahlkopf dunkel schimmerte, sagte, bevor er sachliche Angaben zu seiner Person machte, er wolle hier noch etwas mitteilen, das der Herr Vorsitzende, den er kenne, schätze, ja, verehre, ihm nicht verübeln möge; es sei eben, was er zu sagen habe, die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit, wenn es auch eine sehr persönliche Aussage sei; was er sagen wolle: ihm läge nichts, nicht das geringste an Recht und Gesetz, er würde auch hier keine Aussage machen, nicht einmal sein Alter angeben, wenn nicht - und diese Aussage, die im Zuschauerraum kaum jemand verstand, ging in der tonlosen, leisen Aussprache des Gruhl fast verloren -, wenn nicht persönliche Gründe mitspielten; der erste dieser persönlichen Gründe sei seine Hochschätzung des Herrn Vorsitzenden, der zweite sei seine Hochschätzung der Zeugen, besonders des Polizeimeisters Kirffel, der ein guter, ja, sehr guter Freund seines Vaters, des Landwirts Gruhl aus Dulbenweiler, gewesen sei; auch die Zeuginnen Leuffen, seine Schwiegermutter, und Wermelskirchen, seine Nachbarin, die Zeugen Horn, Grähn und Hall und Kirffel wolle er hier nicht im Stich lassen oder in Schwierigkeiten bringen - deshalb sage er aus, nicht weil er erwarte, daß »aus den Gebetsmühlen der Gerechtigkeit auch nur ein Körnchen Wahrheit herausgemahlen« werde.
Während des größeren Teils dieser Vor-Aussage sprach er Dialekt, und weder der Vorsitzende noch der Verteidiger, die ihm beide wohlwollten, unterbrachen ihn oder forderten ihn auf, deutlich und in Hochdeutsch zu sprechen; der Staatsanwalt, der sich schon oft mit Gruhl unterhalten hatte und den Dialekt weder mochte noch verstand, hörte gar nicht richtig hin; der Protokollführer, Referendar Außem, schrieb in diesem Stadium noch nicht mit: ihn langweilte diese Verhandlung ohnehin. Ein paar Brocken dieser rasch und tonlos vorgebrachten Einleitung verstanden unter den Zuschauern nur zwei Kollegen des Gruhl, Frau Dr. Hermes und eine ältere, fast ältliche Dame, Fräulein Agnes Hall, die den Gruhl sehr gut kannte. Gruhl gab dann seinen Beruf als den eines Tischlermeisters an, seinen Geburtsort mit Dulbenweiler, Kreis Birglar; dort habe er die Volksschule besucht und im Jahre 1929 absolviert; dann sei er in Birglar »bei meinem verehrten Meister Horn« in die Lehre gegangen, habe schon im dritten Lehrjahr Abendkurse an der Kunstgewerbeschule der nahe gelegenen Großstadt besucht, sich im Jahre 1936 im Alter von einundzwanzig Jahren selbständig gemacht, mit dreiundzwanzig habe er im Jahre 1937 geheiratet, mit fünfundzwanzig, »im erforderlichen Mindestalter«, im Jahre 1939 seine Meisterprüfung gemacht; er sei erst 1940 eingezogen worden, bis 1945 Soldat gewesen. Hier unterbrach der Vorsitzende zum erstenmal Gruhls monotone, kaum verständliche Aussage, von der der Protokollführer später sagte, er habe dabei dauernd ein heftiges Gähnen unterdrücken müssen, und fragte den Angeklagten, ob er an Kampfhandlungen während des Krieges teilgenommen oder sich vor oder während des Krieges politisch betätigt habe. Gruhl, fast mürrisch - obwohl von Dr. Stollfuss energisch aufgefordert, lauter zu sprechen - sagte tonlos und fast unverständlich, er habe zu diesem Punkt fast dasselbe zu sagen wie zu Recht und Gesetz; er habe weder an Kampfhandlungen teilgenommen noch sich politisch betätigt, er möchte aber - und hier wurde er ein wenig lauter, weil er ärgerlich zu werden schien -, er möchte aber betonen, daß dies weder aus Heroismus noch aus Gleichgültigkeit geschehen sei: dieser »Blödsinn« sei ihm einfach zu dumm gewesen. Was seine Dienstzeit als Soldat betreffe, so sei er meistens in seiner Eigenschaft als Möbeltischler damit beschäftigt gewesen, Offiziersquartiere und -kasinos in »deren für mich undiskutablem Geschmack« auszustatten, hauptsächlich aber habe er »gestohlene oder beschlagnahmte Directoire-, Empire- und manchmal auch Louis-Seize-Möbel« im besetzten Frankreich restauriert und sachgerecht für den Versand nach Deutschland verpackt. Hier griff der Staatsanwalt ein, der Verwahrung gegen den Terminus »gestohlen« einlegte, der angetan sei, »überholte Kollektivvorstellungen von deutscher Barbarei« zu bekräftigen oder wiederzuerwecken; im übrigen, das sei so rechts- wie aktennotorisch, sei der Abtransport »französischen Eigentums aus dem besetzten Frankreich« verboten gewesen, ja, habe unter hoher Strafe gestanden. Gruhl blickte ihn ruhig an und erwiderte, er wisse nicht nur, er könne beschwören - falls ihm ein Schwur angebracht erschiene -, daß der größere Teil der Möbel gestohlen gewesen und trotz des Verbots, von dem er wisse, nach Deutschland transportiert worden sei, »meistens in den Flugzeugen hochdekorierter Sportskameraden«; es sei ihm, fügte Gruhl hinzu, schnurz und schnuppe, ob er damit ein Kollektivurteil ausspreche oder nicht. Was die Frage nach seiner politischen Betätigung betreffe: für Politik habe er sich nie sonderlich interessiert, »erst recht nicht für diesen Blödsinn«, der damals im Gang gewesen sei; seine verstorbene Frau sei sehr religiös gewesen, sie habe vom »Antichrist« gesprochen; das habe er, obwohl er seine Frau sehr geliebt habe, zwar nicht verstanden, aber respektiert und er habe »fast verehrt, wie sie sich ereiferte«; selbstverständlich sei er immer auf »der Seite der anderen gewesen«, das sei aber, wie er betonen möchte, selbstverständlich. Nach dem Krieg sei es ihm unter Mithilfe holländischer Freunde - er sei damals in Amsterdam gewesen - gelungen, »irgendeiner Gefangenschaft zu entgehen«, und er habe von 1945 an, jetzt in Huskirchen, wieder als Tischlermeister gelebt und gearbeitet. Er wurde vom Staatsanwalt gefragt, was er unter dem von ihm so betonten selbstverständlich verstehe. Gruhl antwortete: »Das würden Sie doch nicht verstehen.« Der Staatsanwalt legte, zum erstenmal leicht gereizt, Verwahrung gegen diese unzulässige Beurteilung seiner Intelligenz seitens des Angeklagten ein. Als Gruhl, von Dr. Stollfuss gerügt, aufgefordert wurde, dem Staatsanwalt Antwort zu geben, sagte er, das sei ihm zu umständlich und er verweigere die Aussage. Vom Staatsanwalt, der böse zu werden begann, gefragt, ob er je mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sei, sagte Gruhl, er habe in den letzten zehn Jahren in ständigem Konflikt mit dem Gesetz, dem Steuergesetz, gelebt, vorbestraft sei er aber im Sinne der Frage des Herrn Staatsanwalts nicht. Energisch dazu aufgefordert, die Beurteilung von »im Sinne des Staatsanwalts« diesem selbst zu überlassen, sagte Gruhl, er wolle ja nicht so sein und zugeben, daß er ständig unter Pfändungs- und Zwangsvollstreckungsbefehlen gestanden habe; darüber könne ja der Hubert aussagen; Hubert - das erklärte Gruhl, der auch gereizt zu werden begann, auf die Frage des Staatsanwalts - sei der Herr Gerichtsvollzieher Hubert Hall, wohnhaft in Birglar, übrigens ein Vetter des Vaters seiner Schwiegermutter, wenn er es genau ausdrücken dürfe. Vom Verteidiger nach seinen Einkommensverhältnissen und seiner Vermögenslage gefragt, lachte Gruhl liebenswürdig und bat darum, die Beantwortung dieser Frage, die sehr, sehr kompliziert sei, dem Zeugen Hall und dem Volkswirt Dr. Grähn überlassen zu dürfen.
Sein Sohn, Georg Gruhl, einen Kopf größer als der Vater, schwerer auch als dieser, fast dicklich, blond, glich dem Vater gar nicht, sehr aber seiner verstorbenen Mutter, die manche Zuschauer »direkt in ihm wiederzusehen« glaubten. Lieschen Gruhl, eine geborene Leuffen, Metzgertochter aus Huskirchen, deren Blondheit und Blässe so sprichwörtlich gewesen waren wie ihre Frömmigkeit und heitere Sanftmut, die in der mündlichen Überlieferung der Bevölkerung der umliegenden Dörfer als »Leuffens Lies« noch immer mit poetischen Vokabeln wie »unser Goldengel«, »zu gut für diese Erde«, »fast eine Heilige« erwähnt wurde, hatte nur dieses eine Kind gehabt. Mit einer, wie einige Zuschauer empfanden, etwas zu stark aufgetragenen Fröhlichkeit gab Georg an, er habe in Huskirchen bis zur vierten Klasse die Volksschule besucht, dann die Realschule in Birglar, habe aber schon seit seiner frühen Kindheit dem Vater geholfen und habe auf Grund einer Abmachung mit der Innung gleichzeitig mit der Abschlußprüfung in der Realschule, das heißt genau gesagt, wenige Wochen später, seine Prüfung als Tischlergehilfe abgelegt; er habe danach drei Jahre bei seinem Vater gearbeitet und sei mit zwanzig Jahren zur Bundeswehr eingezogen worden; »als das passierte«, sei er Gefreiter bei der Bundeswehr gewesen. Im übrigen schließe er sich dem an, was sein Vater vor seiner Aussage als Erklärung gesagt habe.
Was die Zuschauer am jungen Gruhl »als etwas zu stark aufgetragene Fröhlichkeit« empfanden, wurde in einem mehr privaten Teil des Protokolls, das Referendar Außem sich als literarische Skizze anlegte, mehrmals als »frivole Heiterkeit« bezeichnet; so beantwortete der junge Gruhl auch einige Fragen des Staatsanwalts. Ob ihn die Haft psychisch belastet habe, möglicherweise Schädigungen hervorgerufen habe? Nein, sagte der junge Gruhl, er sei froh gewesen, nach der Militärzeit wieder mit seinem Vater zusammenzusein, und da sie auch die Erlaubnis bekommen hätten, kleinere Arbeiten auszuführen, habe er sogar einiges gelernt; sein Vater habe ihm auch Französischunterricht gegeben, und »körperlich« habe es ihnen an nichts gemangelt.
Obwohl den Zuschauern alles, fast mehr als die beiden Gruhl hier ohne Pathos bekanntgaben, vertraut war, schienen sie diesen Ausführungen mit großer Spannung zu lauschen; auch der Verlesung der Anklage, die nichts Neues für sie brachte, lauschten sie mit Teilnahme.
Die beiden Gruhl waren an einem Junitag des Jahres 1965 auf einem Feldweg, der von den Dörfern Dulbenweiler, Huskirchen und Kireskirchen gleich weit, nämlich ungefähr zwei Kilometer entfernt lag, entdeckt (hier verbesserte sich der Vorsitzende, Amtsgerichtsdirektor Dr. Stollfuss, in »ertappt«) worden, wie sie, beide saßen rauchend auf einem Grenzstein, einen Jeep der deutschen Bundeswehr abbrennen ließen, als dessen Fahrer sich später der junge Gruhl herausstellte; nicht nur »seelenruhig, sondern mit offensichtlicher Genugtuung«, wie der Polizeimeister Kirffel aus Birglar zu Protokoll gegeben hatte, schauten sie dem Brand zu. Der Tank des Jeeps war, wie der Brandsachverständige Professor Kalburg, der als einer der bedeutendsten Pyrotechniker galt und hatte kommissarisch vernommen werden müssen, in einem schriftlichen Gutachten festgelegt hatte, zuerst durchlöchert worden »mit einem spitzen stählernen Gegenstand«, dann erst, was am Tatort geschehen sein müsse, aufgefüllt worden, auch müsse der Jeep »regelrecht mit Brennstoff übergossen, ja, geradezu durchtränkt worden sein«, denn ein bloßes Leerbrennen des Tanks habe solche Verheerungen, wie sie festgestellt worden seien, nicht bewirken können. Angesichts dieser mutwillig vorgenommenen Perforation, so hatte Professor Kalburg es formuliert, habe eine Explosion als fast ausgeschlossen gelten können. Das »erhebliche Feuer« hatte, obwohl die von den beiden Gruhl zugegebenermaßen mit Vorbedacht ausgewählte Stelle von den umliegenden Dörfern jene bereits erwähnten je zwei Kilometer entfernt, also in »relativer« Einsamkeit liege, in erstaunlich geringer Zeit eine Menschenmenge herbeigelockt, Bauern und Landarbeiter von den umliegenden Feldern. Schulkinder, die aus Huskirchen kommend auf dem Heimweg in die umliegenden Weiler Dulbenhoven und Dulbenkirchen sich befanden, vor allem aber Autofahrer, die von der Landstraße, einer Bundesstraße zweiter Ordnung aus, den ungewöhnlichen Brand bemerkt, angehalten hatten, um Hilfe zu leisten, ihre Neugierde zu befriedigen oder sich am Anblick des »erheblichen Feuers« zu ergötzen.
Zur Sache vernommen, erklärten beide Angeklagten, die Schilderung stimme wortwörtlich, sie hätten nichts hinzuzufügen; einige für sie wichtige Details würden sich noch aus den Zeugenaussagen ergeben. Vom Vorsitzenden aufgefordert, doch nun endlich anzugeben, was sie sowohl in der Voruntersuchung wie im Ermittlungs- und Zwischenverfahren verweigert hätten: eine Erklärung für diese unerklärliche Tat, sagten beide, unabhängig voneinander, ihr Anwalt werde in seinem Plädoyer darauf eingehen. Ob sie nicht wenigstens den sie erheblich belastenden Termini »seelenruhig« und »mit offensichtlicher Genugtuung« widersprechen oder diese einschränken möchten? Nein, der Polizeimeister Kirffel habe das sehr genau beobachtet und zutreffend beschrieben. Ob sie sich im Sinne der Anklage für schuldig erklärten. »Im Sinne der Anklage, ja« erklärten beide. Der Vorsitzende, der gegen seine Gewohnheit jetzt einige Gereiztheit zeigte, fragte, ob er dieses »im Sinne der Anklage« als einschränkend auffassen müsse, was beide Angeklagte bejahten und mit ihrer vor der Aussage abgegebenen Erklärung begründeten.
Vom Vorsitzenden gefragt, ob sie Reue empfänden, antworteten beide ohne Zögern und ohne Einschränkung mit »Nein«.
Vom Staatsanwalt aufgefordert, sich zur Durchlöcherung des Tanks zu äußern, wer von beiden, was noch immer nicht geklärt sei, nun die Durchlöcherung vorgenommen habe und wie, antwortete Gruhl sen., der Brandsachverständige habe festgestellt, die Durchlöcherung sei mit einem spitzen stählernen Gegenstand erfolgt, dem habe er nichts hinzuzufügen. Gefragt, ob die beiden Kanister, die man am Tatort gefunden, Eigentum der Bundeswehr gewesen wären, antwortete der junge Gruhl, ja, sie seien Eigentum der Bundeswehr gewesen, einer habe zur Ausrüstung des Jeeps gehört, den zweiten habe er mitbekommen, weil er eine »ziemlich lange Dienstfahrt« habe antreten sollen. Ob er die Dienstfahrt angetreten habe? Ja, angetreten habe er sie, doch er habe sie zu Hause unterbrochen und »dann nicht wiederaufgenommen«. Nicht der Staatsanwalt, der Verteidiger fragte den jungen Gruhl, welcher Art die Dienstfahrt gewesen sei, doch hier protestierte der Staatsanwalt, indem er sagte, eine solche Frage vor der Öffentlichkeit zu stellen sei unzulässig; er beantrage also, entweder die Frage nicht zuzulassen oder die Öffentlichkeit auszuschließen. Der Vorsitzende sagte, diese Frage bäte er dem Angeklagten Gruhl jun. in Gegenwart seines als Zeugen geladenen damaligen Vorgesetzten Oberleutnant Heimüller stellen zu dürfen; ob Verteidiger und Staatsanwalt damit einverstanden seien; beide nickten zustimmend.
Zur Beweisaufnahme sagte als erster der Kreisverkehrsbevollmächtigte Heuser aus, der darum gebeten hatte, seine Aussage als erster machen zu dürfen, da er einen über Nacht anberaumten wichtigen Termin, bei dem lebenswichtige Interessen des Kreises auf dem Spiel stünden, wahrzunehmen habe. Heuser, ein etwas aufdringlich gekleideter, auch ziemlich beleibter Mensch mit gelocktem Blondhaar, der sein Alter mit neunundzwanzig Jahren angab, seinen Beruf als den eines Verkehrssoziologen, sagte aus, »schon eine Viertelstunde nach dem als wahrscheinlich angenommenen Zeitpunkt der Brandstiftung«, also etwa gegen 12.45 Uhr, habe sich eine Menschenmenge von mehr als hundert Personen am Tatort befunden; es habe sich eine in südlicher Fahrtrichtung parkende Motorfahrzeugschlange von fünfundzwanzig, in nördlicher Fahrtrichtung eine solche von vierzig Motorfahrzeugen gebildet. Die Tatsache, daß die in nördlicher Fahrtrichtung haltende Schlange um fünfzehn Fahrzeuge länger gewesen sei als die in südlicher Richtung haltende, entspreche, wie Heuser in umständlicher, recht selbstgefälliger Redeweise zum Ausdruck brachte, »genau der Verkehrserfahrung, die wir im Kreise Birglar gesammelt haben und die als Verkehrsnotstand unseres Kreises der Öffentlichkeit hinlänglich bekannt ist«, da sie eine unterschiedliche Abnutzung der Straßenoberfläche mit sich bringe. Heuser ging dann noch auf ein Problem ein, das ihn offensichtlich sehr zu beschäftigen schien: womit der seit Jahren auf dieser Bundesstraße festgestellte »Nord-Süd-Überhang« an Verkehrsteilnehmern zu erklären sei, ein Überhang, der sich permanent auf die während der Affäre Gruhl festgestellten sechzig Prozent belaufe; Heuser nannte die auf der Rückfahrt von Süden nach Norden fehlenden Fahrzeuge »Ab- oder Ausweichler«, auch »Zirkulanten« (was wie Zigeuner klang), und führte diese ihn offensichtlich quälende Differenz auf die Tatsache zurück, daß eben nördlich Huskirchen »auf Grund soziologisch leicht zu erfassender Umstände« ein Reisevertreteransiedlungsschwerpunkt entstanden sei und daß jene, die Reisevertreter, in nördlicher Richtung die Bundesstraße, auf ihrem Rückweg aber offensichtlich Nebenstraßen benutzten. Er übersah das Handzeichen des Vorsitzenden, der ihn hier unterbrechen wollte, und rief in den Saal, indem er drei Schwurfinger seiner rechten Hand drohend gegen Unbekannt erhob: »Aber ich werde noch dahinterkommen; ich werde diese Sache klären.« Er habe schon die Autonummern der »entsprechenden Herrschaften« notieren lassen und Ermittlungen eingeleitet über die Art und Weise, auch die Motive des Ab- und Ausweichens beziehungsweise der Zirkulation, denn eine einseitige Benutzung der Bundesstraße sei auf die Dauer »schlechthin nicht angängig«; dieser einseitige Verschleiß mache die Verhandlungen mit Bund und Ländern schwierig, die diesen auf die Landwirtschaft abzuschieben versuchten. Hier machte er endlich im Vortrag seiner Theorie eine Pause, die der Vorsitzende sofort benutzte, ihm jene schlichte Frage zu stellen, um deren Beantwortung es eigentlich ging: ob die Tat der beiden Angeklagten den Verkehr behindert habe. Heuser beantwortete diese Frage ohne Umschweife mit einem »Aber ja, ganz erheblich«. Es seien am Tatort zwei Unfälle passiert; ein Kleinwagen sei auf einen parkenden Mercedes 300 SL aufgefahren, es habe ein Handgemenge zwischen den beiden Fahrern gegeben, es seien beleidigende Äußerungen gefallen, der Mercedesfahrer habe von »Kaninchenzüchterauto«, der Fahrer des Kleinwagens von - »mit Verlaub, Herr Vorsitzender« - »Leute-Bescheißer-Auto« gesprochen. Außerdem habe er beobachtet, daß sich am Tatort die Fahrer eines Zementlastwagens mit den Fahrern eines Flaschenbierautos angefreundet hätten, daß es »an Ort und Stelle« zum Austausch von, »wie ich hoffe«, Deputaten gekommen sei; ob nun Bier gegen Zement oder Zement gegen Bier getauscht worden sei, in diesem Punkt wolle er sich nicht festlegen; er habe nur den Beifahrer des Flaschenbierlastwagens, einen gewissen Humpert aus dem Weiler Dulbenhoven, zwei Tage später seine Einfahrt mit Zement jener Firma ausbessern sehen; die beiden Zementfahrer aber hätten »das Bier auf der Stelle genossen« und wären drei Kilometer vom Tatort entfernt bei der Weiterfahrt von der Landstraße abgewichen und in eine Rübenmiete hineingefahren. Ein weiterer Unfall habe zwischen einem Tonröhrenlastwagen und einem Opel stattgefunden, sieben Tonröhren seien - aber hier blickte er plötzlich auf seine Armbanduhr, gab ein entsetztes »Um Himmels willen, die Landtagsabgeordneten warten ja schon« zu Protokoll und bat mit hastiger Stimme darum, entlassen zu werden. Der Vorsitzende blickte Verteidiger und Staatsanwalt fragend an - beide schüttelten resigniert den Kopf, und Heuser verließ, im Abgehen noch »Verkehrsnotstand« murmelnd, den Saal. Niemand, am wenigsten seine Frau, die im Zuschauerraum saß, bedauerte Heusers Abgang.