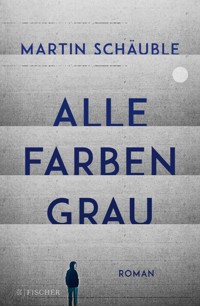Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der junge Soldat Anton bewacht die Grenzmauer, die Deutschland umschließt. Er ist begeistert von der Nationalen Alternative, der neuen Regierungspartei, und vom Selbstbewusstsein seines Landes. Seinem besten Freund Noah dagegen ist diese Politik verhasst. Er ist weder für Atomkraft und die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe, noch findet er es richtig, dass Flüchtlingen kein Schutz geboten wird. Menschen wie Fana, die nach ihrer Flucht aus Äthiopien im letzten Flüchtlingslager Deutschlands auf Anton trifft und sich mit ihm anfreundet. Als Anton einen tödlichen Anschlag ausführen soll, ist er gezwungen, sich zu entscheiden: für eine nationale Ideologie oder für seine Freunde – und ein freies Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
WIE SÄHE UNSER LAND AUS, WENN ES VON EINER RECHTSNATIONALENPARTEI REGIERT WÜRDE?
Anton ist ein junger Soldat und bewacht die neue Grenzmauer, die Deutschland umschließt. Er ist begeistert von der Nationalen Alternative, der neuen Regierungspartei, und vom Selbstbewusstsein seines Landes. Seinem besten Freund Noah dagegen ist das alles verhasst. Er ist weder für Atomkraft noch findet er es richtig, dass die Schulpflicht und gesetzliche Arbeitslosenhilfe abgeschafft und konservative Rollenbilder gefördert werden. Und Flüchtlingen keinerlei Schutz geboten wird. Flüchtlingen wie Fana. Sie flieht aus Äthiopien, wo der Klimawandel zu einer Hungerkatastrophe führt. Im letzten Flüchtlingslager Deutschlands treffen Anton und Fana aufeinander und freunden sich an. Als Anton einen zweifelhaften Auftrag ausführen soll, ist er gezwungen, sich zu entscheiden: für eine nationale Ideologie oder für seine Freunde und ein freies Leben.
Martin Schäuble
Endland
Roman
Carl Hanser Verlag
Gewidmet den 71 Menschen
Prolog
»Verschwinde!«, ruft die junge Frau. Sie humpelt über Glassplitter. Sie stützt einen Mann. Trotz der Schnittwunde an ihrem Bein. Er ist nicht viel älter als sie. Er trägt eine Uniform und einen Gummiknüppel am Gürtel. »Verschwinde endlich!« Sie meint nicht den Wachmann an ihrer Seite – der kann nicht allein weg, der braucht einen Notarzt. Sie meint den anderen Mann.
Blaulicht flackert von der Hauptstraße her. Sirenen heulen. Fünf, sechs Fahrzeuge bestimmt. Krankenwagen, hofft sie. Ein Mannschaftswagen der Polizei biegt um die Ecke. Der Mann mit dem Knüppel sackt in sich zusammen. Die junge Frau zieht ihn hoch. Hinter ihr brennen Tische, Stühle, Schränke, Bettwäsche, Kleider, Koffer und Papier, sehr viel Papier. Alles hat Feuer gefangen.
Egal. Sie sind draußen, haben es geschafft.
Ein tonnenschweres Stück Betondecke kracht auf den Boden. Die Erde bebt. Asche wirbelt durch die Luft und bleibt an ihren verschwitzten Körpern kleben.
Der andere Mann steht ein paar Meter weiter weg. Er hält ein Handy in der Hand, will fotografieren. Er zittert am ganzen Körper. Doch er macht das Foto. Schickt es an alle 532 Freunde. Dann wirft er das Telefon in die Flammen.
Minuten später sehen bereits über zwanzigtausend Menschen sein Bild. Und teilen es. Noch in derselben Nacht weiß halb Deutschland von der Katastrophe. Die Übertragungswagen der Fernsehsender rollen an. In fast allen Zeitungen ist das Foto am nächsten Tag auf der ersten Seite. 150 Verletzte, 94 Tote. Bisher.
Es ist ein Foto wie aus dem Krieg. Wenn die bewaffnete Drohne nicht die feindlichen Stellungen trifft, sondern das Krankenhaus daneben. Aus Versehen.
Nur ist es nicht dort passiert, in einem Kriegsgebiet, sondern hier.
In Deutschland.
Und da ist diese Frau in den Trümmern, den Schwerverletzten in ihren Armen. Sie gehören eigentlich nicht zusammen. Das sieht man gleich. Trotz der Asche, des Rauches und der Flammen überall.
Auf eine Wand hinter den beiden hat jemand etwas geschrieben. In menschengroßen Buchstaben.
Nicht auf dem Foto zu sehen, weil auf der anderen Seite der Mauer, im zerstörten Gebäude: ein Mann. Er kniet, beugt sich vor, drückt den Kopf und beide Hände auf den Boden. Er betet. Er bleibt. Bis ihn die Betondecke unter sich begräbt.
1 Fana
Die Direktorin starrt an die Decke. Sie schließt die Augen, atmet hörbar ein und schüttelt langsam den Kopf. So habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Sie ist sauer. Und zwar richtig.
Ich kenne die Direktorin der Schule gut, ich habe an diesem Ort fast mein halbes Leben verbracht. Hier habe ich Lesen und Schreiben gelernt, Englisch und Deutsch.
Vor zwei Stunden hat sie mich in ihr Büro gebeten. Vom Krankenhaus aus, wo ich arbeite, dauert das eine Stunde. Addis Abeba, unsere Hauptstadt, ist riesig.
Meine Kollegen dort haben ziemlich geflucht. Zu Recht. Die brauchen im Krankenhaus gerade jede Hand. Wieso? Der Hunger ist wieder in Äthiopien.
Die Menschen werden durch den Hunger geschwächt, und mit der Schwäche kommen die Krankheiten. Wir wissen gar nicht mehr, wohin mit den Patienten. Ich hoffe, es ist etwas wirklich Wichtiges passiert in meiner alten Schule.
»Diese Deutschen …«, die Direktorin schnappt nach Luft, die Augen noch immer zur Betondecke gerichtet. »Die denken, nur weil sie reiche Ausländer sind, können sie sich alles erlauben.«
»Um was geht es denn?«, frage ich.
»Eine Deutsche. Sie braucht Hilfe. Will sie dir aber selber erklären.« Sie schließt die Augen und lässt den Kopf nach vorn fallen. »Vorausgesetzt, sie kommt heute noch.«
Auf ihrem Schreibtisch steht ein Teller Popcorn. Überreste von der traditionellen Kaffeezeremonie. Wahrscheinlich war hoher Besuch da. Und es ist wie früher: Mir bietet die Direktorin nichts an. Nicht mal das kalt gewordene Popcorn oder den abgestandenen Kaffee. Obwohl ich inzwischen quasi eine Kollegin von ihr bin.
Drei Mal die Woche unterrichte ich Deutsch. Im Krankenhaus verdiene ich viel zu wenig. Ist auch nur ein Aushilfsjob dort. Ich spare für mein Studium. Besser gesagt, ich spare, um während des Studiums nicht zwölf Stunden am Tag arbeiten zu müssen. So wie es derzeit läuft, habe ich in fünfzig Jahren das Geld zusammen.
Die Direktorin nimmt sich eine Handvoll Popcorn. »Ich habe zwei Termine für diese Ärztin abgesagt, nur weil dieser Mann von der Botschaft anrief und meinte –«
Die Tür springt auf, knallt gegen den Schrank. Eine eingerahmte Urkunde fällt auf den Boden, das Glas zerspringt.
»Oh shit.«
Die weiße grauhaarige Frau, die das sagt, könnte vom Alter her meine Oma sein, Mitte sechzig, schätze ich.
»Sorry.« Sie sammelt die Scherben ein, ich helfe ihr.
»No problem.« Die Direktorin ruft die Sekretärin zum Saubermachen. Dann zeigt sie einladend auf den Stuhl neben mir.
Ich muss keine Psychologin sein, um zu wissen: Die Direktorin hasst diese Deutsche schon jetzt aus tiefstem Herzen.
»Ich spreche nur wenig Deutsch.« Die Schuldirektorin deutet mit ihrem Daumen und Zeigefinger einen Abstand von zwei Zentimetern an. »Ich bin die –«
Die Deutsche beachtet sie gar nicht. »Du musst Fana sein?«
Ich nicke.
»Danke für deine Zeit.« Sie schaut die Direktorin an. »Wo kann ich mit Fana reden?«
»Hier.« Die Schulleiterin zeigt noch einmal auf den freien Stuhl vor ihrem Schreibtisch.
»Okay.« Die Deutsche hat offenbar so langsam verstanden, wie die Sache hier läuft, und setzt sich. Sie greift in die Schale, wirft sich Popcorn in den Mund.
Oje. Ich mag die Direktorin gar nicht anschauen.
Die Deutsche kaut, überlegt, springt auf, geht zur Tür und hält sie auf. »Ein schöner Ort für eine Besprechung. Danke. Fana und ich brauchen nur zehn Minuten …«
Die Direktorin starrt die Deutsche an. Sie ist fassungslos.
Die Deutsche wiederholt alles in Kurzversion langsam auf Englisch. »Thaaaaanks. Seeeee youuu laaaaater.«
Die Direktorin schüttelt den Kopf und geht an uns vorbei. »Netsch Ayt!«
Die Deutsche verbeugt sich überschwänglich. »Ameseginalow.«
Die Schulleiterin dreht sich verwirrt um, will etwas sagen, doch da hat die Deutsche die Tür schon geschlossen.
»Sie können Amharisch?«, frage ich.
»Äthiopisch? Überhaupt nicht. Nur eben ›Danke‹. Und dann vielleicht noch zwei, drei andere Sachen.« Sie grinst. »Was hat die Frau Direktorin zu mir gesagt?«
»Wollen Sie das wirklich wissen?«
»So schlimm?«
»Sie hat ›weiße Ratte‹ zu Ihnen gesagt.«
»Klingt doch niedlich.« Die Frau nimmt den Teller und reicht ihn mir.
Ich greife in das Popcorn. Etwas viel Salz, ansonsten aber gut. Nun machen die Deutsche und ich also gemeinsame Sache.
»Also, Fana, ich bin Karla. Entschuldige die Verspätung. Ich arbeite in einem Krankenhaus in der Afar-Region, im Osten von –«
»Ich weiß, wo Afar liegt.« Für wie dumm hält sie mich eigentlich?
»Ich brauche dich dort.«
Ich schlucke. Ich will es gar nicht hören. Wenn sie mir jetzt einen Traumjob anbietet, was dann? Nie im Leben werden das meine Eltern erlauben. Die Deutsche hat wirklich keine Ahnung von Äthiopien. Ich kann nicht einfach mit ihr dorthin. Manche Orte in Afar liegen zehn Autostunden weit weg. Meine Familie lebt hier. Ich müsste dort übernachten. »So leicht ist das nicht. Hier ist es etwas komplizierter als in Deutschl–«
»Also dort ist gerade alles verdammt kompliziert.«
Wieso ist sie auf einmal so wütend? Ich weiß, wie die Stimmung in Deutschland ist. Ich lese deutsche Zeitungen online auf dem Handy, um Deutsch zu üben. Vor den teuren Hotels der Ausländer geht das am besten. Die haben ordentliches WLAN. Und dort steht immer einer mit seinem Handy, der das Passwort schon rausbekommen hat.
Ich weiß, wie verdammt kompliziert es dort ist! Die Wahlen, der Sieg der Nationalen Alternative, die Jagd auf politische Gegner, die Abschottung. Doch die Deutschen bleiben doch die Deutschen. Und in den Medien wird sowieso immer übertrieben, oder?
»In Deutschland gibt es immerhin –«
Karla lässt den Teller auf den Tisch knallen. »Vergiss Deutschland!«
Popcorn kullert auf die Tastatur der Direktorin. Ein Stückchen bleibt zwischen den Buchstaben F und G stecken. Wenn sie das sieht, bekommt sie einen Herzinfarkt.
»Sind deine Eltern das Problem?«, fragt Karla.
Offenbar kennt sie sich doch ein wenig in meinem Land aus.
»Ja.«
»Das regeln wir.«
»Wie?«
»Ich brauche dich in Afar. Sofort. Als Übersetzerin. Du wärst so etwas wie meine Assistentin dort. Lernst also auch was.«
»Wieso ich? Sie –«
»Wir sind per Du.«
»Du kennst mich nicht. Wieso also ich?«
»Lass mich überlegen.« Sie lehnt sich zurück, holt ein Haarband aus der Hosentasche und bindet ihre grauen Haare zu einem Zopf. »Du sprichst fließend Deutsch. Die Leute von der deutschen Gemeinde hier singen Loblieder auf dich.«
Aber auch nur, weil ich dauernd kostenlos für sie alle möglichen Dokumente übersetze.
»Du jobbst bereits in einem Krankenhaus hier in der Stadt, hast sogar schon Seminare besucht, kennst dich besser aus als manche Pflegerin und kommst mit der Belastung klar, mit dem Stress. Der Chefarzt ist begeistert von dir.« Der Zopf ist fertig. Sie macht eine Pause und breitet beide Arme aus. »Hab ich was vergessen?«
»Es gibt keinen Chefarzt. Mein Chef ist eine Frau.«
»Okay, der letzte Satz war gelogen.«
Zwei Tage später stehe ich vor der deutschen Botschaft. Karla sagte, wir würden gemeinsam mit einem Freund zu meinen Eltern fahren. Dort könnten wir dann alles besprechen. Ganz in Ruhe. So wie ich Karla erlebt habe, kann sie viel, aber sicher nicht ruhig sein.
Ich solle mir keine Sorgen machen, meinte sie.
Ich kenne meine Eltern. Und ich mache mir riesige Sorgen. Nie im Leben lassen die mich allein reisen. Und Karla, diese selbstbewusste grauhaarige Deutsche mit Zopf und Jeanshose, die hat bei meinem Vater sowieso keine Chance. Solche Frauen mag er nicht. Sie passen nicht in seine Welt. Und was würden die Nachbarn denken, wenn ich mit so einer fortgehe.
Ein älterer Mann kommt aus dem Tor der Botschaft. Er trägt einen schwarzen Anzug, weißes Hemd und rote Krawatte. Er winkt mir zu. »Fana?«
Kaum sitzen wir im Taxi, fängt er an zu lachen.
Ich schaue ihn verwirrt an.
»Karla ist verrückt«, sagt er.
»Wo ist sie?«
»An irgendeinem OP-Tisch in Afar wahrscheinlich.«
Ist das ein Test? Ich lächele den Satz erst mal weg. Aber weil der schicke Botschaftstyp nichts weiter sagt, muss ich doch nachfragen. »Sie ist gar nicht in der Stadt?«
Er beugt sich zu mir. »Ach du meine Güte, hat sie dir etwa gar nichts von ihrem Plan erzählt?«
Ich schweige ihn an.
Er lacht laut. Muss ja unheimlich lustig für ihn sein.
»Schlimm, wenn wir deinen Eltern gleich nicht die ganze Wahrheit sagen?«
»Wie bitte?« Ich meine, niemand lügt seine Eltern gern an. Und ich mache das ohnehin schon zu oft. Meine Eltern leben wie die meisten in unserem Viertel sehr traditionell. Wie im Museum fühle ich mich da. Natürlich geht’s vielen in meinem Alter genauso. Aber vielleicht habe ich mit meinen Deutschkenntnissen mehr über den Tellerrand geschaut. Und mich stört es daher viel, viel mehr.
Deswegen war mir Karla auch sofort sympathisch. Also ihr Auftritt bei der Direktorin. Sie macht ihr Ding und lässt sich von keinem was sagen.
Der Mann von der Botschaft kurbelt die Fensterscheibe im Taxi runter. Er lässt sich vom Fahrer Feuer geben. »Es ist eine Notlüge.«
»Was für eine Notlüge?«
»Na ja, die besten Geschichten stehen zwischen Dichtung und Wahrheit.«
Ich verstehe kein Wort. Aber ich will den Job! Karla zahlt ein ordentliches Gehalt. Ich könnte also doch noch irgendwann Medizin studieren. Und der Gedanke, mehr Abstand zu meinen Eltern zu haben, ist verlockend.
Die Fahrt in unser Viertel ist mir unangenehm. Der Mann neben mir arbeitet in der deutschen Botschaft. Er kommt aus einem reichen Land. Er verdient wahrscheinlich so viel Geld an einem halben Tag wie mein Vater im Monat. Und er wohnt in einem hübschen Haus mit Wachpersonal, Köchin, Putzfrau und einem Gärtner. Unsere Wohnung ist eine Hütte mit Wellblechdach. Wir teilen uns zu dritt einen Raum. Er wird drei Räume für sich allein haben. Mindestens.
Immerhin hatten wir gestern Nacht fließendes Wasser. Manchmal versiegt es tagsüber und kommt dann nur nachts. Meine Mutter bleibt in solchen Nächten wach. Sobald das Wasser in den Leitungen gluckert, füllt sie alle Behälter, die wir haben. Doch mit diesem Wasser würde sich der Deutsche von der Botschaft vermutlich nicht einmal die Zähne putzen. Auf einer deutschen Webseite über Äthiopien habe ich gelesen, dass man dafür Trinkwasser in Flaschen kaufen soll – mit Trinkwasser Zähne putzen!
Aber was ist, wenn er auf die Toilette muss? Wir haben keine eigene, es gibt nur eine Gemeinschaftstoilette für alle im Viertel.
Hauptsache, wir haben Strom und müssen keine Kerzen anzünden oder Taschenlampen einschalten.
Das Taxi hält vor unserer Hütte. Drinnen brennt grelles Licht, tatsächlich ein Stromabend.
Meiner Mutter hatte ich nur gesagt, es ginge um ein tolles Stellenangebot in Afar.
»Das können wir doch nicht machen«, hatte sie mit vorwurfsvollem Ton erwidert.
Das können wir nicht machen. Meine Familie lebt, wie gesagt, traditionell. Und bei uns gibt es kein Ich. Das Kollektiv zählt, das Wir. Großartig finden das alle. Fast alle. Mich ärgert es. Doch ich zähle ja nicht, weil nur das Wir zählt.
Immerhin konnte ich meine Eltern zu dem Treffen überreden. Ewig mag ich nicht für einen Hungerlohn jobben, weder im Krankenhaus von Addis Abeba noch in der deutschen Schule.
Meine Mutter öffnet die Tür. Der Mann von der Botschaft reicht ihr die Hand und verbeugt sich leicht. Meiner Mutter ist das unangenehm. Aber das merke nur ich. Sie lächelt dann immer etwas schief. Der Deutsche verbeugt sich gleich noch einmal.
»My name is Doctor Schmidle.«
Aha, jetzt ist er Doktor. Ich kann mir denken, worauf die Notlüge hinausläuft.
Mir fällt auf, wie sehr es bei uns nach Weihrauch riecht. Wahrscheinlich wollte meine Mutter damit den Geruch vom Mittagessen loswerden. Die Wots, ihre selbst gemachten Soßen zum Fladenbrot, schmecken traumhaft. Nur riecht es dann immer nach Zwiebeln und Knoblauch. Aber immerhin wird bei uns noch jeden Tag gekocht. Andere in unserem Viertel können sich das längst nicht mehr leisten. Die einfachsten Sachen wie Gemüse oder Obst sind auf dem Markt mittlerweile viel zu teuer. Manche wärmen das Essen drei, vier Mal auf. Tag für Tag. Bis sie wieder etwas Geld zum Einkaufen zusammenhaben. Für ein wenig Mehl, Gewürze oder ein paar Tomaten.
Oder meine Mutter hat gerade noch gebetet und es riecht deshalb in unserer Hütte wie in einer Kirche. Dann ist sie wegen des hohen Besuches genauso aufgeregt wie ich. Sonst betet sie kaum noch.
Mein Vater sitzt am Tisch und steht zur Begrüßung kurz auf. Er hört sich an, was der Deutsche zu erzählen hat. Besser gesagt meine Übersetzung davon.
Wie der Deutsche im Krankenhaus als leitender Arzt auf mich achtgeben will. Wieso er mich unbedingt braucht. Warum dort außer ihm ausschließlich Frauen arbeiten. Wie sicher das Schwesternheim ist. Er trägt ziemlich dick auf für meinen Geschmack.
Mein Vater nickt nach jedem Satz. Immerhin. Er ist nicht der große Gefühlsmensch. Nicken bedeutet bei ihm sehr viel. Vielleicht bemerkt er auch den Schwindel. Nach außen sieht die Sache aber gut aus, und darauf kommt es an. Schließlich liebt mich mein Vater. Und er will, dass ich eine Ärztin werde mit einem guten Gehalt. Oder nicht?
Als der Deutsche sagt, was ich im Monat verdienen werde, da öffnet mein Vater sogar kurz den Mund. Er schuftet im Hotel als Nachtwächter. Sechs Tage die Woche, zehn Stunden die Nacht. Er spricht kaum Englisch, aber ein Cousin von ihm arbeitet in der Küche. Und der wiederum kennt einen von der Verwaltung. Und der hat meinem Vater den Job gegeben.
»Ich werde darüber nachdenken«, sagt mein Vater. Er schaut zu meiner Mutter, dann zu Doktor Schmidle. »Jetzt trinken wir Kaffee.«
So ist das bei uns. Zumindest, wenn Besuch da ist. Der Mann denkt nach, die Frau kocht Kaffee.
Meine Mutter breitet eine Decke auf dem Boden aus. Sie holt die nötigen Utensilien aus der Kochecke und setzt sich auf einen Holzschemel. Doktor Schmidle lehnt sich zurück. Er kennt diese Zeremonie. Er weiß, dass das seine Zeit dauert.
Meine Mutter röstet die Kaffeebohnen über glühenden Kohlen, schwenkt die kleine Pfanne mit den Bohnen darin, fächert uns den Duft zu. Der Deutsche atmet tief ein und nickt langsam mit einem wohlwollenden Lächeln, wie ich es nur von Männern in seinem Alter kenne. Er macht alles richtig.
Im Mörser stampft meine Mutter die Bohnen zu Pulver.
»Nehmen Sie Zucker?«, fragt mein Vater.
»Lieber Salz«, übersetze ich die Antwort.
Doktor Schmidle hat sich gut vorbereitet auf seine Rolle heute. Ich kenne keinen Ausländer, der seinen Kaffee mit Salz trinkt. Für meinen Vater ist das auch neu. Er nickt mit dem Kopf gleich zweimal hintereinander.
Der Deutsche trinkt den Kaffee so wie die Eltern meines Vaters. Die waren vom Land nach Addis gezogen. Bei uns macht das aber keiner mehr so.
Meine Mutter stellt einen Korb mit warmem Popcorn auf den Tisch. So wie es für eine Kaffeezeremonie typisch ist. Alle greifen zu.
In der nächsten Stunde wird nur über das Wetter gesprochen. Die Regenzeit ist zu kurz. Die Dürre davor und danach zu lang. Irgendwann übersetze ich, ohne genau zuzuhören.
Draußen donnert es. Ein Gewitter zieht auf und keine zwei Minuten später prasselt Regen auf unser Dach. Kalte Luft zieht durch den Türspalt in den Raum. Fenster müssen wir nicht schließen. Wir haben keine. So bleibt etwas Wärme im Raum. Immerhin.
Doktor Schmidle schaut zu einer Dose in der Ecke. Wasser tropft hier durch ein Loch im Wellblechdach hinein. Er blickt zu seinem Mantel, dann zu mir, und mein Vater ahnt, was gleich kommt.
Mein Vater springt auf. »Nein, nein, jetzt darf er nicht gehen! Bei diesem Regen. Unmöglich.« Er verschwindet hinter dem Vorhang, der die zwei Sofas vom Bett meiner Eltern trennt.
Ich weiß, was er vorhat. »Lass doch«, sage ich. »Doktor Schmidle will wirklich los.«
Mein Vater kommt mit einer Flasche wieder. »Er ist doch Arzt, da weiß er, was gesund ist!«
Auf der Flasche steht Wodka, aber es ist selbst gebrannter Schnaps von Freunden.
Mein Vater lässt sich von meiner Mutter zwei Kaffeetassen auswaschen und füllt sie bis zur Hälfte.
»Herr Doktor Schmidle, Sie müssen das nicht –«
Aber Doktor Schmidle prostet meinem Vater bereits zu und leert die Tasse in einem Zug. Mein Vater strahlt. Doktor Schmidle strahlt zurück. Nach dem zweiten Becher muss ich die Zutaten übersetzen.
»Mais, Malz, Knoblauch und ein paar Geheimnisse.«
Nach dem vierten Becher hat es aufgehört zu regnen. Gott sei Dank.
Ich begleite Herrn Schmidle noch zur Hauptstraße. Wir warten auf ein Taxi.
»Das war eine große Notlüge.« Ich klinge wütender, als ich bin. Eigentlich bin ich einfach nur erleichtert. Das Treffen ist vorbei.
»Eine große Notlüge? Ich mag wirklich Salz zum Kaffee. Damals in Irland, da habe ich immer gern Ingwer –«
»Sehr witzig. Ich meine die Show davor.«
»Es war nicht alles gelogen.« Er zündet sich eine Zigarette an.
»Was nicht?«
»Dein Gehalt zum Beispiel. Karla zahlt das aus eigener Tasche. Die hat Reserven.«
»Was stimmt noch?«
Er zieht kräftig, und bei seiner Antwort qualmt es aus seinem Mund wie aus einem Kochtopf. »Ich habe wirklich einen Doktortitel.«
»Aber niemals in Medizin. So wie Sie vorhin über die Arbeit gesprochen haben. Davon haben Sie keine Ahnung.«
»Stimmt. Ich bin kein Mediziner.«
»Was haben Sie dann studiert? In welchem Fachgebiet haben Sie einen Doktor?«
»Politikwissenschaft … Jahrzehnte ist das her …«
»Daher das Redetalent?«
»Blödsinn.« Er bläst die Asche von der Spitze der Zigarette. »Theater-AG, schon zu Schulzeiten.«
Ein Taxi hält. Ich reiche ihm die Hand. Er verbeugt sich tief.
»Auf Wiedersehen«, sage ich.
»Wohl kaum. Ich reise in zwei Wochen zurück nach Deutschland.«
»Glückwunsch! Darauf können Sie sich doch freuen.«
Doktor Schmidle schaut mich ernst an. »Ich gehöre zu denen, die von der Nationalen Alternative nichts halten.«
»Wieso gehen Sie dann zurück?«
»Weil weltweit eine Botschaft nach der anderen geschlossen wird.«
»Gehört das zur Abschottung?«
»Nein. Es ist eher so, dass wir rausgeworfen werden.«
»Und Karla bleibt?«
»Die bleibt. Keine Sorge. Die ist schließlich wegen der Situation in Deutschland hergekommen.«
»Eine Auswanderin?«
Er überlegt. »Eher ein Flüchtling.« Er lächelt gequält. Wahrscheinlich sind sie sehr gute Freunde. Oder sogar mehr. Und nun muss er zurück.
Doktor Schmidle steigt in das Taxi und wirft die Zigarette durch das offene Fenster – sie landet in einer Pfütze.
Ich stehe noch immer neben der Autotür.
»Ich bin nicht so mutig wie Karla«, sagt er. »Sonst würde ich in Äthiopien bleiben. Irgendwas anderes machen.«
»Sie sind mutiger als Karla. Gerade weil Sie zurückgehen.«
Er schaut mich noch ein letztes Mal an. »Ich verstehe immer mehr, wieso Karla unbedingt mit dir arbeiten will.«
Ich gehe zurück zur Hütte und stoße vor dem Eingang auf meinen Vater. Er hält einen Becher Schnaps in der Hand. Er schaut mich an und nickt.
Ich weiß, was das heißt, und gehe mit einem großen Grinsen zu meiner Mutter.
Ich wundere mich nicht über die Entscheidung meines Vaters. Noch nie kam jemand von irgendeiner Botschaft in unser Viertel. Und der sympathische Herr im Anzug hat uns nicht nur besucht, nein, er hat auch viel Geld versprochen.
Meine Mutter sitzt auf dem Sofa und schaut fern. Sie weint. Für sie wird der Abschied am schwersten.
Ich setze mich zu ihr und lege meinen Arm um sie. So richtig freuen kann ich mich jetzt auch nicht mehr. Sie legt ihren Kopf auf meine Schulter. Die Talentshow läuft, ihre Lieblingssendung.
Drei Tage später sind die Tränen fast vergessen. Kündigen musste ich im Krankenhaus nicht. Ich hatte nie einen Arbeitsvertrag.
Mein Vater ist nicht da, er arbeitet, meine Mutter drückt mich dafür aber für zwei. Sie zwingt sich sogar zu einem kurzen Lächeln. Afar ist ein einmaliges Angebot. Das weiß sie natürlich. So weh es tut.
Sie ringt um Worte. Tausend Ratschläge müssen ihr jetzt durch den Kopf gehen. Was ich als junge Frau alles beachten muss, welche Gefahren überall lauern. Schließlich geistern die schlimmsten Geschichten durch unser Viertel. Obwohl keiner unserer Nachbarn je über die Stadtgrenzen hinausgekommen ist.
Meine Mutter steht im Türrahmen, ihre Lippen zittern, wieder werden die Augen feucht. Aber sie bleibt stumm und winkt mir einfach nur nach.
Die Fahrt nach Afar zu Karlas Krankenhaus dauert keine zehn Stunden, sondern zwanzig. Die Straße ist überschwemmt, Autos versinken im Schlamm, Lastwagen bleiben stecken, Staus bilden sich. Das kommt in der Regenzeit vor.
Unter meinem Sitz liegt die Reisetasche. Meine Mutter wollte sie unbedingt für mich packen. Als ob ich so viele Sachen hätte. Mein Vater, der Addis Abeba noch nie verlassen hat, hat ihr Ratschläge erteilt.
Ich lese auf dem Handy immer wieder die letzten Nachrichten von Samira. Sie hat mich sofort verstanden. Beste Freundin eben. In Addis Abeba ist mehr los, klar. Aber sonst? Darum geht’s ja. Um das Sonst.
Vermissen werde ich sie trotzdem. Sehr.
Samira ist keine Christin wie ich. Und ihre Eltern sind sogar noch traditioneller als meine. Die sind nicht in Addis aufgewachsen, sondern kommen vom Land.
»Du haust ab?«, war eine der ersten Reaktionen von Samira.
Erst war ich empört. Ich haue doch nicht ab! Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir klar: genau das tue ich. Ich haue ab.
Vor meinem Vater, vor unserer Hütte, vor meinem Viertel, vor Addis Abeba.
Das Krankenhaus in Afar wirkt im Vergleich zu dem riesigen Bunker in Addis wie eine Lagerhalle.
An Karlas Tür steht auf einem Zettel nur Karla, den hat sie vermutlich selbst dahingeklebt. Darunter hat jemand ihren Namen in äthiopischer Schrift geschrieben. Mit Doktortitel.
Ich klopfe und die Tür geht auf – sie war nur angelehnt. Karla schaut aus dem Fenster, am Ohr ein Handy aus dem 17. Jahrhundert. Sie hört und sieht mich nicht.
»Waaaas?«, schreit sie und haut gegen einen Schrank. Ein Bild kippt um. Offenbar gehört das bei ihr dazu. Laut sein und etwas kaputt machen. Immerhin fällt das Bild nicht auf den Boden. »Ihr habt drei davon, ich will nur eins. Ein einziges!«
Ihre Gesprächspartnerin schreit inzwischen auch.
Karla lässt nicht locker. »Reiß es aus der Steckdose. Verpack das Ding einfach. Schick es dem alten Schneider, der fliegt bald wieder hierher. Fertig.«
Die Gegenseite brüllt etwas.
»Was du sagen sollst? Na, das hat euch einer geklaut. Punkt. Das war’s. Mensch, merkt doch keiner. Ihr bekommt doch sofort ein neues.«
Wieder regt sich die Frau am anderen Ende auf.
»Kriminell? Geschätzte Kollegin, was du da machst, das ist kriminell. Du tötest mit deiner Entscheidung Menschen. Ja, du bist … Hallo?« Karla wirft das Handy auf den Tisch. »Mist.« Sie lässt sich in ihren Drehstuhl plumpsen, entdeckt mich und strahlt. Offenbar hat sie irgendwo einen Schalter für Stimmungslagen. Von schlechter Laune zu bester Laune in einer Sekunde.
So einen Schalter würde ich meinem Vater auch gern einbauen. Und mir selbst ehrlich gesagt auch.
Karla winkt mich zu sich und blättert in einem blauen Ordner. »Lass uns anfangen.«
Okay. Zeit ist Geld. Aber ich muss doch erst einmal richtig ankommen. In Addis war sie wesentlich freundlicher. Jetzt spricht sie fast schon mit mir wie mit der Direktorin.
Ich klatsche ein paarmal auf meine Reisetasche. Das soll heißen: Hallo! Ich bin gerade eben angekommen und brauche vielleicht erst einmal ein Zimmer!
Ihr Büro ist winzig. Zwei Laptops stehen auf dem Tisch zwischen aufgeschlagenen Büchern, Ordnern, roten Patientenmappen und einer Kaffeemaschine. Neben dem Tisch ein Sofa mit Bettdecke, darüber hängen an einem Wasserrohr Hosen, Hemden und Blusen.
Aha. Sie wohnt hier. Meine neue Chefin schläft neben ihrem Schreibtisch. Wenn sie überhaupt schläft.
Keine fünf Minuten nach meiner Ankunft frage ich mich, ob es die richtige Entscheidung war, nach Afar zu kommen. Und noch etwas beschäftigt mich. Genau genommen seit unserem ersten Treffen. »Darf ich dich was fragen?«
»Wir haben im Gästehaus ein Zimmer für dich.«
»Nein, nein. Ich will was anderes wissen.«
Karla steht auf, rollt ihren Stuhl zu mir, zeigt auf ihn und setzt sich auf das Sofa gegenüber. Sie sieht so müde aus, als würde sie sich am liebsten hinlegen und die nächsten zwei Wochen durchschlafen.
Ich bleibe stehen. »Wieso Äthiopien?«
Sie nimmt die Brille ab und wischt sich mit den Händen einmal über das Gesicht. Und sieht dabei noch müder aus. »Auf dem Tisch liegt dein Zimmerschlüssel. Komm erst mal an.«
Dort liegen mindestens zwanzig Schlüssel. Das sieht jetzt auch Karla.
»Der auf dem gelben Ordner.« Sie schaut auf die Uhr. »In zwei Stunden treffen wir uns hier.« Sie reibt sich die Augen. »Dann zeige ich dir, wieso Äthiopien.«
Ich stehe schon im Flur, da ruft Karla mir noch hinterher. »Nimm auch gleich den Ordner mit! Ich hab aufgeschrieben, was wir am dringendsten brauchen. Das sollte möglichst zügig übersetzt werden.«
Ich tue so, als ob ich das nicht gehört hätte. Der Ordner bleibt liegen. Karla hätte ruhig mal sagen können, dass sie sich freut, mich zu sehen.
Bei einem Stand an der Straße hole ich mir eine Cola und nehme sie mit auf mein Zimmer. Egal wie leer die Supermarktregale sind, das billige Zuckerwasser geht offenbar nie aus.
Das Zimmer im Gästehaus ist klein. Doch es gehört mir allein. Zu Hause schlafen wir zu dritt in einem Raum. Und das nur, weil meine Mutter nach mir keine Kinder mehr bekommen konnte. Sonst wäre es noch enger.
Ich bin nach diesem Reisetag todmüde. Durch das Fenster blicke ich auf das Krankenhaus. Die Lichter gehen aus. Raum für Raum. Ich sehe einige Patienten und kann von hier aus erkennen, ob sie lachen oder weinen. Mitarbeiter verlassen das Gebäude. Ein paar wenige bleiben. Die Nachtschicht.
Zwei Stunden später stehe ich wie vereinbart wieder vor Karlas Schreibtisch. Sie reicht mir eine Art weiße Uniform, Handschuhe und einen Mundschutz. Unter ihrem Arm klemmt eine rote Patientenmappe. Im Flur brennt kaum noch Licht, und ich versuche, nicht zu gähnen.
Der Arzt rennt an uns vorbei. Karla und er klatschen sich ab. »Selamno, Fana!«, ruft er mir zu.
Er kennt meinen Namen. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass eine Neue da ist.
Die Krankenzimmer sehen so schlicht aus wie in Addis Abeba. Das Zimmer, das wir betreten, hat acht Betten. Darum herum liegen mindestens zehn Menschen auf Decken und mitgebrachten Strohmatten.
Es sind die Angehörigen, die da auf dem Boden kampieren. Sie kümmern sich um alles. Sie bringen Blutproben ins Labor. Sie holen Ergebnisse ab. Wenn ein Arzt gebraucht wird, dann suchen sie im Krankenhaus nach einem. Und zwar so lange, bis er mitkommt. Patienten ohne Angehörige haben schlechte Karten.
Die meisten im Raum schlafen. Karla tritt auf einen Mann zu, der in einer Ecke auf dem Boden kauert. Als er uns bemerkt, rüttelt er die Frau neben sich wach. Beide folgen uns durch einen langen Flur.
»Sie sind gestern gekommen, mit drei Kindern. Wir gehen jetzt zu ihrem Jüngsten.«
»Wo liegt er?«
»Im OP.«
»Er wird gerade operiert?«
»Nein.«
Wir biegen in einen breiten Gang ab. An der Wand hängen von Kindern gemalte Bilder in schwarzen Holzrahmen. Runde Köpfe, dünne Striche für Arme und Beine. Auf einem Bild ist ein Gewehr, schwarze, runde Kugeln fliegen auf ein kastenförmiges Haus. Auf dem Bild daneben rollt ein Panzer über einen Hund oder ein Pferd, irgendetwas mit vier Beinen.
Karla merkt, dass ich langsamer werde und die Bilder ansehe. »Ach je, die hängen hier angeblich seit Jahrzehnten.«
»Der Bürgerkrieg. Ich kenne solche Kinderbilder.«
Weder ich noch ein anderer Äthiopier käme auf die Idee, so etwas aufzuhängen. Das waren die Ausländer, die, die helfen wollten: Lasst uns Bilder malen und den Krieg vergessen. Wenn das mal so einfach wäre. Karla scheint auch so eine Weltverbesserin zu sein. Sonst wäre sie nicht in Afar.
In den Gängen schlafen Menschen auf Bänken und auf dem Boden. So wie in Addis. Manche wohnen im Krankenhaus, sie haben kein Zuhause. Tagsüber betteln sie auf der Straße, nachts liegen sie in den Fluren. Wenn hoher Besuch kommt, müssen sie unsichtbar werden. Die übrige Zeit dürfen sie bleiben. In Afar gelten offenbar die gleichen Spielregeln. Die Eltern und ich sind kein hoher Besuch – auf drei zusammengeschobenen Stühlen liegt vor uns ein alter Mann. Barfuß. Seine Kleidung ist nicht viel mehr als ein brauner Lumpen.
Karla öffnet langsam eine Tür, lässt den Eltern und mir den Vortritt und schließt sie behutsam hinter uns. Ich wusste gar nicht, dass sie das auch leise kann.
Auf einem Monitor wandern Herzstromkurven. Der Sauerstoffkonzentrator summt. Infusionen tropfen aus zwei Flaschen, die an einem rostigen Ständer hängen. Ich lese die Aufschrift: einmal eine Zucker-Salz-Lösung und einmal Aminosäuren.
Die Geräte sehen so alt aus wie in Addis. Im Black-Lion-Krankenhaus werden die kaputten Geräte in einem der hundert Flure gelagert. Keiner kann sie reparieren. Man wartet auf neue Spenden. Auf den Besuch eines Technikerteams aus dem Ausland. Entsorgt werden die kostbaren Geräte nicht. Man weiß ja nie.
Nichts hier drinnen erinnert an Grey’s Anatomy, Dr. House oder Emergency Room – an die Serien, mit denen ich aufgewachsen bin. Eine Lehrerin aus Deutschland, die ein halbes Jahr an meiner Schule unterrichtete, konnte gar nicht fassen, dass wir so etwas hier überhaupt kennen. Als sie hörte, womit wir unsere Zeit verbringen, war sie perplex. »Ihr habt zu Hause weder Kühlschrank, Waschmaschine noch Toilette, aber einen Fernseher, in dem Serien aus den USA laufen?« Aber sie hat dann recht schnell verstanden, warum das so ist. Fernsehen ist bei uns einfach die billigste Freizeitbeschäftigung. Und sie kostet sogar kaum Strom, wenn er denn gerade fließt.
Später, im Krankenhaus von Addis, da kam dann die Realität. Keine Operationssäle aus Stahl und Chrom, nichts war medizinisch auf dem neuesten Stand. Die meisten hätten die Zustände dort geschockt. Doch ich fand Medizin jetzt noch interessanter. Menschen begleiten, manchmal auf ihrem letzten Weg. Und jeden Tag ein Leben retten. Mindestens. Zugegeben, klingt total kitschig, so ist es aber für mich.
Ich stehe mit Karla und den Eltern an einem Bett. Es dauert, bis ich zwischen den Geräten und Kabeln den kleinen Jungen entdecke.
Ein kahler Kopf, die Augen geschlossen. Das Gesicht eingefallen, die Haut zerknittert. Der Junge sieht aus wie ein alter Mann. Die Lippen sind geschwollen, die Mundwinkel eingerissen. Ein Schlauch führt zur Nase. Dadurch wird er ernährt. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt das Essen für solche Patienten F-100 oder F-75, ein Brei. Die Kanüle für die Infusionen steckt in der knochigen Hand. Die Elektroden für das EKG kleben am Brustkorb.