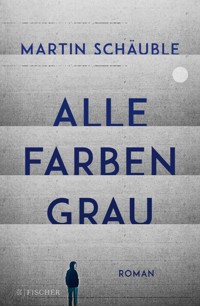12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ob Backpacker, Bildungsreisende oder Expats – Israel und Palästina sind mit ihrer landschaftlichen Fülle und ihren kulturellen Wurzeln für jeden eine Reise wert. Martin Schäuble, der in beiden Ländern gelebt hat, verrät, wo Sie innerhalb von 24 Stunden in den Bergen Ski fahren, Süßwasserfische angeln und in der Wüste übernachten können. Was der Filmemachers Hany Abu-Assad auf die Frage nach seinem Nahost-Friedensplan antwortet. Wen Sie mit »Schalom« und wen besser mit »Salam« grüßen. Warum sich Sicherheitskräfte am Flughafen nach Ihrer Zahnpasta erkundigen. Und wie Sie reagieren, wenn Sie nach dem Holocaust gefragt werden. Ein packender und aufschlussreicher Band über das Heilige Land, in dem trotz Zerrissenheit die Herzlichkeit seiner Bewohner regiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die Schreibweisen des Hebräischen und des Arabischen sind der mündlichen Aussprache angepasst.
März 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke | Agentur für Autoren und Verlage, www.AenneGlienkeAgentur.de
Redaktion: Fabian Bergmann, München
Karte: cartomedia, Karlsruhe
Coverkonzeption: Büro Hamburg
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Coverabbildungen: Blick vom Ölberg auf den Felsendom (Blaine Harrington III/Corbis)
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Theater über den Wolken
Willkommen an Bord! Von Deutschland aus dauert der Flug nach Tel Aviv rund vier Stunden. Entspannen Sie sich, Sie haben nichts vergessen. Den Reisepass mussten Sie ja schon beim Einchecken vorzeigen. Wenn Sie öfter in arabischen Ländern Urlaub machen, lohnt sich ein Zweitpass. Den stellen Ihnen die deutschen Behörden nach Ihrem dezenten Hinweis »Israelreise« aus. So hübsch die arabischen Schriftzeichen auch auf dem Papier aussehen, sie führen zu vielen Fragen, die keine Reise verschönern.
Wenn Sie einen Flieger der Gesellschaft El Al buchen, dann wird Ihnen die große Bühne geboten. Das Theaterticket ist quasi im Flugpreis enthalten. Mit der staatlichen Fluglinie Israels reisen Sie bei früher Buchung nicht teurer als mit den deutschen Konkurrenten. Und das, obwohl man sich viel mehr um Sie kümmern wird. Ob Sie wollen oder nicht.
Schon am deutschen Flughafen erwarten Sie El-Al-Sicherheitsmitarbeiter mit ihren Fragen zur anstehenden Reise. Vor einiger Zeit traf ich an einem Berliner Flughafen auf einen ehemaligen Kommilitonen, einen Israeli, der in Deutschland studiert hatte und jetzt für El Al arbeitete. Nun fragte er mich streng nach Protokoll aus, als ob wir uns noch nie zuvor gesehen hätten. Sicherheit geht vor! Oder mit einem El-Al-Werbespruch gesagt, der sicher anders gemeint ist: »Es ist nicht nur eine Fluggesellschaft. Es ist Israel.«
Im Flieger geht die Vorstellung weiter. Ein klarer Vorteil zu den Theatern unten am Boden ist hier oben: Sie dürfen während der Vorstellung essen. Alles ist koscher, und was das genau bedeutet und wieso koscher nicht gleich koscher ist, erfahren Sie bei den Diskussionen an Bord oder im Kapitel »Shrimps in Falafel«.
Bei der Essensausgabe beobachte ich: Nicht jeder Israeli freut sich über koscher. Nehmen wir die zwei jungen nicht religiösen Juden neben mir, offenbar noch erschöpft von der großen Berlin-Party. Missmutig stochern sie im vorgesetzten Essen herum. Vielleicht erinnern sich beide in diesem Moment an den einen oder anderen nicht so koscheren Genuss während des Urlaubs – oder in ihrem Tel Aviver Lieblingsrestaurant, wo man es auch nicht immer so genau nimmt. Dabei kann koscher sehr fantasievoll und lecker sein, wie der deutsch-israelische Spitzenkoch aus dem Rheinland Tom Franz im besagten Kapitel erklären wird.
Ach, ich träume bereits vom ofenfrischen Fladenbrot, getunkt in Olivenöl und Balsamico, in Meersalz getupft. Dazu Fisch, ins Netz geschwommen vor der Küste Jaffas. Diese Küste werden Sie übrigens sehen, wenn Sie in einigen Stunden über dem Mittelmeerstrand und den Hochhäusern von Tel Aviv zur Landung ansetzen. Hier wohnen immerhin rund 400 000 der rund acht Millionen im Land lebenden Israelis.
Weiter südlich werden Sie dann den Gazastreifen erahnen können, mit dem Flieger wären Sie in vier Minuten dort. Landen kann man da allerdings nicht mehr. Den Flughafen zerstörte das israelische Militär. Doch zum Konflikt kommen wir später noch ausführlich. Schauen Sie beim Anflug erst mal nach links und folgen dem Küstenstreifen. Keine 150 Kilometer weiter beginnt der Libanon. So groß Israel und Palästina in den Nachrichten wirken, so klein sind die beiden Länder geografisch: selbst zusammengenommen um einiges kleiner als die Schweiz.
Den orthodoxen Juden ein paar Reihen vor mir ist die so sorgsam verpackte Speise hingegen nicht koscher genug; das falsche Zertifikat stamme vom falschen Rabbi und so weiter. Den mit schwarzen Mänteln bekleideten Religiösen habe ich bereits beim Verpacken ihrer großen Hüte zugesehen. Ihre schwarzen Hutkoffer passten wunderbar ins Handgepäck. Wohin mit dem Rest? Das gehört zu den ungelösten Problemen der Luftfahrt.
Zähe Verhandlungen mit dem Bordpersonal führten zu meterweiten Verschiebungen des Handgepäcks in die vorderen Reihen und wieder zurück. Was für ein wundervolles Schlamassel über den Wolken! Zuschauen lohnt sich schon allein deswegen, damit Sie später Ihre Sachen wiederfinden. Und vielleicht hören Sie auch einen Orthodoxen selbst von »Schlamassel« sprechen, das Wort kommt schließlich aus dem Jiddischen.
Diese alte, dem Deutschen verwandte Sprache beherrscht noch so mancher Israeli, vor allem die Orthodoxen. Ansonsten wird immer das Neuhebräisch gesprochen – in Palästina Arabisch. Sollten Sie Fragen zur Sprache und überhaupt zur bevorstehenden Reise im Land haben, wenden Sie sich am besten an Ihre Sitznachbarn auf den Plätzen vor und hinter sich.
Vielleicht lernen Sie vorab schnell noch ein paar schöne Worte zum Einstieg. »Manischma?« bedeutet »Wie geht’s?« auf Hebräisch. Und locker auf Arabisch an Palästinenser gerichtet: »Kief il-hal?« – frei übersetzt: »Wie läuft’s?« Oder legen Sie mit Händen und Füßen und anderen Fremdsprachen los. Einziges Problem, die Kommunikation könnte etwas einseitig ausfallen, denn Palästinenser werden Sie in diesem Flugzeug kaum finden. Die müssen aufgrund von israelischen Bestimmungen über Jordanien einreisen. Dort landen sie in Amman und fahren mit Bussen weiter in die Westbank, die auf Deutsch Westjordanland heißt, weil es westlich des Jordans liegt, des Grenzflusses zu Jordanien.
In der Westbank leben rund drei Millionen Palästinenser, im Gazastreifen sind es etwa zwei Millionen. Wer von den Gaza-Palästinensern reisen darf, macht das natürlich nicht über Jordanien, sondern über das angrenzende Ägypten. Andersherum können Entwicklungshelfer, Journalisten, Politiker und Ärzte nach Antragstellung bei israelischen Behörden in den Gazastreifen einreisen.
So sehenswert die Region ist und besuchenswert ihre Bewohner sind, eine Reise dorthin benötigt eine Gebrauchsanweisung für sich. Der Gazastreifen ist ein Krisengebiet, das immer wieder unberechenbar und schnell zum Kriegsgebiet wird. Daher werde ich in diesem Buch nur selten auf den Gazastreifen eingehen. Wenn auch vieles, was ich über Kultur, Religion und Gesellschaft sage, auf beide Teile Palästinas zutrifft.
Doch zurück an Bord: Selbst wenn sich also kein Palästinenser unter Ihren Mitreisenden befinden sollte, entdecken Sie bestimmt den ein oder anderen »arabischen Israeli« – der sich vielleicht selbst eher »palästinensischer Bürger Israels« nennen würde. Was das nun wieder zu bedeuten hat, werde ich Ihnen auch später erklären.
Die meisten Araber, die ich kenne, meiden El Al wegen der zähen Fragerei zu ihrer Herkunft bereits vor dem Abflug. Doch egal, mit welcher Gesellschaft sie reisen, am Flughafen in Tel Aviv werden sie dennoch häufig stundenlang ins Kreuzverhör genommen. Eine deutsche Freundin mit palästinensischen Wurzeln musste das einmal einen halben Tag lang über sich ergehen lassen, bevor sie mit ihrer kleinen Tochter einreisen durfte.
Aber keine Sorge, dieser Flughafen mit all seinen Herausforderungen liegt noch in weiter Ferne. Ihre Fragen beantwortet man derweil an Bord sicher gern. Israelis und Palästinenser sind Deutschen gegenüber sehr offen. Und sie freuen sich oftmals über Kontakt mit ihnen. Gefühlt kenne ich weit mehr Israelis als Deutsche, die schon mal in Berlin waren. Aufgrund unserer Geschichte können natürlich auch ganz andere Situationen und Gespräche entstehen.
Bestimmt stoßen Sie bei Ihrer Kontaktaufnahme im Flieger auch auf andere Reisende, also weder Israelis noch Palästinenser. Meine unvollständige Liste dieser Personengruppe ist sehr lang: von Neurodermitis geplagte Kurgäste auf dem Weg ans heilsame Tote Meer, stets gut gelaunte und gesellige Pilger, Kulturfreunde aus aller Welt, Städtebummler und Wüstenwanderer.
Ganz oben stehen jedoch die vom Liebeskummer Geplagten. Liebeskummer nach der israelischen oder palästinensischen Partnerin oder dem Partner oder den Partnern. Liebeskummer nach Meeresstrand oder Wüstensand, nach Hummus oder Falafel, nach dem heiligen Jerusalem oder dem weltlichen Tel Aviv; manchmal auch einfach nur Liebeskummer nach Israel oder Palästina. Selten nach beidem – doch das wird sich hoffentlich irgendwann ändern.
Ihre unterhaltsamen Stunden über den Wolken werden höchstens durch das Serviceangebot der El-Al-Flugbegleiter unterbrochen. Für das bargeldlose Zahlen benötigen Sie wie immer im Flieger eine Kreditkarte. Und auch nach der Landung ist das Plastikteil wichtig: für die Reise durch Israel und Palästina geradezu unerlässlich! An nicht allen Bankautomaten erhalten Sie mit einer einfachen EC-Karte Geld. Und Sie können damit auch keinen Wagen ausleihen oder eines der erholsamen Hotelbetten bezahlen.
Zudem lohnt es sich nicht, in Deutschland Geld zu wechseln. Am Flughafen in Tel Aviv lassen sich bei den Automaten unmittelbar neben den Gepäckbändern oder am Ausgang israelische Schekel abheben. Der Schekel ist ebenso in Palästina die vorrangige Währung. Wenn auch manch einer im Geldbeutel dort zusätzlich jordanische Dinar und US-Dollar aufbewahrt.
Egal, was Sie vorhaben, Städtetrip oder Naturidylle, Automaten finden Sie in jeder israelischen Kleinstadt. In Palästina werden Sie nur in größeren Städten wie Ramallah, Nablus, Bethlehem oder Hebron fündig. Überhaupt bietet sich bei einer Reise ein Mix aus Stadt und Land an. Sie reisen durch drei sehr unterschiedliche Klimazonen, je nachdem, ob Sie in den Bergen, am Mittelmeer oder in der Wüste unterwegs sind. Die Natur ist dementsprechend vielfältig. Ich denke da an die schwer von den Ästen hängenden Granatäpfel, die Zitronen-, Oliven- und Mandelbäume, die Bananenstauden und Dattelpalmen.
Kurz vor der Landung ist Ihr Adressbüchlein voll. Vielleicht knüpften Sie auch erste Geschäftskontakte, handeln alsbald mit palästinensischem Olivenöl oder israelischen Computerchips. In den Gesprächen haben Sie bereits so manches über die Vorurteile auf beiden Seiten gehört.
Vielleicht haben Sie aber auch keine Unterhaltung geführt, sondern zu einem Glas israelischen Rotwein in aller Ruhe diese Gebrauchsanweisung gelesen. Auch gut. Zeit für Gespräche, gewollte und ungewollte, wird es auf Ihrer anstehenden Reise ohnehin noch genug geben.
Hightech-Superdemokratie gegen Diktatur mit Eselsantrieb?
Israel ist eine Superdemokratie. Von Juden für Juden errichtet. Aus dem Nichts entstanden. Nein, besser: aus unfruchtbarer Wüste erschaffen! Ein Wunder, keine Frage. Alles göttlich so gewollt, natürlich. Ein Heimatland für Juden aus aller Welt, egal, welcher Herkunft. Zu allem Überfluss auch noch eine lupenreine Superdemokratie, die weder Kleptokratie noch Korruption, noch andere Formen von Machtmissbrauch kennt.
Und Palästina? Was ist Palästina? Das Wort existiert doch gar nicht, alles reine Erfindung der Araber … Und eine palästinensische Identität gibt es sowieso nicht. So erzählt man sich das Märchen in Israel.
Die palästinensische Version geht so: Palästina war schon immer da. Heute ist das Land die einzige arabische Demokratie. Und was für eine! Mit freien Wahlen, freien Politikern, einem freien Volk – was der Westen sich so wünscht. Alles wäre in bester Ordnung, wären da nicht die Juden. Ja, die Juden. Denn Israelis heißen nicht schlicht Israelis, sondern »die Juden, die Palästina besetzen«. Und nur diese Besatzung ist an allem palästinensischen Übel schuld.
Sie werden auf Ihrer Reise so manchen Märchenerzählern begegnen. Der verworrene Konflikt lädt dazu ein, Fremde mit verdrehten Fakten und einer gehörigen Portion Patriotismus verführen zu wollen. Trotz all meiner Reisen höre ich immer noch gebannt zu. Dafür mag ich Geschichten viel zu sehr, auch wenn sie in Nahost selten ein Happy End haben. Es geht darin immer um den Kampf zwischen Gut und Böse, David gegen Goliath. Je nach Herkunft des Erzählers ist das Böse israelisch oder eben palästinensisch.
Verstehen Sie mich nicht falsch, Sie werden viele tolle, ehrliche Menschen treffen, die es gut mit Ihnen meinen. Doch die Wahrnehmung der politischen Ereignisse ist sehr einseitig. In Israel hören Sie die Klagen über palästinensische Terroristen, in Palästina über israelische Soldaten. Das eigene Schicksal rückt in den Mittelpunkt. Was auf der anderen Seite passiert, interessiert nicht, ist unerheblich. Und die Medien spielen mit, liefern die Bilder über das eigene Leid. Die Tränen der anderen berühren nicht.
Die 1922 in Bethlehem geborene Palästinenserin Amelie Dschaqaman fasste ihr Leid für mich so zusammen: »Meine Mutter kam während der osmanischen Besatzung auf die Welt. Ich wurde während der englischen Besatzung geboren, meine Kinder während der jordanischen, deren Kinder während der israelischen. Es gibt immer jemanden, der dieses Land will, aber nie jemanden, der uns will. Ist das keine Tragödie?«
Und der Israeli Abraham Bar-Am, Armeeoffizier im Ruhestand, sagte zu mir: »Von klein auf sah ich Kriege. Ich selbst kämpfte im Unabhängigkeitskrieg, im Suezkrieg, im Sechs-Tage-Krieg, im Jom-Kippur-Krieg und in vielen weiteren Einsätzen. Mein Sohn kämpfte. Mein Enkel kämpfte. Er liegt verwundet im Krankenhaus. Und ich glaube, der Enkel meines Enkels wird auch kämpfen.«
Solche Gespräche machen den Konflikt für mich greifbarer. Und ich verstehe seither auch, wieso es fast schon eine übermenschliche Leistung wäre, wenn Israelis oder Palästinenser zu einer nüchternen, objektiven Schilderung in der Lage wären. Ihr Leben ist eng verwoben mit dem Konflikt, der bis heute ihren Alltag prägt.
Wenn Sie mit den Menschen in der Region sprechen und immer wieder nachfragen, hören Sie ihre Geschichten von Krieg und Vertreibung. In Israel haben die Väter und Mütter Angst, wenn ihre Söhne und Töchter zur Armee gehen. Männer müssen drei Jahre dienen, Frauen zwei.
Auf palästinensischer Seite fürchten die Eltern, was der Konfliktalltag aus ihren Kindern macht. Ob sie sich radikalen Gruppen anschließen, die für sie Widerstandsbewegungen sind? Ob sie eines Tages in israelische Haft kommen? Und die ständige Frage: Was wird aus den Kindern in diesem Land werden?
Eine Mutter aus Nablus erzählte mir von einer der Ausgangssperren, von denen es während der Zweiten Intifada viele gab – des zweiten großen Aufstandes der Palästinenser gegen die israelische Besatzung, der 2000 ausbrach. Das israelische Militär untersagte allen, ihre Häuser zu verlassen. Der Sohn der Frau hörte nicht darauf, er wollte raus, etwas einkaufen, was auch immer, drinnen wäre ihm die Decke auf den Kopf gefallen. Er verließ also das Haus und kehrte nicht mehr zurück. Ein Freund von ihm zeigte mir die Stelle, wo man ihn erschossen hatte.
Beim Besuch eines Krankenhauses in Gaza sah ich sowohl Opfer israelischer Raketenangriffe als auch Verletzte innerpalästinensischer Konflikte. Ich sprach mit Menschen, die jahrelang im Gefängnis saßen oder im Untergrund lebten; mit Schülern, die am Checkpoint schikaniert wurden; mit israelischen Soldaten, die dort eingesetzt waren und mir erzählten, wie viel Angst sie vor Anschlägen an den Kontrollpunkten hätten.
Wenn Sie in solche Gespräche verwickelt werden oder sie bewusst suchen, empfehle ich Ihnen Folgendes: nicht urteilen. Oder anders: einfach nur zuhören. Auch wenn das in den meisten Fällen gar nicht so einfach ist.
Ich sehe noch die israelische Familie vor mir, die sich daran erinnerte, wie sie die Zweite Intifada erlebt hatte. Sie saß im Restaurant, ein Blitz, ein Knall, überall Blut – doch die Familie überlebte. Ich traf auch die Familie des palästinensischen Selbstmordattentäters. Hunderte strömten nach dem Anschlag zu ihr, um zu gratulieren. Denn für diese Menschen war es kein Anschlag, sondern eine militärische Operation. Für sie war der Attentäter kein Terrorist, sondern er wurde mit seiner Tat zum Märtyrer, zu einem gefeierten Helden. Doch irgendwann war die Feier zu Ende. Als die Siegesparolen der Radikalen nicht mehr zu hören waren, kam die Trauer.
Für eine Buchrecherche besuchte ich über mehrere Monate die Familie eines anderen Selbstmordattentäters. Der Vater weinte, wenn er sich an die Kindheit seines Sohnes erinnerte. Mit siebzehn Jahren hatte der sich an einer Jerusalemer Bushaltestelle in die Luft gesprengt und dabei viele Menschen getötet. Die Mutter zeigte in der Hoffnung auf die Tür, er werde eines Tages zurückkommen.
Oder da war der Israeli, der mir von den verwundeten Soldaten seiner Einheit erzählte, wie er sie zwei, drei Mal die Woche in Albträumen schreien hörte – noch dreißig Jahre nach dem Krieg. Und der die Nase rümpfte, als er sich an das verbrannte Fleisch seiner Kameraden erinnerte, der Geruch hatte sich in sein Gedächtnis gebrannt. »Ein Mensch ist ein Mensch«, sagte er, als ob er sich für sein Trauma entschuldigen müsste.
Trauma ist ein wichtiges Wort in Israel und Palästina, ein Wort, über das keiner so richtig sprechen will. Doch traumatisiert sind beide Völker. Für mich schildern diese Geschichten am eindringlichsten, wie der Konflikt den Alltag bestimmt. Doch ich könnte auch einen anderen Weg gehen und über einen Ball sprechen, genauer, den Fußball.
Es ist die beliebteste Sportart auf israelischer wie palästinensischer Seite. Die Nationalmannschaften beider Länder tauchen auf der Weltrangliste der FIFA nicht an prominenten Stellen auf. Der Nahost-Fußball schafft es meist nur mit politischen Themen in unsere Medien. Zum Beispiel, wenn die Ultraorthodoxen in Israel fordern: kein Fußballspiel am Schabbat! Für deutsche Fußballfans wäre das wie keine Bundesliga am Wochenende.
Fehlen die internationalen Erfolgsmeldungen über die eigene Nationalmannschaft, sucht man sich andere Länder als Vorbild. Dabei drücken Palästinenser und Israelis oft denselben Nationalteams die Daumen – allen voran dem brasilianischen. Und in der Zeit vor und nach der Weltmeisterschaft sind die spanischen Spitzenvereine in aller Munde.
Einmal stieg ich in ein Sammeltaxi und nahm neben einem jungen Palästinenser Platz, der vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre alt war. Ich grüßte ihn, und er antwortete grinsend mit einer Frage: »Real Madrid oder Barcelona?« Auch Sie müssen da irgendwann eine Entscheidung treffen auf Ihrer Reise.
Der Konflikt begegnet Ihnen fortan überall. Der palästinensische Fußballverband klagt über die Militärkontrollen, die seine Spieler erdulden müssen, wenn sie unterwegs sind. Selbst, wenn sie innerhalb von Palästina zum Spiel wollen. Und wie finden Kicker aus dem Gazastreifen in die Westbank? Entweder nach langem behördlichen Hin und Her oder gar nicht. Auch beim Stadionbau muss mit israelischen Behörden verhandelt werden. Welche Technik darf eingeführt und wie hoch dürfen Flutlichter gebaut werden? Trotz allen Widrigkeiten qualifizierte sich die palästinensische Nationalmannschaft für den Asien-Cup. Da waren die Fans natürlich stolz und vergaßen einen Augenblick all die Widrigkeiten.
Die palästinensischen Fußballerinnen haben es sogar doppelt schwer. Nicht nur die Besatzung, auch die eigene Gesellschaft macht Probleme. Ungern wird es im traditionellen Palästina gesehen, wenn Frauen öffentlich Sport treiben, zumal in der Sportart entsprechenden Bekleidung, vielleicht auch noch ohne Kopftuch.
Bereits in den 1920-Jahren gab es im britischen Mandatsgebiet Palästina Turniere, bei denen britische Soldaten sowie jüdische und arabische Mannschaften gegeneinander spielten. Heute füllen die israelischen Vereine landesweit die Stadien – von Hapoel Ironi im Golan-Städtchen Kiryat Schmona, also im Norden, bis zu Hapoel Beerscheba, benannt nach der Wüstenstadt im Süden.
»Hapoel« heißt übersetzt »der Arbeiter«, und das hat einen Grund: Der riesige Sportverband blickt auf eine Geschichte zurück, die von der Gewerkschaftsbewegung geprägt wurde. Sehr früh organisierten sich die jüdischen Arbeiter in Gewerkschaften, weit vor der eigentlichen Staatsgründung Israels 1948.
Den Arbeitern steht der Verband Maccabi gegenüber – im Fußball wie auch in anderen Sportarten. Auch bei Maccabi ist der Name Programm, leitet er sich doch von den Makkabäern ab. Die jüdischen Aufständischen erhoben sich im zweiten Jahrhundert vor dem Beginn unserer Zeitrechnung gegen die hellenistische Fremdherrschaft der Seleukiden. Maccabi steht daher traditionell eher für eine jüdisch-nationale und religiöse Ausrichtung.
Wer nun auf die erste Liga blickt, der entdeckt viele Hapoel- oder Maccabi-Vereine. Und wer bei welchem Verein mitfiebert, ist daher nicht selten auch eine politische Frage. Eine weitere, die dazugehört, lautet: Wie viele arabische Israelis spielen mit, und wie sehen das die Fans? Bei Bnei Sachnin handelt es sich um eine arabisch-israelische Mannschaft. Ein Novum. Auch jüdische Israelis spielen mit.
Und das Gegenteil davon: Immer wieder in den Schlagzeilen ist der Verein Beitar Jerusalem, nicht selten auch außerhalb des Sportteils. Bei Spielen sind Sprechchöre wie »Tod den Arabern!« oder Anti-Mohammed-Lieder zu hören. Ein befreundeter Israeli stellte fest: »Es werden Sachen gesungen, die man auf der Straße nicht singen dürfte. Und die Kinder singen mit.«
Für viele Beobachter ist Beitar schlicht der »Siedler-Klub«.
Über Siedlungen muss man in diesem Zusammenhang sprechen, sie stellen eines der großen Probleme dar – zumindest, wenn es darum geht, irgendwann einmal den Konflikt zu beenden.
Ich erinnere mich an einen Wüstenausflug im Rahmen einer kleinen Reisegruppe. Mit gemieteten Quads waren wir quer durch die bergige Wüstenlandschaft unterwegs und machten Rast, um die Aussicht zu genießen. »Das ist mein Heimatland!«, rief ein junger US-Amerikaner, der vor mir stand. Seine Arme waren weit ausgestreckt. Er wartete darauf, fotografiert zu werden. Doch offenbar störte die Hobbyfotografen etwas im Hintergrund. Auch wenn es von hier oben nur ein kleiner Punkt war. Es war eine Stadt, das palästinensische Jericho.
Archäologischen Ausgrabungen zufolge handelt es sich hierbei um eines der ersten Siedlungsgebiete der Menschheit. Auch wenn um diesen Titel noch andere Orte streiten, so ist klar, auch schon für andere Völker war das Heimat. Und solche nationalen Kategorien wie Palästinenser oder Israelis gab es da noch lange nicht.
Auf jenem Ausflug befanden wir uns mit den Geländefahrzeugen geografisch in der Westbank. Wer von Jericho nach Jerusalem fährt, der befindet sich laut Karten der Vereinten Nationen im besetzten Palästina. Auch wenn Sie von Jerusalem aus das Tote Meer besuchen wollen, fahren Sie auf dieser Straße, und Wachposten und Wachtürme deuten an, dass da etwas nicht stimmt. Am Wegesrand finden Sie Ausschilderungen zu Orten, in denen Israelis leben und die nach israelischer Auffassung zu Israel gehören: Siedlungen.
Wieso ich das so ausführlich darstelle, hat einen Grund. Immerhin reden wir über 600 000 Israelis, die in einem Gebiet leben, das laut Vereinten Nationen den Palästinensern gehört. Die Siedlungen verstoßen gegen das international gültige Völkerrecht und wachsen dennoch Jahr für Jahr. Vor allem im Speckgürtel von Jerusalem ist das gut zu beobachten.
Wenn Sie durch die Westbank fahren, so werden Sie in vielen Siedlungen Bagger und Lastwagen sehen – egal, ob offiziell ein Baustopp besteht oder nicht. Vor den Siedlungen entdecken Sie ein Dutzend Autos mit grünen Nummernschildern. Damit fahren Palästinenser nach Hause, die als Bauarbeiter bei der Erweiterung der Siedlung geholfen haben. Ein Paradox, das nur zu verstehen ist, wenn man auf die wirtschaftliche Situation des quasi bankrotten Palästinas blickt.
Vielleicht lässt sich das Phänomen der Siedlungen mit einem kleinen Gleichnis illustrieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Häuschen mit einem Garten. Nicht den ergiebigsten, aber Ihnen reicht er so, für mehr fehlt Ihnen das Geld. Eines Tages entdecken Sie einen Fremden dort. Er gräbt Ihren Garten um, verwendet moderne Geräte und erzielt rasch Ergebnisse. Sie finden das nicht so toll.
Am nächsten Tag stehen fünf Fremde da, sie haben bereits einen Wohncontainer mitgebracht. Nach einer Woche erhalten Sie ein Schreiben des Staates, dessen Bürger diese Fremden sind. Ihr Land gehört nun denen. Ihr Haus übrigens auch. Als Sie die Fremden wütend zur Rede stellen, was das solle, erklären sie ihnen, dass genau an dieser Stelle Heiliges geschehen sei.
Weil Sie eine andere Religion haben, interessiert Sie das reichlich wenig. Dafür umso mehr, wo Sie nun wohnen sollen. Sie packen Ihre Sachen, laden das Auto voll und entdecken die neue Straße, die zu Ihrem Haus führt, vierspurig, stellenweise beleuchtet. Sie haben kaum Zeit, sich wenigstens über die verbesserte Infrastruktur zu freuen, da stoppt Sie das fremde Militär. Sie haben ja ein grünes Nummernschild! Doch auf dieser frisch asphaltierten Straße, die auch dem fremden Staat gehört, dürfen Sie nur noch mit einem gelben fahren. Gelb bekommen Sie aber nicht. Also fahren Sie wie immer auf einer kleinen, kaputten Straße weiter.
Natürlich ist das zugespitzt. Es gibt auch nicht den Siedler. Jeder hat seine eigenen Motive, und nicht immer sind es religiöse. Bei vielen Siedlern handelt es sich um Israelis, die verzweifelt nach günstigem Wohnraum in der Nähe von Ballungsgebieten suchen. Nach Orten, von denen man mit dem Auto in einer halben Stunde am Arbeitsplatz in Tel Aviv oder Jerusalem sein kann.
Ariel in der Westbank ist so ein Ort, sogar mit eigener Universität. Von großen Wohnanlagen bis zum Einfamilienhaus gleichen sich die Grundrisse der Gebäude. Viel Wohnraum, schnell gebaut, für wenig Geld. Mit dem Leihwagen können Sie sich problemlos so eine Siedlung ansehen und in einem Café mit Siedlern ins Gespräch kommen.
Oder Sie nehmen einen der vielen jungen israelischen Anhalter mit, die am Ortsausgang der großen Siedlungen stehen. Auf diese Weise verbrachte ich schon einige Stunden und fuhr sie zu ihrem Wunschort quer durch die Westbank oder nach Israel. Nur so lernte ich außer denen, die aus wirtschaftlichen Gründen in Siedlungen leben, auch andere kennen.
Zum Beispiel Israelis, für die es einzig ein Großisrael gibt – ein Gebiet inklusive Gazastreifen, Westbank, Ostjerusalem und Golan. Die Nationalreligiösen unter ihnen betrachten das alles als ihr Gelobtes Land, das sonst keinem gehört. Das ruft mir ein kleines Missgeschick ins Gedächtnis: »Wo geht’s nach Israel?«, fragte ich eine Gruppe von Siedlern mitten in der Westbank. Ich hatte mich verfahren. Verwirrt schaute mich der älteste unter ihnen an. »Nach Israel?« Zu spät begriff ich, dass ich für diese Siedler bereits mitten in Israel war.
Hört sich verwirrend an, ist es auch. Selbst für Israelis.
»Darf ich mit Ihrem Leihwagen auch auf die palästinensische Seite fahren?«, fragte ich eine Mitarbeiterin des größten israelischen Autoverleihers am Tel Aviver Flughafen.
»Nein! Nur in Israel.«
»Wieso?«
»Wegen der Versicherung.«
»Und wenn ich nach Kiryat Arba fahren will?« Diese israelische Siedlung liegt mitten im Süden der Westbank.
»Natürlich. Das geht«, erklärte die Mitarbeiterin.
»Aber wie komme ich denn dorthin? Da muss ich doch durch palästinensisches Gebiet.«
Sie blickte zu ihrer Kollegin, beriet sich und sagte zu mir: »Kein Problem. Kiryat Arba ist israelisch.«
»Aber wie komme ich da nun hin?«, hakte ich nach.
»Ich kenne mich da auch nicht so aus.«
»Ach so.« Mehr fiel mir zu dieser Antwort nicht ein.
Sie wandte sich dem Kunden hinter mir zu.
Ich blieb stur. »Haben Sie vielleicht eine Karte für mich? Damit ich auf den Straßen fahre, auf denen ich auch versichert bin.«
Sie schüttelte mit dem Kopf und beriet bereits eifrig den neuen Kunden.
Ich probierte beim nächsten Autoverleiher mein Glück.
Auf dem Weg quer durch die Westbank entdecken Sie Megasiedlungen und Minisiedlungen, die lediglich aus Wohncontainern bestehen. Manche Siedlungen werden von ultraorthodoxen Siedlern bewohnt. Ultraorthodoxe Juden nennen sich Haredim, was »Gottesfürchtige« bedeutet. Einige von ihnen erkennen den Staat Israel nicht an. Nach ihrem Glauben muss zuerst der Messias erscheinen, und dann wird das Königreich Davids neu entstehen.
In vielen Siedlungen leben nationalreligiöse Juden. Diese erkennen den Staat an, denken dabei allerdings an besagtes Großisrael – ganz ohne Palästina. Die Siedlerbewegung fand in nationalreligiösen Ideologien ihren Anfang – nicht in den ultraorthodoxen. Die Radikalen unter ihnen – wir sprechen von einer absoluten Minderheit – gehören der sogenannten Hügeljugend an. Selbst viele Israelis nennen sie Terroristen – auf ihr Konto gehen auch Anschläge gegen Palästinenser.
Ein bewaffneter Traktorfahrer eskortierte mein Auto einmal wie bei einem Gefangenentransport zum Ausgang so einer Siedlung. Ich wollte sie mir aus Recherchegründen ansehen. Von solchen Ortsbesichtigungen auf Reisen rate ich hingegen ab. Die großen Megasiedlungen wie die bereits erwähnte Stadt Ariel bieten genug Einblicke. Und auch ohne eigenes Auto, ganz bequem per Straßenbahn oder mit einer kurzen Taxifahrt, können Sie eine Siedlung besuchen: die riesigen Wohnanlagen in Ostjerusalem. Je nach politischer Lage erwartet Sie dort nicht einmal ein Kontrollpunkt – so wissen selbst viele Israelis nicht, dass sie sich gerade mitten in den Palästinensergebieten befinden.
Wer für oder gegen Siedlungen ist, war in Israel einst gut erkennbar. Als israelische Soldaten den Gazastreifen im Jahr 2005 räumten, kannte Jerusalem nur zwei Farben: Blau oder Orange. An den viel befahrenen Kreuzungen konnte man sich von Aktivisten ein Band in der jeweiligen Farbe schenken lassen.