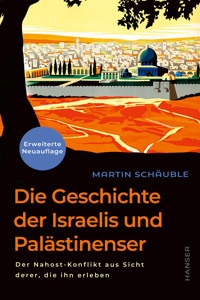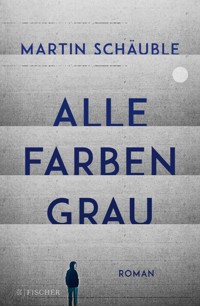
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet von der JungeMedienJury (JMJ) der Stadt Frankfurt am Main als »bester Jugendroman 2023«! Paul begeht Suizid. Seine Familie, seine Freunde und sein restliches Umfeld müssen damit klarkommen. Der Roman von Martin Schäuble folgt einer wahren Geschichte. Paul ist sechzehn und war schon immer ein bisschen eigen: Er lernt Japanisch und hört Musik, die keiner in seinem Alter kennt. Er ist unheimlich schlau und könnte alles erreichen, wären da nicht seine Ängste und Abgründe. Über die spricht er lange nicht, erst in der Jugendpsychiatrie. Dort lernt er die junge Alina kennen, die seine Liebe zu Katzen teilt und ihn Jesus nennt. Nach der Zeit dort kehrt er zurück in sein normales Leben, und alle haben riesige Hoffnung. Außer einem, der sich längst verabschiedet. - Nach Pauls wahrer Geschichte: aufrüttelnd und tragisch - Hochaktuell und relevant: Psychische Erkrankungen bei Jugendlichen nehmen seit Jahren dramatisch zu - Als Unterrichtslektüre zu den Themen Depression und Suizidprävention geeignet Der Verlag weist darauf hin, dass dieser Roman von einem jungen Menschen handelt, der sich das Leben nimmt, und außerdem selbstverletzendes Verhalten geschildert wird. Für die Verwendung in der Schule ist unter https://www.fischer-sauerlaender.de/verlag/kita-und-schule/unterrichtsmaterialien ein Unterrichtsmodell zu diesem Buch abrufbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Martin Schäuble
Alle Farben grau
Roman
Über dieses Buch
Aufrüttelnd, tragisch, authentisch. Ein Roman, den das Leben schrieb. Oder der Tod.
Paul ist sechzehn und war schon immer ein bisschen anders als die anderen: Er lernt Japanisch und hört Musik, die keiner in seinem Alter kennt. Dass er unheimlich schlau ist und es auch gern zeigt, macht ihn noch mehr zum Sonderling – ob in der Schule, zu Hause oder im japanischen Internat. Nur in der Psychiatrie, da verstehen sie ihn. Die junge Alina zum Beispiel, die seine Liebe zu Katzen teilt und ihn Jesus nennt. Kaum ist Paul wieder draußen, haben alle riesige Hoffnung. Außer einem. Und der war schon immer ein bisschen anders als die anderen ...
Ein Roman über Depression und Suizid bei Jugendlichen, für den Martin Schäuble über Monate mit Hinterbliebenen und Betroffenen gesprochen hat. Entstanden ist ein bewegender Roman nach einer wahren Geschichte.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Martin Schäuble, geboren 1978, ist für seine kritischen Jugendbücher bekannt. Bei FISCHER KJB sind von ihm bereits »Sein Reich«, »Cleanland« und »Godland« sowie unter dem Pseudonym Robert M. Sonntag die Dilogie »Die Scanner«/»Die Gesannten« erschienen. Er ist außerdem der Autor des vielbeachteten Titels »Endland«. Als Sachbuch-Autor schrieb er mehrfach ausgezeichnete Titel zum Nahost-Konflikt (u.a. »Black Box Dschihad«).
Sein neuer Roman »Alle Farben grau« beruht auf einer wahren Geschichte. Die Familie von Paul (Name geändert) und der Autor fanden zueinander. Sie vereint ein gemeinsamer Wunsch: Über psychische Erkrankungen muss gesprochen werden, es darf keine Stigmatisierungen geben. Und nur so ist eine Prävention möglich.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Für die Verwendung in der Schule ist unter
www.fischer-sauerlaender.de/verlag/kita-und-schule/unterrichtsmaterialien
ein Unterrichtsmodell zu diesem Buch abrufbar.
Erschienen bei Fischer Sauerländer E-Book
© 2025, Fischer Sauerländer GmbH, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch
Aenne Glienke, Agentur für Autoren und Verlage
www.AenneGlienkeAgentur.de
Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Fachberatung: Trine Karcher
Angaben zu den Quellen der zitierten Originaltexte im Anhang
Zuerst erschienen 2023 als Hardcover im Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag, Frankfurt am Main
Covergestaltung: Buchgut, Berlin, unter Verwendung einer Abbildung von Jun Yamaguchi/Arcangel
Coverabbildung: Jun Yamaguchi/Arcangel
ISBN 978-3-7336-0552-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Dieser Roman handelt [...]
Nach Pauls wahrer [...]
Krisenrausch eins
ALINA
Elftes Gebot: Du [...]
JESUS (damals noch PAUL) Drei Jahre zuvor
Krisenrausch zwei
JESUS Drei Jahre später
Japan eins
PAUL Sechs Monate vor der Einweisung in die Akutstation
Japan zwei
LIEN Drei Tage vorher
Krisenrausch drei
JESUS (früher PAUL) Sechs Monate später in der Akutstation
Konnichiwa
PAUL Sechs Monate vor der Einweisung in die Akutstation
Neko heißt Katze
RIKU Pauls Japanischlehrer in Deutschland
Entscheidungsschlacht
PAUL Zweieinhalb Jahre vor Japan
Zwischenrufe
NOAH Pauls bester Freund
Winterruhelos
PAULIn Japan, zwei Wochen vor Weihnachten
Hanfdialoge
NOAH Pauls bester Freund
Fallende
PAUL Nach der Weihnachtspause, zurück in Japan
Space
PAUL In Deutschland, kurz vor Weihnachten
Abschied eins
PAUL Nach den Weihnachtsferien, die letzten Stunden in Japan
Danach eins
LIEN
Abschied zwei
PAUL, kurz vor der Einweisung in die Akutstation
Abschied drei
PAUL Nach der Akutstation
Danach zwei
PAULS ELTERN
NOAH
Hier kannst du Hilfsangebote finden, wenn es dir oder anderen psychisch nicht gutgeht:
Danksagung
Quellenangaben
Dieser Roman handelt von einem jungen Menschen, der sich das Leben nimmt. Es geht auch um Selbstverletzungen. Sprich bitte mit anderen, wenn es dir nicht gut geht und du ähnliche Gedanken hast. Anonym und kostenlos findest du zum Beispiel hier Hilfe:
TELEFONISCH:
In Deutschland: 116 111 und 0800-1110-111 oder -222
In Österreich: 142
In der Schweiz: 143
ONLINE (CHAT UND MAIL):
In Deutschland: www.krisenchat.de, www.u25.de,
www.nummergegenkummer.de,
www.telefonseelsorge.de
In Österreich: www.telefonseelsorge.at
In der Schweiz: www.143.ch
Nach Pauls wahrer Geschichte …
»Ich weiß, wenn man in deren Haut steckt oder auch wenn man ganz nah rangeht und sie beobachtet, scheint das alles einen Sinn zu geben, was sie da so wursteln, aber wenn man nur einen Schritt zurück macht, ist das doch alles sehr rätselhaft …«, sagt das Känguru.
Marc-Uwe Kling, Die Känguru-Chroniken
ALINA
Die Ausgangszeiten sind hier das Traurigste überhaupt. Und das hat an diesem Ort schon was zu bedeuten. Schließlich ist hier fast alles traurig, sowohl für die Eltern, die uns abholen und wieder bringen, als auch für uns, die wir hier untergebracht sind.
Untergebracht klingt nach einem Bullterrier im Tierheim, den keiner mehr haben will, weil er zu viel Probleme macht. Oder weil er einfach nur anders ist als andere Hunde. Und bei den Ausgangszeiten darf er mal kurz raus an die frische Luft, wird abgeholt und nach zwei Parkrunden an der dicken Leine zurückgezogen, weil er gar nicht zurückwill, ins Heim.
Untergebracht klingt nach Klassenausflug und Jugendherberge, nach einem Bus voller Kotztüten und vollgeschwitzten Sechsbettzimmern.
Untergebracht ist vielleicht das falsche Wort.
Das hier ist kein Tierheim und keine Schulveranstaltung, sondern der noch fiesere Teil vom Ernst des Lebens. Es ist die Akutstation der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Wir werden hier nicht untergebracht, sondern eher eingewiesen. In meinem Fall war es fast freiwillig – nachdem mein zweiter Suizidversuch scheiterte, musste ich mal was anderes probieren.
Fast freiwillig, wie gesagt.
Und was war geschehen?
Meine Mutter stand mit roten Augen neben dem Notarzt, und als ich vor Schmerzen aufschrie, sagte sie: »Alinchen, was soll der Scheiß? Was machst du für Sachen?«
Alinchen geht vor anderen Menschen gar nicht, aber ich hatte gerade meinen zweiten Versuch hinter mir und wollte meine Mutter nicht noch mehr stressen. Immerhin wäre ihr legendäres Alinaschätzchen noch peinlicher gewesen.
Meine Mutter musste schon wieder weinen, und der Mann in der orangenen Weste reichte ihr ein Taschentuch, obwohl er sicher längst an anderen Einsatzorten wichtigere Sachen zu tun hatte.
Adipöse und nikotinsüchtige Menschen auf ihrer Wohnzimmercouch reanimieren.
Brandwunden von hyperaktiven Kleinkindern in Reihenhausküchen versorgen.
Dem verunfallten Motorradfahrer auf der Autobahnausfahrt Schmerzmittel spritzen, bevor er sein Bein auf der anderen Straßenseite entdeckt.
Solche Alltagsdinge eben.
Doch Suizidversuche sind kein Alltag.
Das dachte ich zumindest, bis ich die Akutstation von innen sah.
Was meine Mutter in unserem Badezimmer dem Notarzt entgegenheulte, setzte mir ziemlich zu: »Ich kann …«, fing sie an, holte tief Luft und probierte es noch einmal. »Ich kann echt nicht mehr.«
Ich glaubte das meiner Mutter sofort, so fertig, wie sie aussah. Dabei war es ja nicht mein Ziel gewesen, meine Mutter zu töten, sondern mich selbst. Dass das aufs Gleiche rauskommt, verstand ich erst später in der Psychiatrie so richtig.
Der Notarzt hatte keine Zeit für große Worte, doch immerhin für große Taten. Er drückte meiner Mutter aus einer Packung eine Pille in die Hand. Sie schluckte das Ding trocken herunter.
Kurz schauten sich beide an und überlegten vermutlich synchron, ob das jetzt so das richtige Verhalten war, vor der suizidalen Teenagerin, doch sie sind eben auch nur Menschen.
Noch am selben Abend saß ich in einem krass gelben Raum, und das war noch nicht einmal die Akutstation, sondern die Praxis einer Psychologin.
Überall zwischen dem Gelb hingen große Fotos von Steinen: ein Stein am Strand. Ein Stein neben einem Teich. Ein Stein auf der Wiese. Ein Stein im Wald. Ein Stein in der Wüste. Und dann, total überraschend: drei Steine, übereinandergestapelt.
Die Psychologin auf dem Sessel gegenüber räusperte sich. Sie hätte eigentlich erst in eineinhalb Jahren wieder einen Termin frei gehabt. Doch sie war eine Bekannte der Freundin einer Arbeitskollegin von meiner Mutter. Oder eine Arbeitskollegin der Bekannten von einer Freundin oder was ganz anderes …
Auf jeden Fall hatte sie eine freie Stunde gefunden oder arbeitete länger für mich.
Kaum hatte die Psychologin die Tür zwischen meiner Mutter im Warteraum und uns beiden im Steinemuseum geschlossen, legte ich los. »Was soll ich hier? Das ist mein Körper, ich allein darf darüber bestimmen, und keiner hat das Recht, mich …«
»Moment bitte!«, sagte die Frau.
»Das ist hier total sinnlos. Ich will …«, machte ich weiter.
»Ich weiß, was du willst. Aber stopp jetzt!«
Ich stutzte.
Sie hatte mich zweimal unterbrochen.
Ich dachte immer, bei einer Psychologin kann man sich alles von der Seele reden. Das, was einem durch den Kopf geht, darf man rausbrüllen, ohne Punkt und Komma.
Klassischer Irrtum nach zu viel Netflixen.
Und vermutlich nicht einmal der einzige.
Nach zwei Schluck vom Kamillentee, von dem ich nichts wollte, machte die Psychologin endlich weiter. »Also, Alina, bevor wir miteinander reden, muss ich etwas klarstellen. Wir können eine Therapie machen, gern sogar. Die Uhrzeit passt?«
Ich schaute zur Tür, hinter der meine Mutter saß. Doch was sollte sie gegen diese Uhrzeit haben? Also nickte ich der Psychologin zu. Obwohl die Frage für mich gar nicht war, ob die Uhrzeit passte, sondern so eine Therapie generell.
»Gut, dann bleibt es bei 17 Uhr«, sagte die Psychologin und notierte etwas in ein Buch. »Also, folgender Punkt ist für mich ganz wichtig: Ich mache mit dir keine Sterbebegleitung. Verstanden?«
Keine Sterbebegleitung.
Ich starrte sie sprachlos an, und wer mich kennt, der weiß, das geschieht äußerst selten, denn eigentlich fällt mir immer was ein.
»Keine Sterbebegleitung!«, wiederholte sie. »Du hast zweimal versucht, dich zu töten. Richtig?«
»Ja.«
»Und warum zweimal?«
»Vielleicht war ich nicht gut genug darin? Nicht mal das kriege ich hin!«
»Vielleicht kriegst du es nicht hin, weil du es nicht möchtest.«
Dazu schwieg ich erst einmal eine Runde.
»Und da du eigentlich gar nicht sterben willst, versuchst du jetzt mal zu leben. Ist manchmal schwieriger und kann auch weh tun, ich weiß. Doch deswegen bist du hier.«
Über ihr hier musste ich komischerweise nachdenken. Meinte sie hier in ihrer Praxis für Psychotherapie oder hier insgesamt, also auf der Welt? Andererseits spielte es keine Rolle, ob das jetzt von ihr eher pragmatisch oder philosophisch gemeint war.
»Sind wir uns einig?«, fragte die Psychologin.
Irgendwie waren mir die Argumente ausgegangen und auch die Luft und die restliche Energie in meinem Körper sowieso. Ich sackte zusammen, als hätte mir jemand den Stecker gezogen. Überall sah ich schwarze Flecken im Raum, der sich plötzlich auch noch um mich drehte.
Ohne zu fragen legte ich mich auf das rote Sofa, das sicher nicht rein zufällig direkt neben meinem Sessel stand. Oder war es die Psychologin gewesen, die mich dorthin führte? Ich bekomme es nicht mehr zusammen.
Auf diesem Sofa liegend, sagte ich zu allem ja, ohne das Kleingedruckte zu hören, was eigentlich nie eine gute Idee ist.
Erst einmal sollte ich für einige Wochen in die Akutstation, die Psychiatrie. Erst dann könnte die wöchentliche Therapie zur vereinbarten Zeit beginnen.
Ich war laut der Psychologin in einem zu schlechten Zustand und immer noch gefährdet. Beide Punkte waren übrigens vollkommen zutreffend.
Die Psychologin konnte mich nicht bei sich einziehen lassen und mir von früh bis spät Kamillentee kochen und aufpassen.
Das leuchtete mir alles ein.
Daher lautete unsere Vereinbarung, die sie sogar schriftlich festhielt und die ich unterschreiben musste: erst die Psychiatrie, dann die Therapie, und diese Therapie ist keine Sterbebegleitung.
Außerdem musste ich ausdrücklich versichern, keinen Suizidversuch mehr zu unternehmen, was zugegeben etwas seltsam war, weil mir doch im Fall der Fälle jeder Vertrag egal sein würde.
So stehe ich nun in meiner dritten Woche vor dem Eingang der Psychiatrie.
Die Ausgangszeit endet in drei Minuten und dreißig Sekunden.
In diesem grauen Betonklotz bin ich also untergebracht.
Meine Mutter wischt sich die Augen mit ihrem Pullover trocken, ich versuche sie mit einem Lächeln aufzumuntern, obwohl ich es doch bin, die gleich wieder eingeschlossen ist.
Meine Mutter lebt in Freiheit weiter, darf entscheiden, was sie morgen zu Mittag essen möchte, wen sie nach der Arbeit sehen will und wann sie einschlafen mag.
Mich wird in drei Minuten und zehn Sekunden ein Plan für jeden Lebensbereich erwarten: Essensplan, Medikamentenplan, Aktivitätenplan, Einschlaf- und Aufwachplan.
Ich verstehe das Prinzip schon: Wer beschäftigt ist, kommt nicht auf dumme Gedanken, soweit die Theorie von Prof. Dr. Dr. Soundso, vermute ich.
Meine Mutter zieht ihr Handy aus dem Mantel. »Du musst rein Alinaschääätz… Alina. Ich rufe jetzt an, okay?«
Sie muss anrufen, damit mich jemand vom Personal abholt. Das ist Vorschrift für die schweren Fälle wie mich, damit ich nach der Verabschiedung nicht doch noch abhaue, obwohl ich keine Ahnung hätte, wohin überhaupt.
Ich nicke meiner Mutter zu und lächele, so haben wir das vereinbart.
An den ersten Ausgangstagen erdrückte sie mich fast, also jetzt nicht metaphorisch, sondern in echt. Meine Mutter konnte mich einfach nicht mehr loslassen, und am Ende heulten wir beide nur noch.
Diese peinliche Vorstellung wollten wir vermeiden und einigten uns auf ein wenig mehr Distanz und auf folgenden Ablauf: Den Abschiedskuss gibt es zu Hause, die Umarmung auf dem Parkplatz im Auto. Vor der Psychiatrie ist es nur noch ein nettes Zunicken und ein warmes Zulächeln. Fertig.
»Alina ist da«, spricht meine Mutter ins Handy.
Das wäre geschafft.
Jetzt steht mir nur noch der Abschied von Madonna bevor. Das mir der weitaus schwerer fällt, kann ich meiner Mutter ja nicht sagen. Meine Mutter und ich kennen uns seit fünfzehn Jahren, Madonna und ich erst seit drei.
Madonna schaut mich mit ihren riesigen braunen Kulleraugen an und schnurrt. Sie hat sich in meine Arme gekuschelt und holt sich an Nähe, was sie braucht, um sich wohlzufühlen.
»Bis bald«, sage ich und küsse sie auf die feuchte Nase.
Ich fand früher Menschen, die Tiere küssen, immer pervers, bis diese Katze vor meinem Zimmerfenster saß und ihr sepiafarbenes Köpfchen mit den schwarzen Flecken gegen die Scheibe drückte.
Das arme Ding miaute so penetrant lange, bis es rein durfte. Ich gab der Katze Wasser und Dosenthunfisch, und mehr brauchte sie nicht, um mich als ihre künftige Besitzerin auszuwählen. Ein Halsband trug sie nicht, und niemand in der Nachbarschaft hängte einen Zettel mit ihrem Foto auf.
Ich nahm die satte und friedliche Katze in den Arm und folgte den schrägen Tönen, die in unserem Wohnzimmer zu hören waren.
Meine Mutter hörte Madonna im Radio und sang furchtbar falsch »Time goes by so slowly«.
Ich beeilte mich, das Fenster zu schließen. »Mama, die armen Nachbarn!«
Meine Mutter entdeckte beim dritten »so slowly« die Katze und schaltete das Radio aus. »Oh nein, bitte nicht.«
»Immerhin ist es kein Hund«, sagte ich.
»Den hattest du vor zwei Wochen angeschleppt, richtig.«
»Der war nur ausgeliehen.«
»Das sah sein Herrchen anders.«
»Der Typ hatte die Leine an einem Fahrradständer befestigt! Der Tierquäler! Ich dachte, der hätte den armen Kleinen aufgegeben.«
»Wie sich herausstellte, war er aber nur im Supermarkt einkaufen.«
»Trotzdem Tierquäler.«
»Egal jetzt. Und was ist das?«, fragte meine Mutter, als hielte ich einen abgestürzten Außerirdischen im Arm.
»Darf ich vorstellen«, sagte ich, und die Katze miaute, was wie ein krasser Zufall klingt, doch genau bei dieser Katzenart, wie ich später auf einer Katzenseite las, total häufig vorkommt, also diese hochkommunikative Art. »Das ist Madonna. Unsere Katze.«
»Ach, Alinchen.«
Mehr sagte meine Mutter nicht, und somit war die Sache klar, und sie duldete unsere neue Mitbewohnerin. Schließlich sah sie mich glücklich, und das kommt seit Jahren nicht allzu oft vor.
Mit dem Katzennamen konnte sich meine Mutter schnell arrangieren. Mir fiel auf die Schnelle nichts Besseres ein, und ich bin einfach nur froh, dass nicht gerade Helene Fischer im Radio lief.
In die Psychiatrie darf Madonna natürlich nicht, und deswegen kraule ich ihr noch einmal die Ohren. Sie drückt ihren Kopf so kräftig sie kann gegen meine Finger, und dann übergebe ich sie meiner Mutter.
Auf der anderen Straßenseite sehe ich Justin, wie er eine Bierdose austrinkt und in den Mülleimer wirft. Er hat keinen Suizid versucht wie ich, sondern ließ sich vorher einweisen. Er wusste nicht, wohin mit sich, verletzte erst andere, dann sich selbst.
Justin ist allein, er braucht keinen Begleitschutz, und winkt mir mit beiden Armen zu, als hätten wir uns seit einer Woche nicht mehr gesehen. Dabei saßen wir uns beim Mittagessen noch gegenüber und rätselten, ob das in der Linsensuppe Würstchen oder die abgeschnittenen Finger des Kantinenpersonals waren.
Ich will ins Gebäude, bevor Justin uns erreicht, weil es mit ihm schnell peinlich wird. Doch die Tür geht noch nicht auf. Manchmal dauert es eben, weil die Leute da drinnen vierzig Sachen gleichzeitig machen müssen, mindestens eine von ihnen Corona hat, einer auf Fortbildung ist und die Dingsstelle immer noch unbesetzt ist, weil niemand den Job mit uns machen will.
Was ich im Übrigen sehr gut verstehen kann.
Justin wirft sich ein grünes Fisherman’s ein und zerkaut es sofort. Doch seine Alkoholfahne ist stärker. Das Bier eben war definitiv nicht das einzige, was er sich in der Ausgangszeit gegeben hat.
Justin streicht Madonna über die Pfoten, weil er einfach keine Ahnung von Katzen hat, und klatscht meine Hand ab. »Alina, schön, dass du noch lebst.«
»Das finde ich auch«, sagt meine Mutter.
Sie hat sich an unsere Suizidsprüche gewöhnt – im Vergleich zu den Suizidwitzen, die wir zum Leidwesen des Personals auf Station machen, ist das alles noch harmlos.
Reifen quietschen, und Katha springt aus einem roten E-Porsche.
Katha ist wie Justin in meiner Gruppe und heißt eigentlich Katharina. Da sie aber keinen Satz zu Ende bringt, schenkten wir uns irgendwann auch bei ihrem Namen das rina-Ende.
Katha fand es lustig, zumindest im bekifften Zustand, doch das ist ein Thema für später.
»Hast du mich vermisst?«, fragt Justin und blickt Katha mit einem Hundeblick an, vor dem Madonna fast Angst bekommt.
»Total, ich hab auch gedacht …«, fängt Katha an und hört wie immer wieder auf.
»Also, ich hab euch beide Bekloppten auch vermisst«, sagt Justin zu uns.
Keiner regt sich über seine Wortwahl auf, denn wir sind die Bekloppten, und das ist die Klapse.
Meine Mutter schweigt, sie hat sich auch an unser Vokabular gewöhnt, und Madonna ist es sowieso egal.
Katha klatscht Justin ab. »War jetzt nicht so nett von dir, aber …«
»Aber Rhabarber«, ergänzt Justin, denn Katha wird ihren Satz die nächsten vierzig Jahre nicht zu Ende bringen.
Endlich schiebt sich langsam und mechanisch die Klapsentür auf. Herr Doktor hat Dienst, dann kann der Restabend anstrengend werden.
Justin und Katha gehen rein, ich bin auch schon fast an der Tür, da höre ich die schnellen Schritte von dem, der noch fehlt in unserer Gruppe.
Ich dachte, er wäre schon längst vor uns zurück gewesen und würde im Aufenthaltsraum auf uns warten. Er kommt sonst nie zu spät, eher viel zu früh.
Pünktlich, würde er dazu sagen, wobei für mich Leute, die fünfzehn Minuten zu früh an einem Ort sind, auch unpünktlich sind.
Im Gegensatz zu Katha bringt er jeden Satz zu Ende, auch wenn es ein verschachtelter Gedanke mit fünf eingefügten Nebensätzen ist. Außerdem ist er ein wandelndes Lexikon, ein allwissender Dauerredner und der Einzige auf Station, der sich außer mir wirklich mit Katzen auskennt.
Und nun das alles Entscheidende, das ihn zum Einzigartigen aller Einzigartigen macht: Er raucht das beste Gras von uns allen.
»Spät dran«, sagt meine Mutter, die seiner Mutter vorsichtig die Hand reicht, damit Madonna nicht von der Bühne fällt.
»Ein Unfall, keine fünf Minuten von hier«, sagt seine Mutter. »Wir steckten im Stau.«
»Alinaschätz…, Alina«, fängt meine schon wieder an.
Seine Mutter umarmt meine und niest dreimal hintereinander, kein Corona, sondern Madonna ist schuld daran.
Sie nickt ihrem Sohn zum Abschied zu.
Der streichelt Madonna den Kopf und deutet eine Verbeugung an. »Hallo, Alina!«
»Hi, Jesus«, sage ich.
After seven days he was quite tired, so God said: »Let there be a day. Just for picnics with wine and bread.«
Crash Test Dummies, God Shuffled His Feet
JESUS (damals noch PAUL) Drei Jahre zuvor
Meine Mutter verschränkt die Arme ineinander und schüttelt den Kopf. In jedem Film würde der Regisseur an dieser Stelle verzweifelt Cut! schreien. Das sieht viel zu künstlich aus, zu gespielt, zu unecht. Noch einmal bitte, Achtung! Und Action!
Doch das sind keine Dreharbeiten für ein Drama, sondern das ist mein echtes und einziges Leben – wenn auch das gleiche Genre: ein Drama.
Und kaum habe ich den Gedanken zu Ende geführt, rollt meine Mutter auch noch mit den Augen. Arme, Kopf, Augen, alles ist in Bewegung, mehr Drama ist wirklich nicht möglich.
Meine Mutter spricht lauter als in den letzten dreißig Minuten. »Paul, bitte, wir sind im Urlaub. Können wir vielleicht über etwas anderes reden?«
Ich schiebe mir das letzte Stück Salamipizza in den Mund, schaue auf den Sandstrand voller Sonnenschirme und antworte kauend: »Können wir gern. Dann akzeptierst du hiermit meine Bitte, aus der Kirche austreten zu dürfen?«
»Nein!«, sagt meine Mutter in etwa dreihundertfünfzig Prozent der Lautstärke, die ich sonst von ihr kenne. Sie stellt in Zeitlupe ihr Saftglas auf den Tisch. »Das wirst du nicht!«
Die drei deutschen Rentnerinnen vom Nachbartisch schauen neugierig zu uns, mein Vater blickt von seinem Handy auf, während meine zwei kleinen Schwestern Sofie und Lena ihre Mutter überrascht anstarren. Sie ist selten so laut.
Nur der Kellner interessiert sich nicht für unsere Vorstellung. Wir sind auf Sizilien, und die Italiener hier sprechen fast die ganze Zeit so, wie wir uns streiten, nur streiten die sich nicht so richtig.
»Kirchenaustritt?«, fragt mein Vater. »Ging es bis eben nicht noch um deine Konfirmation?«
Ich trinke die Cola leer und nicke zustimmend. »Doch, doch, aber da wusste ich noch nicht, wie intensiv das Gespräch mit Mama wird. Wenn ich austrete, dann sparen wir uns die komplette Diskussion beim nächsten Mal, dann ist das hiermit und heute final entschieden.«
»Paul, was heißt final?«, fragt Sofie, und Lena zieht sie am Kleid weg vom Tisch zum Strand. Keine schlechte Idee, bei uns wird es gleich sicher noch lauter.
Das Telefon meines Vaters klingelt, er geht ran, nennt nur seinen Nachnamen, springt auf und entfernt sich ein paar Schritte.
Meine Mutter beugt sich zu mir und nimmt meine Hand. »Können wir bitte zu Hause weiter darüber sprechen und nicht hier?«
»Zu Hause ist es zu spät, da erwartet mich der Konfi-Unterricht, jede Woche, eineinhalb Stunden Propaganda für hirnlose …«
»Du warst doch schon sechs Mal da. Luca und Sarah aus deiner alten Grundschule, die sind doch auch in der Gruppe und …«
»Das war vor einem halben Jahrhundert! Triffst du dich etwa noch mit deinen alten Grundschulfreunden?«
Sie schaut mich vorwurfsvoll an. »Das würde ich genau jetzt liebend gern machen, viel lieber, als hier mit dir über …«
»… sehr witzig, Mama. Also, wie bei der Grundschule handelt es sich beim Konfi-Unterricht um eine zufällig zusammengewürfelte Schicksalsgemeinschaft mit einem entscheidenden Unterschied: Schule ist eine staatliche Zwangsmaßnahme, der Konfi-Unterricht nicht. Ich muss mich nicht konfirmieren lassen, und kein Gesetz der Welt verpflichtet euch dazu, mich dazu zu zwingen.«
»Und doch sind Luca und Sarah jede Woche dort und …«
»… zocken Fortnite unter dem Tisch beziehungsweise bekommen für jedes Konfi-Treffen zwanzig Euro von den Eltern.«
»Luca bekommt dafür Geld von seinen Eltern?«, fragt meine Mutter ziemlich schockiert.
»Nein, Sarah kassiert die Kohle, Luca ist der, der zockt.«
Meine Mutter blickt zu meinem Vater, der sich zum Telefonieren an einen leeren Nachbartisch gesetzt hat. Das kann also länger dauern, und sie muss das hier mit mir allein durchstehen. Herzlichen Glückwunsch!
»Würdest du auch für zwanzig Euro den Konfi-Unterricht besuchen?«
»Zwanzig Euro pro Termin, so wie bei Sarah?« Ich breite beide Arme aus und lächele meiner Mutter zu. »Natürlich!«
»Und du wirst dann kein Theater mehr veranstalten, es gibt keine Diskussionen? Du besuchst die restlichen Stunden und lässt dich konfirmieren?«
»Klar.«
Meine Mutter schaut ratlos auf den Tisch, sie sortiert ihre Gedanken, und es rattert, keine Frage. Sie ist gläubig, und für sie muss diese Vorstellung furchtbar sein: Der eigene Sohn glaubt nur gegen Bezahlung an Gott.
Andererseits ist es auch kein großes Geheimnis, dass fast alle die Konfirmation nur deswegen machen, weil es da sogar noch mehr Geschenke gibt als zum Geburtstag. Die Konfi steht quasi zwischen Geburtstagsparty und dem Weihnachtsexzess.
Meine Mutter nippt an ihrem Saft, schaut noch einmal zu meinem Vater, der inzwischen sein Tablet ausgepackt hat, um das Gespräch mit dem Anrufer in tiefere Sphären zu lotsen.
»Das kann ich nicht machen«, sagt meine Mutter. »Dafür bekommst du kein Geld. Ich weiß nicht, was sich Sarahs Eltern dabei denken, aber das geht für mich überhaupt nicht in Ordnung.«
»War auch nur ein Witz.«
»Sarah bekommt kein Geld?«
»Natürlich nicht. Ich wollte nur sehen, wie weit dich das System Kirche schon korrumpiert hat.«
Meine Mutter schaut zu Lena und Sofie, die eine an Land gespülte Qualle inspizieren.
»Nicht anfassen!«, ruft meine Mutter und spricht dann ziemlich leise mit mir weiter. »Können wir zwei vielleicht eine Pause machen mit dem Thema?«
»Klar«, sage ich und greife in meine Umhängetasche.
Kurz scheint meine Mutter zu hoffen, dass ich wirklich meine Nintendo Switch heraushole und ich sie für ein paar Stunden ihren Sizilientraum leben lasse. Doch nie war ich meinem Ziel näher als heute. Also hole ich das dicke Buch heraus und knalle es auf den Tisch.
Die Rentnerinnen sind schon fort, und der Kellner rollt ein Verlängerungskabel für meinen Vater auf, der offenbar sofort einen Akku-Notstand überbrücken muss, weil sonst der deutsche Aktienindex unmittelbar in ein historisches Jahrestief rauschen würde.
So ein Glück, das mit dem Kellner und dem Strom, jetzt hätte mein Vater fast noch Urlaub mit seinen Kindern machen müssen.
Meine Mutter betrachtet ungläubig (ja, mir ist der Wortwitz durchaus bewusst an der Stelle) mein Buch mit den 1536 Seiten. »Die Bibel? Du hast eine Bibel eingepackt?«
»Nicht irgendeine, sondern die einzig wahre Lutherbibel, vollständig revidiert und so nah an Luthers kraftvoller Sprache wie nie zuvor. Wissenschaftlich überprüft, natürlich.«
So oder so ähnlich stand es in dem Werbetext bei Amazon.
»Und wieso hast du die dabei, wenn du eigentlich austreten willst?«
Meine Mutter will die Bibel zu sich ziehen, doch ich bin schneller und klappe sie auf. »Weil ich mit dir über ein paar Textstellen reden muss, Mama.«
»Muss das jetzt …«
»Ja.«
»Solche Textstellen kannst du nicht einfach so aus dem Zusammenhang reißen. Genau das lernst du auch beim Konfi-Unterricht und …«
»Drittes Buch Moses, Kapitel 20, da geht es ganz schön zur Sache. Morde am laufenden Band, hier, da sollen Wahrsager getötet werden, Ehebrecher …
»… das war eine andere Zeit, das kann man heute nicht so …«
»Und diese fiesen Steinigungen immer!«
»Paul, bitte …«
»… und schau mal hier, Vers 13: Wenn jemand bei einem Manne schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Gräuel ist, und sollen des Todes sterben; ihre Blutschuld komme über sie.«
Ich versuche so entsetzt wie möglich meine Mutter anzusehen, so, als hätte sie mir persönlich einen Korb mit Steinen überreicht. »Und daran glaubst du?«
»In der evangelischen Kirche werden Homosexuelle getraut, schon mal davon gehört?« Sie zeigt mit einem Finger zum Strand. »Willst du vielleicht baden?«
Sofie und Lena buddeln mit ihren gelben Plastikschaufeln ein Grab für die tote Qualle.
»Nicht anfassen«, ruft ihnen meine Mutter schon wieder zu.
»Ist nur eine Lungenqualle«, sage ich.
»Wie schön. Und willst du jetzt ins Wasser?«
»Nein, danke«, sage ich. »Ich werde später über das Meer gehen, dabei wird man nicht so nass.«
»Können wir bitte einmal über Religion sprechen, ohne dass du dich lustig darüber machst?«
»Ich zitiere Primärquellen, mehr mache ich doch gar nicht.«
»Du willst das jetzt echt den ganzen Urlaub durchziehen?«
»Was?«
»Diese Gespräche.«
Statt einer Antwort suche ich ein griffiges Bibelzitat, und das dauert nicht lange. »Hier, auch recht kraftvoll in der Sprache, da soll für den lieben Herrn ein ganzer Volksstamm abgeschlachtet werden, erstes Buch Samuel, Kapitel 15, Vers 1 bis 11, oder warte, machen wir mal zur Zusammenfassung nur Vers 3. Wir wollen ja noch Urlaub machen, während in anderen Ländern Menschen im Namen Gottes massakriert werden, also, warte hier, noch einmal ein Auszug aus der Primärquelle: … töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.«
»Ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer nur aus dem Alten Testament zitierst?«, fragt meine Mutter.
»Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Reihenfolge in diesem Vers ziemlich interessant ist? Auf Platz eins kommt der Mann, natürlich, wer sonst, den hat Gott ja auch zuerst erschaffen. Auf Platz acht tauchen erst die störrischen Esel auf. Säuglinge haben es auf den vierten Platz geschafft, gerade noch so vor den Rindviechern.«
»Will jemand Nachspeise?«, ruft mein Vater, das Handy klemmt noch zwischen Kopf und Schulter, der Kellner hat eine Karte mit Desserts vor ihm aufgebaut.
Sofie und Lena hören ihn nicht und bohren ein selbst gebasteltes Kreuz aus alten Eisstielen in das Quallengrab.
»Wir haben noch Eis im Kühlschrank«, sagt meine Mutter und schaut wieder zu mir. »Diese Bibelstellen, die musst du im Kontext sehen, das liest sich heute alles anders, es sind ja auch oft Gleichnisse und …«
»Also, wenn das totaler Quatsch ist, der da im Alten Testament steht, wieso ist dann das Alte Testament noch in dieser frisch gedruckten Bibel hier abgedruckt, die ich für den Konfi-Unterricht lesen soll?«
»Für euch auch Tiramisu?«, ruft uns mein Vater zu.
»Nein«, sagt meine Mutter. »Wir haben noch Eis im …«
»Doch, doch, zweimal, ich übernehme deine Portion, Mama.«
»Was denn nun?«, will mein Vater wissen.
»Bestell jetzt einfach!«, sagt meine Mutter.
»Ja, ja, entspannend, so ein Urlaub«, flüstert mein Vater. Aber er ist nicht leise genug, und meine Mutter dreht sich zu ihm. »Wieso nennst du das Urlaub, wenn du dauernd arbeitest?«
»Wo waren wir?«, frage ich.
»Beim Alten Testament«, sagt sie wieder zu mir.
»Genau. Da hätten wir doch für den Konfi-Unterricht gleich nur das Neue Testament bestellen können, das spart auch Papier und ist besser für das Klima. Aber nein, es musste schon das ganze Propaganda-Paket sein.«
»Hörst du bitte auf, ständig von Propaganda zu sprechen.«