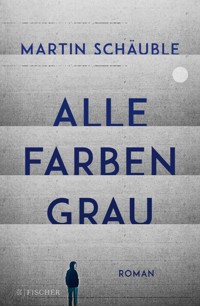Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Martin Schäuble hat Israel und Palästina zu Fuß von den Golanhöhen bis ans Rote Meer durchquert. In seinem großen, lebendigen Reisebericht erzählt er, wie sich die Menschen dort ihr Leben unter ständiger Bedrohung im Nahost-Konflikt eingerichtet haben. Er sprach mit orthodoxen Juden und verzweifelten Palästinensern, beobachtete die Protestbewegung in Tel Aviv und wanderte eine Etappe mit David Grossman. Unter großen Schwierigkeiten gelang ihm ein Abstecher in den Gaza-Streifen. Schäuble bringt uns nicht nur den Alltag der Israelis und Palästinenser näher, er hilft auch zu verstehen, wie hier auf engstem Raum unterschiedliche Lebensweisen, Interessen und Ansprüche aufeinandertreffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Martin Schäuble
ZWISCHEN DEN GRENZEN
Zu Fuß durch Israel
und Palästina
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24275-3
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2013
© Karten: Peter Palm, Berlin
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhalt
Der junge Mitarbeiter
Die durchwachte Nacht – Tel Aviv
Vermessung der Stadt
Auf der Suche nach Heiligen – erster Versuch
Auf der Suche nach Heiligen – zweiter Versuch
Auf der Suche nach Heiligen – dritter und letzter Versuch
Siedlertourismus in Hebron
Die Wüstenstadt
Am Rande des Kraters
Der Höllentrip zum Toten Meer
Deutschstunde
Der Friseur & der Händler – Besuch in der ältesten Stadt
Auf dem Weg nach Ramallah
Bei James Bond
Der Rüssel am Checkpoint
Von Kühen und Kiffern
Im Märchenwald
Die Suche nach Wildblumen
Tage und Nächte in Gaza
Dankeschön
DER JUNGE MITARBEITER der Flughafen-Sicherheit in Tel Aviv trug einen dunkelgrauen Anzug. Er blätterte durch meinen Reisepass und entdeckte den schwarzen Einreisevermerk. Eine israelische Grenzpolizistin hatte ihn mir am Gazastreifen in den Reisepass gestempelt. Der Anzugträger von der Flughafen-Sicherheit schaute mich an.
»Was haben Sie in Gaza gemacht?«
»Ich war zu Fuß unterwegs in Israel und Palästina. Darüber schreibe ich ein Buch.«
»Zu Fuß in Gaza?«
Der Anzugträger war skeptisch. Ich konnte ihn verstehen.
»Das macht keiner. Wieso schreiben Sie ein Buch darüber?«
»Weil es so selten ist.«
Der skeptische Blick wurde noch skeptischer. Der Anzugträger ging zu anderen Anzugträgern, besprach sich, ein anderer von ihnen trat an mich heran.
»Wo waren Sie auf der arabischen Seite?«
»Das ist eine lange Liste.«
»Nennen Sie einfach die Hauptorte.«
Ich drehte den Roman um, in dem ich in der Warteschlange gelesen hatte, zeigte dem Befrager die blaue Rückseite und malte eine Landkarte mit meinem Finger. Ich wollte auch die israelischen Städte aufzählen, so konnte ich mich besser an die Namen erinnern, an die Route, auf der ich die letzten Wochen unterwegs war. Der Mann hatte nichts dagegen.
Ich fing an zu malen und nannte einige der Orte: »Tel Aviv, Jerusalem, Bethlehem, Hebron, Beerscheba, Mitzpe Ramon, Eilat, Ein Gedi, Jericho, Ramallah, Nablus, Dschenin, Nazareth, Kiryat Schmona, Haifa und wieder zurück nach Tel Aviv. Das war die erste Reise. Dann flog ich noch einmal hierher, um in den Gazastreifen zu kommen. Das klappte beim ersten Mal nicht. Im Gazastreifen war ich in Gaza-Stadt, Khan Yunis und Rafah.«
Der Anzugträger lächelte. Das irritierte mich. Er wünschte mir einen guten Flug. Stellte keine einzige Frage mehr. Wollte nicht wissen, wen ich getroffen hatte, wer mit mir sprach und worüber. Noch nie war ich bei der Sicherheitsbefragung am israelischen Flughafen so schnell fertig. Ich verstand es nicht. Was war geschehen? Folgte die große Befragung erst noch? Ein anderer Mitarbeiter vielleicht, ein paar Meter später, bei der Kontrolle des Gepäcks? Auch das hatte ich schon erlebt. Aber nichts geschah.
Erst auf dem Weg zum Terminal, vorbei an einem Laden voller Bücher und Zeitungen, verstand ich es, wurde mir alles klar. Und ich lächelte, so wie er, der Befrager, der Anzugträger, es getan hatte. Es gab nur eine Erklärung. Er hielt mich für verrückt.
DIE DURCHWACHTE NACHT – TEL AVIV
Die Unterkunft war billig, auch Bruce, der Billiglöhner, schlief dort. Bruce war ein Jude aus Boston, der einige Wochen des Jahres in Israel arbeitete. Zwei Jobs machte er hier gleichzeitig. Fensterputzer und Krankenpfleger. Bruce ist das gewöhnt. In Boston arbeitet er als Taxifahrer und Kellner in einem Restaurant, für das man »einen dicken Geldbeutel braucht«. Er rutschte sitzend beim Erzählen auf seinem Bett vor und zurück, als würde einer seiner Arbeitgeber mit der Stoppuhr die Zeit messen, in der er nicht schuftete, sondern nur dasaß.
Bruce hatte in einem der beiden Doppelstockbetten, die das ansonsten karge Zimmer ausfüllten, die untere Matratze belegt. Ich bezog ein löchriges Stück Schaumgummi auf dem oberen Bett gegenüber. Die durchgeschlafene Matratze wie das ganze Zimmer mussten Generationen von Reisenden und Gastarbeitern und reisenden Gastarbeitern beherbergt haben. Ich war zu erschöpft zum Aufräumen, Putzen, Sortieren, und wenn man in so einem Zimmer damit anfängt, ist die Nacht schnell vorbei.
Bruce rutschte weiter, sprang auf, hielt sich am Gestell des oberen Bettes fest und redete weiter. Von der Idee, bald Hebräisch für Anfänger zu unterrichten – sein dritter Job. Von seinen Fortschritten, weil er fleißig und autodidaktisch lerne. Von einem Buch, das jeder unbedingt zum Hebräischlernen haben sollte.
Er suchte in einer bunten Plastiktüte, die groß genug war, um sich hineinzusetzen. In einer schwarzen Reisetasche. In einem großen Rucksack. In einem kleinen Rucksack. Er fand das Buch nicht. Ich wollte schlafen, war erschöpft von der Reise zum Flughafen, vom Flug, von den Gesprächen der ersten Stunde, den Beobachtungen, den Notizen, von allem. Ich bot Bruce an, die Suche auf morgen zu verschieben. Bei einer Tasse Kaffee, auf die ich ihn einladen wollte. Denn er war, so wie er war, ein feiner Kerl.
Die roten Ohren mit dem grauen Flaum. Die etwas gelbliche Haut im Gesicht, was auch an den zwei Neonröhren an der Decke liegen konnte, die die Farben im Raum verfälschten. Die rauhen, kräftigen, braungebrannten Hände. Seine Art, mir ohne Punkt und Komma sein Herz auszuschütten. Er arbeitete und lebte in Israel, um zu sehen, ob er umziehen könnte. Für immer von Boston nach Tel Aviv. Über seine gescheiterte Ehe, seine erwachsenen Kinder sprach er nur kurz und nur, weil ich ihn danach fragte.
Unsere Zimmertür konnte nicht abgeschlossen werden. Das hielten die Besitzer der Unterkunft offenbar nicht für notwendig. In der ersten Etage tobten Brasilianer, durchtrainierte Jungs mit langen schwarzen Haaren auf Club-Tour in Tel Aviv. Benigno saß dort irgendwo, der Mexikaner, mit dem Becher Wasser in der Hand. Er sah einer Daily Soap auf Spanisch zu, als wir uns kurz unterhalten hatten. Sicher schlief auch Han Gyul in der ersten: der Südkoreaner, der im Kibbuz arbeiten wollte, die Zusage einer Vermittlungsorganisation hatte, noch auf die Zuweisung wartete.
Als ich Han Gyul vor ein paar Stunden kennengelernt hatte, stützte er sich mit den Ellenbogen auf einen Tresen neben der Gemeinschaftsküche ab. Er blätterte auf seinem iPad durch Facebook-Seiten, während er mir seine Geschichte erzählte. Er betonte, was ihm wichtig war. Er komme aus Korea, aus Südkorea. Als ob sie in Nordkorea iPads hätten. Er verstand meinen Witz nicht, der wohl einfach nicht witzig war.
Die Brasilianer, der Mexikaner und der Südkoreaner hatten etwas gemeinsam. Alle schliefen in der ersten Etage. In die zweite steckten sie Bruce und mich. In ein Vierbettzimmer gegenüber des Frauen-Schlafsaals. Ich malte mir das Schild an unserer Tür aus und wusste, was der Mann an der Rezeption dachte, als er uns dieses Zimmer zuwies: »Die zahnlosen Tiger«.
Unsere wilden Jahre waren vorbei oder hatten nie begonnen. Und als ein weiterer Mann den Raum betrat, sah ich meinen Verdacht bestätigt. Ein Jude aus der Schweiz, Anfang zwanzig, schmal, bubenhaft, Brille. Sein Hebräischkurs fing bald an. Sein Appartement in Tel Aviv war aber noch nicht frei, so schlief er bei Bruce und mir.
Wir sprachen so lange, wie man benötigt, um festzustellen, dass man sich versteht. Ich suchte einen friedlichen Schlaf, in der Gewissheit, nette Menschen um mich zu haben. Bruce verabschiedete sich für ein paar Stunden Spätschicht. Der Schweizer verließ den Raum zum nächtlichen Einkauf von Lebensmitteln. Meine erste Nacht brach an, vor dem langen Fußmarsch durch Israel und Palästina.
Ein tiefes Grollen durchzog die Dunkelheit. Eine Nachtbaustelle. Vielleicht. Ein Gewitter. Ich dachte an mein letztes Gewitter in Israel, an das ich mich erinnerte, weil ich es nie vergessen werde. Und seitdem ich nachmittags in Israel gelandet war, kamen sowieso alle Bilder wieder. Jeder Ort, jedes Geräusch war verbunden mit einem Erlebnis, einer Person, einer Geschichte. Alles erinnerte mich an meine Zeit in Israel und Palästina. Und das Grollen, das Gewitter, an den Juli 2006.
Israel und die Hisbollah kämpften gegeneinander. Der Kampf trug später mindestens zwei Namen: Israelis nannten ihn den »Zweiten Libanonkrieg«, die arabische Seite sprach vom »33-Tage-Krieg«. Ich hatte keinen Namen dafür, lag im Bett, in einem gemieteten Zimmer in einer Stadt im Norden Israels, Haifa. Täglich heulten mehrmals die Sirenen. Das Heulen bedeutete Rennen.
Etwa eine Minute blieb bis zum Einschlag der georteten Katjuscha-Raketen. Eine Minute, um aus der Wohnung, zwei Etagen durch das Treppenhaus und in den Bunker neben dem Hauseingang zu eilen. Dort traf ich wochenlang den Rest des Hauses: einen israelischen Musiker, der mit einer deutschen Krankenschwester verheiratet war, deren Kinder im Schulbunker saßen oder bei uns; ein junges Paar, über das ich nicht viel wusste, außer dass er beim Militär arbeitete; ein älteres Paar, der Mann schwerkrank, seine Frau sprach mit mir immer ein paar Worte auf Deutsch. Und meine Vermieterin, eine ältere Dame mit drei Töchtern, vielen Enkeln und einem großen Herzen.
Wir saßen im Bunker auf Matratzen und zählten die Einschläge der Katjuschas aus dem Libanon, hörten Radio und warteten auf die Entwarnung. Am 19. Juli 2006 heulten die Sirenen kurz vor acht Uhr morgens. Ich zog mir eine Jeans an und rannte in den Bunker. Die deutsche Krankenschwester trug einen Bademantel und hatte nasse Haare. Wir warteten und wir zählten. Von der Bunkermatratze schleppte ich mich zurück auf meine eigene, schlief sofort wieder ein, überhörte den Wecker.
Ein kräftiges Gewitter riss mich gegen zehn Uhr aus dem Schlaf. Ich drückte mich in die Bettdecke, glücklich, nicht im Regen zu stehen. Aber es regnete nicht. Und das Gewitter, das kein Gewitter war, war vorüber. Die Katjuscha-Raketen landeten ohne Vorwarnung in Haifa, brachten angeblich etwas in Hafennähe zur Explosion. Auch das gab es, lernte ich an diesem Tag. Katjuschas ohne Warnung.
Die erste schlaflose Stunde auf meiner Tel Aviver Matratze war vorbei. Von den Katjuschas in Haifa döste ich nach Jerusalem, meinem nächsten Reiseziel. Die Reise in den Gazastreifen musste in der Stadt beantragt werden, beim Pressebüro der israelischen Regierung. Und so drehte ich mich von Jerusalem nach Gaza. Sah den Jungen, keine fünfzehn Jahre alt, wie er damals, bei meinem ersten Besuch, auf mich zukam. »Welcome to Gaza«, sagte er mit dem bitteren Unterton eines über Jahrzehnte frustrierten Erwachsenen.
Keine zwei Meter vor mir öffnete er seine Weste mit beiden Händen, und ich sah seinen Brustgürtel aus einem Dutzend Handgranaten, quer über dem Oberkörper verbunden. Ich überlegte nicht, sondern sprach mit ihm, sagte »Marhaba«, Hallo, fragte »Schu Achbarak?«, was gibt’s Neues? Ich reichte ihm reflexartig die Hand. Mir fiel in dieser Nacht in Tel Aviv nicht mehr ein, ob er sie ergriff oder nicht.
Eineinhalb Stunden vergingen, dann ließen mich die Katjuscha-Raketen und der Gaza-Junge schlafen. Kurz. Viel zu kurz. Bruce trat ins Zimmer, schaltete das Licht an und hantierte mit der großen Tüte, dem Koffer, dem kleinen und großen Rucksack so, als ob er die Unterlagen für seine Steuererklärung zusammensuchen würde. Ich schwieg, stellte mich schlafend. Einige Minuten hörte ich Rascheln und Reißverschlüsse. Dann absolute Ruhe.
Ich öffnete langsam mein linkes Auge und sah einen strahlenden Bruce vor mir im Neonlicht. Er reichte mir das Buch, das er am Abend gesucht und nun gefunden hatte. Es war gegen Mitternacht. Gewissenhaft bedankte ich mich, richtete mich auf und notierte in mein Notizbuch den Titel »Multi-Dictionary«, den Untertitel »Bilingual Learners Dictionary« und die Autorinnen »Edna Lauden und Liora Weinbach«. Ich überflog die Inhaltsangabe, eine Tabelle mit Verben, und reichte Bruce das Buch.
Er verließ wieder das Zimmer, ließ das Licht an. Ich machte die Augen zu, der Schweizer kam irgendwann und schaltete das Licht aus. Sein Oberkörper warf einen Schatten an die Wand. Die Lichter aus den Wohnungen des Nachbarhauses strahlten in unser Zimmer. Aufrecht saß er auf seinem Bett, wippte leicht nach vorne, bewegte geschmeidig und lange einstudiert seine Arme. Er betete. Danach schlief er sofort ein.
Bruce eilte ins Zimmer. Legte sich hin und begann zwei Minuten später ein ganzes Feld von Olivenbäumen zu zersägen. Sachte. Nicht so aufgeregt, wie er noch vor kurzer Zeit war. Eine Handsäge, mit der er jede Faser des Stammes spüren wollte. Ich wollte Schafe zählen, was ich noch nie getan hatte, aber meine Phantasie weigerte sich, hatte andere Pläne mit mir. Sie nutzte meine Müdigkeit aus und machte alberne Sachen.
Ich sah keinen Zaun, sondern einen Schützengraben vor mir. Soldaten sprangen nicht hinüber, sondern hinein. Es waren die jungen Leute, die mir auf dem Weg vom Flughafen hierher begegnet waren, die Jungs mit den olivgrünen Uniformen, mit den M16-Gewehren, die sie immer trugen. Drei junge Frauen mit den blauen Uniformen der Grenzpolizei. Der Kampfpilot versuchte in den Schützengraben zu springen. Ich hatte ihn am Eingang einer Shopping Mall auf dem Weg zur Unterkunft gesehen. Er war aus Bronze und nichtrostendem Stahl. Sein Helm mit Atemmaske lag neben ihm. Er stand gebückt und trank aus einem Wasserhahn, der ihm bis zum Bauchnabel reichte. Neben ihm saß eine lebende Katze, als würde das Tier den Geist des vielleicht verschollenen Piloten aus Bronze und Stahl bewachen.
Der Soldat aus dem klobigen Metall war den zierlichen Soldaten im schmalen Schützengraben zuviel. Sie sprangen alle wieder raus. »Zurück!« »Das ist ein Befehl!« Sie hörten nicht auf mich. Alle waren weg. Geflüchtet. Ein tiefes Brummen ertönte. Ein Panzer? Ich sah nichts. Ich hörte es. Es war Bruce. Er wechselte von der Handsäge zur Motorsäge. Ich konzentrierte mich auf deren Rhythmus und schlief ein. Mein Kugelschreiber samt Block fiel zu Boden. Ich schreckte auf, zog mich an, trabte in die leere Gemeinschaftsküche.
Die Nachtschicht an der Rezeption, die tagsüber Informatik studierte, reichte mir eine Packung Toastbrot und eine Plastikschale mit Butter. Am Eingang der Unterkunft schaute ich auf eine Nahost-Karte, die an die Wand gemalt war. Von Israel war dort zu lesen. Von Ägypten. Von Syrien. Vom Libanon. Nicht aber von Palästina. Israel füllte auf der Karte die ganze Landschaft, die sich beide Völker teilen. Kurz darauf stand ich unter Pfannen und Töpfen, die an handgroßen Metallhaken über mir hingen, legte die weißen Scheiben auf ein verrostetes Laufband, das sie langsam über glühende Heizstäbe zog, ließ Butter darauf schmelzen.
Ein junger Mann lief mit einem Wälzer unter dem Arm an mir und meinem Toastbrot vorbei. Auf dem Buchrücken las ich »The Power Broker«. Ich folgte ihm, wir tauschten uns kurz aus. Er kam aus Florida, studiert bald an einer israelischen Universität in Tel Aviv Politikwissenschaft. Die 1344 Seiten aus den 1970ern handelten von New Yorks Bürgermeister Robert Moses. Von New York kam der Leser aus Florida auf Tel Aviv, von Tel Aviv auf Israel, von Israel auf den Nahen Osten. »It’s all about power«, sagte er wie ein alter Professor. Und er blätterte weiter.
Am nächsten Morgen saß der Schweizer mit seinen Nachteinkäufen in der Gemeinschaftsküche. Er tunkte ein dunkelbraunes Brötchen in die Humus-Packung. Ich hatte drei Stunden geschlafen, er zehn. Ich sah noch seinen Schatten vor mir, nachts, an der Wand gegenüber. Ich störte ihn beim Frühstück.
»Darf ich was Persönliches fragen?«
»Natürlich.«
»Ich sah dich gestern Nacht beten. Und wollte fragen …«
Er schaute mich so erstaunt an, dass ich die Frage nicht fortsetzte. Er wisse gar nicht im Detail, wie man das Abendgebet spricht. Ein Stückchen Teig verschwand in der cremigen Masse aus Kichererbsenmus. »Ich bin nicht religiös. Ich habe mir vielleicht nur Schlafsachen angezogen. Keine Ahnung.«
Die Phantasie hatte die Oberhand in dieser schlaflosen Nacht. Sie hatte es leicht. Lange Aufenthalte, Gespräche und Reisen in Israel und Palästina hatten sie mit Bildern, Tönen, Szenen gefüttert. Doch ich war angekommen und ich musste die Oberhand zurückgewinnen für die kommenden Wochen, nicht sie, das könnte gefährlich werden. Vielleicht macht diese Reise alles besser. Vielleicht ließe sich so ordnen, was sich nicht einordnen lassen wollte. Bisher. In Berlin. Auf anderen Reisen. Ich wusste es nicht. Ein Versuch war es wert.
VERMESSUNG DER STADT
Ich schlenderte über den Schuk Ha’Carmel, den zentralen Markt Tel Avivs. Nicht an den Ständen entlang, in der Mitte, im Gedränge, sondern hinter den Ständen. Zwischen ihnen und der Häusermauer erstreckt sich ein schmaler Korridor. Die Händler standen dort, an den Eingängen zu ihren Geschäften, die sich hinter den Ständen verbargen. In den Markt trieb mich mein Hunger. Von einem russischen Lokal hörte ich, aber ich fand es nicht in dem Labyrinth. Statt dessen aß ich in einem Imbiss, am großen Fenster sitzend, mit Hackfleisch gefüllte Paprika. Überlegte, wie die Reise beginnen sollte. Ich versuchte Fuß zu fassen. Die Stadt zu vermessen. Ein Bild zu gewinnen. Wie? Bei so einer Stadt in zwei, drei Tagen?
Rund 400 000 Einwohner, nicht viel für eine Großstadt. Aber bei einem so kleinen Land doch eine Menge. Ein paar hundert davon drängten sich durch den Markt, mit vollen gelben und orangenfarbigen Plastiktüten. Drei kichernde Mädchen mit übergroßen, blumigen Handtaschen. Die alte Frau im weißen Mantel, die kräftig an ihrer Zigarette zog. Der dünne Blumenverkäufer, der zwischen den schmalen Gummipflanzen kaum auffiel, schwarze Locken bis zu den Schultern, Vollbart, mit gespitzten Lippen band er einen Strauß Rosen. Die junge, rothaarige Kundin belohnte ihn mit einem geduldigen Lächeln.
Ich ging auf und ab, setzte mich in Cafés, bestellte Espresso und ich kam an, ganz langsam. Ich fand ein russisches Restaurant. An den umliegenden Tischen sprach man Russisch, so wie der Kellner. Auf dem Weg zum Ausgang hob ein Herr Mitte fünfzig die Hand und rief mir auf Russisch etwas zu, die leere Rotweinflasche und zwei Wodka-Gläser zwischen ihm und seiner Begleiterin. Die Rechnung wollte er bei mir begleichen, wie sich später herausstellte. Ich verstand das nicht auf Anhieb und ging leer aus.
Und irgendwann war die Idee da, wie ich die Stadt vermessen konnte und wollte. Ein Plan. Ich fange unten an, ganz unten, bei den Ärmsten, und bewege mich nach oben, zu den Reichen, will sehen, wie weit ich komme in der Zeit, die mir bleibt für diese Stadt. In einigen der Galerien und Museen war ich schon auf früheren Reisen gewesen, die dumpfe Leere von Geschäften schreckte mich ab, in Tel Aviv wie überall. So war es die Vermessung von arm bis reich, die mir blieb.
Ich fragte mich in den Cafés durch und ein Name viel immer wieder: Levinsky-Park. Ich schaute auf die Karte, der Park lag nahe der zentralen Bushaltestelle im Viertel der Gastarbeiter, Neve Sha’anan. Vom Strand führt eine Verlängerung der langen Allenby-Straße fast bis dorthin. Der Weg von den Cocktail-Bars am Sandstrand zu den Ärmsten sah kurz aus, vielleicht eine halbe Stunde zu Fuß, nicht mehr und das war gut, es war schon 22 Uhr vorüber.
An der Allenby-Straße entlang schaute ich durch die Fenster der Cafés, Bars, Mini-Supermärkte und Fast-Food-Läden. Im Pizza-Imbiss lief ein Action-Film. Pizzabäcker und ein essender Gast schauten gebannt zu. In der Bar daneben eine junge Moderatorin auf fünf Flachbildschirmen, die gespielte Ernsthaftigkeit ließ auf Nachrichten schließen. Hinter dem Tresen des Sandwich-Standes lief Fußball, im nächsten Pizza-Laden auch. Auf dem Weg zum Levinsky-Park sah ich mehr Menschen im Fernsehen als in den Bars und Geschäften.
In einem kleinen 24-Stunden-Laden kaufte ich Batterien für mein Aufnahmegerät. Der Kassierer saß hinter einem aufgehäuften Sortiment Schokoriegel, tippte etwas in seinen Laptop. Drei Kühlschränke mit Bier, Sekt und Softdrinks standen in einer Ecke. Die Kundin neben mir, vielleicht Mitte zwanzig, ließ sich von ihm Wodka in einen Plastikbecher füllen. Neben seiner Kasse lagerte ein Flaschenarsenal an offenen Spirituosen. Sie holte sich einen Energydrink aus dem Kühlschrank, schüttete die Dose in den Wodka und zog an einem Röhrchen. Sie musste bemerkt haben, wie ich sie beobachtete. Ich drückte die Batterien in den Apparat. Sie passten.
»Woher kommst du?«, fragte sie mich und machte mir klar, ich war in ihren Augen kein Israeli, wie ich mit meinem Aufnahmegerät kurz nach 22 Uhr sie, die Plastikbecher-Minibar und den Laptop-Kassierer anstarrte. »Aus Deutschland.« »Toll! Ich liebe Berlin.« Der Kassierer hörte auf zu tippen und schaute sich einen Film an. Die Wodka-Trinkerin fragte weiter, und als sie von meiner Wanderung zum Levinsky-Park hörte, wollte sie mitkommen. Ich hatte nichts gegen Gesellschaft auf meiner Reise, aber sie war in Partylaune, und das passte nicht zum Park und nicht zu mir.
Sie wollte reden, eigentlich mit ihrer Freundin, die versetzte sie vor einer halben Stunde, und so blieb ich. Wir setzten uns auf eine Bank an der Allenby-Straße. Sie hieß Adi und sie erzählte von ihrem Leben. Sie hatte ihr Video-Design-Studium abgebrochen, jobbte für die Homepage eines Kinderkanals, las die von Kindern verfassten Beiträge im Forum, löschte die Links, die auf Seiten führten, die nicht für Kinder gedacht sind. Und die Beiträge der Erwachsenen, die sich als Kinder ausgaben, um Kontakte zu knüpfen.
Dafür bekam sie umgerechnet vier Euro und 40 Cent die Stunde. Eine Wohnung konnte sie sich damit nicht leisten, wohnte bei den Eltern, und die wohnten nicht in Tel Aviv. Und ihr Ziel war es, in Tel Aviv zu leben. »Tel Aviv ist Israel.« Sie zog am Röhrchen. »Ohne Tel Aviv würde ich Selbstmord machen.« Und nach Berlin möchte sie wieder.
Ihr Großvater war ein Holocaust-Überlebender aus Polen, kam 1947 nach Israel, das damals noch Palästina hieß. Sie sagte das mit dem Großvater beiläufig. Ein Bettler trat an uns heran, blieb vor uns stehen, er trug eine weiße, aufgeplusterte Polyesterjacke. Er zeigte auf das aufgeschnittene Brötchen mit Sesam in seiner Hand. »Habt ihr ein, zwei Schekel, damit ich mir ein Schnitzel reinmachen kann?« Er war noch nicht weit von uns weg, da lachte Adi über ihn und seine Frage. Ich wollte weg von ihr, ihm folgen, er lief in die Richtung, in die ich heute Nacht wollte, zum Levinsky-Park. Ich wollte unten anfangen, und der Weg dorthin hatte schon begonnen.
Adi lief Richtung Strand, mit dem Pappbecher in der Hand, es war wohl nicht ihr erster heute. Ich schaute ihr nach. Noch in Sichtweite prostete sie mit dem Becher einem Soldaten zu, der ihr entgegenkam. Er blieb stehen, sie ging langsamer. Wer weiß, was aus beiden geworden ist. Ich überquerte den Rothschild-Boulevard, die teuerste Straße der Stadt. Ein Herrchen zeigte seinen Hunden etwas Grün, beide Hundeleinen hingen locker in der rechten Hand, der eine Mops trottete dem anderen hinterher.
Auf dem Boulevard saßen ein paar Leute unter Heizstrahlern an einer Theke, aßen Sushi. In der Bar nebenan trugen alle – die Gäste wie die Kellner – Schwarz. Die Ampel schaltete auf Grün, und ich ließ den Boulevard hinter mir, weiter die Allenby-Straße entlang. Ein streunender Hund suchte mit der Schnauze im umgekippten Mülleimer nach Essbarem. Ein junger Israeli lief zum Fahrradständer neben dem Müll und sprach gleichzeitig in sein Handy. Ein Fahrradständer ohne Fährräder. Der Mann hob ein meterlanges, daumenbreites Fahrradschloss hoch, warf es auf den Boden, rannte davon, immer noch das Telefon am Ohr, nicht mehr sprechend, schreiend.
Ich bog in die Levinsky-Straße ab, es war nun kurz vor 23 Uhr. Ein Mann Ende dreißig kam mir singend entgegen, klatschte sich im Takt die ausgezogenen Arbeitshandschuhe in die Hände. Er sang seinen Feierabendsong. Die Gebäude sind das Gegenteil der Bauhaus-Meile am Boulevard. Grau in grau, Putz blättert ab, die Leitungen verlaufen offen an den Gebäuden. Selbst am Strand in bester Lage sehen viele Häuser so aus, doch dort ist Sand und Meer, das lenkt von den altersschwachen Bauten ab, an denen die salzige Meeresluft nagt. Und hier liegt nur der Park, der Levinsky-Park.
Scheinwerfer erleuchteten ihn grell an manchen Stellen, vieles blieb im Halbdunkel. Zwei orthodoxe Juden unterhielten sich, liefen weiter. Zwei andere Männer, Händchen haltend, der eine mit Kippa, überholten mich schnell. Nun war ich der einzige Weiße. Verstreut im Park vielleicht hundert Schwarze. Manche gingen auf und ab. Andere standen in kleinen Gruppen. Zwei Kinder schaukelten mitten in der Nacht auf dem Spielplatz. Mehrere Rutschen verliefen nebeneinander, bildeten mit ihren Leitern und Verschalungen eine Burg aus Plastik.
Vor deren Mauern, vor dem Burggraben, ein Schlafplatz der Bewohner des Levinsky-Parks. Sie schliefen dicht an dicht, ein Obdachlosen-Park. Die Polizei lässt sie hier schlafen, scheucht sie nicht weg, wie an anderen Orten der Stadt, hatte ich gehört. Der Park gehört nachts denen, die ganz unten angekommen waren.
Noch war Platz für den Mann im grauen Pullover und der schwarzen Jacke. Er setzte sich auf eine Decke, zog sich eine dünne gelbe und eine dicke grüne erst über die Beine, die Brust, den Kopf. Sein ganzer Körper war von Stoff überspannt. Er lag zwei Meter neben dem Ausgang der größten Rutsche, dem Burgtor.
Ich setzte mich auf eine Mauer im Park. Schaute über die Burg und die Menschen, die sie nicht aufgenommen hatte. Diese Nacht kannte edle Ritter. Zwei Frauen stiegen aus einem weißen Kombi, gingen in den Park, zu denen, die noch wach waren, einen Kreis bildeten und redeten. Sie sprachen mit ihnen, gestikulierten. Drei aus dem Kreis folgten den Frauen zum Kofferraum des Kombis, kamen mit vollgepackten Tüten zurück.
Ich schaute weiter zur Burg. Unfähig mich zu bewegen, zu müde geworden vom Tag, ich wusste, was ich noch zu tun hatte, aber noch nicht tun konnte. Andere taten es für mich. Vier neue Ritter, ohne Ross und Rüstung, traten in den Kreis. Sie hielten zwei Kochtöpfe und stellten sie in der Mitte ab, schüttelten Hände, holten Plastikbecher und Löffel heraus.
Einige der Wachen gingen zu den Schlafenden, weckten sie. Sie versammelten sich um die zwei Töpfe, erst fünf, dann vielleicht fünfzehn. Aus Plastikbechern löffelten sie Suppe. Eine Viertelstunde verging. Die jungen Ritter, zwei Männer, zwei Frauen, zwischen zwanzig und dreißig, schritten fort mit ihren Töpfen, ich folgte und sprach sie an. Der, der am meisten von ihnen auffiel, hieß Noam. Er hielt seine Laptoptasche noch in der Hand und nahm sie mit zur Suppenausgabe. Er hatte an diesem Tag lange gearbeitet, kam direkt vom Büro, sagte er mir.
Vor ein paar Tagen war ein Parkbewohner erfroren. Die Medien berichteten darüber, und seither kamen mehr Helfer als sonst. Noam erzählte mir davon und wie er die anderen drei über das Internet kennengelernt hatte, wie sie sich zum gemeinsamen Kochen getroffen hatten heute Abend. Die anderen wollten weiter, eine der Frauen sagte zu ihm etwas auf Hebräisch. »Lust auf ein Bier?«, fragte er mich. Ich hatte Lust, aber in diesem Park noch etwas zu erledigen.
Es dauerte eine weitere Stunde, in der ich feige durch den Park schlenderte, bis ich endlich einen aus dem Kreis ansprach, der längst kein Kreis mehr war, weil viele aus dem Kreis vor den Rutschen schliefen. Er stand am Spielplatz, fand keinen Schlaf, so wie ich, wir schauten uns an und gingen aufeinander zu.
Wir reichten uns die Hand, nannten unsere Vornamen. Abdullah war aus dem Sudan nach Israel geflohen. Seine Frau und zwei Kinder, beides Jungs, leben noch dort. Im Krieg. Er selbst hätte es nicht länger überlebt, als Mann und potentieller Kämpfer war der Märtyrertod nur eine Frage der Zeit. »Sind alle aus dem Sudan«, sagte er und zeigte auf die Burglandschaft. Er wollte Geld verdienen, der Familie etwas zukommen lassen, doch auf Arbeit hoffte er nicht mehr. Seit vier Monaten war er in Israel, und der Park war die Endstation. Ich drückte Abdullah Geld in die Hand und wusste, es würde nicht helfen.
Hilflos ging ich weit nach Mitternacht zurück. Auf der Allenby versuchte der Anführer einer Gruppe Israelis den Türsteher eines Stripplokals zu bestechen. Er hielt ihm einen roten 200-Schekel-Schein vor die Nase. Der stämmige Aufpasser schmunzelte und schüttelte mit dem Kopf. 40 Euro waren offenbar nicht genug.
Der Wind schob mich am nächsten Morgen über die Pflastersteine. Er wehte kräftig und trieb mich voran. Ich überließ es ihm, welchen Weg nach Norden ich einschlug, an welchen Stellen ich links oder rechts abbog. Zur Orientierung sah ich immer wieder den Strand linker Hand. Das gefiel dem Wind nicht und er blies so stark, dass ich den Schutz der Häusermauern suchte, den Meerblick aufgeben musste, ein paar hundert Meter vor dem Hafen rechts in die Gordon-Straße flüchtete.
Ich wollte aber nicht nach Osten, sondern nach Norden und bog in die Ruppin-Straße ab. Bis jetzt kam mir niemand zu Fuß entgegen. Die Stadt war menschenleer. Im Sommer mag das anders sein, an einem stürmischen Tag im israelischen Winter könnte man, mitten in Tel Aviv, einen Endzeit-Film drehen: die nach dem Supergau evakuierte Stadt. Man müsste nicht einmal Geld für Straßensperren ausgeben, keine Passanten vom Set fernhalten, am helllichten Tag könnte man filmen. Tel Aviv ist eine Sommerstadt, sie scheint im Winter – zumindest in manchen Vierteln – zu schlafen.
Eine Südostasiatin in ausgefransten Jeans schob eine alte Dame in ihrem Rollstuhl. Deren Hände lagen gefaltet auf dem Schoß, die Augen waren unter großen, braunen Sonnengläsern verborgen. Ich kannte solche Paare, hatte sie schon oft gesehen, viel von ihnen gehört. Ohne die billigen Gastarbeiterinnen aus Südostasien und Osteuropa würde das System der Altenbetreuung auch in diesem Land zusammenbrechen. Sie verdienen zwischen 400 und 800 Euro im Monat, aber das Leben in Israel ist teuer. Manche betreuen die Alten rund um die Uhr, wohnen bei ihnen. Kennen kein Privatleben. Die Büros in Rumänien, Bulgarien, auf den Philippinen und in Nepal, die sie nach Israel vermitteln, verlangen vierstellige Summen Provision.
Ich hatte bei meinen Recherchen einen israelischen Kriegsveteranen kennengelernt. Er lebte in einer Villa im Norden Tel Avivs. Wir saßen auf der Terrasse, er machte mir einen Espresso und stellte Gebäck auf den Tisch. Als ich die Gästetoilette aufsuchte, im Untergeschoss, saß seine südasiatische Pflegerin im Vorraum, schaute Fernsehen, wartete auf Arbeit, sie war zugleich die Putzkraft des Hauses.
Das Paar auf meiner Wanderung durch Tel Aviv rollte auf der Straße, die Gehwege waren versperrt von Fahrrädern, Motorrollern, Mülleimern, einem Lieferwagen, der Baumaterial auslud. In den Vorgärten der Häuser wuchsen dicht mit Laub bedeckte Bäume mit verschlungenen Ästen, Wurzeln, die wie Lianen herabhingen, sich im starken Wind auf und ab bewegten. Ich fragte einen Mann, der mit zwei Begleiterinnen eilig ein Haus verließ, zum Auto wollte.
»Wie heißt der Baum?«
»Keine Ahnung. Tut mir leid.«
»Ein Ficus«, sangen die zwei Frauen im Chor.
Ich kannte die meisten der in dieser Straße wachsenden Pflanzen nur aus dem Botanischen Garten oder in Kleinformat aus dem Wohnzimmer meiner Mutter.
Ich wusste noch immer nicht, was der Wind mit mir vorhatte, was ich hier sollte. Aber ich wollte ihm vertrauen und ging weiter, balancierte auf Bewässerungsschläuchen, die die Erde durchzogen, überquerte eine Promenade, blickte an Häusern vorbei auf das Meer, sah rechts die Stadt und vor mir das Ben-Gurion-Haus. Ich schmunzelte über den Wind, der mich zu David Ben-Gurion brachte. Eine Legende in Israel, der Mann mit der Halbglatze, den seitlich weit nach oben stehenden grauen, buschigen Haaren. Er verlas 1948 die Unabhängigkeitserklärung, war der erste Premierminister, führte den ersten Krieg des Landes. Und von ihm stammt der Satz: »Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.«
Seine Residenz in Tel Aviv ist heute ein Museum. Aber ich wollte nicht hinein, verhandelte mit dem Wind. Ich wollte auf dieser Reise keine Sehenswürdigkeiten besuchen, keine Museen, keinen Reiseführer schreiben. Einer der beiden Sicherheitsmitarbeiter am Tor sah mein Grübeln und führte die Entscheidung herbei. Er winkte mich durch das Fenster zu sich, und mit einem Summen öffnete sich der Eingang. Der Wind hatte Verbündete.
Im Haus traf ich auf eine Museumsmitarbeiterin wie im Hollywoodfilm. Strenger Blick durch die Brille, die Kaffeetasse in der linken Hand, einen dicken Stapel Papier unter dem rechten Arm. Sie entschuldigte sich für die hinter Glas präsentierten Gastgeschenke aus Burma, Thessaloniki, von einem Mayor aus Toronto, für das viele Porzellan und das teure Metall. »Das war bei Ben-Gurion damals nicht so.« Bevor ich nachfragen konnte, war sie am anderen Ende der Treppe verschwunden.
Manche der Exponate standen außerhalb der Vitrinen so ungeschützt da, dass ich sie hätte mitnehmen können. Die Museumsmitarbeiterin würde das sicher freuen. Aber ich hatte noch eine lange Reise vor mir. Das Haus war voller Bücher, die einfach in Regalen standen. »Hebrew Ethical Wills« könnte ich mir in die Jacke stecken oder »The Modern Hebrew Poem Itself«.