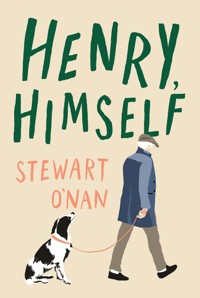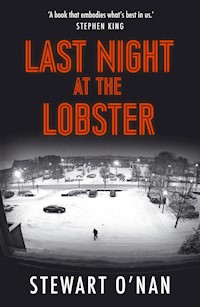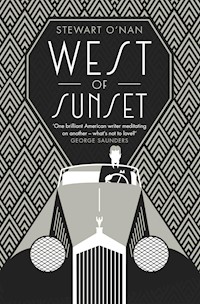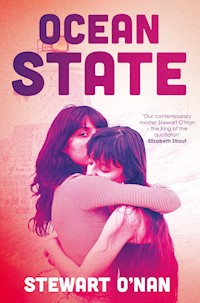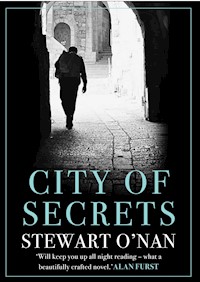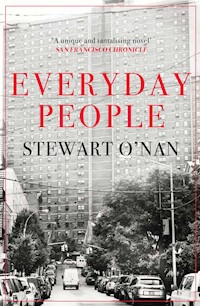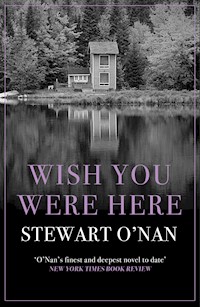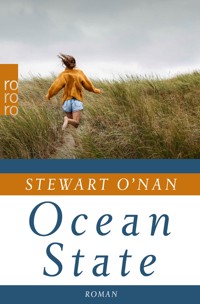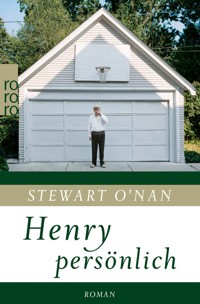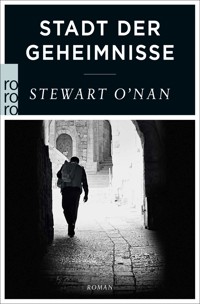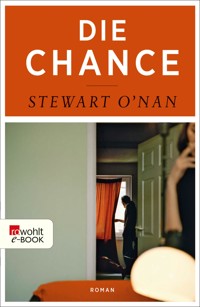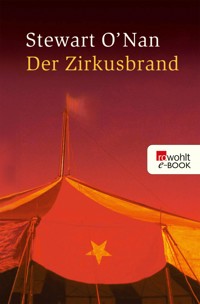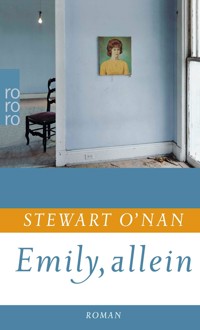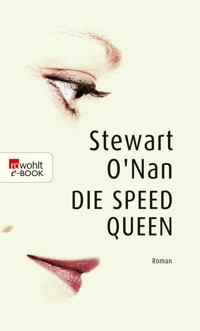8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1974 in der Kleinstadt Butler, Pennsylvania; ein verschneiter Winternachmittag. Der fünfzehnjährige Arthur Parkinson übt mit seiner Highschool-Band. Plötzlich knallen Schüsse. Was Arthur da hört, ist der Mord an Annie Marchand, seiner früheren Babysitterin und dem Objekt seiner ersten erotischen Begierden. Annie ist eine hübsche junge Frau, der nichts im Leben gelingen will, nicht einmal, ihre Liebsten vor Schaden zu bewahren. Sie liebt ihren Mann Glenn und treibt ihn in den Alkoholismus; sie vergöttert ihre kleine Tochter Tara und misshandelt sie beim geringsten Anlass. Auch in Arthurs Leben geht manches schief. Seine Eltern lassen sich scheiden, seine Mutter fängt an zu trinken, er selbst wird zum Psychiater geschickt. Trotz seines fassungslosen Staunens über die unverständliche Erwachsenenwelt fängt er an, um sein Glück zu kämpfen, und wird mit der Liebe einer Schulfreundin belohnt. Indessen wenden sich die zerstörerischen Kräfte, die Annie gerufen hat, allmählich gegen sie selbst und ziehen sie in einen Strudel der Gewalt. Menschliche Ohnmacht und Unzulänglichkeit sind die treibenden Kräfte dieses bewegenden Romans. O'Nan schildert Annie Marchands unausweichliche Tragödie mit einer zarten Poesie, die unsentimentales Mitgefühl und genaueste Beobachtung verbindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Stewart O'Nan
Engel im Schnee
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Für Kurt Cobain
Nichts ist so öde wie die Hauptstraße dieser Kleinstadt,
wo die ehrwürdige Ulme krank wird und gehärtet
mit Teer und Zement, wo kein Blatt
sprießt, fällt oder sich bis zum Winter behauptet.
Aber ich erinnere mich an ihre einstige Fruchtbarkeit,
daran, wie alles deutlich sichtbar wurde
in der Stunde der Leichtgläubigkeit,
und an den jungen Sommer, als auf dieser Straße
bereits ein leichter Schatten lag,
und hier am Altar der Hingabe
traf ich dich,
die den Durst meines vergänglichen Fleisches stillte.
Robert Lowell
Eins
In dem Herbst, als mein Vater fortging, spielte ich in der Band, in der Mitte der zweiten Posaunenreihe, weil ich Anfänger war. Dienstags und mittwochs nach der Schule übten wir im Musiksaal, aber freitags führte uns Mr. Chervenick in unseren Daunenjacken, Steelers-Bommelmützen und klobigen Stiefeln nach draußen und über die Fußgängerbrücke, die sich über die Interstate zum Footballplatz der Junior Highschool spannte. Dort scherten wir, wie das Footballteam selbst, im rechten Winkel oder Bogen aus und führten ein von Mr. Chervenick Schrägmarsch genanntes Manöver aus, bei dem wir – alle 122 – zum Finale jeder Halbzeitshow die Figur eines wirbelnden Trichters beschrieben, die dem Spitznamen unseres Schulteams alle Ehre machte: die goldenen Tornados. Wir kriegten es nie ganz richtig hin, obwohl Mr. Chervenick uns jeden Freitag zu inspirieren versuchte, indem er in seinem schokoladenbraunen Ledermantel, seinen Glacéhandschuhen und seinen Schuhen aus Korduanleder über das vom Raureif schlüpfrige Gras hetzte, um uns in Formation zu halten, bis er eine widerspenstige Oboe, statt sie wieder auf Kurs zu bringen, voller Abscheu bei den Schultern packte, sodass die ganze Holzbläsergruppe und dann die Blechbläser und die Trommeln stehen bleiben und wir noch mal von vorn anfangen mussten.
An einem Freitag Mitte Dezember übten wir noch spät den Tornado. Die Abenddämmerung hatte sich über den Himmel zu breiten begonnen, und es schneite, aber am Samstag sollte unser letztes Heimspiel stattfinden, und Mr. Chervenick überredete den Hausmeister, die Lampen einzuschalten. Tagsüber waren zwei bis drei Zentimeter Schnee gefallen, und es war unmöglich, die Linien zu erkennen. «Falsch, falsch, falsch!», brüllte Mr. Chervenick. Als das Mädchen, das das Xylophon zog, ausrutschte und sich den Fuß verstauchte, blies er dreimal auf seiner Pfeife, was bedeutete, dass wir zu einer abschließenden Gardinenpredigt antreten mussten, bevor wir gehen konnten. Er stieg die drei Stufen seines Podests auf Rädern hinauf und ließ uns eine Minute lang schweigend dastehen, damit wir begriffen, wie enttäuscht er war. Schnee legte sich auf unser Haar. Durch das dichte Gestöber, das im Schein der hohen Lampen trieb, drang das klirrende Rasseln der Ketten eines Sattelschleppers auf der Interstate. Im Tal lagen, von einer Wolkendecke eingehüllt, der brennende Straßengitterrost von Butler, der schwarze Fluss, die geschäftigen Fabriken.
«Wir haben dieses Jahr alle sehr hart gearbeitet», sagte er, atmete dampfend aus und legte eine Pause ein, als würde er zu einem vollen Stadion sprechen und darauf warten, dass seine Worte durchs Rund hallten. Warren Hardesty neben mir murmelte irgendwas – einen Witz, eine Entgegnung –, und dann hörten wir etwas, das ich (von meinem eigenen .22er, dem Mossberg meines Vaters, den abendlichen Nachrichten aus Vietnam) sofort als Schüsse erkannte. Eine ganze Salve. Sie knatterten wie Feuerwerkskörper, hallten über die kahlen Bäume auf der anderen Seite des Highways. Sie kamen ganz aus der Nähe. Die Band drehte sich unisono danach um, wozu Mr. Chervenick uns noch nie hatte bringen können.
Die Jagdsaison für Rehe hatte gerade begonnen, und wir alle wussten, dass die Stadtwerke hinter dem Wasserturm eine Schneise geschlagen hatten und auch über das Besitzrecht an den paar überwucherten Feldern verfügten, die man aus dem Wald geschnitten hatte, aber jeder von uns, der eine Waffe besaß, wusste, dass Schilder dort das Jagen verboten, weil das Land zu nahe an der Straße und der Schule lag. Und es war auch nicht die richtige Zeit zum Jagen, es war stockdunkel geworden. Wir sahen uns an, als wollten wir einander unsere Überraschung bestätigen.
Auch Mr. Chervenick schien zu verstehen, obwohl er nicht gerade der Typ war, der jagen ging. Er lobte unsere Hingabe, entließ uns und steuerte, statt uns über die Fußgängerbrücke zurückzubringen, über den leeren Parkplatz auf die beleuchteten Türen der Junior High zu, stand dann davor und klopfte an die Scheibe, bis der Hausmeister ihn hereinließ.
Was wir da gehört hatten, war, wie jemand umgebracht worden war, jemand, den die meisten von uns, wenn auch nur flüchtig, kannten. Ihr Name war Annie Marchand, und ich hatte sie zunächst – Jahre vorher – nur als Annie die Babysitterin kennengelernt. Zu jener Zeit hieß sie Annie Van Dorn. Sie lebte damals bei ihren Eltern im von uns aus nächsten Haus an der Straße. Genau genommen waren wir aber keine Nachbarn; zwischen unserem neuen aufgestockten Holzbungalow und ihrem kastenförmigen Neoklassizismusbau erstreckte sich eine Meile weit ein Feld, das Mr. Van Dorn einem alten Farmer namens Carlsen verpachtet hatte. Doch jedes Mal, wenn meine Mutter und mein Vater beschlossen zu flüchten, um auswärts zu Abend zu essen oder ins Kino zu gehen, hielt Mr. Van Dorns Lieferwagen am Ende unserer Einfahrt, und Annie sprang mit ihrer Handtasche und ihren Schulbüchern heraus, bereit, mich beim Candyland zu schlagen und meiner Schwester Astrid beizubringen, wie man Eyeliner aufträgt.
Ich vermute, dass Astrid sie zunächst mehr liebte als ich. Mit dreizehn war Annie größer als unsere Mutter und auffallend dünn. Das rote Haar reichte ihr bis zur Taille; ihre Finger steckten voller Ringe von Bewunderern. Sie roch nach dem Ölheizungskessel der Van Dorns, nach Secret-Deodorant und Juicy-Fruit-Kaugummi, und sie machte Pizza und sang «Ruby Tuesday» und, für mich, «Mr. Big Stuff». Ich gebe zu, dass sie in unseren Tagträumen manchmal zu unserer Mutter wurde. Einmal haben wir uns einen ganzen Abend lang über das Wort «Milch» gestritten, das wir – wie die meisten Leute aus dem Westen Pennsylvanias – «Mülch» aussprechen, aber das änderte nichts daran, dass wir für sie schwärmten. Diese Schwärmerei zog sich über mehrere Jahre hin, wie eine wunderbare Liebesaffäre. Annie verließ uns erst, als meine Schwester alt genug war, um auf mich aufzupassen, und da war sie schon mit der Schule fertig und arbeitete, und manchmal konnte meine Mutter sie sowieso nicht für freitags bekommen. Dann sahen wir sie im Maverick ihres Bruders Raymond vorbeifahren oder hinter ihrem Freund auf dessen Honda sitzen, aber das kam selten vor. Ein paar Jahre lang wurde sie – durch die räumliche Nähe und ihre Abwesenheit – zu etwas Fernem und Geheimnisvollem. Mein Schlafzimmer lag zu dem Feld hin, und nachts beobachtete ich die gelben Augen ihres Hauses und stellte mir vor, dass auch sie in ihrem abgedunkelten Zimmer zu mir herüberschaute.
Danach war sie, wie ihre Brüder, ausgezogen, hatte geheiratet und ein Mädchen zur Welt gebracht, aber es war nicht gut gelaufen für sie. In diesem Frühjahr hatten sie und ihr Mann sich getrennt. Die inzwischen verwitwete Mrs. Van Dorn lebte allein im Haus der Familie. Meine Mutter schaute jeden Tag nach der Arbeit kurz bei ihr vorbei, und in diesem Herbst war Annie oft da, in der Küche, und die beiden bemitleideten sich verbittert beim Kaffee. Sie müssen gedacht haben, das Schlimmste sei schon passiert.
Meiner Mutter zufolge wollte Mrs. Van Dorn, dass Annie wieder bei ihr einzog. Annie und ihre Tochter wohnten allein neben der Highschool oberhalb der Stadt. Ihr Haus war das einzige in der Turkey Hill Road, einer von Wald umgebenen Sackgasse, die am Fuß des County-Wasserturms endete. Die Straße hatte früher mal die alte Route 2 gekreuzt, aber beim Bau der Interstate hatte die Regierung die ganzen Häuser aufgekauft und die Straße auf beiden Seiten abgesperrt. Hinter einer in Signalfarben gestreiften Leitplanke verschwand der rissige Straßenbelag im Gestrüpp. Die anderen Häuser hatten Pech gehabt und standen noch dort hinten, überwuchert, die Schindeln moosbedeckt; wir feierten immer Partys darin. Mrs. Van Dorn machte sich Sorgen um Annies Sicherheit, aber sie und Annie kamen – wiederum meiner Mutter zufolge – nicht gut genug miteinander aus, um zusammenzuwohnen, und so blieb Annie, wo sie war.
Bei der Vernehmung sagte ihre nächste Nachbarin Clare Hardesty, dass sie die Schüsse gehört habe und ans Fenster gegangen sei. Die Straße sei leer und der angestrahlte Wasserturm im Schnee kaum noch zu sehen gewesen. Bei Annie habe Licht gebrannt; eine bunte Lichterkette habe an einem Baum geschimmert. Clare hatte kein Auto gesehen, das nicht hierhergehörte, womit, so erklärte sie, das von Annies Freund gemeint sei. Die beiden hätten sich vor kurzem getrennt; das habe sie mitbekommen. Als sie angerufen habe, habe niemand abgehoben, also habe sie die Stiefel und einen Mantel angezogen und sei die Straße hinuntergegangen. Die Haustür sei offen gewesen, das Licht sei auf den Schnee draußen gefallen. (Hier wurde sie nach Fußspuren befragt, nach einer zerbrochenen Fensterscheibe, nach Glasscherben auf dem Teppich im Bad; davon wisse sie nichts, davon wisse sie nichts.) Obwohl niemand im Haus gewesen sei, müsse sich drinnen etwas abgespielt haben. Sie habe das Telefon ausprobiert und sei dann zu ihrem Haus zurückgelaufen, um die Staatspolizei anzurufen.
Und erinnern Sie sich daran, bemerkt zu haben, steht im Protokoll, ob die Hintertür zu diesem Zeitpunkt offen stand?
Daran erinnere sie sich nicht, antwortete Clare Hardesty.
Ich weiß – und alle, mit denen ich aufgewachsen bin, wissen es –, dass die Hintertür offen stand und dass zwei Fußspuren von dort in den Wald führten. Wir folgten ihnen zuerst in unserer Vorstellung, in jenen verschneiten Nächten allein im Bett (Annies Atem, wie ihre nackten Füße einsanken), und dann, als die Mutigen schon hingepilgert waren, zogen wir in der Mittagspause unsere Stiefel an, überquerten die Interstate und rutschten den Hügel hinunter zu der Stelle, die wir alle einhellig ansteuerten, direkt jenseits der Holzbrücke über die Überlaufrinne von Marsdens Teich. Sowohl der Teich als auch der Bach waren zugefroren, nur die Überlaufrinne erzeugte ein Geräusch. Die romantischeren unter den furchtlosen Mädchen hatten Rosen in eine aus Schnee geformte Vase gestellt, jeden Tag eine frische zwischen die verwelkten. Irgendjemand hatte ein Kreuz in den Schnee gestampft, das im Januar säuberlich von Bierdosen gesäumt war. Auf einer Seite lag ein Haufen lippenstiftverschmierter Zigarettenkippen und verbrannter Streichhölzer wie eine Opfergabe. Wir standen da, allein oder in Gruppen, und blickten zurück über das Gewirr von kahlen Bäumen, hinter denen sich der Wasserturm und darunter, nicht zu sehen, ihr Haus erhob. Wir reichten einen Joint oder ein Schillum herum und sprachen davon, dass sie immer noch in den Bäumen und im Bach gegenwärtig sei, weil die Seele niemals sterbe. Irgendjemand hatte immer Kaugummi dabei, und ich erinnere mich daran, wie ich kaute und das Gefühl im Kiefer verlor und dachte, dass es stimmte, dass ich Annie dort spüren konnte. Aber bei anderen Gelegenheiten spürte ich gar nichts, nur Heißhunger und ein Schwindelgefühl, für das ich mich später schämte.
Im März schwänzten Warren Hardesty und ich die Schule, gingen von dieser Stelle den ganzen Weg bis zum Rand ihres Grundstücks und verfolgten so ihre letzten Schritte zurück. Es war weiter, als wir dachten, und wir mussten stehen bleiben und uns einen Grasjoint reinziehen, den ich mir aufgehoben hatte. Warren hatte etwas Brombeerbranntwein in einer Plastikfeldflasche der Girl Scouts dabei. Es war Montag, um die dritte Schulstunde. Das Haus stand zum Verkauf, aber niemand wollte es haben. Die Farbe blätterte ab, auf der von Fliegengittern geschützten Veranda lag noch ihr ganzes Gerümpel – Gartenstühle, Kaninchenkäfige, Bälle, denen die Luft ausgegangen war. Warren versuchte mich dazu anzustacheln, dass ich den Rasen überquerte und das Haus berührte.
«Mach du’s doch», sagte ich.
«Quatsch, ich wohne doch gleich die Straße rauf.»
«Na und?», sagte ich.
Wir taten es gemeinsam und ließen zwei Paar Stiefelspuren im unberührten Schnee zurück. Wir legten beide eine behandschuhte Hand an die Verandatür. Durch eins der Flügelfenster konnte ich die Ecke eines Teppichs und einen Stuhl sehen und Licht, das durch die blauen Vorhänge davor fiel.
«Lass uns reingehen», sagte Warren.
«Du spinnst wohl», sagte ich.
«Angsthase», sagte er, als wäre noch jemand anders da und begutachtete uns.
Ich ließ meinen Handschuh auf die Türklinke sinken.
«Ich bleibe direkt hinter dir», versprach Warren.
Die Türfeder leistete Widerstand, machte ein Geräusch, als würde jemand darauf herumklimpern. Ich steckte meinen Kopf hinein. Ein Schlauch lag aufgerollt wie eine Schlange neben einer durchgescheuerten Chaiselongue; darüber waren zwei Wäscheleinen gespannt, an denen noch ein paar grau gewordene Klammern hingen. Ich stellte mir Annie mit einem Korb voll Wäsche vor und fragte mich, ob sie wohl einen Trockner oder auch nur eine Waschmaschine besaß, weil wir – das heißt, meine Mutter – in unserem alten Haus immer beides gehabt hatten und jetzt keines von beiden mehr.
Warren schubste mich von hinten, und ich fiel über die Bank eines Campingtischs und warf einen Stapel Kartons um. Einer ging auf, und ein gelber Briefkasten für den Butler Eagle rollte heraus. Ich schrie, als wäre es ein Kopf. Warren rannte in Richtung Wald davon und lachte sich tot. Ich rappelte mich auf, lief ihm nach und rief: «Arschloch!»
Später gingen wir zurück, feierten erst an dem Campingtisch und dann, als wir uns wohler fühlten, im Haus selbst. Wir saßen im kalten Wohnzimmer auf dem Sofa, reichten die Feldflasche hin und her und tranken auf Annies Wohl. Wir nahmen nie jemand anderen mit, und wir gaben acht, dass wir hinter uns aufräumten. Wir versprachen, nie etwas mitgehen zu lassen oder auch nur von der Stelle zu bewegen. Warren nannte das die Verhaltensregel Nummer eins.
So war ich mit vierzehn, und ich bin nicht stolz darauf, wie ich mich in ihrem Haus benommen habe, aber heute glaube ich, dass ich hingegangen bin, weil ich schon damals wusste, dass ich Annie näher war als all diese Mädchen mit ihren Rosen und die Leute, die zu ihrer Beerdigung gingen. Wir hatten eine Vorgeschichte. Bekifft versuchte ich, mir ihr Leben dort auszumalen und ihren Tod, obwohl es mir damals unmöglich war, das richtig zu verstehen. Ich habe wohl damit versucht, mich von ihr zu verabschieden. Das Haus hat sich seit damals nicht allzu sehr verändert. Schließlich brach jemand ein, der weniger ehrfürchtig war und Feuer legte, und die Polizei vernagelte es mit Brettern. Es steht immer noch da, samt den verbrannten Möbeln und allem. Ich bin da gewesen.
Meine Mutter und ich haben eigentlich nie darüber geredet, was vorgefallen ist. Wir wechselten erschüttert ein paar tröstende Worte, und es herrschte Trauerstimmung im Haus, aber während die Zeitungen voller Berichte waren, sprachen wir nicht über den Mord selbst oder darüber, wie und warum es dazu gekommen war. Heute verstehe ich, dass sie (und ich auch, obwohl ich mir das damals nicht eingestand) ihre eigene sich dahinschleppende Tragödie durchmachte und ihren Schmerz für uns beide brauchte. Sie rief meinen Vater noch an, um dafür zu sorgen, dass er mich jeden zweiten Samstag abholte, aber sie redeten nur noch über Geld und die Regelung seiner Besuche.
Wir gingen alle zu einem Psychiater, der in Verbindung mit unserer Kirche stand, einzeln, an verschiedenen Wochentagen. Ich erinnere mich, dass Dr. Brady und ich meistens über Eishockey sprachen, obwohl er sich in jeder Sitzung unverblümt erkundigte, wie es mir zu Hause, in der Schule, in der Band, bei meiner Mutter, meinem Vater gehe.
«Okay», sagte ich ihm.
Wenn meine Mutter mich abholte, fragte sie unweigerlich: «Meinst du, dass es hilft?»
«Schätze schon», sagte ich.
Astrid, in Tennstädt, Westdeutschland, bei der Air Force, rief einmal im Monat an, um zu hören, wie es uns gehe, und um ihren Kontostand zu überprüfen. Ihre Staffel flog Aufklärungsflüge; «Geheimoperationen» nannte sie das, obwohl wir alle wussten, dass es sich nur um Luftaufnahmen von Russland handelte. Sie legte die Hälfte ihres Soldes auf die Seite, indem sie den Betrag an die Mellon Bank in Butler überwies, und jedes Mal, wenn meine Mutter mich in die Stadt zu Dr. Brady fuhr und wir an der Zweigstelle vorbeikamen, dachte ich an Astrids Geld dort drinnen, das sich, geborgen wie in einem Nest, vermehrte. Ich dachte sehnsüchtig, dass wir, wenn ihre Dienstzeit um wäre, zusammen in der Stadt über Woolworth wohnen könnten und ich dort in der Schallplattenabteilung arbeiten könnte. Am Telefon sprachen wir miteinander wie Gefangene. Sie stellte lange, unerträgliche Fragen («Was glaubst du, warum reden sie nicht miteinander, wenn sie doch zu demselben Typen gehen, und warum gehst du ganz allein hin?»), auf die ich unter dem wachsamen Lächeln meiner Mutter nur mit «Ich weiß nicht» antworten konnte. Meine Mutter wartete bis nach Weihnachten damit, ihr von Annie zu erzählen, und als ich ans Telefon kam, weinte Astrid und war wütend, als hätte ich es verhindern müssen.
«Es geht einfach alles in die Binsen bei euch, was?»
«Ich weiß nicht», sagte ich. «Glaub schon.»
Alles, was mein Vater zu dem Mord sagte, war, dass es eine rundum schlimme Sache sei. Er hatte – wenn auch nur kurz – mit Glenn, Annies von ihr getrennt lebendem Mann, zusammengearbeitet. Ich bekam meinen Vater in diesem Winter nicht oft zu Gesicht, und wenn, dann wählten wir sorgfältig unsere Worte, wie Überlebende. Er sagte nicht ein Wort gegen oder zugunsten von Glenn Marchand. Der Standpunkt meines Vaters war, dass mehr dahinterstecke, als wir zu erfahren berechtigt seien. Das gehe uns nichts an. Für mich war das genauso, als hätte er zugegeben, dass er die ganze Geschichte kenne. Ich wollte, dass er mir alles erzählte, weil meine Mutter es nicht getan hatte und ich es wissen musste. Ich kannte nur die Gerüchte und das, was ich aus der Zeitung folgern konnte, während er beide Beteiligte gekannt hatte. Er wollte nicht darüber reden, und ich bin froh, dass er es nicht getan hat, denn wenn er mir damals gesagt hätte, wie er die Sache sah, hätte ich es wahrscheinlich genauso wenig verstanden wie die Gründe, warum er meine Mutter verlassen hatte.
Einmal im Jahr komme ich in den Westen Pennsylvanias zurück, an Weihnachten. Dieses Jahr haben Astrid und ich Flüge nach Pittsburgh gebucht, sodass wir uns ein Auto mieten und gemeinsam nach Butler fahren konnten, und da sind wir jetzt und fahren in unserem großen Century durch das verschneite Land. Ich habe eine erträgliche Scheidung hinter mir; sie ist immer noch unverheiratet. Keiner von uns kommt darauf zu sprechen. Wir werden noch genug davon hören, wenn wir nach Hause kommen. Im Lauf der Jahre ist es für mich so etwas wie ein Ritual geworden, bei unserem alten Haus vorbeizufahren und anzuhalten, um es mir anzusehen. Das ist eine Art, Zeit zu gewinnen, sich für den schwierigen Teil in Schwung zu bringen.
«Können wir?», sage ich.
Astrid sagt nichts, drosselt aber widerwillig die Geschwindigkeit und fährt auf den mit Schlacke aufgefüllten Randstreifen. Wir haben den ganzen Herbst in telefonischer Verbindung miteinander gestanden, und sie weiß, dass ich etwas Nachsicht brauche.
Wir sitzen bei ausgeschaltetem Radio in der Wärme des Wagens. Die Sträucher sind groß geworden und haben sich um das Fundament herum ausgebreitet, aber das Haus selbst hat sich nicht sonderlich verändert. Astrid glaubt, dass es an der Außenverkleidung liegt. Auf dem Dach steht ein ausgeblichener Weihnachtsmann und winkt. Den neuen Bewohnern geht es ganz gut. Im vergangenen Jahr haben sie einen Swimmingpool aufgestellt; er ruht unter einer blauen Plane. Ich habe gesehen, wie ihr Sohn in der Einfahrt Reifen warf, und einmal, wie eine Tochter ein Loch schaufelte. Aber wie sieht’s drinnen aus, hat sich irgendwas verändert – der Baum, der Geruch von Truthahn den ganzen Nachmittag, während im Fernsehen ein Footballspiel auf das andere folgt? Wir sitzen im Auto, und ich stelle mir unseren Vater vor, wie er im Freizeitraum im Keller unter einer Wolldecke auf dem Sofa liegt, mit seinem Aschenbecher auf dem Flokati. Das Geplapper eines Werbespots für Rasierapparate ist zu hören, die Heizungsrohre unter der Fußleiste knarren. Die Steelers schlagen irgendwen, aber er schläft, und unsere Mutter scheucht uns wieder nach oben.
«Genug gesehen?», fragt Astrid und schaltet, als ich nicht antworte, in den Vorwärtsgang. Ich werde nie aufhören, das Kind zu sein; sie trifft alle Entscheidungen.
Carlsens Feld besteht aus Schlamm und Stoppeln. An Weihnachten wundert sich unsere Mutter jedes Mal laut darüber, dass er noch am Leben ist und seinen Deere mit der verglasten Fahrerkabine über die Furchen lenkt. Eine Meile weiter erhebt sich das Haus der Van Dorns.
Hier, dazwischen, während wir uns ihrem Haus nähern, holt die Vergangenheit mich ein. Zu beiden Seiten nichts als Felder, Schnee in den Straßengräben, Telefonmasten. Die als Windschutz dienenden alten Eichen wiegen sich rund ums Haus. Astrid fährt nicht langsamer, obwohl ich mich von ihr abwende. Der zweite Sohn, Dennis, wohnt jetzt darin; der Hof steht voll mit seinen Projekten. Neben zwei Bussen des Schulbezirks ein Wohnmobil auf Hohlziegeln, daneben ein Schneemobil, ein großer Haufen Traktorreifen. An die Rückseite lehnt sich eine kleine, türlose Scheune, aus der wie eine Maus ein Auto die Nase streckt – Raymonds alter Maverick. Das Haus gibt wenig preis, genau wie unseres, aber die Farbe ist neu, wie auch das Blechdach und die anheimelnden Spitzengardinen. An der Veranda weht ein regenbogenfarbener Windsack in Fischform und spricht der Jahreszeit hohn. Das muss ich mir merken. Und dann sind wir vorbei und brausen zwischen den verwehten Feldern dahin. Ich drehe mich in meinem Gurt um, um zu beobachten, wie das Haus kleiner wird, und Astrid seufzt.
«Sollen wir das schon wieder durchkauen?», sagt sie.
«Nein», sage ich, «das ist erledigt für mich.»
Sie sieht mich an, als wollte sie sagen, dass ich niemanden zum Narren halten könne, und wendet sich dann wieder der Straße zu.
«Ich sollte es wohl einfach vergessen, was?» Darüber streiten wir schon seit einer Ewigkeit.
«Ich sage nicht, dass du es vergessen sollst», sagt Astrid. «Hör einfach auf, es immer wieder durchzugehen. Lass es ausnahmsweise mal auf sich beruhen. Für ein Jahr.»
«In Ordnung», sage ich. «Das ist das letzte Mal. Versprochen.»
Sie schnaubt und schüttelt den Kopf, gibt es auf mit mir. Ich sage das jedes Jahr, aber was ist, wenn es diesmal stimmt?
Die zwei Häuser hinter uns sind leuchtende Punkte im Spiegel, Tupfen am Horizont, und während wir an den leeren Feldern entlangbrausen, wandern sie mit dem steiler werdenden Blickwinkel aufeinander zu, treten hintereinander und werden eins, wie im Visier eines Gewehrs.
Unsere Mutter wird heute, wenn wir uns begrüßt und es uns gemütlich gemacht haben, einen von uns bitten, zum Laden rüberzufahren, und Astrid wird mich, bevor sie mir die Schlüssel gibt, ansehen, als wollte sie sagen: Ich weiß, wo du hinfährst. Ich werde mich ein paar Minuten unter den Wasserturm setzen, während es schneit, und hinterher meiner Mutter erzählen, dass ich den ganzen Weg in die Stadt fahren musste.
Ich komme nicht gern nach Hause. Es hält mich davon ab, nostalgisch zu sein, was ich von Natur aus bin. Schon bevor das Flugzeug seinen Landeanflug beginnt, spüre ich die Angst vor den Fragen, die meine Kindheit unbeantwortet gelassen hat. Annie. Meine Eltern. Meine eigenen verlorenen Jahre. Ich weiß, dass ich, sobald wir aufsetzen, nicht mehr fähig sein werde, klar zu denken, dass mich jede Pizza Hut und jede Karosseriewerkstatt, an die ich mich erinnere, jedes Stück Straße, das ich genau kenne, ebenso überwältigen wird, wie die Liebe es tut.
Das Flugzeug, das ich nehme, fliegt direkt über Butler hinweg. Fünfzig Meilen vor Pittsburgh geht der Pilot durch die Wolken, und ich kann die Stadt ausmachen. Es gibt nicht viel zu sehen, das Geschäftsviertel, das sich dort konzentriert, wo die Route 8 zur Main Street wird, dann die Brücke, die Bahngleise, die sich am Connoquenessing entlangschlängeln, die blauen Blocks der Armco-Fabrik. Autos kriechen den langgestreckten Hügel hinauf. Ich halte Ausschau nach dem blaugrünen Punkt des Wasserturms, obwohl jedes Mal eine andere Landmarke ins Auge springt. Das Einkaufszentrum, das damals neu war. Das Depot des Postamts mit seinen Reihen von Jeeps davor. Das Heim für verkrüppelte Kinder – jetzt ein Rehabilitationszentrum –, wo meine Mutter immer noch arbeitet. Straßen kreuzen und verbinden sich; Wälder teilen sich säuberlich, um die Überlandleitungen durchzulassen. So hoch oben habe ich das Gefühl, dass der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, nicht so ein Rätsel ist. Wenn ich auf die Farmen und Felder, die beiden durch die Interstate voneinander getrennten Schulen, den schwarzen, bohnenförmigen Marsdens Teich hinunterblicke, glaube ich, dass ich, wenn ich mich auf die Einzelheiten konzentriere, wie meine Schwester, die Russland Stück für Stück zusammengesetzt hat, aus dem Ganzen schlau werden kann, dass ich endlich alles verstehen werde, was damals geschehen ist, obwohl ich weiß, dass ich dazu nicht in der Lage bin.
Zwei
Glenn Marchand klopft sich im Spiegel ans Gesicht und sieht zu, wie sich die Schnittwunde mit Blut füllt. Er hat sich heute schon einmal rasiert, für den Kirchgang, und trägt noch seine guten Schuhe und seine beste dunkle Hose. Sein gutes weißes Hemd und die kastanienbraune Paisley-Krawatte, die Annie ihm letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hat, hängen, sicher vor dem Barbasol und dem spritzenden heißen Wasser, am Griff der Badezimmertür. Auch das Hai Karate war ein Geschenk von ihr, zum Geburtstag, er weiß nicht mehr, zu welchem, aber er kann unbesorgt sein, es gefällt ihr. In der Schnittwunde brennt es wie Feuer. Ich mache mich viel zu fein, denkt Glenn. Er reißt eine Ecke Toilettenpapier ab, um die Blutung zu stillen.
«Du willst doch nicht zu spät kommen», ruft sein Vater von der Schlafzimmertür. Glenn entdeckt ihn im Spiegel und winkt über die Schulter.
Frank Marchand lehnt am Türpfosten und beobachtet, wie sein Sohn sich mit offenem Mund über das Waschbecken beugt und versucht, das winzige Dreieck mit den Fingern an die richtige Stelle zu kleben. Glenn ist jetzt seit drei Monaten zu Hause, ohne zu arbeiten. Er ist bei der Feuerwehr, aber ansonsten hat Frank keine Ahnung, was er mit seiner Zeit anfängt. Fährt durch die Gegend. Trinkt mit seinem Kumpel Rafe. Schläft. Sein Schlafzimmer ist ein einziges Durcheinander, wie das eines Kindes; der Hartholzfußboden ist mit Hemden, Schuhen und achtspurigen Bändern übersät, dazu Stücke von Bombers Kaustangen und seine Knochen aus ungegerbtem Leder, alle mit Büscheln von Hundehaar bedeckt. Das Zimmer riecht nach Bomber, der im Augenblick draußen in seiner neuen Hütte ist, ausgesperrt seit heute Morgen, als er Olive in wilder Dankbarkeit gegen den Küchentisch stieß und den ganzen Saft verschüttete. Frank geht zum Fenster. Bomber scheint es sich ganz bequem gemacht zu haben, mit übereinandergeschlagenen Pfoten, das Huskygesicht von einem ständigen Grinsen gespalten. Ein kalter Oktoberregen tropft von den Bäumen, und das Licht färbt die Laken des ungemachten Bettes grau. Eine Bibel liegt aufgeschlagen auf dem Nachttisch, stellenweise rot unterstrichen. Auf einem Stuhl in einem dunklen Winkel sitzt ein Plüschhase, den Glenn für Tara gekauft hat, mit einem roten Band um den Hals und die Arme ausgebreitet, als warte er nur darauf, jemanden damit zu umschlingen. Er ist fast so groß wie Tara selbst, und Frank will gar nicht daran denken, wie viel er gekostet hat.
Jeden zweiten Sonntag ist es dasselbe. Frank ist nicht Glenns leiblicher Vater, aber das ändert nichts daran, dass ihm das weh tut. Tara ist ihr einziges Enkelkind, das in Pennsylvania wohnt, und Glenn ist ihr Jüngster. Olive nennt ihn immer noch «unseren Kleinen», und es stimmt, Glenn hat sich nie auf die Welt eingelassen wie Richard und Patty. Er hat sowohl das Talent, Jobs zu finden, als auch, in letzter Zeit, sie wieder zu verlieren. Das liegt teilweise an seinem Charme, dem unverbesserlichen Optimismus, den er ausstrahlt. Er hat die Gabe, sich einzuschmeicheln – genau wie sein leiblicher Vater, denkt Frank, ein freundlicher, wirklich harmloser Mann, der, als sie das letzte Mal von ihm gehört haben, fünf bis fünfzehn Jahre in Minnesota absaß, weil er im Ruhestand lebende Paare um ihre Rente geprellt hatte. Frank hat versucht zu helfen, indem er Glenn an Leute aus seinem Bekanntenkreis vermittelte. Sie alle mögen Glenn zunächst, und dann fängt er an, zu spät zu kommen, sich krankzumelden oder, wenn er kommt, schlampig zu arbeiten – das alles kennt Frank mittlerweile. Es ist ihm ein Rätsel; er weiß, dass Glenn gut arbeiten kann. Der Junge ist verzweifelt, sagen ihm seine Freunde bei den Elks, gib ihm Zeit. Olive meint, die Rolle des Verkäufers wäre ihm auf den Leib geschrieben; er sehe im Anzug gut aus, er sei intelligent, und er habe gern mit Leuten zu tun. Er habe gern mit Leuten zu tun, stimmt Frank zu, aber er sei ihm immer eher gutmütig als intelligent vorgekommen, und was sein Aussehen betreffe, so kann Frank das, was Männer angeht, nicht beurteilen. Was ihm an Glenn als Junge gefiel, findet er jetzt langweilig – seine Ausgeglichenheit, sein unerschütterliches Vertrauen darauf, dass am Ende alles gut wird. Das stimmt jetzt alles nicht mehr, hat sich als verkehrt erwiesen. Es ist nicht nur die Trennung; seit kurzem lässt Frank ihn auch den Schlauch halten, statt ihn wie gewöhnlich im Rettungsdienst einzusetzen. Im entscheidenden Moment ist Glenn unentschlossen, und das kann für die Leute den Tod bedeuten. Frank versteht nicht, was los ist, warum dieser Sohn von ihm schon der ersten Pechsträhne nicht gewachsen ist. Er ist gern bereit, einen Teil der Schuld auf sich zu nehmen, aber nicht die ganze; die neue Kirche, die Glenn besucht, seit er versucht hat, sich umzubringen – die Lakeview New Life Assembly –, ist mitschuldig. Sie befindet sich in einem Fertigbau mit einem drei Meter hohen hölzernen Kirchturm, der obendrauf mit Draht festgezurrt ist, und man sollte einen großen Bogen darum machen. Frank versteht das nicht – er und Olive haben sie alle zu guten Presbyterianern erzogen. Olive sagt, es sei schon in Ordnung, es sei der einzige Halt, den er noch habe im Leben, das Einzige, was ihn bei der Stange halte. Sie macht Annie für alles verantwortlich. Frank widersteht dieser Versuchung; er hat sie immer gemocht. Sie war das einzig Gute in Glenns Leben.
Glenn hat den Föhn an. Von unten ruft Olive: «Viertel nach eins!»
«Es ist Viertel nach eins», brüllt Frank.
Glenn föhnt sich noch einen Augenblick lang die Haare, als hätte er nichts gehört, hört dann auf und zwängt sich in sein Hemd.
Frank bahnt sich einen Weg durch die Unordnung und lehnt sich an die Badezimmertür. «Wie sieht’s mit Geld aus?»
«Alles klar», sagt Glenn, knöpft das Hemd aber nicht weiter zu.
Frank holt seine Brieftasche heraus, feuchtet einen Finger an und blättert seine Scheine durch. «Warum lädst du sie nicht auf Kosten ihres Großvaters irgendwohin ein?» Er gibt Glenn einen Zwanziger, wohl wissend, dass er das Wechselgeld einstecken wird.
«Danke», sagt Glenn. Er schaut auf seine Armbanduhr und dreht sich zum Spiegel, um die Krawatte umzubinden. Frank macht ihn auf einen Klecks Rasiercreme an seinen Koteletten aufmerksam, und Glenn wischt ihn weg.
«Wo gehst du heute mit ihr hin?»
«An den See. Vielleicht zum Einkaufszentrum raus. Die Fotoleute sind dieses Wochenende da.»
«Also, dann viel Spaß.»
«Haben wir immer», sagt Glenn mit einem solchen Schwung, dass Frank ihn am liebsten zum Hinsetzen nötigen und ihm sagen will, es sei schon in Ordnung, niemand gebe ihm die Schuld an dem, was passiert sei.
Glenn bekommt die Krawatte nicht in der richtigen Länge hin und wünscht sich, sein Vater würde aufhören, um ihn herumzuschleichen. Er versteht, dass er sich Sorgen macht; gestern hat Glenn sich mit Gary Sullivan drüben auf dem Hof des Abschleppdienstes unterhalten, und der war nahe dran, ihm einen Job zu versprechen. Als Glenn nach Hause kam, lagen ihm seine Eltern anfangs immer damit in den Ohren, warum er nicht arbeite; jetzt haben sie aufgehört, danach zu fragen. Wochentags beachten sie ihn kaum, aber sonntags behandeln sie ihn, als stünde irgendeine Auszeichnung für ihn an. Beim Abendessen fragen sie ihn aus und sehen sich dann aus Enttäuschung den Rest des Abends schweigend «Columbo» an. Er wird diesen Job bekommen und behalten, das spürt er. Es geht ihm besser. Er ist bereit.
Endlich kriegt er den Knoten richtig hin und knöpft die Ecken seines Kragens fest. Er nimmt das Stück Papier vom Kinn. Es ist noch nicht gut, aber gut genug; er ist schon spät dran. Sein Vater folgt ihm wie ein Leibwächter nach unten.
Sein Jackett hängt an der Rückseite der Küchentür. Kurz vor halb zwei, Annie wird sauer sein; ihre Mutter wollte, dass sie ein paar Einkäufe erledigt.
Glenns Mutter kommt vom Footballspiel herüber, um ihn zu verabschieden. Sie streicht die Ärmel seines Jacketts glatt, zupft Fusseln ab. «Bestell schöne Grüße von uns.»
«Mach ich», sagt Glenn und klimpert mit seinen Schlüsseln.
«Und erinnere Tara daran, dass sie nächstes Mal bei Oma und Opa vorbeikommen soll.»
«Mach ich», sagt er zu heftig, und es tut ihm leid. Sein Vater hält ihm einen Regenschirm hin, einen alten Totes, den Glenn ihnen vor Jahren mal geschenkt hat, und Glenn nimmt ihn schuldbewusst entgegen. Seine Mutter will einen Kuss haben, also bückt er sich und dreht seine Wange ihrem gepuderten Mund zu. «Ich muss los», sagt er.
«Dann geh», sagt sein Vater und öffnet mitten in einer feuchten Windbö die Hintertür. «Lass dich nicht von uns alten Leutchen aufhalten.»
Sie stehen auf der Veranda hinter dem Fliegendraht und sehen zu, wie er den Hof zu Bombers Hütte überquert. Glenn hat ein neues, blaues Halstuch für ihn, und Bomber zerrt an der Kette. Der Regen hat etwas nachgelassen. Der Hof ist mit nassen Blättern übersät. Olive weiß, dass Glenn todunglücklich nach Hause kommen wird, aber obwohl er selbst daran schuld ist, weil er nicht sieht, was seine Frau für eine ist, kommt sie nicht umhin, sich zu wünschen, es wäre anders. Sie denkt an das Bild, das Richard von seinem neuen Haus in Tucson geschickt hat, Debbie und Becky neben ihm in der Einfahrt, lächelnd und braun gebrannt. Hinten haben sie einen Swimmingpool. Richard hat ihnen zwei Tickets geschickt, damit sie ihn an Weihnachten besuchen kommen, und obwohl sie hinfahren werden, hat Olive das Gefühl, dass es nicht richtig ist, Glenn allein zu Hause zu lassen.
«Ich weiß nicht, was ich für ihn tun soll», sagt sie, die Arme verschränkt, um sich warm zu halten.
«Nichts», sagt Frank. «Er ist kein Kind mehr.»
«Ich weiß», sagt sie.
Er legt den Arm um sie, während Bomber, von der Leine gelassen, auf die Ladeklappe von Glenns Lieferwagen springt. Die Pritsche ist mit Dosen übersät, und Bomber stößt sie in der Gegend herum. Glenn winkt, während er ins Führerhaus steigt. Sie winken zurück, als ginge er für immer fort.
Er lässt den Motor aufheulen, und Olive schüttelt Franks Arm ab.
«Mir ist kalt», sagt sie, geht nach drinnen und lässt Frank allein zusehen, wie er wegfährt. Die Auspuffgase ballen sich zu weißen Wolken. Es tropft von den Bäumen, und Bomber hüpft herum. Gerade als Glenn den Gang einlegt, fällt Frank das Geschenk in seinem Zimmer ein.
«Der Hase», ruft Frank und versucht, ihm ein Zeichen zu geben. «Du hast den Hasen vergessen», aber sein Sohn ist spät dran und denkt, dass er ihm winkt und Glück wünscht.
Glenn merkt es auf der Interstate, als er sich der Abfahrt zur Highschool nähert. Er schlägt aufs Armaturenbrett und schüttelt den Kopf. «Du Idiot.»
Der Tag ist ihm verdorben. Er sieht keinen Sinn darin weiterzumachen. Bei ihm muss alles perfekt sein, und er kriegt nicht mal so etwas Simples hin. Nur einmal, denkt er, bitte. Er träumt – obwohl er nicht mehr daran glaubt –, dass Annie ihn am Ende eines dieser sonntäglichen Besuche bitten wird, zum Abendessen zu bleiben und vielleicht noch etwas fern zusehen, bei ein paar Drinks. Eins führt zum anderen, und wer weiß, vielleicht bleibt er die Nacht da und die nächste und die übernächste, und alles ist wieder so, wie es mal war. Sie leben jetzt seit nahezu acht Monaten getrennt, und nicht einmal ist es dazu gekommen. Sie haben zusammen mit Tara gepicknickt und waren mit ihr diesen Sommer zum Schwimmunterricht am See, und Annie war in den letzten paar Wochen ihm gegenüber relativ freundlich, aber er hat sich daran gewöhnt, sonntags allein nach Hause zu fahren, wütend darüber, dass er auch nur an eine Versöhnung denken konnte. Die ganze Woche hat er sich darauf vorbereitet, eine Abfuhr einzustecken, aber schon gescheitert zu sein, bevor er auch nur einen Fuß über ihre Schwelle gesetzt hat, ist niederschmetternd.
Er drosselt die Geschwindigkeit, während er die Rampe hinauffährt, und biegt in die Burdon Hollow Road ein. Bomber lächelt im Rückspiegel, und sein Fell wird durcheinandergewirbelt. An jedem anderen Tag ließe Glenn ihn ins Führerhaus, aber er würde seinen Anzug ruinieren. Es ist nicht so kalt, nur der Boden ist nass. Von der Brücke kann er sehen, wie die Wolken sich im Tal ausbreiten und die wuchernde Stadt halb verdecken. Wenn sie ausgingen, parkten Annie und er immer hinter der Highschool und blickten auf die Lichter hinab. Jetzt fahren die Bullen dort herum, und die Jungs und Mädchen haben sich an den See verzogen.
«Sowieso schöner da», gesteht er sich ein.
Er biegt in die Far Line ein und sieht unwillkürlich nach, ob die Schnauze irgendeines Autos aus der Einfahrt zur Junior High hervorschaut. Es ist seltsam, wie gut er die Straßen jetzt kennt, während er bei seinem alten Zuhause, seiner Frau und seinem Kind vor einem Rätsel steht. Die Bäume sind schwarz vom Regen. Er überprüft sein Kinn im Spiegel – annehmbar. Annie hat ihn nicht mal im Krankenhaus besucht. Der einzige Mensch, mit dem er richtig über den Selbstmordversuch gesprochen hat, ist Elder Francis, der sagt, dass Glenn sich einer größeren Gnade ausliefern musste, um wirklich gerettet zu werden. Wurde er schließlich auch, aber eher von den Sanitätern des Bezirkskrankenhauses. Seine Freunde vom Wagen 3 mussten die Wohnungstür einschlagen. Sein Vater war auch dabei und sah zu, wie sie sich mit ihm abmühten. Glenn konnte ihn über den sich herabneigenden Köpfen sehen, wollte mit ihm reden, sich entschuldigen, aber das Seconal hatte bereits angefangen zu wirken, und der Raum zwischen ihnen wurde flüssig und drückend schwer, als blickte er vom Grund eines Baches auf. Als er den Mund aufmachte, packten Finger seine Zunge. Er denkt nicht gern daran zurück, es ist lange her, es war dumm.
Während er vor der Turkey Hill Road bremst, wirft er einen Blick zum Haus von Clare Hardesty hinüber, rechnet damit, dass sie am Fenster steht und sein Eintreffen zur Kenntnis nimmt. Die Vorhänge sind zugezogen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht zu ihm herausguckt. Er winkt, nur um sicherzugehen.
Und dann sieht er sich seinem alten Zuhause gegenüber, dem zweistöckigen weißen Haus, das einsam am Ende der Straße steht. Der Wald ist dunkel, und die einzige Straßenlaterne ist an. Der Wasserturm zeichnet sich blau und riesenhaft ab. Er fährt in die Einfahrt hinter Annies Maverick, springt heraus und passt auf, dass er nicht in einer Pfütze landet. Hier regnet es kaum. Sie hat schon für Halloween dekoriert – Katzen aus Pappkarton und Kürbislaternen, die in die Fenster gehängt sind, eine Vogelscheuche mit weit aufgerissenen Augen an der Tür. An Feiertagen war immer ihre ganze Familie da. Erneut denkt er an den Hasen und schüttelt den Kopf. Hinten dreht Bomber langsam durch und ballert die Dosen in der Gegend herum.
«Spring ja nicht», warnt Glenn und sagt dann: «Runter», und Bomber springt über die Seite, schießt an ihm vorbei zur Tür und spritzt seine Hose voll Matsch. Glenn wischt mit einer Hand daran herum und gibt es dann auf. Bevor er klopft, kommt ihm der Gedanke, dass er nächstes Mal Blumen mitbringen sollte. Er wird ihr von dem Job erzählen.
Er hat die ganze Woche Zeit gehabt, aber als sie ihm die Tür aufmacht, stellt Glenn fest, dass er nicht darauf vorbereitet ist, Annie zu sehen. Ihre Größe ist erstaunlich, ihre Haarfarbe, als hätte er sie nur dunkel in Erinnerung, wie auf einem alten Foto, das seinem Motiv nicht gerecht wird. Sie trägt ein ausgeblichenes Paar Levis, ein Thermo-Unterhemd und ihre neue Brille. Ihr Gesicht ist ein Gewirr roter Striemen – sie gesteht, auf dem Sofa geschlafen zu haben; sie seien beide krank gewesen –, aber als sie Bomber anlächelt, ist Glenn wehrlos und so gerührt, dass er auf sich und, aus anderen Gründen, auf sie wütend wird.
«Du bist zu spät», sagt sie im Spaß, wartet aber auf eine Erklärung.
«Die Kirche.»
«Tara», ruft sie, «dein Vater ist da», und die kurze Zeit, die Tara benötigt, um vom Schlafzimmer herüberzukommen, stehen sie da. Glenn verlagert sein Gewicht. Er mustert die Möbel, schnappt Signale von der zur Hälfte gelesenen Mademoiselle auf, die auf dem Sofa liegt, von den Buntstiften, die wie umgestürzte Bäume übereinandergefallen sind. Im Fernsehen läuft ein schlechter Film, in dem Leute durch dunkle Krankenhauskorridore verfolgt werden.
«Wie geht’s deinen Eltern?», fragt Annie.
«Haben die Nase voll von mir. Und deiner Mutter?»
«Gut.»
«Gut.»
Tara erscheint und liefert ihnen so eine Ausrede dafür, nicht mehr miteinander zu reden. Sie drückt ein ausgestopftes Exemplar von Pu dem Bären an die Brust. Bomber wirft sie beinahe um; Glenn klatscht einmal in die Hände, und er setzt sich, zweimal, und er legt sich hin. Glenn hat die Latzhose, die Tara anhat, roter Cord mit einem Känguru auf der Tasche, noch nie gesehen. Er kniet sich hin, um sie zu bewundern und sich umarmen zu lassen. Tara riecht nach Hustensaft mit Traubengeschmack.
«Mommy hat sie gemacht», sagt sie.
«Sie ist sehr schön», sagt Glenn. «Wo würdest du heute gern mit deinem alten Dad hinfahren? Würdest du gern zum Einkaufszentrum fahren und ein Bild von dir machen lassen?»
«Nein.»
«Okay, wo würdest du gern hinfahren – zum See?»
«Frag nicht», sagt Annie, «bestimm es einfach. Und nimm Stiefel mit, falls ihr euch draußen aufhaltet.»
«Ich will zur Oma», sagt Tara.
«Nein, Schätzchen», sagt Annie, «du fährst mit Daddy zum Einkaufszentrum. Mommy muss für die Oma einkaufen.»
«Ich will aber auch einkaufen», sagt Tara und macht ein finsteres Gesicht.
«Wir können», sagt Glenn, um einen fröhlichen Ton bemüht, «zu dem Einkaufszentrum mit dem Pferd und dem Raketenschiff fahren.» Er nimmt ihre Hand, aber sie zieht sie weg.
«Ich will Daddy nicht. Ich will Mommy.»
«Schnapp sie dir einfach», sagt Annie und zieht sich ihre Schuhe an. «Sie wird fünf Minuten lang schreien und heulen, und dann geht’s ihr wieder gut. Sie lässt sich gern fotografieren – nicht, Schätzchen? Klar. Sie ist bloß schlecht gelaunt wegen des entzündeten Ohrs.» Sie zieht sich den Mantel an. «Fährt Pu mit euch?»
Glenn streckt die Hand aus.