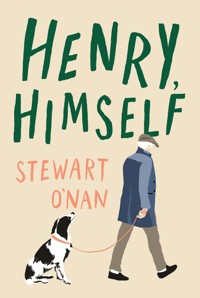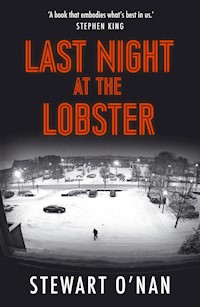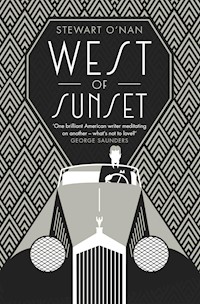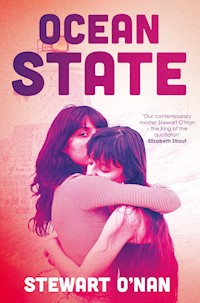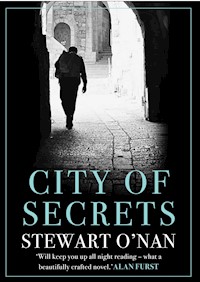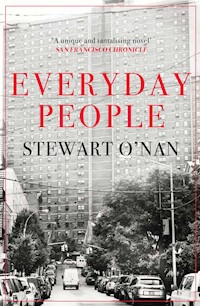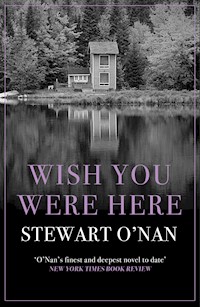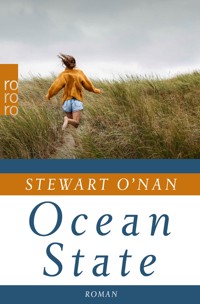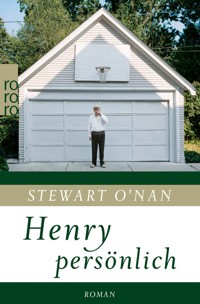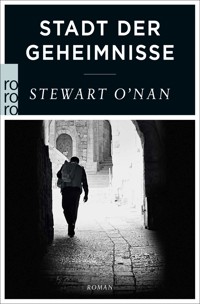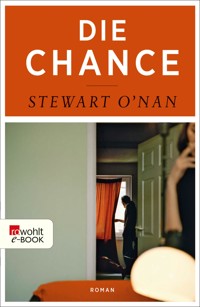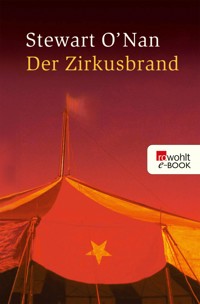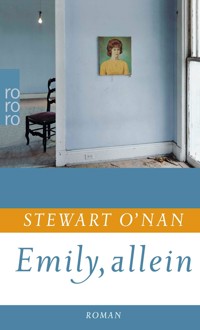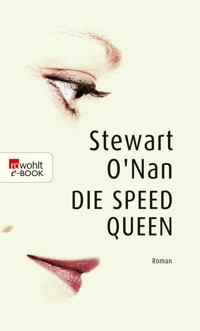9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«An diesem kleinen Buch stimmt alles.» (NZZ) Ein grauer Winterabend Ende Dezember. Zum letzten Mal öffnet Manny, der Leiter eines kleinen Restaurants, die Tür, kontrolliert die Fritteuse, den Grill und die Eismaschine. Zum letzten Mal kommen die Angestellten zur Arbeit und binden sich ihre Schürzen um. Zum letzten Mal geht das Leben der Menschen im «Red Lobster» seinen gewohnten Gang, bevor es sich für immer verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stewart O′Nan
Letzte Nacht
Roman
Über dieses Buch
«An diesem kleinen Buch stimmt alles.» (NZZ)
Ein grauer Winterabend Ende Dezember. Zum letzten Mal öffnet Manny, der Leiter eines kleinen Restaurants, die Tür, kontrolliert die Fritteuse, den Grill und die Eismaschine. Zum letzten Mal kommen die Angestellten zur Arbeit und binden sich ihre Schürzen um. Zum letzten Mal geht das Leben der Menschen im «Red Lobster» seinen gewohnten Gang, bevor es sich für immer verändern wird.
Vita
Stewart O’Nan wurde 1961 in Pittsburgh/Pennsylvania geboren und wuchs in Boston auf. Bevor er Schriftsteller wurde, arbeitete er als Flugzeugingenieur und studierte an der Cornell University Literaturwissenschaft. Für seinen Erstlingsroman «Engel im Schnee» erhielt er 1993 den William-Faulkner-Preis. Er veröffentlichte zahlreiche von der Kritik gefeierte Romane, darunter «Emily, allein» und «Die Chance», und eroberte sich eine große Leserschaft. Stewart O’Nan lebt in Pittsburgh.
Thomas Gunkel, geboren 1956, übersetzt seit 1991 Werke u. a. von Stewart O’Nan, John Cheever, William Trevor und Richard Yates. Er lebt in Schwalmstadt/Nordhessen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel «Last Night at the Lobster» bei Viking, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2023
«Last Night at the Lobster» bei Viking, New York, 2007 Copyright © Stewart O´Nan 2007
© 2007 by marebuchverlag, Hamburg
Covergestaltung any.way, Cathrin Günther, nach dem Original des Mare Verlags
Coverabbildung Ron Saari
ISBN 978-3-644-01039-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meinen Bruder John und alle, die die Schichten übernehmen, die kein anderer will
All the vatos and their abuelitas
All the vatos carrying a lunch pail
All the vatos looking at her photo
All the vatos sure that no one sees them
All the vatos never in a poem
Luis Alberto Urrea
Darden Restaurants Inc. erhöht seine Prognose und rechnet für das Jahr 2005 mit einer Steigerung der Dividende von insgesamt 22 bis 27 Prozent pro Aktie …
MSN.com
Geschäftszeiten
Ein grauer Wintertag, der Verkehr am Einkaufszentrum ist zum Erliegen gekommen. Später Vormittag, aber die schwach leuchtenden Straßenlaternen brennen noch. Vereinzelte Schneeflocken schweben herab wie Asche, doch die Straßen sind im Moment größtenteils trocken. Die Feiertage stehen bevor – am Kühlergrill eines Müllautos, das an der Ampel hält, ist mit Draht ein großer Kranz befestigt, rote Samtschleife inklusive. Auf der Abbiegespur warten sie darauf, dass der Pfeil über der Straße auf Grün springt, dann setzt sich eine Kolonne salzverkrusteter Fahrzeuge in Bewegung und biegt nach links in die Einfahrt des Einkaufszentrums, wo sich ihre Wege trennen und jeder sich auf die Suche nach einer Parklücke macht.
Ein einzelner Wagen gleitet allein über die Weite des Parkplatzes, vorbei an einem zusammengeschobenen Schneehaufen, der aufragt wie ein schmutziger Eisberg. Ein schrottreifer weißer Buick, wie man ihn vielleicht von einer Großmutter erben würde, an der Fahrertür fehlt ein Stück Zierleiste. Der Regal bleibt auf der markierten Spur ganz am äußersten Rand, hält am Stoppschild, obwohl es hier draußen bloß freie Parkflächen gibt, und schließlich das Fahrtziel des Wagens, weit hinten in einer Ecke gelegen, als wäre dort der Angelpunkt des gesamten Parkplatzes, ein dunkler Holzrahmenbau mit eigener Parkfläche und unbeleuchtetem, dem Highway zugewandten Neonschild – ein Red Lobster.
Der Regal blinkt überflüssigerweise und gleitet auf den Parkplatz wie ein Ozeandampfer, der endlich den Hafen erreicht, vorbei an den Behindertenparkplätzen zu beiden Seiten des Wegs, der zum Eingang führt, er bremst, biegt dann ab und verschwindet hinter dem Gebäude, nur um ein paar Sekunden später ganz hinten auf der anderen Seite wieder aufzutauchen und neben einem umzäunten Müllcontainer zu halten, als wollte sich der Fahrer verstecken.
Einen Augenblick steht der Wagen mit ausgeschalteter Zündung da, Schnee rieselt auf Dach und Heckfenster, und die beheizte Scheibe scheint jedes auftreffende Schneekristall aufzusaugen. Im Wageninnern, eingerahmt von den Schalensitzen, baumelt am Rückspiegel eine goldbefranste puertoricanische Flagge. Der Fahrer beugt sich zu einer Flamme hinab, drückt den Kopf wie ein Astronaut gegen die Kopfstütze und stößt Rauch aus. Nochmal, und dann ein weiteres Mal, und der Rauch schwebt derweil in einer Wolke über dem Rücksitz.
Der Blick des Mannes schnellt ängstlich zum Rückspiegel. Es ist noch zu früh, und außerdem ist er zu alt, um sich zu bekiffen – gut und gern fünfunddreißig, Doppelkinn, kakaobraune Haut, borstiger Ziegenbart und Koteletten –, aber vielleicht liegt es auch bloß an seiner Krawatte, dass er so seltsam aussieht, als er das Feuerzeug an den stählernen Pfeifenkopf führt. Er könnte Börsenmakler sein oder ein Verkäufer bei Circuit City, der gerade Kaffeepause macht, doch das Namensschild, das aus der offenen Lederjacke hervorlugt, zeigt einen garnierten Hummer über seinem Namen: MANNY. Auf seinem Schoß liegt, schwer wie ein Vorhängeschloss, ein an der Gürtelschlaufe befestigter dicker Schlüsselbund.
Wenn jemand hier etwas zu suchen hat, dann Manny DeLeon. Als Geschäftsführer ist er dafür zuständig den Laden aufzusperren, eine Aufgabe, die ihm mittlerweile Spaß macht. Obwohl Red Lobster keine Lizenzen vergibt, betrachtet er die Filiale als sein Eigentum – zumindest tat er das, bis er den Brief von der Zentrale bekam. Er ging davon aus, dass sie wegen Renovierungsarbeiten schließen würden, wie die Filiale in Newington, dass die dunkel lackierten Nischen und das Küstendekor-Imitat ersetzt würden durch einen offenen Grundriss und zarte blaugrüne Pastelltöne, den Coastal Home-Stil, der auf der Webseite des Unternehmens verheißen wurde. Mit ihren Fachwerkdecken, dem eingedrückten Fiberglasschwertfisch und den mit Schellack überzogenen Treibholzschildern für die Toiletten waren sie längst überfällig. Stattdessen bedauerte die Zentrale, ihm mitteilen zu müssen, eine Unternehmensstudie habe ergeben, dass der Standort in New Britain die Erwartungen nicht erfülle, und deshalb mit Wirkung vom 20. Dezember endgültig geschlossen werde.
Vor zwei Monaten hat Manny noch vierundvierzig Leute beschäftigt, zwanzig davon Vollzeit. Wenn er heute Abend die Tür abschließt, werden bis auf fünf alle ihren Job verloren haben, und einer von diesen fünfen – ungerechterweise, denn er war ihr Vorgesetzter – wird er selbst sein. Am Montag werden die Verbliebenen im Olive Garden in Bristol anfangen, eine zusätzliche Viertelstunde Fahrzeit, aber besser als das, was Jacquie und die Übrigen erwartet. In den letzten paar Wochen hat er an den Empfehlungsschreiben gesessen und versucht, sich etwas Nettes einfallen zu lassen – in manchen Fällen nicht schwer, in anderen fast unmöglich.
Jacquie könnte er immer noch mitnehmen, wenn sie zu ihm käme und ihn darum bäte. Eigentlich stimmt das nicht, aber es ist eine Lüge, an die er gern glauben würde, weshalb er es sich immer wieder einredet. Vielleicht hat es vor ein paar Monaten noch gestimmt, aber jetzt tut es das nicht mehr. Jacquie hat selbst gesagt, es wäre besser so, und er hat ihr zugestimmt – wenn auch nur aus praktischen Erwägungen. Nach dem heutigen Abend wird er sie nie mehr wiedersehen. Das müsste eine Erleichterung sein. Ein Schlussstrich. Doch warum malt er sich dann aus, dass er sie nach Feierabend anfleht, mit ihm mitzukommen, oder braucht er bloß ihre Vergebung?
Er bläst ein letztes Mal Rauch in die Luft und klopft die Pfeife im Aschenbecher aus, verstaut sie dann neben sich in der Konsole, öffnet das Fenster einen Spaltbreit, schnippt eine Zigarette aus der Packung, zündet sie sich an und pustet einen sich kräuselnden Rauchschleier über das Dope. Er schließt die Augen, als wollte er schlafen, und schiebt den Ärmel seiner Jacke zurück, um auf die Armbanduhr zu schauen. «Okay», murmelt er, als würde ihn jemand antreiben, öffnet dann langsam die Tür und schwingt sich nach draußen, die Zigarette zwischen die Zähne geklemmt. Obwohl niemand da ist, macht er sich die Mühe, den Wagen abzuschließen.
Kein Lüftchen regt sich, nur die sich überlappenden Verkehrsgeräusche von der anderen Seite des hübschen, in Habachtstellung stehenden Kiefernspaliers und die Schneeflocken, die sanft auf den rissigen Asphalt fallen, empfangen ihn. Als er den Parkplatz überquert, fliegt eine Krähe auf von der Laderampe, wie ein schlechtes Omen. Er hält mitten im Schritt inne und beobachtet, wie sie zu den Kiefern gleitet, geht dann weiter, fächert die Schlüssel am Bund auf, ordnet sie bedächtig, die Zigarette im Mundwinkel wie ein Klugscheißer in einem Film. Als er den Richtigen gefunden hat, zieht er ein letztes Mal an der Zigarette und wirft den Stummel in einen großen schwarzen Plastikaschenbecher neben der Hintertür, der wie ein Butterfass geformt ist (und sieht auf dem Boden mehrere Zigarettenstummel vom vorigen Abend liegen, um die er sich später kümmern muss).
Drinnen ist es dunkel wie in einem Bergwerk. Er schiebt einen Gummikeil unter die Tür, damit sie offen bleibt, knipst das Licht an und wartet, während an der Küchendecke eine Neonleuchte nach der anderen aufflackert. Die Edelstahltische glänzen wie Spiegel. Die backsteinroten Fliesen, die Eddie und Leron gestern Nacht vor Feierabend gewischt haben, sind blitzsauber. Eddie kommt mit in den Olive Garden; wenigstens den kleinen Kerl kann Manny mitnehmen. Leron findet jederzeit einen anderen Job – außerdem trinkt Leron und hat Probleme mit dem Wagen, während Eddie vom Easy Street-Kleinbus bei Wind und Wetter immer pünktlich vorbeigebracht und wieder abgeholt wird. Und obwohl Manny es nie zugeben würde, weil sie Freunde sind, lässt sich Eddie, der stets einen guten Eindruck machen will, viel leichter herumkommandieren.
Er geht die Kochzeile entlang und lässt die Hand wie ein Zauberer über die Fritteusen und den Grill gleiten, um sich zu vergewissern, ob alles ausgeschaltet ist. Die Eismaschine läuft und ist voll – gut. Er geht zur Stechuhr und stempelt die Karte ab, hängt dann seine Jacke auf, kontrolliert, ob der Safe verschlossen ist, und schiebt sich durch die Schwingtür in den Speiseraum.
Dort ist es dämmerig, graue Lichtstrahlen sickern durch die Jalousien und fallen auf eine glänzende Tischplatte, eine Messingstange, die Segel eines Modellschiffs. An der großen Servicetheke leuchtet ein Kassenmonitor, ein königsblaues Viereck. Bei den Schaltern zögert er, weiß das Halbdunkel zu schätzen. An der Bar funkeln die in den Regalen aufgereihten Flaschen, und aus dem vorderen Teil des Gebäudes dringen das Summen des Filters und das Wasserfoltergetröpfel des Aquariums herüber. Wenn ich nicht aufmache, denkt er, können sie auch nicht schließen. Das ist ein Kindertraum. Egal, was heute passiert, morgen ist das Restaurant so zu wie das Perkins ein Stück die Straße runter (und trotzdem wird er für ein paar Stunden in Uniform aufkreuzen und an die enttäuschten Mittagsgäste Geschenkgutscheine verteilen müssen, als wäre das alles seine Schuld). In den letzten beiden Monaten hat er den Lagerbestand beträchtlich verringert, sodass sie kaum noch Frisches dahaben. Der Konzern wird prüfen, was noch zu gebrauchen ist, und es nach Newington schicken – die Kriegsbeute. Alles Übrige, wie der glasäugige Schwertfisch, wird abtransportiert. Wahrscheinlich wird alles leergeräumt und das Gefilde den Mäusen und Silberfischen überlassen, die er so lange bekämpft hat, ohne dass es einen eindeutigen Sieger gab.
Warum nicht einfach alles abbrennen? Der Nächste, der herkommt, will sowieso neu bauen.
Er knipst das Licht im Hauptraum und dann in der Bar an. Draußen auf dem Gehweg liegt die Zeitung, die Nachrichten bereits veraltet. Er holt sie rein, breitet sie für Kendra flach auf dem Empfangspult aus und streift sich das Gummiband übers Handgelenk wie ein modisches Sportarmband – eine Gewohnheit aus Kindertagen, als er frühmorgens mit seinem Vater und später dann allein den Herald austrug. Vielleicht sind weder das Restaurant noch die Angestellten zu retten, doch für ein Gummiband findet man immer eine Verwendung.
Er lässt die Jalousien unten und zieht sich in die Küche zurück, heizt die große Kaffeemaschine auf, das zischende Herz des Hauses, lauscht ihrem Gluckern und gibt am Safe die Kombination ein. Die Kunstledermappe liegt mitten drin, der Reißverschluss zeigt nach hinten und ist zugezogen, alles genauso wie er es gestern Abend zurückgelassen hat. Aus Gewohnheit blickt er über beide Schultern, bevor er den Schlüssel rausholt. Er ist nie in Versuchung geraten, aber heute scheint das Geld nicht mehr ihm zu gehören. Auch wenn es ihm niemand verübeln könnte, kann er sich nicht vorstellen, in den Regal zu steigen und in Richtung Bridgeport und Deena zu verschwinden. Und außerdem soll es schneien, vom Meer wirbelt ein Nordostwind herüber, bis Mitternacht sollen es acht bis fünfzehn Zentimeter werden. Er malt sich aus, wie er mit all den Lastwagen auf der 95 feststeckt, wie der Staatspolizist mit seiner einem Schlagstock verdammt ähnlichen Taschenlampe zum Fenster reinleuchtet und seinen Namen nennt. Es ist bloß grüne Tinte auf Papier, die Ehre eines Mannes nicht wert, würde seine Oma sagen, aber weil er nie Geld besessen hat, denkt er unwillkürlich, dass es bei der ganzen Sache um nichts anderes als darum geht.
Das Problem ist, dass es keine Vorwarnung gab. Ihre Einnahmen waren okay, nicht toll, aber besser als letztes Jahr – trotz der ganzen Bauarbeiten auf der 9 im Sommer. Man hat ihnen nicht mal die Zahlen vom Herbst mitgeteilt. Das Letzte, was er von der Zentrale erhalten hat, war Tys Anstecknadel zum Zehnjährigen, und dann BUMM, wie ein altes, baufälliges Gebäude, das auf einen Schlag einstürzt, als wär’s ganz aus Sand.
Wie an jedem anderen Tag zählt er die Scheine zweimal nach, verschließt dann die Geldmappe und den Safe wieder, füllt die Schublade der Kasse hinter der Bar und lässt die Niederhaltebügel mit ihren Sprungfedern wie Mausefallen zuschnappen. Als er fertig ist, wäscht er sich wie ein Chirurg die Hände, schrubbt zwischen den Fingern und singt in Gedanken «Happy Birthday». Seit einer Salmonellenvergiftung in Tennessee hat die Zentrale auf eine größere Sorgfalt bei der Lebensmittelhygiene gedrängt, und Manny hat wie bei allen Anordnungen des Konzerns sein Bestes getan, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Er hat Graffiti übertüncht, die cholesterinfreundliche Speisekarte empfohlen und seinen Leuten beigebracht, dass jede Kleinigkeit zählt, wenn man seinen Gästen ein tolles Esserlebnis bereiten will. Er hat alles getan, was man verlangt hat, und doch muss da noch etwas anderes gewesen sein, etwas, das ihm entgangen ist.
Mit dem neuen tragbaren Sensor kontrolliert er die Temperatur in der Kühlvitrine, im Kühlraum und im Gefrierschrank und speichert im Gehen die Zahlen in dem pistolenförmigen Gerät – ein Nachtwächter, der mit seinem Schlüssel für die Zeitschlösser seine Runden macht. Manny geht die Checkliste mit den Vorbereitungen durch, hakt seine Aufgaben der Reihe nach ab und wärmt die Suppen in den beiden Kochkesseln auf. Bei dem Schnee kommt die Fischsuppe bei den Leuten, die den ganzen Morgen im Einkaufszentrum verbringen, bestimmt gut an, die Gumbosuppe eher nicht. Da draußen wird die Hölle los sein.
Es sind noch genau vier Einkaufstage bis Weihnachten, und er hat immer noch keinen Schimmer, was er Deena schenken soll. Nichts für das Baby; die Sachen müssen sie sowieso kaufen. Sie hat ihn schon darauf hingewiesen, dass sie etwas Romantisches haben will – wie die Halskette, die er Jacquie gekauft hat, als sie ein halbes Jahr zusammen waren, aber das ist zu teuer, besonders bei seiner unsicheren Zukunft. Vor kurzem hat sie durchblicken lassen, dass sie heiraten sollten – nicht bloß wegen des Babys, sondern ihretwegen. Immer wenn sie davon anfängt, macht Manny einfach dicht, er weiß auch nicht, warum.
Die Frage verfolgt ihn durch den Lagerraum bis nach vorn. Das Aquarium ist mit einer heimelig blinkenden bunten Lichterkette, schäbigem Goldlametta und zusammengewürfeltem Weihnachtsschmuck behängt, der schon ein Dutzend Nebensaisons auf dem Lagerschrank überstanden hat. Mit einem Netz schöpft er die Wasseroberfläche ab, beobachtet die trägen, in den Ecken versammelten alten Hummer und denkt gerade an Ohrringe, als der Easy Street-Bus in mehrere Schichten zerlegt zwischen den Jalousien vorbeihuscht. Der Fahrer ist gut zehn Minuten zu früh – wahrscheinlich aus Angst vor dem Schnee. Manny legt das tropfende Netz auf den Filter und begibt sich nach hinten, damit Eddie nicht dasteht und an den Türrahmen klopft, wie man’s ihm im Heim beigebracht hat.
Manny geht ans andere Ende der Bar, zieht an der Ecke die Hüfte ein, strafft dann die Schultern, trippelt kurz und stößt die Schwingtür auf. Es dürfte eigentlich keine Überraschung sein, dass sich sein Körper jede Einzelheit im Lobster eingeprägt hat, aber heute wirkt alles fremd und bemerkenswert, kostbar, weil es schon fast verloren ist.
Er erreicht die Laderampe, und Eddie steigt gerade die Stufen des Busses herunter, eine nach der anderen wie ein kleines Kind, den Kopf gebeugt, als wäre das eine Ohr an die Schulter geklebt. Seine Augen quellen vor, vergrößert durch die dicke Kassenbrille, und sein Gesicht ist ständig verzerrt, als koste ihn jede Bewegung Mühe. Wegen seiner Knieprobleme braucht Eddie zum Gehen zwei Krücken. Als er auf die Rampe zukommt, knicken die Beine bei jedem Schritt ein, und er wankt heftig, als könnte er jeden Moment stürzen, seine Krücken zwei nützliche Ausleger, die ihn immer wieder retten. Nicht dass es Manny noch auffallen würde, so geht Eddie eben. Alle paar Jahre muss Manny für die Stiftung eine Beurteilung schreiben, und jedes Mal schreibt er: «Eddie ist der beste Mitarbeiter, den ich habe.» Und obwohl das rührselig und in mancher Hinsicht falsch sein mag (er betrachtet Roz als Königin des Speiseraums und Ty als den Fels in der Küche), ist es kein Zufall, dass Eddie heute als Einziger aus der Mittagsschicht pünktlich ist.
«Big Papi», sagt Eddie.
«El Guapo.»
«Weißt du, wie viel es inzwischen ist? Ich hab’s im Radio gehört.»
«Wie viel?»
«Zweihundert Millionen.»
Manny pfeift. «Wie viele Spielscheine hast du?»
«Ich hab schon fünf. Wenn ich darf, kauf ich mir noch fünf.» Hinter ihm winkt der Fahrer, und Manny winkt zurück und entlässt ihn aus seiner Verantwortung. «Wie viele hast du?»
«Brother, ich hab nicht mal Geld für Geschenke.»
«Vielleicht kannst du mir später welche kaufen?»
«Mal sehen.»
Eddie hängt sich eine Krücke über den Arm und ergreift das Treppengeländer. Manny weiß, dass Eddie es allein schaffen muss, und als er oben angelangt ist, schüttelt ihm Manny die Hand – eine Formalität, die nichts damit zu tun hat, dass heute der letzte Tag ist, doch unwillkürlich begreift er, dass sie dieses Ritual jetzt zum letzten Mal vollziehen. Wie viele andere letzte Rituale erwarten ihn?, fragt er sich. Wird es den ganzen Tag so gehn?
Drinnen beauftragt er Eddie, vorn alles abzustauben – die Jalousien und dann die Balken –, während er das Öl in den Fritteusen wechselt und sie aufheizt. Ob letzter Tag oder nicht, er muss sich an die Checkliste halten und schleppt einen schweren Eimer voll dunkler, stinkender Schmiere nach draußen und über den Parkplatz zum Altfettcontainer. Ein Sperling beobachtet von einem kahlen Baum aus, wie er das Fett hineinschüttet, und reitet auf einem im Wind schaukelnden Zweig. In der Kälte merkt Manny, dass er nicht mehr bekifft ist, dass der private Teil des Tages vorbei ist, auch das zum letzten Mal.
Als er auf dem Rückweg gerade an eine Zigarette denkt, kommt ihm Ty mit seinem aufgemotzten Supra in die Quere und macht hupend einen Satz nach vorn, sodass Manny nicht vorbei kann. Manny hält den tropfenden Eimer hoch, droht, den Rest über die lange Haube zu kippen, und Ty braust auf den freien Platz neben dem Regal.
Ty sieht klasse aus, er trägt eine schwarze Lederjacke wie Manny, aber ein wirkliches gutes Stück, nicht von Men’s Warehouse, Schultern und Taille auf Maß, wie angegossen. Mit seinem dünnen Oberlippenbart und dem kurz geschnittenen Ziegenbärtchen sieht er aus wie Mekhi Phifer in Emergency Room, dasselbe verschmitzte Lächeln.
«Hey, Chef», sagt er und streift einen Autohandschuh ab, um Manny die Hand zu geben, «was machen wir hier eigentlich? Wir müssen doch sowieso früher schließen. Es soll ungefähr einen halben Meter Schnee geben.»
«Acht bis fünfzehn Zentimeter.»
«Vor fünf Sekunden haben sie fünfundzwanzig bis fünfunddreißig angesagt», erwidert er und deutet auf seinen Wagen.
«Ja, und wann hatten sie zum letzten Mal recht?»
Die Wolken hängen direkt über dem Einkaufszentrum, und der Wind frischt auf. Warum sollte es ihm etwas ausmachen, wenn sie früher schließen? Er weiß nicht, aber der Gedanke ist enttäuschend. Es kommt ihm schon seltsam vor, dass er das Restaurant verlässt – als bliebe ihm hier noch irgendetwas zu beweisen, als hätte er noch etwas zu erledigen. Im Olive Garden fängt er als stellvertretender Filialleiter an, und obwohl er weiß, dass sie ihm nicht einfach seine eigene Filiale geben konnten, und obwohl sein Gehalt gleich bleibt, betrachtet er das Ganze als Zurückstufung. Deena ist froh, dass er weniger arbeiten muss. Auch er sollte froh sein.
«Ich kann’s immer noch nicht glauben», sagt Ty. «Das ist derselbe Scheiß, den die Navy mit uns gemacht hat. Ich kann nicht glauben, dass ich mich auch im wirklichen Leben mit so was abfinden muss.»
«Musst du ja nicht», sagt Manny.
«Wenn ich was zu Beißen haben will, schon.»