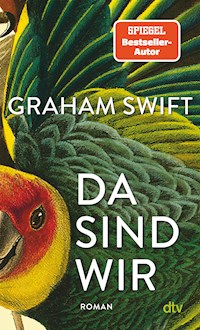9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Feinsinnige Geschichten – mitten aus dem Leben Warum bricht es einem Vater fast das Herz, als er auf seiner wöchentlichen Einkaufstour eine Packung Fusilli in den Wagen legt? Was geht einem Zwölfjährigen durch den Kopf, bevor er seiner Mutter das Küchenmesser klaut? Was hält eine junge Ehefrau davon ab, das beste Hemd ihres Mannes zu waschen? Es sind Alltagsszenen, fragile Augenblicke und Gefühle, die Graham Swift mit klarer Sprache ertastet wie Gebilde aus sehr dünnem Glas. Stets sind es die scheinbar unbedeutenden, fast beiläufigen Begebenheiten, die Duldsamkeit ein Ende setzen, Aufbruch verheißen, Lebenswegen eine neue Richtung geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Graham Swift
England und andere Stories
Erzählungen
Aus dem Englischen von Susanne Höbel
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Candice
L--d! said my mother, what is all this story about?
Laurence Sterne, Tristram Shandy
Aufsteigen in der Welt
Charlie Yates ist ein kleiner kompakter Mann, dessen Erscheinung – wie bei solchen Männern oft der Fall – den Eindruck erweckt, dass er sich in seinen mäßigen Proportionen wohlfühlt. Weniger wohl fühlte er sich früher mit seinem Namen. Eigentlich hieß er Charles Yates, das war der Name, den er auf Formularen eintragen musste, ein Name für reiche Pinkel, ein Witz. Was hatten seine Eltern sich dabei gedacht? Und dann Charlie, auch das war zum Lachen, ein Name für einen Witzbold. Ein echter Charlie. Aber davon konnte er sich nicht frei machen. Charlie Yates. Niemanden sonst schien es zu stören.
Jetzt ist er siebenundfünfzig. Wie es so weit gekommen ist, weiß er nicht genau. Er ist 1951 in Wapping zur Welt gekommen. Das Wapping, an das er sich von damals erinnert, war praktisch noch das Wapping, das Hitler mit Bomben in Trümmer gelegt hatte. Und wenn man es heute sieht!
Er kann es jetzt sehen, weil er und Brenda vor über zwanzig Jahren nach Blackheath gezogen sind. Keine große Entfernung entlang der Luftlinie, aber in anderer Hinsicht ein anderes Land. Sie waren dorthin gezogen, weil sie es konnten. Zur selben Zeit waren auch Don Abbot und Marion dorthin gezogen. Don und Charlie waren alte Freunde und Geschäftspartner. Und Bren und Marion verstanden sich ebenfalls gut.
Jetzt, mit siebenundfünfzig, achtet Charlie darauf, dass er sich fit hält. An einem hellen klaren Sonntagmorgen, möglichst früh, geht er gern joggen. Nicht gerade eine kurze Strecke: quer über die Blackheath bis zum Greenwich Park, dann zwischen den Bäumen hindurch zum höchsten Punkt der Erhebung, von dem aus man den besten Blick auf die Stadt hat. Dort setzt er sich auf eine der Bänke und nimmt die Aussicht in sich auf. Meine Stadt, mein London. Auch jetzt sitzt er da.
Seinem Freund Don würde es nicht einfallen, an einem frühen oder überhaupt am Sonntagmorgen joggen zu gehen, selbst an einem strahlend klaren wie diesem nicht, deshalb sind Charlie und Don nie zusammen joggen gewesen. Charlie geht allein. Aber an jedem zweiten Sonntag, auch wenn Charlie vorher joggen war, treffen sich die beiden und spielen eine Runde Golf. In Shooters Hill oder in Eltham, oder manchmal sogar, wenn sie eingeladen werden, in Blackheath selbst – »Royal Blackheath«. Da wäre Charles eher angemessen.
In Wapping gab es nicht viele Golfplätze.
Beim Joggen trägt Charlie einen hellgrauen Trainingsanzug mit einem blauen Streifen, dazu ordentliche Trainer, nichts, was abgetragen oder billig wäre. Die dünne Goldkette, die er, so scheint es ihm, schon sein ganzes Leben getragen hat, hüpft an seinem Hals auf und ab. Er hat kurz geschnittenes Haar, inzwischen eher weiß als grau, aber es ist weich und fein, und manchmal streichelt seine Frau darüber, als streichelte sie über den Kopf eines Hundes.
Er bleibt eine Weile sitzen, ist aber kaum außer Atem. Mit siebenundfünfzig war sein Vater, Frank Yates, schon ziemlich am Ende. Aber er war auch Werftarbeiter – vielmehr, war es gewesen –, so wie Dons Vater auch. Wenn man die Docks jetzt sieht! Francis Yates. Auch so ein Name für reiche Pinkel.
An einem schönen Vormittag in Wapping vor über fünfzig Jahren haben Charlie Yates und Don Abbot sich auf dem Schulhof der Lea Road Infants’ School kennengelernt, und aus einem unerfindlichen Grund wussten sie beide – ein großer, kräftiger Bengel und ein kleiner Knirps –, dass es eine Sache fürs Leben war. Auch die Lea Roads Infants’ School ist später in Trümmer gelegt worden, allerdings nicht von Bomben.
Für jemanden seiner Größe hat Charlie ziemlich breite Schultern. Wenn er die Ärmel seiner Trainingsjacke (oder die seines roten Kaschmirpullovers beim Golf) nach oben schiebt, sieht man die Tätowierungen an seinen Unterarmen, außerdem fällt auf, dass er für jemanden seiner Größe kräftige Handgelenke und Hände hat. Auch hat er, gemessen an den Ausmaßen seines Gesichts, eine ziemlich große, aber wohlgeformte Nase. Das und seine tiefliegenden Augen geben ihm, besonders wenn er grinst, ein etwas wölfisches Aussehen, womit er früher bei einer bestimmten Sorte Mädchen gut ankam.
Aber Charlie ist der Meinung – und das Joggen, manchmal eher ein leichtes, fließendes Laufen, bestätigt das nur –, dass die Füße am wichtigsten sind. Das Gleichgewicht und die Füße.
Früher einmal, drei oder vier Jahre lang, ist Charlie Boxer gewesen. Große Hände, aber im Grunde kam es auf die Füße an. Bantamgewicht. Er gewann ein paar Boxkämpfe und ist noch heute stolz darauf, dass ihm seine wohlgeformte Nase nie zertrümmert wurde. Einmal hat er auch auf einer Bohrinsel gearbeitet, wo er sich in seiner Blödheit hat tätowieren lassen. Aber jetzt sind Tätowierungen wieder Mode – er geht also mit dem Trend. Und dann ist er Dachdecker geworden. Das war das, was ihm lag. Auf keinen Fall würde er je auf einer Werft arbeiten. Auch besser so.
Dachdecker. Klettern konnte er wie ein Affe. Er hatte den Körperbau dafür. Dann schien es, dass die Dächer immer höher wurden und er mehr als nur Dachdecker war, ohne wirklich damit gerechnet zu haben und ohne zu wissen, wo die Grenze war, wie hoch er gehen konnte.
Er stieg auf in der Welt. Er entdeckte, dass er keine Höhenangst hatte.
Wäre er früher zur Welt gekommen, hätte er Turmarbeiter werden können, aber das war ein Handwerk, und auch ein Wort – wie Werftarbeiter –, das kaum noch im Umlauf war. Wo waren die Kirchtürme? Wo die hohen Schornsteine? Stattdessen waren da plötzlich die anderen Türme, die in die Höhe sprossen, als ginge es um die Wette, und Charlie arbeitete ganz oben, auf den freiliegenden Trägern, ohne jedes Schwindelgefühl, ohne jede Angst. Ein Kopf für Höhen, hieß es, aber Charlie behauptete, es seien die Füße. Man steht einfach da, wo man steht.
Er verdiente gut, Arbeit gab es genug. Manche nannten es Gefahrenzulage. Charlie mochte es nicht Gefahrenzulage nennen, weil das unterstellte, dass die Arbeit gefährlich war, aber er akzeptierte das Grundprinzip: ohne Risiko kein Gewinn. Macht man etwas Besonderes – wie Boxen –, dann kriegt man etwas mehr und kann davon etwas beiseitelegen, statt sich bis Freitag durchhangeln zu müssen. Werde auf keinen Fall Werftarbeiter.
Manche Menschen – eigentlich ziemlich viele der Menschen aus Charlies Bekanntenkreis – wetten gern und setzen ihre Hoffnungen auf Hunde oder Pferde. Charlie hat in seinem ganzen Leben nie gewettet. Stattdessen wurde er ein Vogelmensch und half beim Erbauen von Türmen.
Und da stehen sie und glitzern in der Sonne des frühen Septembertages, die Türme, an denen Charlie Yates mitgebaut hat. Da, hinter den verborgenen Windungen des Flusses, liegt Wapping. Und da ist Stepney, da Limehouse. Die Gegend, die Docklands heißt.
Eines Abends, als es zwischen ihm und Brenda gerade erst anfing, als es noch ungewiss war, hatte Brenda gesagt: »Charlie, du hast schöne Füße.« Das gab den Ausschlag. Das hatte noch nie jemand zu ihm gesagt. Das ging ihm unmittelbar – nein, nicht in die Füße – es ging ihm ins Herz, nicht nur, weil niemand es je zuvor gesagt hatte, sondern auch, weil es die Wahrheit war. Er sagte: »Brenda, an dir ist alles schön.« Und damit war alles besiegelt.
Jetzt gehen Marion und Brenda zusammen auf Einkaufstour. Jetzt fahren sie zweimal im Jahr zu viert in die Ferien, in ferne Gegenden. Letztes Jahr waren es die Malediven. Charlie könnte nicht genau sagen, wo die Malediven sind, aber er ist da gewesen. Man steigt aus dem Flugzeug. Die anderen wollten diesen Winter wieder hin, aber Charlie hatte Bedenken. Irgendwo hatte er gehört, dass die Malediven als eine der ersten Regionen überflutet würden, wenn der Meeresspiegel stieg. Es war unwahrscheinlich, dass es während ihrer Ferien dort passierte. Aber er hatte Bedenken.
Komisch, was für Gefühle man haben konnte. Er hatte keine Angst vor Höhen, aber mit dem Meer war er nie gut klargekommen. Das hatte er begriffen, als er auf der Bohrinsel war. Einmal war genug. Dasselbe traf vielleicht auch auf die Malediven zu, obwohl es eine ganz andere Geschichte war. Aber wenn er ehrlich sein sollte, dann war es ihm genauso recht, mit Don auf ihrem gewohnten Golfplatz eine Runde zu spielen, wie auf den Malediven zu sitzen. Oder sonst wo. Es wäre ihm genauso recht hierzubleiben. Es ist überall das Gleiche, man ist immer in seinem eigenen Körper.
Zu Brenda hatte er gesagt: »Mach dir keine Sorgen, Brenda, bei diesen Füßen.« Als hätten seine Füße kleine Flügel. Aber jeden Abend war er wieder da, an Leib und Seele unversehrt, und schmiegte sich an sie. Ein dreißig Stockwerke hoher Turm auf der Isle of Dogs war – in dieser Hinsicht wie in jeder anderen – nicht dasselbe, wie auf einer Bohrinsel in der Nordsee zu hocken.
Er sagte: »Bist du nicht froh, Bren?«
»Froh, weshalb?«
»Froh, dass ich nicht auf einer Bohrinsel bin.«
Aber ihr gegenüber war es nicht fair, die Aussicht, dass er auf unabsehbare Zeit jeden Tag losging, um im Himmel herumzuklettern, das wusste er selbst. Er sagte, wenn er genug auf die hohe Kante gelegt hätte, würde er sich nach etwas anderem umsehen. Er hatte keine Ahnung, was das sein würde. Er würde zur Erde zurückkommen.
Irgendwann begriff er, das Risiko beherrschte nicht nur den Bau der Türme, es beherrschte auch das Innere der Türme. Es war Risiko, drinnen wie draußen. Sie wurden gebaut, die meisten wenigstens, für Leute, die mit ihren eigenen geheimnisvollen Gefahrenzulagen handelten. Gut, das war ihre Sache. Er nahm sein Geld und akzeptierte das Risiko, dass er eines Tages ins Leere treten könnte – obwohl das nie geschah.
Aber eines Tages ließ er sich auf ein neues Risiko ein. Wieder folgte er einer wegweisenden Eingebung.
Es war offensichtlich, wenn man es erst mal gesehen hatte, vielleicht ist das mit allen großen Dingen so. Es war so offensichtlich, dass der zweite Gedanke unmittelbar folgte: Wenn es so offensichtlich war, wie vielen anderen war das auch schon aufgefallen? Aber es war alles noch am Anfang. Immer mehr Türme wurden gebaut. Und woraus waren diese Türme gemacht – oder wie sah das aus, woraus sie gemacht waren? Was sah man manchmal nicht, obwohl es direkt vor einem war?
Er ging zu Don, der damals – was machte Don Abbott damals eigentlich? Er machte dies und jenes, war ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen. Vielleicht war er auf der Gewinnerstraße, vielleicht war alles nur Gerede. Sie trafen sich auf einen Drink im Queen Victoria. Don hörte zu. Er musterte seinen kleinen Freund von oben bis unten. Dann sprach er, als hätte er nicht richtig zugehört, aber das war typisch Don.
»Und was schlägst du vor, Charlie? Dass wir beide Fensterputzer werden?«
»Nein, Don. Mach dich nicht über mich lustig.«
Dann redeten sie weiter.
Das zumindest war die Geschichte, die sie zum Besten gaben, die Standardgeschichte. In den Bars der Golfclubs. In den Hotelbars, am blauen Pool, überall in der Welt.
»Ich bin Don, das ist Charlie. Wir sind Fensterputzer.«
Er blickt zu den Türmen hinüber. Er hat bei der Erbauung mitgeholfen. Und dann haben er und Don gut zwanzig Jahre lang dafür gesorgt, dass sie glänzten.
Don hatte gesagt: »Eins musst du wissen, Charlie. Ich steige nie in eins von diesen – Dingern, ich will da nicht hoch. Ich bin nicht so ein Boss, der allen zeigen will, dass er die Arbeit selbst machen kann.«
»Gut, das kannst du mir überlassen. Ich bin derjenige, der weiß, wovon er redet. Aber versteh mich nicht falsch, Don. Ich werde es genauso machen wie du. Das habe ich Brenda versprochen.«
Abbot und Yates. Kein Streit über die alphabetische Reihenfolge. Wir putzen Fenster, aber nicht irgendwelche Fenster. Es dauerte eine Weile, bis es mit der Sache aufwärts ging, sozusagen, aber dann … So viel glitzerndes Glas.
Jetzt wohnen sie inmitten der vornehmen Leute von Blackheath. Und nicht nur er und Bren und Don und Marion, sondern auch ihre Kinder, jeweils ein Junge und ein Mädchen. Die gar keine Kinder mehr sind. Sie sind in Blackheath aufgewachsen und zur Schule gegangen, und dann sind sie alle, mit einer Ausnahme, auf die Universität gegangen. Universität! Das haben sie damals geschickt gemacht, als sie über die Themse nach Süden gezogen sind.
Die eine Ausnahme war Sebastian, der Sohn von Don und Marion. Sebastian! Wie sind Don und Marion bloß auf diesen Namen gekommen? Zum Glück nannten alle ihn Seb. Seb hatte, kaum, dass er sechzehn war, wenigstens schien es so, in einem der Türme zu arbeiten angefangen. Für eine New Yorker Bank. Seb verdiente jetzt, mit dreiundzwanzig, richtig viel Geld, wahnsinnig viel Geld – kam ganz drauf an, wie man es betrachtete –, so viel, dass Don und Charlie daneben ziemlich lächerlich aussahen. Daneben sahen auch Vorsätze, wie die Schule abzuschließen und zur Universität zu gehen, ziemlich lächerlich aus. Oder, wie Don es ausdrückte: Seb war Straßenhändler, allerdings war Charlie sich nie ganz sicher, wie Don das meinte. Ein Straßenhändler, der weitergekommen war, weiter und nach oben.
Charlie blickt zu den Türmen hinüber. Sein eigener Sohn, Ian, studiert in Southampton Meeresbiologie, und das weckt in Charlie das Gefühl – aber anders als bei Don wegen Seb –, nicht mithalten zu können. Charlie und Don konnten sagen: »Mein Alter war Werftarbeiter.« Was sollten sie sonst sagen? Und was würden ihre Kinder sagen? »Mein Alter war Fensterputzer«? Sie würden nicht »mein Alter« sagen. Außer vielleicht Seb. Seb würde es vielleicht sagen und dabei lachen.
Ian, der in Southampton ist, kann nicht denken: »Meine Stadt, mein London.« Er kann nicht zeigen und sagen: »Siehst du, da drüben?« Wenn Charlie und Brenda zu Ian nach Southampton fahren, gibt Charlie sich ganz bescheiden und hört zu, während sein Sohn erzählt. Vielleicht kam die Idee mit den Malediven von Ian. Bestimmt sogar. Aber es ist nicht schwer, bescheiden zu sein. Vielleicht ist es auch keine Bescheidenheit. Manchmal, wenn Ian erzählt, spürt Charlie kurz etwas in sich aufwallen. Wie das Gefühl an einem Sonntagmorgen mit Don, wenn er einen richtig guten Schlag ausgeführt hat. »Was für ein Schlag, Charlie.« Wie das Gefühl, das er einmal vor Jahren hatte, als der Schiedsrichter den Arm hob und seinen mit in die Höhe zog.
Mein Sohn Ian. Der Meeresbiologe.
Er sitzt in seinem Trainingsanzug auf der Bank und spürt, wie das Blut durch seine Adern pulsiert, und fühlt sich, wie er es nicht anders kennt, wohl in seiner Haut. Charlie ist Geschäftsmann (ein Wort, das er bisweilen merkwürdig findet), und dazu ein erfolgreicher, trotzdem würde er sagen, das Wichtigste ist der eigene Körper. Den hat man mitbekommen, man hat diesen Körper, und sich daran zu freuen und ihm zu vertrauen, ist schlicht und einfach das größte Geschenk des Lebens.
Deswegen schien es ihm seltsam, dass es den meisten Menschen ein Bedürfnis und ein Wunsch war – fast wie eine Art Weltgesetz –, in den eigenen Kopf zu steigen, in das oberste Abteil ihres Körpers, und dort zu leben, in und durch ihren Kopf zu leben, wo doch die meisten Menschen (er war die Ausnahme, die die Regel bestätigte) Höhenangst hatten.
Er blickt zu den Türmen hinüber, eine Hand als Schirm über den Augen gegen das Blenden, und lächelt. Zumindest sieht es aus wie ein Lächeln. Nur Brenda wüsste, dass es kein Lächeln ist. Nur Brenda würde die beiden kleinen Falten in seinen Mundwinkeln sehen und diese Widersprüchlichkeit an ihm erkennen. Sein Gesicht kennt kein Stirnrunzeln. Wenn Charlie besorgt oder verwirrt ist, lächelt er, aber anders.
Und er ist besorgt, schon seit einiger Zeit, besorgt um seinen Freund Don, wegen dessen zunehmender Körperfülle. Don war schon immer ein Mann von kräftiger Gestalt, mit kräftigem Knochenbau, aber nicht fett oder dick oder behäbig. Doch jetzt nimmt er zu, er geht immer mehr in die Breite. Es wird als eine Art Witz erzählt – dass er Pfunde zulegt –, ein Witz, mit dem Don sich über sich selbst lustig macht, aber eigentlich ist es kein Witz, und wenn Charlie mit Don Golf spielt, weiß er, dass es nicht nur zum Vergnügen ist, sondern dass es wichtig ist, Don in Bewegung zu halten. Sie sollten jeden Sonntag spielen. Sie sollten auch die restlichen neun Löcher spielen, statt sich in die Bar zu setzen.
Er weiß, dass es keinen Sinn hat, Don zum Joggen aufzufordern, es war immer schon sinnlos gewesen. Und was für ein Bild würde das jetzt abgeben, wie sollte das gehen: Don, der sich neben ihm abmüht, schwitzend und schnaubend, während er, Charlie, neben ihm auf Zehenspitzen federt? Inzwischen kommt es ihm auch irgendwie verkehrt vor, dass er allein joggen geht, während Don das Gewichtsproblem hat – was nicht nur völlig unlogisch, sondern auch ein bisschen abergläubisch ist. So wie der Gedanke, man solle besser nicht auf die Malediven reisen, weil die Inseln eines Tages untergehen könnten.
Aber Charlie macht sich Sorgen um Don. Es ist, als würde sich all das Geld jetzt in Fett verwandeln. Vor fünfzig Jahren und mehr hatte Charlie gedacht, weil er selbst ein mageres Kerlchen war, könnte der größere Junge ihn unter seine Fittiche nehmen. Und so war es auch. Wohingegen man jetzt sagen könnte, Don müsse Charlie endlos dankbar sein. Aber aus seiner seltsamen Besorgnis heraus hat Charlie das Bedürfnis, als wäre es eine unbeglichene Schuld, seinen immer massiger werdenden Freund unter seine Fittiche zu nehmen. Wie das?
Und jetzt hat er eine neue Sorge, die könnte sogar die erste beiseiteschieben. Er muss demnächst mit Don darüber sprechen. Wenn sie in knapp zwei Stunden ihre Runde Golf spielen, wird Don ihm berichten, was er alles darüber weiß. Sieht ganz so aus, als würden sie sich weder mit Dons Gewichtsproblem noch mit dem Golfspiel befassen können. Obwohl es ein so klarer Morgen ist.
Charlie ist Geschäftsmann, ja, so kann man ihn rechtmäßig bezeichnen, aber obwohl er gern hier sitzt und zu den Türmen hinüberblickt, interessiert er sich nicht dafür, was in ihnen vorgeht. Das ist deren Geschäft, er kümmert sich nur um die Fenster. Aber Don hält die Ohren offen, er hat sogar Insider-Ohren, wegen Seb. Manchmal hat Charlie die absurde Vorstellung, dass Don in der Gondel die Fenster putzt, zum Beispiel in der fünfundzwanzigsten Etage – was er allerdings niemals könnte (Charlie schon, ohne Weiteres) – und seinem Sohn, der drinnen sitzt, zuwinkt.
Don hatte angerufen und gesagt: »Seb hat Probleme. Echt große Probleme.«
Probleme? Verdiente Seb nicht Summen so groß wie Telefonnummern lang waren? Sahen sie alle nicht lächerlich aus neben Seb?
Don hatte gesagt: »Ihm wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Ihm und allen anderen auch. Da kommt was ganz Großes auf uns zu, groß und übel. Wenn du mich fragst, nach dem, was Seb gesagt hat, hat nicht nur Seb Probleme, sondern die ganze verdammte Welt.«
Klang Don betrunken? Nein. Charlie hatte nichts zu Brenda gesagt, nur, dass Don wegen Sonntag angerufen habe, obwohl Brenda wahrscheinlich gedacht hatte: Warum muss er deswegen anrufen? Es war Samstagabend. In den Spätnachrichten hörte Charlie nichts darüber. Später, als sie sich aneinanderschmiegten, sagte er: »Bist du nicht froh, Bren?«
»Froh, weshalb?«
»Dass ich nicht Meeresbiologe bin?«
»Wovon redest du?«
Das wusste er selbst nicht so recht. Irgendwas war in Dons Stimme, irgendwas war da in dem, wie er »die ganze verdammte Welt« sagte.
Am Morgen folgte er seinem Gefühl und stand auf, um wie üblich joggen zu gehen; er wollte in Bewegung sein, wollte bereit sein – seinen Verstand vorbereiten, in dem er seinen Körper vorbereitete. Und es war ein so schöner Morgen, Anfang September, ein Hauch von Herbst in der Luft.
Jetzt steht er auf und sieht ein letztes Mal zu den Türmen hinüber. Sie funkeln in seine Richtung. Dann wendet er sich ab und joggt weiter, zwischen den glitzernden Bäumen hindurch, und fühlt sich mit siebenundfünfzig so leichtfüßig wie damals, als er siebzehn war.
Wunder gibt es immer wieder
Als Aaron und ich jünger waren, haben wir Frauen nachgestellt. Das sagt man so. Wie oft sieht man denn, dass ein Mann einer Frau tatsächlich nachstellt, dass er, sagen wir, zehn Meter hinter ihr herläuft und sie langsam einholt? Wir waren beide Läufer, buchstäblich – wir waren Sportler. Ich machte Hürdenlauf. Wir haben zusammen am College Sport studiert, und Mädchen gehörten zu unserer Sportausbildung dazu. Ich gebe ohne Weiteres zu, dass Aaron darin besser war als ich. Bei ihm war es eher so, dass die Frauen ihm nachstellten oder dass sie sich an ihn ranmachten. Er war der Typ dafür. Ich kriegte immer die Abgelegten. Aber auch Aarons Abgelegte waren oft nicht schlecht, und schließlich habe ich eine von ihnen geheiratet und mich mit ihr häuslich niedergelassen. Patti.
Danach war ich nicht mehr so viel mit Aaron zusammen, ja, wir hörten nur noch selten voneinander. Vielleicht dachte er, ich hätte ihn im Stich gelassen, als Patti und ich heirateten und uns häuslich niederließen. So ist das eben.
Vor zehn Jahren hätte ich es nicht so gesagt, aber ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, für die das Leben wie ein Buch ist, mit Kapiteln. In einem Kapitel treibt man sich rum, dann heiratet man und kriegt Kinder, kauft ein Haus und so weiter. Ich bin nicht wie Aaron. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher Aaron gelesen hat. Aber so ist das beim Sport, da geht es nicht ums Lesen.
Die Möglichkeit gab es jedenfalls. Wenn man die Ausbildung zum Sportlehrer durchlief und abschloss, konnte man eine feste Stelle finden und sich sein Leben einrichten. Man hatte diese Chance. Gleichzeitig waren wir auch Sportler.
Ich machte mir keine Illusionen, an großen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Ich war einfach gut im Hürdenlauf, Hürdenlauf machte mir enorm viel Spaß. Aaron sagte immer: »Das ist nichts für mich. Wenn ich laufe, will ich laufen. Ich will nicht auf etwas zulaufen, das mich zu Fall bringen kann.«
Ich sagte nicht: »Ist das nicht auch bei Frauen so?«
Sie stellten ihm ein Bein und brachten ihn zu Fall. Und sie stellten ihm nach, weil er eine Ausstrahlung hatte. Es war ein Teufelskreis. Aber ich glaube – ich spreche hier nur vom Laufen –, Aaron hatte das Zeug für Wettkämpfe. Das sage ich als qualifizierter Sportlehrer.
Jedenfalls kam die Zeit – das liegt jetzt auch schon Jahre zurück –, als ich mich mit Patti häuslich niedergelassen hatte und Aaron und ich uns praktisch aus den Augen verloren hatten. Ab und zu stellten Patti und ich Mutmaßungen zum Thema »Was Aaron wohl macht?« an. Ich war dann immer ein bisschen nervös, weil Patti ja eine von Aarons Abgelegten war. Manchmal dachte ich, das sei vielleicht der Grund, warum zwischen mir und Aaron Sendepause war. Es lag an Patti, an Aaron, an mir. Ich weiß es nicht. Einmal – es war Sonntag, wir saßen beim Frühstück – sagte ich zu Patti: »Ich vermute, die Frauen machen ihm zu schaffen.« Ich hätte auch »die Jahre« sagen können. Es war nur beiläufig, ein privater Witz, aber vielleicht etwas sorglos dahingesagt.
Patti reagierte jedenfalls nicht darauf. Sie sagte: »Mmhm, könnte ich mir auch vorstellen.« Sie biss von ihrem Toast ab. Dann sagte sie: »Wenn du dir Sorgen um ihn machst, ruf ihn an, besuch ihn.« Es klang wie eine Herausforderung.
Damals war sie mit Daryl schwanger, unserem Ältesten. Sie hatte eine Gier nach Orangenmarmelade! Vielleicht dachte sie: Wenn ihm nach einem letzten unbeschwerten Männerabend ist, dann ist jetzt die Zeit dafür. Inzwischen haben wir zwei Jungen, Daryl und Warren, zwei lebhafte Kinder. Und viele Abende zu Hause.
Jedenfalls habe ich ihn nicht angerufen. Aber eines Tages, Jahre später, kriege ich einen Anruf von Aaron, aus heiterem Himmel. Er klingt wie der Aaron von früher, aber er klingt auch ein bisschen verlegen. Es stellt sich heraus, dass er anruft, um mir zu sagen, dass er heiratet. Ich warte einen Moment, falls er mir einen Bären aufbinden will. Dann warte ich noch länger, falls er einen Witz darüber machen will. Ich warte, dass er sagt: »Okay, alter Freund, lach nicht.« Aber der einzige Witz ist der, dass er flüstert, als wäre es eine hoch geheime Information, die er nur mir anvertrauen kann.
Dann sagt er, er möchte, dass ich – mit Patti natürlich – zur Hochzeit komme. Um das gleich klarzumachen, sagt er, keine große Sache, nur Standesamt, nur sie beide. Aber natürlich braucht man Trauzeugen. Würden Patti und ich kommen und ihre Trauzeugen sein?
Die ganze Zeit, während ich natürlich meine Überraschung unterdrücken muss, denke ich: Das hätte er mir gar nicht erzählen müssen – jeder kann Trauzeuge sein –, aber irgendwie kommt es mir so vor, als glaubte er, wenn er es mir erzählt und ich der Trauzeuge bin, dann braucht er es niemandem sonst zu erzählen. Ich fühle mich geehrt, und ich fühle mich genötigt, aber wie kann ich nicht Ja sagen? Auch wenn das anscheinend eine Fahrt nach Birmingham bedeutet. Dort lebt er jetzt. Und ist – man stelle sich vor – Sportlehrer.
Ich sage: »Ja, natürlich.« Bevor ich mit Patti gesprochen habe. Außerdem würde ich am liebsten sagen: »Sei ganz beruhigt, Aaron. Ich sage keinem etwas.«
Ich sage: »Und wie heißt sie?«
»Wanda.«
»Wanda«, sage ich und versuche mir ein Bild von Wanda zu machen. Ich sage nicht: »Ist sie schwanger?«
Zum Glück denkt Patti mehr oder weniger das Gleiche wie ich: Wie auch nicht? Vielleicht denkt sie auch: Müssen wir wirklich? Aber sie wirkt aufgeregt und interessiert, sie macht sogar einen Witz, einen ziemlich guten dazu: »Na, Wanda gibt es immer wieder.«
Wir machen also mit bei dieser »nur wir zwei, keine große Sache«. Die Jungen können wir bei Pattis Eltern lassen. Wir sind schon so weit, dass wir ein Hotel buchen wollen. Aber Aaron sagt: »Nicht nötig, alter Freund, ihr könnt bei uns schlafen.« Darüber müssen wir erst mal nachdenken. Ich möchte es nicht so deutlich sagen, aber wir könnten Aarons und Wandas Hochzeitsnacht stören. Schließlich sind wir keine Studenten mehr.
Aber schon bald kapiere ich, dass außer der Sache am Standesamt und ein paar Drinks und einem Essen im Restaurant nichts Besonderes vorgesehen ist. Es wird keine Hochzeitsreise geben. Anscheinend leben Aaron und Wanda schon seit einer Weile zusammen. In ihrer Wohnung gebe es ein Gästezimmer, in dem Patti und ich schlafen können. Sie hätten einfach beschlossen, es sei Zeit zum Heiraten.
»Okay«, sage ich und wünschte, es wäre leichter, auf einem Hotelzimmer zu bestehen. Allerdings, bei zwei Kindern müssen Patti und ich auf das Geld achten. Aber am meisten beschäftigt mich der Gedanke, und Patti genauso: Was ist das für eine, diese Wanda? Und angesichts all der Jahre, die dazwischenliegen: Was für einer ist Aaron jetzt?
Also, kann sein, dass es ein schlechtes Licht auf mich wirft, aber ich muss sagen, Wanda war eine Enttäuschung. Wenigstens im ersten Moment. Eine Überraschung und eine Enttäuschung. Ich will keine Missverständnisse aufkommen lassen. Ich will nicht sagen, dass sie – nicht völlig akzeptabel war. Aber wenn die ganzen Jahre, in denen Aaron es so wild getrieben hat, so eine Art Auswahlprozess waren, bei dem er am Ende die perfekte Frau finden würde – also, dann war Wanda nichts Besonderes.
Ich hatte sogar das Gefühl – auch das lässt mich in keinem besonders guten Licht erscheinen –, dass ich mit Patti eine bessere Wahl getroffen hatte.
Patti und ich haben nicht darüber gesprochen, aber ich spürte, dass es ihr ähnlich ging und sie sich entspannte. Bei ihr stand ich jetzt in einem guten Licht. Ich glaube, Patti hatte befürchtet, wir würden eine Frau kennenlernen, der ich das ganze Wochenende, gegen meinen Willen, hinterherhecheln würde. Und dass das der eigentliche Zweck der Übung war. Dass Aaron mit seiner Siegestrophäe angeben wollte.
Ehrlich gesagt war das auch meine Befürchtung.
Wanda war nicht gerade üppig und damit ganz anders als der Typ Frau, den Aaron früher gemocht hatte, wenn ich mich richtig erinnerte. Sie war nicht mager, aber sie war, also, drahtig und hatte kräftige Schultern. Und obwohl man sich bei ihrem Anblick seltsam wohlfühlte und sogar den Wunsch hatte zu lachen, war es doch kein Gesicht, das einen faszinierte. Manchmal sah es sogar ein bisschen verhärmt und abweisend aus.
Sie war keine Schönheit, aber die Art und Weise, wie sie sich hielt und bewegte, hatte eine Energie, eine Intensität. Ich mochte sie. Ich war froh, dass ich nicht scharf auf sie war. Und kurz darauf dämmerte es mir.
Ich wartete auf einen Moment, als ich mit Aaron allein war, und sagte: »Sie ist Läuferin, oder?« Knapp eine Stunde war vergangen, seit die beiden Mann und Frau geworden waren.
»Ich hoffe nur, sie läuft nicht weg, nach dem, was wir gerade gemacht haben.«
»Du weißt, was ich meine.«
»Ich weiß, was du meinst.« Ein Glitzern war in seine Augen getreten. Wir standen an der Bar und holten Nachschub.
»Genau«, sagte er. »Vierhundert. Vielleicht achthundert.« Er musterte mich kurz. »Vielleicht Hürdenlauf. Sie muss noch rauskriegen, wo ihre Stärke liegt.« Dann sagte er mit einem gewissen Stolz in der Stimme, wobei er quer durch den Raum zu seiner neuen Frau hinüberblickte und ihr zuzwinkerte: »Genau, Läuferin. Sie hat noch was vor. Das Gleiche wie eben?«
Und Aaron selbst, wie sah er aus? Also, gut – in dem Moment sogar sehr gut –, obwohl ich die Spuren der Jahre sehen konnte. Sie hatten die Kanten abgeschliffen, ihm ein bisschen von dem Glanz genommen. Sodass ich dachte: Wie er wohl in fünf Jahren aussehen wird? Und dann dachte ich: Er denkt bestimmt dasselbe über mich.
Nur dass ich mir nichts vormachte, und ich hatte auch nicht gerade erst geheiratet, sondern war Vater zweier Kinder. Und vielleicht war meine Sichtweise immer schon eine andere gewesen. Ich helfe Menschen, fit fürs Leben zu bleiben, und halte ich mich selbst fit, aber es gibt Grenzen, und wir werden alle nicht jünger. Deshalb treffe ich mich in letzter Zeit oft mit einem Mann, der Jarvis heißt und ein Unternehmen für Sportbekleidung aufziehen will. Deshalb habe ich vor Kurzem einen Kurs in Unternehmensführung gemacht. Das ist mein Plan für alle Fälle. Den Jungen und Patti zuliebe. Mir zuliebe.
Ich hätte Hürdenläufer werden können? Vielleicht. Aber ich konnte die Hürden auf dem Weg dahin sehen, das habe ich einmal zu Patti gesagt.
Trotzdem, die Menschen erreichen ihre Bestform, davon bin ich überzeugt. Sie schöpfen ihre Fähigkeiten aus. Es gibt das Buch mit den Kapiteln, aber es gibt da noch etwas anderes. Wir erreichen unsere Bestform, dann überschreiten wir sie. Daran ist nichts zu ändern, und wenn man gar nicht weiß, dass man die Möglichkeit zu einer Bestform in sich hat, ist das traurig. In der Welt des Sports sieht man das ziemlich oft. Man sieht die Gelegenheiten, und man sieht eine Menge verpasster Gelegenheiten.
Was ich damit meine, ist Folgendes: Man hätte denken können, dass für Aaron und Wanda ihr Hochzeitstag der Moment war, an dem sie zur Bestform aufliefen. Aber obwohl der Tag wichtig war, lag ihre Bestform woanders. Vielleicht wusste Aaron, dass er seine schon überschritten hatte.
Jedenfalls, nach ein paar Drinks – die Zeremonie war um drei gewesen – kehrten wir mit ihnen in ihre Wohnung zurück, bevor wir zum Essen ausgehen wollten. Die Wohnung war ganz oben im Haus, auf zwei Ebenen, und unser Zimmer war ein winziges Gästezimmer unterm Dach, aber ich war froh, dass wir nicht unmittelbar neben ihrem Schlafzimmer schlafen mussten.
Mehr als froh. Wir gingen nach oben, auf der Treppe war Patti vor mir. Sie hatte sich für den Tag (vielleicht auch für Aaron, aber das lasse ich mal durchgehen) hübsch angezogen. Ich trug unsere Tasche mit den Übernachtungssachen, konnte aber meine freie Hand nicht im Zaum halten. Ich musste Patti einfach gründlich begrapschen. Und kaum hatten wir die Tür hinter uns zugemacht, um uns »frisch zu machen«, wie Aaron gesagt hatte, fielen wir übereinander her, hastig und atemlos, praktisch im Stehen. Ein kaltes Dachzimmer in Birmingham, draußen Dunkelheit. Mit hochgerafftem Rock hielt Patti sich an der Stuhllehne fest. Keine Kinder, die uns stören konnten. Unter uns zwei Frischvermählte. Wunder gibt es immer wieder.
Wir hatten es richtig gut, ich meine, wir hatten es auch mit Aaron und Wanda gut. Weil wir ihnen voraus waren – schließlich waren wir schon fünf Jahre verheiratet und hatten zwei Kinder –, war das Zusammensein mit Aaron und Wanda wie das mit zwei Kindern. Und weil unsere eigenen Kinder nicht da waren, kamen wir uns selbst auch wie zwei Kinder vor.
Natürlich, als wir später nach Hause kamen – es war ja ihre Hochzeitsnacht –, hätte die Tatsache, dass unser Zimmer über ihrem war, trotzdem peinlich sein können. Aber wir hatten alle getrunken, und Patti und ich – na ja, wir waren den beiden ja voraus. Ich erinnere mich nur noch, dass wir eng aneinanderrückten, diesmal um der Wärme willen, dann bin ich eingeschlafen.
Als ich aufwachte, hörte ich lauter Geräusche von unten. Ich meine kein Liebestreiben. Ich meine Geräusche auf der Treppe und dann im Flur unten. Geräusche von Leuten, die auf sind und was vorhaben – früh am Sonntagmorgen im Januar. Am Tag nach ihrer Hochzeit.
Ich hörte gedämpfte Stimmen. Ich glaubte zu verstehen: »Alles klar, Wan? Schlüssel?« Dann hörte ich, wie jemand die Haustür in dem Bemühen, leise zu sein, schloss. Dann hörte ich Stimmen draußen auf der Straße. Mir kam der Gedanke, dass Aaron und Wanda vielleicht noch betrunken waren. Und dann musste ich einfach aufstehen und einen Blick durch den Vorhangspalt unseres kleinen Mansardenfensters werfen.
Ich musste daran denken, wie ich einmal zu Hause aufgestanden war, weil ich seltsame Geräusche gehört hatte. Es waren bloß zwei Füchse im Licht der Straßenlaterne, die mit einem umgestürzten Mülleimer ihr Unwesen trieben. Ich weiß, dass mir damals der Gedanke kam, mit der Jugend sei es jetzt vorbei und ich sei jemand, der sich von seltsamen nächtlichen Geräuschen verunsichern ließ. Diesmal sah ich unter der Straßenlaterne Aaron und Wanda. Zu sagen, sie trieben ihr Unwesen, wäre nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch gewesen. Sie trugen Trainingsanzüge und Sportschuhe. Am Morgen nach ihrer Hochzeit, bei Dunkelheit und eisiger Kälte, wollten sie laufen gehen. Aber andererseits alberten sie auch herum, so als könnten sie sich noch nicht zum ernsthaften Laufen entschließen. Sie lachten. Auf ihre Art waren sie wie zwei Füchse. Nicht nur einmal küssten und begrapschten sie sich. Ich dachte: Das könnten sie doch auch im warmen Bett machen.
Aber ich sah, dass Aaron an einem Band eine Stoppuhr um den Hals trug. Dann nahmen sie tatsächlich Aufstellung, gingen halb in die Hocke, als wären sie an der Startlinie. Aaron hielt die Stoppuhr in der Hand und blickte darauf, dann spannte Wanda die Muskeln an, und Aaron sagte etwas. Ich bin mir sicher, dass ich »Fertig! Los!« hörte. Wanda rannte los, Aaron guckte weiter auf die Uhr – vielleicht bekam sie einen Vorsprung von zehn Sekunden –, dann rannte er auch los.
Hatte er sie herausgefordert oder sie ihn? Das werde ich nie erfahren. Auch nicht, über welche Entfernung der Lauf ging oder welche Strecke sie liefen. Es war halb sieben.
Jetzt ist Wanda eine Achthundert-Meter-Läuferin. In der obersten Riege. Bis zu den Olympischen Spielen in London ist es kein Jahr mehr. Und sie ist Aarons Angetraute.
Ich drehte mich vom Fenster weg. Patti war wach. Sie knipste die Nachttischlampe an und sah mich verdutzt an. »Was machst du da? Was ist los?«
Da fiel mir der Ausdruck wieder ein. Ich musste lachen. Ich sagte: »Ich habe gerade gesehen, wie Aaron einer Frau nachstellt.«
Ich erklärte es ihr. Ich erklärte, was ich gehört und gesehen hatte, und ich nahm an, dass wir jetzt schmunzelnd und kopfschüttelnd über dieses merkwürdige Verhalten der beiden nach der Hochzeit sprechen würden. Oder dass dies der Moment für unsere gründliche Analyse der ganzen Aaron-Wanda-Sache wäre.
Aber Patti sagte: »Heißt das, sie sind nicht hier, nicht unter uns in ihrem Zimmer? Und wir sind allein im Haus?«
Und damit packte sie mein Handgelenk und zog mich wieder ins Bett.
Leute sind Leben
»Aber Sie haben Freunde«, sagte ich.
Ich weiß nicht, warum ich das sagte. Es war zwischen Sagen und Fragen.
»Freunde?«, fragte er.
»Freunde. Sie wissen schon.« Er war der letzte Kunde an diesem Tag. Ich hatte Hassan schon gesagt, er solle das Schild an der Tür umdrehen. Ich war müde, aber manchmal ist der letzte Kunde am Tag anders, und sei es nur, weil er der Letzte ist. Es war kurz vor sieben und schon dunkel.
Ich schnitt weiter.
»Freunde«, sagte er, als hätte er das Wort noch nie gehört. Dann schwieg er. »Ich habe Treffen«, sagte er.
Jetzt war ich dran. »Treffen?«
»Treffen. Ich kenne Leute und treffe mich mit ihnen. Leute, die ich seit Langem kenne, aber ich treffe mich nur mit ihnen. Sie wissen schon. Die Zeit vergeht, dann treffen wir uns, auf ein Bier oder so. Dann vergeht wieder Zeit. Sind das Freunde?«
Ich war mir nicht sicher, ob das Sagen oder Fragen war.
»Na ja«, sagte ich.
Vielleicht meinte ich mit Freunden nichts anderes, sondern genau das, was er gerade gesagt hatte. Leute, mit denen man reden konnte. Leute, mit denen er reden konnte.
»Na ja«, sagte ich.
Nicht jeden Tag kommt jemand rein und teilt einem mit, dass seit dem letzten Mal seine Mutter gestorben ist. Und der das so ausdrückt: »Das sind jetzt beide. Letztes Jahr mein Dad, letzte Woche meine Mum.«
Also, auf jeden Fall war das Sagen.
Das mit seinem Vater hatte ich nicht gewusst, oder ich konnte mich nicht daran erinnern.
»Das wusste ich nicht«, sagte ich. »Das von beiden.«
Und bisher hatte ich gar nicht gewusst, wie seine Situation in Wahrheit aussah. Er musste es nicht sagen, ich brauchte ihn nicht zu fragen. Ich sah es seinem Gesicht im Spiegel an, an der Art und Weise, wie er sein eigenes Gesicht im Spiegel ansah.
»Na ja, es muss ja passieren«, sagte ich, »irgendwann.« Ich hätte noch sagen können: »In unserem Alter«, aber das sagte ich nicht.
Man erkennt etwas an der Art und Weise, wie Menschen ihr eigenes Gesicht ansehen. Das tun sie nicht oft, und sie wollen es auch nicht, aber in einem Friseurladen gibt es sonst nicht viel zu tun. In einem Café bezahlen die Leute dafür, dass sie aus dem Fenster gucken, wo die Welt an ihnen vorüberzieht. In einem Friseurladen bezahlen sie dafür, dass sie sich selbst ins Gesicht gucken, und man sieht, was mit ihnen los ist, wenn sie das tun.
Man sieht nicht viel, wenn man von oben auf einen Kopf blickt.
Obwohl, manchmal denke ich: Gleich hier, unter meinen Fingern, ist der Schädel und das Gehirn und jeder Gedanke, der darin enthalten ist.
Dieser Mann, so wie er sich im Spiegel ansah, erzählte mir, dass er mit seinen Eltern – und für seine Eltern – gelebt hatte, sein Leben lang. Manche Männer sind große Kinder. Damit ist alles gesagt. Er war bestimmt über sechzig. Einer von diesen großen, schweren, aber weichen Typen. Und jetzt erzählte er mir, dass er ganz allein auf der Welt war.
Ich schnitt weiter. Ich dachte: Und? Was kann ich da tun? Ich schneide Haare.
»Trotzdem, ist ganz schön schwer«, sagte ich. »Wie alt – Ihre Mutter?«
»Dreiundachtzig«, sagte er.
»Dreiundachtzig«, sagte ich. »Das ist nicht schlecht. Dreiundachtzig ist kein schlechtes Alter.«
Dann, nach einem Schweigen, sagte ich, ich weiß nicht warum: »Aber Sie haben Freunde.«
Leute, mit denen man reden konnte, meinte ich, in schweren Zeiten. Jeder hat Freunde. Aber er hatte anscheinend nur »Treffen«.
»Freunde«, sagte er, als wäre das Wort fremdartig. »Als Junge hatte ich Freunde. Ich meine, als ich ein kleiner Junge war. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Wir haben uns gegenseitig besucht, in unseren Häusern, in unseren Leben. Wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Das sind Freunde.«
Ich schnitt weiter. »Na ja, wohl wahr«, sagte ich.
Und wie oft sage ich das zu den Kunden? »Wohl wahr.« Wie man das so sagt. Was immer sie einem erzählen.
»Die Freunde, die wir früh im Leben haben«, sagte ich, »das sind die, die uns bleiben. Die wichtig sind.«
Das war nicht ganz das, was er gesagt oder gemeint hatte, und das wusste ich auch. Es war auch nicht ganz das, was ich meinte. Ich verstand, was er gemeint hatte. Ich schnitt weiter und sah auf sein Haar, aber vor meinem geistigen Auge sah ich meine Freunde in Zypern. In Ayios Nikolaos. Alle meine Freunde, neun und zehn Jahre alt. Ich sah mich in ihrer Mitte.
Vielleicht wusste er, dass ich das, was ich gesagt hatte, nicht gemeint hatte. Ich hatte etwas gesagt, das man gemeinhin sagt, oder so denkt.
Er sagte: »Es ist nicht dasselbe, oder? Leute kennen, sich mit ihnen treffen, mit ihnen reden. Das ist nicht dasselbe wie Freunde haben.«
Ich drehte seinen Kopf in einen anderen Winkel. »Das ist zu schwierig«, sagte ich, »zu schwierig.« Ich spürte ein Gefühl aufkommen, fast wie Wut. Ich schob es zurück. Beinahe hätte ich aufgehört zu schneiden. »Sie verlangen zu viel«, sagte ich. »Bei allem Respekt – vor Ihrer Mutter. Bei allem Respekt vor Ihren Gefühlen. Wenn Sie Leute kennen, mit denen Sie sich treffen und mit denen Sie sprechen können, dann haben Sie Freunde. Wenn Sie Leute haben, haben Sie Leben.«
Es war spät, es war dunkel. Ich versuchte mich manchmal mit ein bisschen Philosophieren. Manche Menschen erwarten das, hin und wieder, von einem Friseur. Ein bisschen Philosophieren. Besonders von einem Friseur, der selbst über sechzig ist, sein eigenes Geschäft hat (ich und drei Angestellte) und dessen Haar kraus und grau ist. Außerdem bin ich Grieche (vielmehr Zypriote), und wir haben die Philosophie erfunden.
»Leute«, sagte ich. »Leute sind Leben.«
Aber was ich dachte, war dies: Sie brauchten sich nicht die Haare schneiden zu lassen, nachdem Ihre Mutter eben gestorben ist. Sein Haar war nicht gerade sehr lang, es musste nicht geschnitten werden.
Ich steckte Schere und Kamm in meine Brusttasche und schaltete den Nackenrasierer an, damit wir nicht sprechen konnten.
Die Leute denken, wenn man Friseur ist, hat man Leute um sich und kann die ganze Zeit reden, den ganzen Tag. Was man alles zu hören bekommt, die Geschichten, was die Leute einem so alles erzählen.
Aber in Wahrheit bin ich froh, wenn ich keine Leute mehr sehen muss. Ich mag es, wenn der Tag zu Ende ist. Deswegen bin ich manchmal anders und sage Dinge, wenn es der letzte Kunde ist. Ich habe dann genug von Leuten. Und die meisten sind einfach Köpfe mit Haaren und manche gar nicht so nette Köpfe mit Haaren.
Ich dachte: Er will, dass es für die Beerdigung sauber und ordentlich ist.
Meine Eltern sind schon vor Jahren gestorben, in Zypern. Ich hatte sie lange nicht gesehen. Ich war nicht mehr hingefahren. Übrigens ist auch meine Frau gestorben, vor drei Jahren – Irene, meine englische Frau. Aber wir waren getrennt, wir hatten uns schon vor Jahren getrennt. Sie trank die ganze Zeit. Sie trank, und sie fluchte die ganze Zeit.
Habe ich allen meinen Kunden davon erzählt, dass sie gestorben war, dass wir uns getrennt hatten? Habe ich das vor meinen Kunden ausgebreitet? Habe ich den Laden zugemacht?
Ich habe zwei erwachsene Söhne, beide sind in der Computerbranche und beiden ist ihr Vater peinlich, weil er sein Leben lang einfach nur Friseur war.
Ich bin froh, wenn ich nach Hause komme und allein sein kann.
Vielleicht hatte er das alles aus meiner Stimme herausgehört. Oder meinem Gesicht angesehen, im Spiegel. Immer kommt ein Moment, wenn man hinter dem Kunden steht, die Finger an seinen Schläfen, und seinen Kopf gerade hält, und man blickt zu zweit in den Spiegel wie für ein Foto. Als wäre der Kopf zwischen den Fingern etwas, das man selbst gemacht hat.
»Leute sind Leben«, sagte ich.
Aber im Spiegel konnte er sehen, was ich dachte: Zu mir brauchen Sie nicht zu kommen, am Ende des Tages, um weise Worte oder Trost zu empfangen, um Freundschaft zu finden, falls Sie das suchen. Was erwarten Sie? Dass ich, wenn ich gleich den Laden zumache, zu Ihnen sage: »Warum gehen wir beide nicht ein Bier trinken? Und lernen uns besser kennen?«
Ich bin froh, wenn ich nach Hause komme und mir ein Bier aus dem Kühlschrank nehmen kann.
Einer von den schweren, aber weichen Typen, die aussehen, als wären sie von ihren Müttern gut gefüttert worden und hätten am Ende ihre Mütter gefüttert. Ein Stammkunde, das wohl. Seit wie vielen Jahren? Wollte immer, dass ich selbst ihm die Haare schnitt, nicht einer der Angestellten. Die Jahre rasen vorbei, wenn man sie in Haarschnitten zählt. Ich wusste nicht, wie er hieß. Nicht, dass das ungewöhnlich ist. Keine Termine, kein Grund, den Namen zu wissen – es sei denn, sie sagen ihn – oder zu wissen, was ihr Beruf ist.