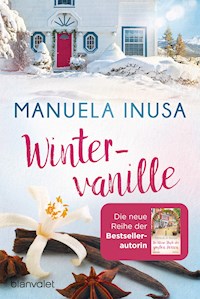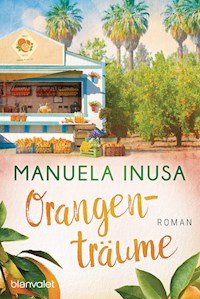9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kalifornische Träume
- Sprache: Deutsch
Der süße Duft von Erdbeeren im Frühling und ganz große Gefühle – willkommen zurück in Kalifornien!
Amanda hat mit ihrer Familie viele glückliche Jahre auf ihrer Erdbeerfarm nahe Carmel-by-the-Sea verbracht, bis ihr Mann Tom vor achtzehn Monaten verstarb und sie mit ihrer Tochter Jane zurückließ. Jane verkraftet den Verlust ihres Vaters nur schwer, und auch für Amanda ist es nicht leicht, ohne ihren geliebten Tom weiterzumachen und sich allein um die große Plantage zu kümmern. Als ihre beste Freundin vorschlägt, an einer Trauergruppe teilzunehmen, rafft Amanda sich endlich auf und hofft, auf diese Weise besser mit ihrem Kummer klarzukommen. Was sie allerdings nicht ahnt, ist, dass sie dort eine ganz besondere Begegnung machen wird. Und sie erinnert sich an ein Versprechen, das sie einst ihrem Mann gegeben hat …
Die zauberhafte »Kalifornische Träume«-Reihe bei Blanvalet:
1. Wintervanille
2. Orangenträume
3. Mandelglück
4. Erdbeerversprechen
5. Walnusswünsche
6. Blaubeerjahre
Alle Bände können auch unabhängig gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Amanda hat mit ihrer Familie viele glückliche Jahre auf ihrer Erdbeerfarm nahe Carmel-by-the-Sea verbracht, bis ihr Mann Tom vor achtzehn Monaten verstarb und sie mit ihrer Tochter Jane zurückließ. Jane verkraftet den Verlust ihres Vaters nur schwer, und auch für Amanda ist es nicht leicht, ohne ihren geliebten Tom weiterzumachen und sich allein um die große Plantage zu kümmern. Als ihre beste Freundin vorschlägt, an einer Trauergruppe teilzunehmen, rafft Amanda sich endlich auf und hofft, auf diese Weise besser mit ihrem Kummer klarzukommen. Was sie allerdings nicht ahnt, ist, dass sie dort eine ganz besondere Begegnung machen wird. Und sie erinnert sich an ein Versprechen, das sie einst ihrem Mann gegeben hat …
Autorin
Manuela Inusa wurde 1981 in Hamburg geboren und wollte schon als Kind Autorin werden. Kurz vor ihrem dreißigsten Geburtstag sagte die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin sich: »Jetzt oder nie!« Nach einigen Erfolgen im Selfpublishing erscheinen ihre aktuellen Romane bei Blanvalet und verzaubern ihre Leser. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in einem idyllischen Haus auf dem Land. In ihrer Freizeit liest sie am liebsten Thriller und reist gerne, vorzugsweise nach England und in die USA. Sie hat eine Vorliebe für englische Popmusik, Crime-Serien, Duftkerzen und Tee.
Von Manuela Inusa bereits erschienen
Jane Austen bleibt zum Frühstück
Auch donnerstags geschehen Wunder
Die Valerie Lane
1 Der kleine Teeladen zum Glück
2 Die Chocolaterie der Träume
3 Der zauberhafte Trödelladen
4 Das wunderbare Wollparadies
5 Der fabelhafte Geschenkeladen
6 Die kleine Straße der großen Herzen
Kalifornische Träume
1 Wintervanille
2 Orangenträume
3 Mandelglück
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag
und www.facebook.com/blanvalet.
MANUELA INUSA
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 der Originalausgabe by Blanvalet Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Daniela Bühl
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
(Ann W. Kosche; Moon Light PhotoStudio; Dmitrij Skorobogatov;
g215; Laura Stone; pbk-pg; Sundry Photography;
aspen rock; Charcompix)
LH · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-26592-2V001
www.blanvalet.de
Für Oma Lisa, die mir vor langer Zeit
das Erdbeermarmeladekochen beigebracht hat
Prolog
März 2006
»Du darfst die Augen jetzt aufmachen«, hörte sie Tom sagen.
Amandas Herz pochte wie wild, und es überkam sie eine Aufregung, wie sie sie bisher nur dreimal im Leben verspürt hatte. Als der Mann ihrer Träume zwei Jahre zuvor mitten auf dem Collegecampus auf die Knie gegangen war und ihr einen Antrag gemacht hatte. Als er sie im Sommer darauf zur Frau genommen hatte. Und als ihr gemeinsames Töchterchen vor neun Monaten zur Welt gekommen war. Jedes Mal hatte sie gewusst, dass es lebensverändernde Momente waren, und genau das verspürte sie auch jetzt, als sie die Augen endlich wieder öffnete.
Als Erstes sah sie Tom, der die kleine Jane auf dem Arm hielt und der sie hierhergeführt hatte, wo immer sie sich auch befanden. Irgendwann hinter Carmel-by-the-Sea hatte er ihr gesagt, dass sie die Augen schließen sollte. Ihr Blick wanderte weiter, an ihrem Mann und ihrem Baby vorbei, zu den Weiten der Felder, die vor ihnen lagen.
»Was ist das?«, fragte sie Tom, der sie strahlend ansah. Sie glaubte sogar, ihn noch nie so breit lächeln gesehen zu haben.
»Das ist unsere Zukunft«, antwortete er.
Stirnrunzelnd sagte sie: »Das musst du mir genauer erklären.«
Tom schmunzelte und gab Jane einen Nasenstupser, bevor er sie sachte in die Luft warf und wieder auffing, woraufhin die Kleine anfing zu lachen. Er wiederholte das Ganze, und Jane hatte ihren Spaß. Amanda aber wurde langsam ungeduldig.
»Tom?«
Er hörte mit dem Fangspiel auf, setzte Jane auf seine Schultern und drehte sich in Richtung des Feldes, das vollkommen leer war und Amanda vor ein Rätsel stellte.
»Du kennst meine Lieblingsfrüchte?«, fragte Tom sie überflüssigerweise.
Sie musste lachen. »Jeder, der dich kennt, weiß, was deine Lieblingsfrüchte sind.« Das war auch nicht schwer zu entschlüsseln, da es in wirklich allem seine Lieblingssorte war. Kuchen, Eiscreme, Marmelade – da gab es für Tom nur eine Option: Erdbeeren! »Und was hast du nun vor? Kann man hier irgendwo Erdbeeren pflücken?«, erkundigte sie sich, während sie gleichzeitig grübelte, ob es überhaupt möglich war, hier Anfang März schon reife Früchte zu finden. Im Treibhaus vielleicht, aber auch davon sah sie weit und breit keins.
»Amy, streng doch mal dein süßes kleines Gehirn an«, neckte er sie nun.
»Hey!«, schimpfte sie und stieß mit ihrer Schulter gegen seine, woraufhin Jane wieder ausgelassen lachte. »Ich hab ein ziemlich großes Gehirn«, erinnerte sie ihn für den Fall, dass er es vergessen haben sollte. »Oder weißt du etwa nicht mehr, dass ich als eine der fünf Jahrgangsbesten das College abgeschlossen habe?«
»Ach, stimmt. Ja, das war mir kurz entfallen.« Er grinste sie an. »Okay, wenn du also so schlau bist, solltest du noch mal scharf nachdenken. Wir stehen hier vor einem riesigen Feld, das ich uns gekauft habe. Was könnte ich also vorhaben, hier anzubauen?«
Ihr fiel die Kinnlade herunter. »Du hast was? Dieses Grundstück für uns gekauft? Bist du denn verrückt geworden? Wie sollen wir uns das nur leisten, ich meine …«
»Schhhh!«, machte Tom, beugte sich gemeinsam mit Jane zu ihr herunter und schloss ihre Lippen mit seinen.
»Aber Tom …«, sagte sie, obwohl dieser Kuss ihr ein wohliges Kribbeln hinterlassen hatte. »Das ist eine Sache, die wir hätten besprechen müssen. Du kannst doch nicht einfach so ein Erdbeerfeld kaufen!«
»Noch ist es kein Erdbeerfeld. Hier wurden bisher Zwiebeln angebaut. Aber bereits nächstes Jahr um diese Zeit könnten wir unsere ersten Früchte wachsen sehen.«
»Na, dann hoffe ich, dass deine Erdbeeren nicht nach Zwiebeln schmecken.« Sie zog eine Grimasse.
Tom lachte, und Jane lachte mit. Die Kleine sah zu süß aus mit den zwei Zöpfchen, die Amanda ihr mit Schmetterlingshaargummis gebunden hatte. Ihre braunen Äuglein glitzerten in der Frühlingssonne.
»Nun nimm die Sache bitte mal ernst, Amy«, sagte Tom, noch immer lächelnd, doch sie konnte in seiner Stimme hören, dass dies wohl doch keine unüberlegte, spontan entschiedene, verrückte Sache war. Tom schien diesen Plan schon vor längerer Zeit ausgeheckt zu haben.
»Du willst also wirklich unter die Erdbeerfarmer gehen?«, fragte sie ihn.
»Ja, genau. Ich dachte mir, das wäre etwas Schönes, was man sich aufbauen könnte. Wir könnten uns hier ein Haus hinstellen und sobald wie möglich herziehen. Oder willst du etwa ewig bei deinen Eltern wohnen bleiben?« Die Einliegerwohnung war eigentlich nur als Zwischenlösung gedacht gewesen, doch jetzt lebten sie bereits seit gut einem Dreivierteljahr dort. Direkt nach dem Studium in Stanford waren sie dort eingezogen. Gleich nachdem Amanda sich das Abschlusszertifikat mit dem kugelrunden Bauch von der Bühne abgeholt hatte.
»Ich fände es toll, endlich etwas Eigenes zu haben«, sagte sie ihrem Mann. »Ein Heim, in dem Jane aufwachsen kann. Und wie schön es wäre, wenn sie das auf dem Land tun könnte. Hier hätte sie die Möglichkeit, sich ganz frei zu entfalten.«
Tom schien sich zu freuen, dass ihr seine Idee zu gefallen begann. »So hatte ich mir das gedacht. Ich baue Erdbeeren an, und du kümmerst dich um den Verkauf und die Buchhaltung.« Sie hatte am College mehrere Wirtschaftskurse belegt, das würde sie sicherlich hinbekommen. »Du könntest auch Marmelade kochen, und wir könnten einen von diesen kleinen Holzständen aufstellen und unsere Erdbeeren direkt an vorbeifahrende Kunden verkaufen. Jane müsste nicht in den Kindergarten gehen, weil wir immer ein Auge auf sie hätten. Wie hört sich das für dich an?«, fragte Tom und sah dabei so hoffnungsvoll aus, dass sie sich, wenigstens in diesem Moment, überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen wollte, wie um alles in der Welt sie eine Erdbeerfarm finanzieren oder sich ein Eigenheim bauen sollten. Stattdessen wollte sie einfach nur mit Tom zusammen träumen.
»Das hört sich perfekt an«, erwiderte sie und schenkte ihrem wunderbaren Mann ein Lächeln. Dann nahm sie ihm Jane ab und deutete mit dem Finger zum Horizont, bis wohin sich das Feld zu ziehen schien. »Guck mal, Jane, das alles wird allein uns gehören. Unser neues Zuhause. Wie findest du das?«
Jane freute sich und klatschte in die Hände, was sie erst vor Kurzem gelernt hatte und nun jederzeit mit Begeisterung tat.
»Ich glaube, es gefällt ihr hier«, sagte Tom.
»Das glaube ich auch.«
»Und gefällt es dir ebenso?«, wollte er wissen.
Sie setzte sich Jane auf die Hüfte, damit sie eine Hand frei hatte, mit der sie nun seine Taille umfasste. Sie schmiegte sich an ihn. »Ich liebe es, Tom. Ich glaube, wir werden hier sehr glücklich werden.«
Tom nickte zustimmend und sah aufs weite Feld hinaus. Und Amanda schloss erneut die Augen, lächelte selig und atmete den Duft der zukünftigen Erdbeeren ein, den sie sich einbildete, schon jetzt riechen zu können.
Kapitel 1
Amanda
Sie wanderte über ihre Farm und sah den Erntehelfern beim Pflücken zu. Es war Ende April, die Saison hatte vor wenigen Wochen begonnen, doch nichts war, wie es mal gewesen war. Die letzten zwei Jahre hatten ihnen schwer zugesetzt. Zuerst Toms Krankheit und danach das weltweite Virus, das auch Kalifornien nicht verschont hatte … all das hatte sie ziemlich weit zurückgeworfen. Im vergangenen Herbst hatte Amanda aus Kostengründen nicht einmal die Erdbeerpflanzen herausreißen können, um für die nächste Saison neue zu pflanzen, wie sie es die letzten dreizehn Jahre stets getan hatten. Denn nur so konnte man sichergehen, dass die folgende Ernte große und pralle Früchte hervorbringen würde. Leider musste Amanda sich in diesem Jahr nun mit sehr viel kleineren und auch nicht so schön geformten Erdbeeren zufriedengeben, was natürlich finanzielle Einbußen mit sich brachte. Glücklicherweise betrieb sie eine Bio-Farm, und die meisten Kunden betrachteten es als völlig akzeptabel, wenn ein paar der Beeren nicht ganz so perfekt aussahen, doch eben nicht alle. Und deshalb musste sie in diesem Frühjahr die Preise anpassen und konnte für eine Palette mit acht Ein-Pfund-Schalen nicht mehr vierzehn, sondern nur noch zwölf Dollar verlangen. Das war nur verständlich, da die Erdbeeren an Supermärkte in ganz Kalifornien und sogar nach Oregon und Washington gingen – und wer wollte schon mickrige Erdbeeren haben?
Anders war es am Stand. Kunden aus der Umgebung, die persönlich vorbeikamen oder auch Reisende, die ihren kleinen Tisch am Straßenrand entdeckten, zahlten die gewohnten vier Dollar pro Schale. Das würde sich natürlich bald ändern, und zwar zur Hauptsaison im Juni und Juli, wenn alle Farmer ihre Erdbeeren zu Spottpreisen herauswarfen. Dann könnte sie gerade mal die Hälfte dafür nehmen, doch daran wollte sie noch überhaupt nicht denken. Die Sorgen um die Existenz der Farm raubten ihr schon nachts den Schlaf, wenigstens tagsüber wollte sie versuchen, positiv zu bleiben. Vielleicht würde sich ja eine Lösung finden, irgendeine.
Sie ging den Weg zwischen zwei Feldern entlang, auf dem ihre Erntehelfer in dem alten Pick-up-Truck zu den hinteren Bereichen fahren konnten. Mit diesem Wagen mit der großen Ladefläche wurden auch die vollen Erdbeerkisten zur Sortierstation gebracht. Erdbeeren – die Pflanzen, die mit botanischem Namen Fragaria hießen und die eigentlich zu den Rosengewächsen gehörten, waren zu Amandas Lebensinhalt geworden. Sie ging in die Hocke, pflückte sich eine reife rote Beere und biss davon ab. Mhmmm – sie waren immer wieder köstlich.
»Buenos días, Señora Parker!«, hörte sie Esmeralda rufen, eine Mexikanerin mittleren Alters, die bereits seit ihrer ersten Ernte auf der Farm half. Ein ganzer Teil ihrer in Kalifornien ansässigen Familie arbeitete inzwischen hier und seit letztem Jahr auch ihr Sohn Romeo, der seinen Schulabschluss in der Tasche hatte und noch am Überlegen war, was er mit seinem Leben anstellen sollte. Das hatte er Amanda erzählt, als sie ihn gefragt hatte, ob er sich denn nicht lieber fürs College bewerben wolle, statt Erdbeeren zu pflücken. Das Pflücken war harte Arbeit. Zehn Stunden am Tag, an sechs Tagen in der Woche, von Anfang April bis in den Herbst hinein, gebeugt über den Pflanzen stehen, Erdbeeren an ihren Stielen abknicken und in die Holzkisten legen, die auf Schubkarren durch die Reihen gezogen wurden. Die vollen Kisten zur Sortierstation in der Nähe des Haupthauses bringen, wo sie von zwei fleißigen Sortiererinnen ausgelesen, abgewogen und in Ein-Pfund-Schalen verpackt wurden. Das alles in der glühenden Sonne und mit Rückenschmerzen, die jeder von ihnen hatte, der eine mehr, der andere weniger, es kam ganz darauf an, wie viele Lebensjahre man der Farmarbeit schon nachging.
Ein einziges Mal hatten sie auf der Plantage einheimische Arbeiter gehabt, zwei Amerikanerinnen, die aber bereits nach zwei Wochen gestöhnt und gekündigt hatten. Ansonsten hatten Tom und Amanda immer nur Mexikaner beschäftigt gehabt, denen die harte Arbeit nichts ausmachte und die sich nie beklagten, die einfach nur froh waren, gutes Geld zu verdienen. Und obendrein ließ Amanda die Leute immer noch so viele Erdbeeren mit nach Hause nehmen, wie sie essen konnten, natürlich nur die aussortierten, die missgeformten oder die mit kleinen Druckstellen. Die, die sie auch zum Marmeladekochen benutzte oder zum Sirupmachen. Die, die genauso gut schmeckten wie die anderen Früchte, die aber keiner kaufen wollte. Einmal hatte sie Esmeralda zu Jane sagen hören, dass diese verkrüppelten Erdbeeren, wie Jane sie nannte, in diesem Land genauso behandelt würden wie die Mexikaner. Sie wären Objekte zweiter Klasse, würden anders gesehen, anders behandelt werden, obwohl sie doch überhaupt nicht minder wert waren. Amanda hatte einen Kloß im Hals gehabt, als sie die beiden belauscht hatte. Danach hatte sie – mit Toms Einverständnis – allen Arbeitern eine Lohnerhöhung von fünfzig Cent die Stunde gegeben.
Schon immer hatten sie es anders gehandhabt als die Mehrheit der Farmer, die ihre Erntehelfer pro gepflückter Palette Erdbeeren bezahlten. Tom war der Meinung gewesen, das würde unter den Pflückern nur für Konkurrenzkampf sorgen. Er wollte nicht, dass seine Erdbeeren im Akkord gepflückt wurden, sondern mit Sorgfalt und Liebe. Das machte in seinen Augen den großen Unterschied, und die Konsumenten würden es spüren, wenn sie in eine der Früchte bissen. Sie würden sie wieder kaufen. Und das hatten sie. Jahrelang war die Farm besser gelaufen, als sie es sich je hätten erträumen können, doch dann war das Drama über sie hereingebrochen. Seit Tom nicht mehr da war, um alles zu überwachen, und nachdem sich im letzten Jahr auch noch mehrere Erntehelfer mit dem Virus infiziert hatten und sie alle gleich dreimal in Quarantäne gehen mussten, was einige Einbußen mit sich brachte, hatte Amanda Schwierigkeiten, die Plantage überhaupt am Laufen zu halten. Die Arbeiter zu bezahlen. Die hohen Wasserkosten zu begleichen. Jane das zu bieten, was sie brauchte. Toms Erbe in Ehren zu halten.
Sie seufzte. In Momenten wie diesen fehlte er ihr noch mehr als sonst. Bevor ihr wieder einmal Tränen in die Augen schießen würden und sich ihre Kehle zuschnüren konnte, rief sie Esmeralda zu: »Mir geht es ganz gut, danke. Und dir?«
»Bestens, Señora«, antwortete Esmeralda, der sie schon eine Million Mal gesagt hatte, dass sie sie ruhig auch beim Vornamen ansprechen konnte. Die Mexikanerin knickte noch ein paar Beeren gekonnt an ihrem Stiel ab und legte sie behutsam in die flache Kiste zu ihrer Linken, dann stellte sie sich aufrecht. »Meine Tochter Dilara ist dieses Jahr Klassenbeste.« Stolz strahlte sie sie an. Dilara war in Janes Alter, wenn Amanda sich nicht irrte. Sie war noch ein Kleinkind gewesen, als Esmeralda bei ihnen angefangen hatte. Damals hatte sie die Kleine in die Obhut ihrer Schwägerin Ricarda gegeben, wenn sie arbeiten kam, bevor diese ebenfalls als Pflückerin bei ihnen einstieg.
Amanda seufzte erneut. Klassenbeste. Das konnte man von Jane wahrlich nicht behaupten.
»Das ist fantastisch.« Sie schenkte Esmeralda ein Lächeln und spazierte weiter. Nach etwa zehn Minuten ging sie zurück zum Haupthaus, in dem sie mit Tom hatte alt werden wollen. Das Haus war wunderschön geworden, viel mehr noch, als sie sich damals erhofft hatte. Von außen war es weiß und hellgrau gehalten, mit weißen Säulen, die es elegant und heimelig zugleich wirken ließen. Drum herum hatte sie mit den Jahren immer mehr Blumen gepflanzt, sodass es jetzt so aussah, als würde es in einem Meer aus lila Hortensien, weißen Rosen und jeder Menge anderer Lieblingsblumen versinken. Und innen war es sogar noch viel schöner. Während sich unten das Familienleben abspielte – Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und Janes Zimmer –, befand sich oben mit dem Schlafzimmer und einem kleinen idyllischen Raum, den sie als Bibliothek und Büro benutzte, Amandas Reich. Tom hatte ihr in diesem Haus alles bauen lassen, was sie sich immer gewünscht hatte, wie einen Kamin, vor dem sie an kalten Wintertagen mit einem guten Buch entspannen konnte, eine Sitzecke vor dem Schlafzimmerfenster, von wo aus sie auf das Meer blicken konnte, und eine Einbauküche nach neuesten Standards, in der sie für ihre Familie leckere Gerichte kreieren und ihre Marmelade kochen konnte. Sie hatte dieses Haus vom ersten Tag an geliebt, und sie verband unendlich viele schöne Erinnerungen damit.
Sie sah zur Straße, da Jane demnächst von der Schule nach Hause kommen musste. Vielleicht hatte sie Hunger oder brauchte Hilfe bei den Hausaufgaben. Fast hätte sie gelacht, so absurd war die Vorstellung, ihre Tochter würde sie dabei tatsächlich um Unterstützung bitten. Jane beachtete sie ja kaum noch. Als würde sie gar nicht mehr existieren. Als wäre sie zusammen mit Tom gestorben.
Sie sah Jane auf ihrem Fahrrad anfahren, absteigen, es in die Einfahrt schmeißen, und ins Haus gehen.
»Jane!«, rief sie ihr zu. »Wie war dein Tag?«
Keine Antwort. Wie immer.
Jetzt konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten, also ließ sie einfach zu, dass sie ihr die Wangen hinunterliefen. Nach einer Minute jedoch wischte sie sie sich mit dem Ärmel weg und ging hinüber zur Sortierstation. Falls Palma und Catalina ihr ansahen, dass sie geweint hatte, so sprachen sie sie zumindest nicht darauf an. Sie machten wie gewohnt mit ihrer Arbeit weiter und unterhielten sich dabei.
Amanda nahm die beiden riesigen Eimer mit aussortierten Erdbeeren je in eine Hand und brachte sie ins Haus. Dann würde sie halt schon wieder Marmelade kochen, zu etwas anderem war sie ja eh nicht zu gebrauchen. Nicht mehr. Und vielleicht nie wieder.
Kapitel 2
Jane
Den Kopf auf die Hand gestützt saß sie am Cafeteria-Tisch und sah Calvin dabei zu, wie er seine Instantnudeln umrührte. Er brachte sie sich fast jeden Tag mit und bat die Dame an der Essensausgabe um heißes Wasser. Die sah ihn immer ganz mitleidig an und füllte ihm seinen Plastikbecher Yum-Yum-Nudeln bis oben hin auf.
»Bist du sicher, dass du nicht die Hälfte von meinem Sandwich haben willst?«, fragte sie ihn.
»Ich kann dir doch nicht immer alles wegessen, J. P.«
Das war noch so eine Angewohnheit von Cal, der seit dem ersten Jahr der Junior Highschool ihr bester Freund war. Er sprach alle Leute bei ihren Initialen an, sogar die Lehrer, was die meisten von ihnen gar nicht lustig fanden.
»Du würdest es mir nicht wegessen. Ich hab überhaupt keinen Hunger, ehrlich.«
»Du musst mehr essen, Kleines.«
»Ach, ich müsste auch mehr lernen und öfter meine Haare kämmen, da hab ich aber gar keine Lust zu«, erwiderte Jane und zuckte die Achseln. Ihr war bewusst, wie sie heute wieder herumlief. Sie hatte verschlafen – zum siebten Mal in diesem Monat – und war – ebenfalls zum siebten Mal – zu spät zum Unterricht erschienen. Sie wusste auch nicht, warum es ihr an Schultagen so schwerfiel, morgens aufzustehen. Und sie hörte ihren blöden Wecker ja auch immer, doch sie stellte ihn halt einfach aus und schlief weiter. Irgendwann kam dann ihre Mutter wie eine Furie ins Zimmer gestürmt, riss ihr die Bettdecke vom Körper und schrie, dass sie nicht schon wieder zu spät kommen dürfe. Weil sie schon schlecht genug in der Schule sei und am Ende noch die zehnte Klasse wiederholen müsse. Sie wusste ja, dass ihre Mom recht hatte, und trotzdem hasste sie sie jeden Tag aufs Neue für ihre Militärmethoden. Sollte sie sich doch um ihren eigenen Kram kümmern. Warum konnte sie sie nicht einfach in Ruhe lassen?
Wie auch immer, sie war wieder mal spät dran gewesen, hatte sich schnell die alten Sachen vom Vortag angezogen, die noch auf dem Boden verteilt herumlagen, hatte sich, statt die Zähne zu putzen, nur schnell einen Kaugummi in den Mund gesteckt, und sich die Papiertüte mit ihrem Lunch, die ihre Mom ihr auf den Flurtisch gestellt hatte, geschnappt. Sie hatte sich aufs Fahrrad geschwungen und erst auf halbem Weg zur Schule gemerkt, dass sie vergessen hatte, sich die Haare zu kämmen.
Egal. Wer achtete schon auf ihre Haare? Die meisten Kids an der Montgomery High beachteten sie doch überhaupt nicht, wussten wahrscheinlich nicht einmal, dass sie existierte. Klar, vor anderthalb Jahren war sie kurz Gesprächsthema gewesen, ein paar der Cheerleaderinnen hatten ihr mitleidige Blicke zugeworfen, nur um sie eine Woche später schon wieder zu ignorieren. Wahrscheinlich kannte keine einzige von ihnen ihren Namen.
Damals hatte Jane noch Freundinnen gehabt, die sich aber alle ganz schnell abwandten, als sie zum Zombie mutierte. Irgendwann war sogar ihre beste Freundin Brianna gegangen, mit einem traurigen Ausdruck in den Augen, der das Ende ihrer langjährigen Freundschaft bedauerte. Nur Calvin war geblieben.
Früher war Cal stets der Typ gewesen, der lieber mit Mädchen abhing als mit anderen Jungen, und der deswegen oft für schwul gehalten wurde, bevor er mit Tessie Fielding ging und alle Gerüchte aus der Welt schaffte. Als er dann kurz nach ihrem schweren Verlust lieber bei Jane war, um sie zu trösten, statt mit Tessie zum weihnachtlichen Schulball zu gehen, machte diese mit ihm Schluss. Es schien Cal nicht allzu viel auszumachen. Er wollte für sie da sein, und das war er. Er war der Einzige, auf den sie sich verlassen konnte. Ihr einziger wahrer Freund, sie wüsste überhaupt nicht, was sie ohne ihn machen sollte.
Jetzt sah sie ihn über den Tisch hinweg an, seine dunklen Haare fielen ihm ins Gesicht, seine Kleidung war so düster wie ihre. Aus Solidarität hatte er nach dem Tod ihres Dads angefangen, gemeinsam mit ihr Schwarz zu tragen, und auch als sie nicht damit aufgehört, sondern sich in diesen Zombie verwandelt hatte, war er mitgegangen.
Sie liebte Cal über alles, platonisch natürlich, er war der einzige Mensch auf der Welt, der sie verstand.
»Nun nimm endlich das blöde Sandwich«, sagte sie und schob es ihm rüber.
Er griff danach und schlang es hinunter, als hätte er seit Tagen nichts gegessen, während seine Nudeln langsam die weiche Konsistenz annahmen, die es benötigte, um sie essen zu können. Jane fragte sich, wie Cal sie überhaupt noch zu sich nehmen konnte – hingen sie ihm nicht langsam zum Hals heraus?
»Danke«, sagte er. »Das war echt lecker. Ich wünschte, meine Mom würde mir Schulsandwiches machen.«
»Ich geb dir gerne meine Mom«, sagte sie.
»Hattet ihr wieder Streit?«
»Ach, immer dasselbe. Sie wollte mich gestern ausquetschen, wollte wissen, wie es in der Schule läuft und so.«
»Und was hast du gesagt?«
»Na, von der Sechs in Spanisch hab ich ihr jedenfalls nichts gesagt.«
»Und was machst du wegen der Unterschrift?«
»Die hab ich inzwischen ziemlich gut drauf.«
»J. P., wenn das irgendwann rauskommt … Was, wenn mal irgendein Lehrer deine Mom zu sich bestellt?«
»Das wird nicht passieren. Sie haben Angst davor, sie zu treffen. Genauso wie sie sich davor fürchten, mich näher wegen der Umstände anzusprechen, die für meine schlechten Noten verantwortlich sind. Sie wissen doch alle, was passiert ist. Sie lassen es durchgehen. Ich krieg nicht mal Briefe mit, weil ich ständig zu spät bin.«
»Du tust ihnen eben leid, J. P.«
»Ihr Mitleid können sie sich sonst wo hinstecken.«
»Ich sehe schon, du bist heute nicht allzu gut drauf. Wollen wir später einen The-Walking-Dead-Marathon machen?«
»Klar, da bin ich immer dabei. Funktioniert euer Netflix wieder?«
»Nope. Noch immer kein Zugang.«
Cals alleinerziehende Mutter hatte vor ein paar Monaten ihren Job im Kaufhaus verloren und konnte die Rechnungen nicht mehr zahlen. Deshalb gab es auch nur noch japanische Instantnudelsuppen zum Lunch – die gab’s für einen Dollar den Becher. Seit sie pleite waren, ging Cals Mom nur noch im Dollar Tree einkaufen.
Cal rollte ein paar Nudeln auf seine Gabel und schlürfte sie aus der Suppe, dass es spritzte.
»Dann komm eben mit zu mir«, schlug Jane vor.
»Ist das okay für deine Mom?«
»Ich denk schon. Sie ist doch froh, wenn ich überhaupt noch Freunde hab. Sie glaubt nämlich, ich mutiere zur totalen Einsiedlerin.«
»Dann wollen wir ihr mal beweisen, dass das nicht der Fall ist, oder?« Er lächelte sie an.
»Du hast da irgend so eine Alge zwischen den Zähnen«, sagte sie, und Cal versuchte, sie sich mit dem Finger wegzuwischen. »Nein, nicht da. Warte …« Sie langte über den Tisch und kratzte ihrem Freund das grüne Ding aus der Zahnritze. Als wäre es das Normalste der Welt.
»Oh Gott, ihr seid wie so’n altes Ehepaar«, hörte sie hinter sich und musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass es Aiden war.
»Hey, A. D.«, grüßte Cal ihn.
»Alles klar?«, fragte Jane.
»Mir geht’s bestens. Ich lass mir heute Nachmittag ein neues Tattoo stechen«, erzählte Aiden aufgeregt und setzte sich auf den Platz neben Calvin.
»Noch eins?« Jane betrachtete den Typen, den sie nicht unbedingt einen Freund nennen würde, der aber genauso ein Außenseiter war wie sie beide, weshalb sie manchmal mit ihm abhingen. Er bezeichnete sich selbst als Rocker, obwohl er eher wie ein Punk rüberkam, da er grün gefärbte Haare hatte und so viele Piercings und Tattoos, dass man sie nicht mehr zählen konnte.
»Yep!«, erwiderte er. »Das Triad, eins der Logos von Thirty Seconds to Mars. Ich will es mir, genau wie Jared Leto, auf den Unterarm stechen lassen.«
Jared Leto, der Sänger der Rockband, war Aidens absolutes Idol. Er sang selbst auch in einer Band, die nicht nur Thirty-Seconds-to-Mars-Songs, sondern auch die von einigen Neunzigerjahre-Bands wie den Red Hot Chili Peppers, den Foo Fighters oder Green Day coverte. Sie hatte Aiden schon oft sagen hören, dass er wünschte, er würde in den Neunzigern leben.
Das Einzige, was Jane über die Neunzigerjahre wusste, war, dass ihre Mom und ihr Dad sich da kennengelernt hatten. Auf der Junior Highschool. Allerdings hatten sie einander zu der Zeit völlig ignoriert und sich erst auf dem College unsterblich verliebt.
Sie wusste, dass Aiden glaubte, Cal und sie wären ebenfalls ineinander verknallt, würden es nur vor anderen nicht zeigen wollen. Aber so war es wirklich nicht, sie beide waren einfach nur die besten Freunde, die man sich vorstellen konnte.
Sie bemerkte jetzt erst, dass Aiden und Cal sich angeregt über Tattoos unterhielten und dass sie mal wieder vor sich hin geträumt hatte. Das tat sie oft, ganz unbewusst, so als würde sie sich selbst davonträumen wollen, weil die Realität einfach zu schwer zu ertragen war.
Sie hörte den Jungs zu, bis es zum Ende der Mittagspause klingelte.
»Bist du mit dem Fahrrad da?«, fragte Cal sie noch, bevor sie sich trennten, um in ihre verschiedenen Kurse zu gehen.
»Ja.«
»Ich auch«, sagte er, der manchmal auch mit dem Schulbus kam. »Dann treffen wir uns nach dem Unterricht und fahren zusammen zu dir?«
»Musst du nicht vorher zu Hause nachfragen, ob das klargeht?«
Er schüttelte den Kopf. »Meine Mom arbeitet doch ab heute Abend in dem Truck-Stop-Diner an der Hauptstraße. Die Nachtschicht. Sie schläft sicher tagsüber. Ich schreib ihr einfach eine Nachricht, das geht schon okay.«
»Na gut, wenn du meinst. Dann bis später.«
Während sie zu ihrem Schließfach ging, um ihre Bücher zu holen, dachte sie über das nach, was Cal über seine Mutter gesagt hatte. Hatte er ihr bereits von deren neuem Job erzählt und sie hatte nur mal wieder nicht zugehört, weil sie mit ihren Gedanken ganz woanders gewesen war? Sie wusste, dass Cal ihr so etwas nicht übel nahm, doch sie nahm sich vor, wenigstens ihm gegenüber aufmerksamer zu sein.
Als sie ihren Spind öffnete, lächelte ihr Dad ihr von dem Foto entgegen, das ihn zusammen mit ihr zeigte, als sie zwölf Jahre alt gewesen war. Als sie noch dieser liebenswerte, immer fröhliche Mensch gewesen war, an den sie sich kaum noch erinnern konnte. An ihren Dad allerdings konnte sie sich so gut erinnern, dass es wehtat. Sie wusste noch genau, wie sich sein Lachen anhörte, hatte seine Stimme im Ohr und wie er ihr vor dem Einschlafen Your Song vorsang. Ihr Dad war einfach der Beste gewesen – warum hatte er sie nur so früh verlassen müssen?
Im Englischunterricht versuchte sie sich auf Steinbeck und Die Straße der Ölsardinen zu konzentrieren, ihre Gedanken wanderten aber immer wieder zu ihrem vierzehnten Geburtstag zurück, dem letzten, den sie mit ihrem Dad zusammen verbringen durfte. Sie waren nach Monterey gefahren, dorthin, wo das Buch spielte, über das sie bis Ende des Monats einen Viertausendwörteraufsatz schreiben sollte, und hatten sich das Boot ihres Grandpas ausgeliehen. Nur ihr Dad, ihre Mom und sie, die Erdbeerfamilie, wie ihr Dad sie immer scherzhaft genannt hatte. Sie waren aufs Meer hinausgefahren, hatten sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, Brie-Sandwiches gegessen und Dr. Pepper getrunken. Sie hatten Musik über Janes Smartphone laufen lassen und einen Buckelwal beobachtet, der so galant aus dem Wasser auftauchte und sich wieder hineingleiten ließ, als wäre er nicht schwerer als eine Sardine. Einen perfekteren Tag hatte es nie gegeben.
Ihre Gedanken fanden zurück zu ihrem Buch, und sie machte sich schwer seufzend daran, wenigstens ein paar Worte niederzuschreiben, da sie die Lehrerin wirklich mochte. Miss Fisher, eine erst Mitte zwanzigjährige Brünette, die immer ungeschminkt aus dem Haus zu gehen schien, was sie in Janes Augen irgendwie sympathisch machte. Wenigstens schwamm sie nicht mit dem Schwarm.
Als sie nun zu ihr aufblickte, bemerkte Jane, wie Miss Fisher sie eingehend betrachtete. Dabei hatte sie denselben Ausdruck in den Augen wie alle anderen. Eine Mischung aus Mitleid und Sorge, wahrscheinlich hofften sie alle, dass sie die Highschool trotz allem irgendwie überstehen würde. Ohne allzu viele andere mit sich in den Abgrund zu ziehen.
Nach der Schule wartete Cal schon wie abgesprochen mit dem Fahrrad auf dem Parkplatz. Während viele der anderen Kids eigene Autos hatten oder von ihren Eltern abgeholt wurden, war Jane meistens mit dem Rad unterwegs. Es war nicht so, dass ihre Mom sie nicht einsammeln würde, sie war aber viel lieber für sich und konnte gut auf die Unterhaltungen verzichten, in die ihre Mom sie immer wieder verwickeln wollte.
Sie verstand es ja. Sie machte sich Sorgen um sie. Trotzdem war ihre Mutter der letzte Mensch, dem sie ihre Gedanken anvertrauen würde. Das lag zum einen daran, dass sie eben ihre Mutter war, und zum anderen daran, dass Jane ihr noch immer nicht verzeihen konnte, nicht ihr Bestes gegeben zu haben, als ihr Dad damals im Sterben lag. Sie hätte seinen Tod verhindern können, und die Tatsache, dass sie es nicht getan hatte, war nicht wiedergutzumachen. Niemals.
Sie steckte den Schlüssel ins Fahrradschloss und rollte das alte rote Gestell zu Calvin. Wortlos fuhren sie los, ließen sich den Fahrtwind ins Gesicht wehen, und Jane wusste, dass auch ihr sechzehnter Geburtstag in sechs Wochen nichts daran ändern würde. Sie würde ganz bestimmt kein Auto bekommen, weshalb sie nicht einmal damit begonnen hatte, ihren Führerschein zu machen. Sie war glücklich auf ihrem Fahrrad, gemeinsam mit Calvin, dessen Mom sich genauso wenig einen Zweitwagen leisten konnte wie ihre.
Nach zwanzig Minuten erreichten sie die Farm, die sich etwas außerhalb von Carmel befand, und legten ihre Räder in die Einfahrt. Als sie das Haus betraten, sah Jane sich suchend nach ihrer Mom um, entdeckte sie aber nirgends. Bestimmt war sie draußen bei den Erntehelfern oder oben im Büro, um sich um Rechnungen oder sonst irgendwas zu kümmern.
»Hast du Lust auf Pommes?«, fragte sie, und Cals Augen strahlten, als er nickte.
»Immer. Da brauchst du nicht zu fragen.«
Sie holte die letzte Tüte Tiefkühlpommes aus dem Fach und schüttete sie auf ein Backblech. Als sie im Ofen waren, bereitete sie für sich und Cal zwei Erdbeer-Bananen-Smoothies mit frischer Minze – ihre eigene Erfindung – zu und stellte ihm einen hin. Zusammen saßen sie am Tresen, tranken ihre Smoothies und schwiegen. Das war das Schöne mit Cal, er musste nicht die Stille mit Worten füllen wie die meisten anderen Menschen. Mit ihm konnte man einfach nur dasitzen und nichts sagen.
Als die Pommes fertig waren, gab sie sie auf einen großen Teller, den sie zwischen sich und ihn stellte. Dann füllte sie zwei kleine Schälchen, eins mit Ketchup für Cal und eins mit Erdbeermarmelade für sich. Da tunkte sie die knusprigen Pommes rein, wie ihr Dad es ihr gezeigt hatte, als sie noch ganz klein gewesen war. Cal hatte diese Variante schon vor langer Zeit für eklig befunden, doch sie fühlte sich ihrem Vater jedes Mal, wenn sie eine Fritte mit Erdbeermarmelade aß, ganz nah.
Cal stupste sie mit der Schulter an, als wollte er ihr sagen, dass er verstand, warum sie so etwas Widerwärtiges aß, und sie war einfach nur dankbar, ihn zu haben.
Kapitel 3
Carter
»Brauchen wir Marmelade?«, hörte er seine ältere Tochter Samantha rufen, die vor dem langen Regal mit den Brotaufstrichen stand.
»Nein, wir haben noch genug«, antwortete Carter. »Die Marshmallowcreme ist aber alle, und du weißt, dass deine Schwester keinen Tag ohne auskommt.« Er grinste Astor, seine jüngere, erst neunjährige Tochter an, die ihren Welpenblick aufsetzte.
»Oh ja, bitte. Ohne Marshmallowcreme bin ich verloren.«
Samantha schmunzelte, nahm gleich zwei große Gläser und stellte sie in den Einkaufswagen. Dann zwinkerte sie ihrer kleinen Schwester zu. »Ich glaube, das sollte ein bis zwei Tage halten.«
»Haha«, machte Astor und lief zum Regal mit der Mayonnaise rüber. Carter sah ihr hinterher und merkte wieder, dass sie ihrer Mutter von Tag zu Tag ähnlicher sah. Samantha aber war ein Abbild von ihr. Wenn sie ein paar Meter entfernt stand und sich das blonde Haar gedankenverloren um den Finger wickelte, konnte man fast denken, Jodie stehe vor einem.
Er schüttelte diese Feststellung ab und lächelte seine Mädchen an. »Also? Was wollen wir uns heute zum Abendessen machen? Und bevor du etwas vorschlägst, Astor: Marshmallowcremesandwiches sind keine Option.«
»Okay, dann Pizza«, entgegnete die Kleine.
»Ist das okay für dich?«, fragte er Sam, und sie nickte.
»Klar, von mir aus. Was brauchen wir dafür?«
»Ich will Pilze drauf«, rief Astor. »Und Mais! Und Tomaten!«
»Und ich natürlich Peperoni«, sagte Carter.
»Ich bin mit allem einverstanden«, meinte Samantha, die der gefügigste Mensch war, den er kannte. Sie wollte es immer allen recht machen, dachte an alle anderen, bevor sie an sich selbst dachte. Sie ging für ein paar ältere Damen in der Nachbarschaft einkaufen, las Kindern im Krankenhaus Geschichten vor und half bei mehreren wohltätigen Projekten. Dazu lernte sie noch in jeder freien Minute für die Schule, trainierte fürs Cheerleading und passte auf Astor auf, wann immer er sie darum bat. Samantha war die perfekte Tochter. Manchmal machte er sich fast Sorgen um sie, weil sie so wenig Zeit für sich selbst zu haben schien. Doch das war es, was sie wollte, sie hatte es ihm bereits mehrmals gesagt, und er würde sie nicht aufhalten, Gutes zu tun.
Sie sammelten alle Zutaten für die Pizza zusammen, Astor griff auf dem Weg zur Kasse noch nach einer Packung Cap’n Crunch – ihre Lieblingsfrühstücksflocken –, und sie bezahlten ihre Einkäufe, die sie kurz darauf ins Auto luden. Carter setzte sich ans Steuer, drehte das Radio an, und sie sangen alle zusammen zu einem alten Bryan-Adams-Song mit, den er zu Hause schon so oft gehört hatte, dass sogar seine Töchter ihn auswendig kannten. Er mochte Musik, sie war immer Bestandteil seines Lebens gewesen. Früher einmal war er Gitarrist in einer Band gewesen, doch das war so lange her, dass er sich kaum noch daran erinnern konnte. So viele andere Dinge hatten dieses Kapitel seines Lebens beiseitegedrängt, sodass es nur noch ein ferner Punkt am Horizont war.
Zu Hause angekommen, bat Samantha, gleich in ihr Zimmer gehen zu dürfen, da sie noch jede Menge Hausaufgaben zu erledigen hatte und auch noch Flöte üben musste.
»Na sicher, geh nur. Astor und ich kümmern uns um die Einkäufe und das Essen. Wir rufen dich, wenn die Pizza fertig ist, ja?«
»Ich glaube, das ist nicht nötig. Die werde ich bestimmt bis in mein Zimmer riechen.« Sam lächelte ihn an, und ihr Lächeln war das Lächeln ihrer Mutter. Auch nach drei Jahren schmerzte es ihn noch so sehr, dass er schlucken musste. Doch er lächelte zurück, würde es nicht zeigen, würde vor seinen Töchtern nicht schlappmachen, wie er es ein ganzes Jahr nach Jodies Tod getan hatte. Ein viel zu langes Jahr. Aber das würde er Sam und Astor nie wieder antun, das hatte er sich geschworen. Das Leben ging weiter, er hatte diese beiden Kinder, die ihn brauchten, für die er funktionieren musste, und das würde er, manchmal besser, manchmal schlechter. Doch er würde immer für sie da sein. Der beste Vater sein, der er sein konnte, die Rolle beider Elternteile einnehmen, weil einer davon es nicht geschafft hatte, einfach nur das zu sein, was man von ihm erwartet hatte. Weil dieser Mensch mehr gewollt hatte, nicht zufrieden sein konnte mit dem, was er hatte. Doch auch diese Gedanken schob er schnell beiseite. Das war Vergangenheit. Was vor ihnen lag, war die Zukunft, und die würde er für seine beiden Mädchen so schön gestalten, wie er nur konnte.
»Wie wäre es mit selbst gemachtem Eis zum Nachtisch?«, rief er Sam nach, die schon auf dem Weg in ihr Zimmer war.
Sie hatte ihr Smartphone in der Hand und tippte eifrig etwas hinein. Wahrscheinlich schrieb sie mit Jeremy, mit dem sie seit zwei Jahren fest zusammen war. »Gerne«, antwortete sie.
»Himbeere oder Zitrone?«
»Lass Astor entscheiden«, rief sie zurück und war in ihrem Reich verschwunden, einem sechzehn Quadratmeter großen Zimmer, das vor Rosa und Glitzer nur so strotzte. Erst letzte Woche hatte sie sich zwei neue Kissenbezüge für ihr kleines Sofa genäht, die sie mit rosa Strasssteinen verziert hatte. Astor war neidisch ohne Ende gewesen, und Sam hatte ihr versprochen, ihr zum Geburtstag auch welche zu machen, in Gelb, ihrer Lieblingsfarbe.
»Okay, Astor, da deine Schwester so nett ist, dich entscheiden zu lassen, was hättest du denn ger…«
»Zitrone!«, rief Astor sofort. »Die sind gelb«, ließ sie ihn wissen, als hätte er keine Ahnung.
Er musste lachen. »Recht herzlichen Dank, dass du mich aufklärst, Prinzessin.«
»Ach komm schon, Dad, Sam ist hier die Prinzessin. Ich bin einfach nur … ein Frosch.«
»Ein Frosch?« Belustigt sah er sie an.
»Ja, genau. Aber eines Tages küsst mich ein Prinz, und ich werde mindestens genauso umwerfend wie Sam.«
»Oh, daran habe ich absolut keinen Zweifel«, erwiderte er und meinte es so.
»Du bist der Beste, Dad«, sagte Astor und sah ihn mit ihren himmelblauen Augen an, was ihn dahinschmelzen ließ.
»Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?«, fragte er und zerstrubbelte ihre Kurzhaarfrisur, die sie sich vor einigen Wochen selbst ausgesucht hatte, mit den Fingern.
Astor flüchtete vor ihm und kicherte. »Lass das, Dad!« Sie griff nach ihren Frühstücksflocken und stellte sie ins Regal. Dann holte sie die Eismaschine hervor, stellte sie vor ihm ab und sagte: »Hab dich auch lieb. Wenn du mir Zitroneneis machst, sogar noch mehr.«
Er schüttelte schmunzelnd den Kopf. »Na, dann wollen wir mal. Reich mir die Zitronen, kleiner Frosch.«
Astor warf ihm lachend zwei der gelben Früchte zu, und er war einfach nur froh, dass die schlimme Tragödie nicht bewirkt hatte, dass sie das Lachen verlernte.
Er nahm sich noch eine dritte Zitrone, jonglierte ein wenig mit ihnen und stellte dann den CD-Player an.
Astor fing gleich wieder an mitzusingen. Und während U2 I Still Haven’t Found What I’m Looking For schmetterten, sorgte er dafür, dass seine Tochter ihr geliebtes Zitroneneis bekam. Denn das war wirklich das Mindeste, was er für sie tun konnte.
Kapitel 4
Samantha
Sie betrachtete sich im Spiegel. Die Skinny Jeans und das geblümte Oberteil standen ihr gut, es zeichnete sich jedoch ein kleiner Bauch ab, was wohl davon kam, dass sie gestern mit der Pizza und dem Eis ein wenig über die Stränge geschlagen hatte. Sie seufzte. Dann würde sie wohl heute besonders darauf achten müssen, den Bauch einzuziehen, denn Jeremy mochte es gar nicht, wenn sie zu viel aß, und auf die fragenden Blicke der anderen Cheerleaderinnen konnte sie auch gut verzichten.
Als es draußen hupte, griff Sam sich ihre Jeansjacke und den Rucksack, drückte ihrer kleinen Schwester einen Kuss auf die Stirn und rief ihrem Vater ein »Hab einen schönen Tag, Dad!« zu.
»Den wünsch ich dir auch. Denkst du dran, dass heute Donnerstag ist?«, rief er aus der Küche zurück, wo er sich noch schnell um den Abwasch kümmerte, bevor er Astor zur Schule fahren musste. Danach würde er zurück nach Hause kommen, wo er in der Garage und dem neuen kleinen Anbau daneben seine Werkstatt hatte.
»Natürlich!«, erwiderte sie, und schon war sie raus aus dem Haus, in dem sie geboren worden war und in dem sie solch eine schöne Kindheit erlebt hatte. Ihre jungen Jahre waren ganz anders gewesen als die ihrer Schwester, das war ihr bewusst, und sie empfand unheimliches Mitleid mit Astor, die bereits mit sechs Jahren ihre Mutter verloren hatte. Mitten im ersten Schuljahr, wie sehr einen das prägen musste. Und genau deshalb tat sie ihr Bestes, um den Verlust irgendwie auszugleichen, und gab als Schwester alles und noch ein bisschen mehr, damit Astor, ihr absoluter Lieblingsmensch, nichts entbehren musste.
Sie wusste, dass ihr Dad genauso auf ihre Hilfe angewiesen war und wollte ihn keinesfalls enttäuschen. Er hatte es schwer genug gehabt. Das hatten sie alle.
»Hey, Honey«, sagte Jeremy, als sie neben ihm auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Er fuhr einen BMW, ein Cabrio, das sein Dad ihm zum sechzehnten Geburtstag geschenkt hatte. Es war ein wenig protzig, aber das war Jeremy ja auch, auf eine gute Art selbstverständlich. Denn Jeremy war nicht nur einer der Star-Lacrosse-Spieler der Montgomery Lions, sondern auch einer der bestaussehenden Jungen an der Schule. Welches Glück für Sam, dass er sich ausgerechnet sie als Freundin ausgesucht hatte. Aber sie passten halt auch zusammen wie Donuts und Streusel. Und die zwei Jahre, die sie inzwischen miteinander gingen, hatten bewiesen, dass sie total auf einer Wellenlänge waren. Die Tatsache, dass sie beide planten, nach ihrem Highschoolabschluss in Berkeley zu studieren, machte die Sache perfekt.
Sie schenkte ihrem Freund ein breites Lächeln und fragte: »Bist du schon aufgeregt wegen des großen Spiels am Samstag?«
Sie wusste, dass Jeremy nichts lieber tat, als über Lacrosse zu reden, weshalb sie ihm hin und wieder diesen Gefallen tat. Dass am Wochenende ein bedeutendes Match gegen den Zweitplatzierten der kalifornischen Highschool League anstand, gab ihr die beste Gelegenheit dazu.
»Klar, und wie!«, sagte er und fuhr mit quietschenden Reifen los. Sie hoffte nur, dass ihr Dad das nicht mitbekommen hatte, ihm gegenüber erwähnte sie nämlich regelmäßig, wie verantwortungsbewusst Jeremy war. Auch wenn das nur teilweise stimmte. »Wenn wir die Dragons schlagen, sind wir Zweitplatzierter und können es bis zum Schuljahresende bis ganz an die Spitze schaffen.«
»Und das werdet ihr, da bin ich mir ganz sicher«, sagte sie, da alles andere inakzeptabel wäre.
Während der Fahrt redeten sie wie meistens über ziemlich belanglose Dinge. Jeremy erzählte vom Lacrosse – irgendwas von Offense und Defense – und davon, den neuesten Fast&Furious-Film im Kino sehen zu wollen, sie selbst berichtete von einem wohltätigen Projekt, an dem sie sich beteiligen wollte. Es ging dabei darum, einen Spielplatz in einer sozial schwachen Gegend zu restaurieren. Das Ganze sollte in den Sommerferien stattfinden, sie würde mit der Charity-Gruppe für eine Woche nach Santa Cruz fahren und dort in einem gemieteten Ferienhaus wohnen, das vom anstehenden Kuchenbasar finanziert werden sollte.
»Das wird sicher gut auf deiner Bewerbung für Berkeley aussehen«, sagte er, weil er dachte, dass sie sich nur deshalb so engagierte. Aber das war nicht der einzige Grund. Sie mochte es, etwas für andere zu tun, für Menschen, die es nicht so gut hatten wie sie.
An der Schule angekommen gab Jeremy ihr einen Kuss und schlenderte lässig zu seinen Freunden rüber, während Samantha sich zu Cassidy, Tammy und Holly gesellte. Ihr war natürlich bewusst, dass ihre Namen sich allesamt anhörten, als könnten sie Mitglieder einer Girlband sein. Doch irgendwie mochte sie diese Tatsache, sie mochte es, dass das Klischee voll auf sie zutraf. Sie alle vier waren im Cheerleading-Team. Im Herbst feuerten sie die Footballmannschaft an, im Winter die Basketballer und im Frühjahr die Lacrosse-Spieler, je nach Saison. Sam liebte ihre Rolle als Co-Captain, sie mochte ihre Clique, die ausschließlich aus hübschen schlanken Mädchen und Sportlern bestand, und manchmal stellte sie sich vor, ihr Leben wäre einer dieser Highschoolfilme, die einen zum Lachen brachten und in denen die Welt vollkommen in Ordnung war. Dann konnte sie sich einreden, dass ihre eigene Welt es auch war, und sie konnte ein Lächeln aufsetzen, obwohl ihr nicht immer danach war.
Lächeln, immer lächeln, ja, das konnte sie am besten.
In der Mittagspause saß ihre Clique wie immer zusammen an einem Tisch in der Cafeteria. Wie in jeder Schule in wohl jedem einzelnen Highschoolfilm gab es auch an der Montgomery High dieses typische Gruppendenken. Es gab ein paar Tische, an denen die coolen Kids saßen, dann welche, die die Wissenschaftler und die Nerds unter Beschlag genommen hatten. Es gab einen Tisch für die Punks, einen für die Rocker, einen für die Gothics, einen für die Emos, einen für die Blaskapelle, einen für die Öko-Freaks, einen für die Einhornfraktion und dann natürlich noch einen für die Zombies. Um die meisten dieser Gruppen machte jeder einen großen Bogen, vor allem die coolen Kids, zu denen die Cheerleader, die Sportler und die Reporter gehörten. Das war wohl eine der wenigen Ausnahmen an ihrer Schule: Die Leute, die für die Gomery News schrieben, waren hip. Wahrscheinlich lag es daran, dass das Team der Schülerzeitung nicht in Flickensakkos und mit Hornbrillen herumlief, sondern dass es aus wirklich angesagten Jungen und Mädchen bestand wie zum Beispiel Eleanor Harbor oder Sookie Collins, die beide ehemalige Cheerleaderinnen waren. Eleanor hatte wegen eines Knieleidens aufhören müssen, Sookie, weil sie fünf Kilo zugenommen und sich geweigert hatte, wieder abzunehmen, um der Norm zu entsprechen. Die beiden waren die Topreporterinnen der Gomery und hatten es drauf, jederzeit die heißesten Neuigkeiten aufzudecken und darüber zu berichten. Als Samantha nun zu den beiden hinüberblickte, die eifrig über irgendetwas diskutierten und sich dabei Notizen machten, hoffte sie nur, dass sie nicht irgendwann ihre Vergangenheit ausgraben und sie zur Schlagzeile der wöchentlichen Gomery-Ausgabe machen würden.
Sie erschrak, als sich plötzlich jemand auf den leeren Stuhl neben sie schmiss, musste aber lächeln, als sie erkannte, dass es Jeremy war.
»Richie, Joaquin und ich haben gerade beschlossen, heute Abend ins Kino zu gehen«, informierte er sie. »Bist du dabei?«
»Es ist Donnerstag, Jeremy. Da kann ich abends nicht, das weißt du doch«, sagte sie so leise wie möglich und hoffte nur, dass ihre Freundinnen nicht mithörten. Ein Blick zu ihnen sagte ihr aber, dass sie noch immer mit Tammys neuer Nagellackfarbe – »Billiges Flittchen« – beschäftigt waren. Cassidy und Holly betrachteten Tammys Nägel nun bestimmt schon seit fünf Minuten.
Jeremy ließ ein leises Stöhnen aus. »Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen?«
»Das geht nicht, Jeremy, tut mir leid. Aber du könntest doch ein anderes Mal ins Kino gehen und stattdessen heute Abend zu mir kommen. Wir könnten zusammen lernen oder einen Film auf Netflix gucken.«
»Nee, eher nicht. Ich hab Bock auf Kino.«
»Hab ich da gerade Kino gehört?« Cassidy blickte neugierig auf.
Jeremy sah Cassidy direkt in die Augen. »Ja. Die Jungs und ich wollen uns den neuen Fast&Furious ansehen. Interesse mitzukommen?«
»Und ob! Heute Abend hab ich noch nichts vor.«
Falls Cassidy ihren stirnrunzelnden Blick sah, ließ sie sich jedenfalls nichts anmerken.
»Wann und wo?«
Jeremy nannte Cassidy die Uhrzeit und den Treffpunkt, und Holly lud sich selbst ebenfalls zu dem Treffen ein. Nur Tammy sah Samantha verwirrt an.
»Warum gehst du nicht mit?«, fragte sie sie über den Tisch hinweg.
»Ich hab meinem Dad versprochen, auf meine kleine Schwester aufzupassen. Er hat etwas Wichtiges vor«, antwortete sie, schielte dabei zu Jeremy und hoffte nur, dass er keine Details ausplaudern würde. Tammy war zwar ihre Freundin, aber genau wie Cassidy und Holly wusste sie nichts von den wöchentlichen Gruppentherapietreffen ihres Dads – und das sollte so bleiben.
Doch Jeremy lächelte sie nur an, als hätte er sie gerade nicht vor den Kopf gestoßen, und sagte: »Dann ein anderes Mal, Schatz, ja?«
Sie nickte und ließ sich von ihm einen Kuss geben in der Sekunde, in der die Schulglocke läutete.
Sie blieb noch einen Augenblick sitzen, trank den letzten Schluck ihres Mineralwassers aus und nahm wahr, wie jedes Mädchen im Umkreis von zehn Metern Jeremy hinterherblickte. Kein Wunder, sein dunkelblondes Haar saß mal wieder perfekt, unter seiner Jeans zeichnete sich ein süßer kleiner Knackarsch ab, und als er sich nun noch einmal zu ihr umdrehte, zeigte er ihr sein schönstes Lächeln. Dieses Lächeln gehörte allein ihr. Und sie wusste wieder, wie glücklich sie sich schätzen konnte.
Kapitel 5
Amanda
»Und Sie denken wirklich nicht, dass Sie da was machen können?«, fragte sie und sah den Bankkaufmann flehend an, der ihr an seinem Bürotisch gegenübersaß.
Der ältere Mann mit den weißen Haaren und dem penibel gestutzten Schnurrbart schüttelte den Kopf und erwiderte: »Es tut mir leid, aber Sie haben bereits eine Hypothek aufs Haus, eine zweite kann ich Ihnen in Ihrer derzeitigen Lage nicht gewähren.«
Amanda spürte, wie ihre Kehle sich zuschnürte. »Aber … wenn Sie mir keinen Kredit geben, dann muss ich meine Farm aufgeben. Das Lebenswerk meines Mannes«, sagte sie verzweifelt und war den Tränen nahe.
Sie konnte nicht sagen, ob das, was sie in seinem Gesicht kurz aufblitzen sah, Mitleid war oder etwas anderes, und sie fragte sich, ob ein jüngerer Bankangestellter ebenso kaltherzig gewesen wäre oder ob es eben Regeln waren, die jeder in diesem Institut befolgen musste. Wie auch immer, der Weißhaarige blieb bei seiner Meinung.
»Mrs. Parker, hören Sie, es liegt nicht in meiner Macht. Womöglich … käme ja ein privates Darlehen infrage. Sie könnten im Familienkreis nachfragen, ob Ihnen eventuell jemand …«
Sie hörte sich gar nicht weiter an, was der Mann zu sagen hatte, sondern erhob sich von ihrem Stuhl und sagte bedauernd: »Sehr schade, dass Sie mir nicht helfen wollen.«
»Ich kann Ihnen nicht helfen, Mrs. Parker.«
»Ja, klar, wenn Sie meinen«, murmelte sie und verließ den Raum ohne ein weiteres Wort oder ein Händeschütteln. Sie wollte einfach nur raus, an die frische Luft, denn wie so oft in letzter Zeit hatte sie das Gefühl, nicht mehr atmen zu können.
Seit Toms Tod hatte sie nicht mehr richtig durchgeatmet. Denn es fühlte sich an, als wäre irgendetwas blockiert, da, wo sonst die Luft ihre Lunge durchströmte. Als würde eine Sperre ihr den Weg verweigern.
Die meiste Zeit fühlte sie sich wie in Trance. Als hätte ihr Verstand zwar begriffen, dass Tom für immer fort war, doch als würde ihr Herz es nicht wahrhaben wollen und noch immer darauf warten, dass er einfach um die Ecke bog, sie anlächelte und sie in seine starken Arme nahm. Als wäre alles nur ein Traum, aus dem sie jeden Moment erwachen könnte.
Auch jetzt brauchte sie ein paar Minuten, um sich wieder zu fangen. Um wieder atmen zu können. Mit gebeugtem Körper, die Hände auf die Oberschenkel gestützt, stand sie da und rang nach Luft. Als sie das Gefühl hatte, es würde langsam wieder gehen, richtete sie sich auf und tat einen Schritt, dann noch einen, bis sie ihr Auto erreichte und sich erschöpft auf den Fahrersitz warf.
Sie schloss die Augen und wünschte sich zum hunderttausendsten Mal, die Dinge wären anders gekommen. Tom wäre noch am Leben. Aber das war er nicht.
Und ihr Leben ging weiter. Musste es. Irgendwie.
Sie sah auf die Uhr, und weil Donnerstag war und sie nicht wusste, was sie sonst anderes tun könnte, fuhr sie schon früher zu ihrer Mutter, mit der sie sich einmal die Woche zum Mittagessen traf.
Als diese ihr schon nach dem ersten Klopfen öffnete, und zwar wie immer mit einem Riesenlächeln im Gesicht, musste Amanda unwillkürlich mitlächeln.
»Amy, du bist heute aber früh dran!«, rief ihre Mutter freudig aus.
»Ich hatte einen Termin und war früher fertig«, sagte sie nur vage und trat ein in das Haus, in dem sie ihr halbes Leben verbracht hatte. Sie würde ihrer Mom bestimmt nicht erzählen, wo genau sie gewesen war. In der Höhle des Löwen nämlich – und der Löwe hatte sie aufgefressen.
»Wie schön, dass du schon da bist. Dann bleibt uns mehr Zeit zum Quatschen.« Oh ja, das tat Patricia Odell gerne, es war sogar ihr liebstes Hobby.
»Wer ist da, Patty?«, hörte sie ihren Vater rufen, der kurz darauf in der Wohnzimmertür erschien. Überrascht sah er erst sie an und dann auf seine Uhr. »Es ist erst zehn vor zwölf!«
»Hi, Dad. Wie geht’s?«, begrüßte sie ihn.
»Gut, gut, danke. Und dir?«
»Ganz okay. Ich schlage mich so durch.«
»Und wieso genau bist du noch mal früher hier?«, wollte er wissen.
»Ich hatte einen Termin.«
»Bei uns in Monterey?«
»Ja, genau.«
»Was war das denn für ein Termin?«
Gott, ihr Vater war ja schlimmer als ihre Mutter!
»Ich müsste mal kurz ins Bad«, sagte sie schnell und verschwand in der kleinen Gästetoilette am Ende des Flurs.
Sie lehnte sich von innen gegen die Tür und zwang sich, ruhig zu atmen. Dabei konnte sie ihre Mom sagen hören: »Nun dräng sie doch nicht, dir zu erzählen, wo sie war, John. Vermutlich war sie beim Frauenarzt und hat sich eine Spirale einsetzen lassen oder was die jungen Leute heute zur Verhütung benutzen.«
»Wozu braucht sie denn was zur Verhütung? Sie hat seit anderthalb Jahren keinen Mann angeguckt.«
»Sie trauert noch um Tom, das musst du verstehen.«
»Das tue ich. Ich frage mich nur, was sie wohl für Termine hat hier bei uns in Monterey«, wunderte sich ihr Dad und versuchte dabei nicht einmal, seine Stimme zu senken.
»Das geht dich überhaupt nichts an, du neugieriges Wiesel«, entgegnete ihre Mom mit einem Kichern, dann gab es eine kleine Pause, in der sich ihre Eltern ziemlich sicher küssten, wie sie es so oft taten, selbst nach vierzig Ehejahren noch.
Amanda musste sich zusammenreißen, um nicht laut zu schluchzen. Vierzig Jahre als Mann und Frau, wie sehr sie sich solch eine Liebe auch gewünscht hätte. Doch ihr und Tom waren lediglich fünfzehn gegönnt gewesen.
»Ich geh dann mal in die Küche und bereite das Essen vor«, hörte sie ihre Mutter sagen und ihren Vater daraufhin etwas erwidern, das nur undeutlich zu ihr durchkam. Sie drehte den Wasserhahn auf und wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser. Make-up gab es keines, das verwischen konnte, da sie nie ein Fan davon gewesen war, sich zu schminken und damit zu jemandem zu machen, der sie nicht war.
Sie trat ans Fenster, von wo aus man einen wahnsinnig tollen Blick auf die Bucht hatte. Das weite Meer schimmerte im Sonnenschein, Segelboote und Möwen, die darüber hinwegflogen, ließen es ganz malerisch aussehen.
Sie warf noch einen Blick auf die Idylle, wappnete sich und trat hinaus in den Flur, der inzwischen leer war. Ihre Mom fand sie in der Küche beim Kartoffelschälen vor. Ihr Dad war nirgends in Sicht.
»Dein Vater lässt sich entschuldigen. Er will sich die Anglermeisterschaften im Fernsehen angucken.« Patty verdrehte die Augen. Amanda musste lachen. Sie wusste, wie sehr ihr Vater ihrer Mutter mit dem Angeln auf den Geist ging. Seit er vor sieben Jahren in Rente gegangen war, verbrachte er die meiste Zeit damit, entweder selbst zu angeln oder sich den »Sport« im Fernsehen anzusehen. Vor drei Jahren hatte er sogar all seine Ersparnisse zusammengesammelt und sich den Traum von einem Boot erfüllt. Ein voll ausgestattetes Motorboot, mit dem er weit aufs Meer hinausfahren und seine Angel ins Wasser werfen konnte. Einmal hatte er Amanda verraten, dass er das nur aus Spaß an der Sache tat, aber niemals einen Köder an den Haken hängte. Er wollte keine Fische töten, sondern einfach nur entspannen. Diese verrückte Tatsache brachte seine Frau nur noch mehr auf die Palme. »Wenn er wenigstens was zu essen mit nach Hause bringen würde«, pflegte sie zu sagen, und John schüttelte dann stets belustigt den Kopf und meinte: »Dann könnte ich doch nicht mehr deine leckeren Tofu-Gerichte genießen.« Ihre Eltern waren wirklich süß miteinander, sie kannte kein Paar, das sich so gerne neckte wie die beiden.
»Kein Problem. Was gibt es zu essen? Kann ich dir helfen?«
»Es gibt Kartoffelpüree mit Zucchinigemüse und Linsenmedaillons«, ließ ihre Mom sie wissen.
»Hört sich gar nicht mal so schlecht an«, meinte sie achselzuckend und setzte sich an den Küchentisch. Seit der Doktor ihrem Vater eine spezielle Diät verordnet hatte, die seinen Blutdruck senken sollte, hatte es weit schlimmere Gerichte gegeben.
»Die Medaillons sind wirklich köstlich, du wirst sehen. Du kannst die Karotten dafür schälen und raspeln. Hast du Lust?«
»Klar.«
Ihre Mutter reichte ihr ein Schneidebrett, drei große Karotten, einen Sparschäler und eine Gemüsereibe, und sie machte sich an die Arbeit.
»Was macht Jane so? Sie hat sich schon eine ganze Weile nicht gemeldet«, erkundigte sich Patty.
»Nimm es nicht persönlich. Sie ist in einer schwierigen Phase«, erzählte sie ihr das, was sie auch schon die letzten Male erzählt hatte.
Ihre Mom sah sie eingehend an.
»Was ist?«, fragte sie stirnrunzelnd.
»Wie sieht es denn mit dir aus? Nimmst du es persönlich?«
»Ich versuche, das nicht zu tun. Ist aber gar nicht so einfach.«
»Sie ist ein Teenager, Amy. Und sie hat ihren Vater verloren, vor nicht allzu langer Zeit«, sagte ihre Mutter, als wüsste sie es nicht.
Das machte sie ungewollt wütend.
»Das ist mir wohl bewusst, Mom, ich habe nämlich gleichzeitig meinen Ehemann verloren. Den wichtigsten Menschen in meinem Leben.«
»Jane ist der wichtigste Mensch in deinem Leben«, stellte ihre Mutter klar.
»Ja …« Sie seufzte. »Du weißt doch, wie ich es meinte.«