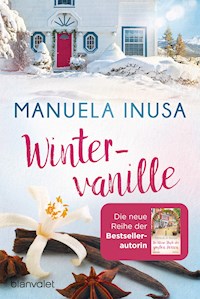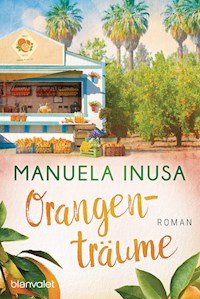12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich werde nie aufhören zu lieben. Weil am Ende die Liebe das Wichtigste ist.« Ela und ihre Oma Lisa, die sie jeden Mittwoch im Seniorenheim besucht, hatten schon immer eine ganz besondere Verbindung. Lisa ist eine Geschichtenerzählerin wie keine andere, und Ela hat dieses Talent von ihr geerbt. Sie selbst ist gerade dabei, ihren ersten großen Liebesroman zu schreiben, momentan mangelt es ihr allerdings noch an Inspiration. Als sie daher eine alte Fotobox durchstöbert, entdeckt Ela eine Postkarte von ihrem bereits verstorbenen Opa Werner. Sie erkennt, dass sie aus einem britischen Gefangenenlager stammt. Nur warum wusste sie bisher noch gar nichts über dieses Kapitel in Werners Leben? Und weshalb hat Lisa bei all ihren Erzählungen die Kriegsjahre eigentlich immer ausgelassen? Einfühlsam und warmherzig erzählt SPIEGEL-Bestsellerautorin Manuela Inusa die bewegende und außergewöhnliche Geschichte ihrer Großeltern Lisa und Werner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Ela und ihre Oma Lisa, die sie jeden Mittwoch im Seniorenheim besucht, hatten schon immer eine ganz besondere Verbindung. Lisa ist eine Geschichtenerzählerin wie keine andere, und Ela hat dieses Talent von ihr geerbt. Sie selbst ist gerade dabei, ihren ersten großen Liebesroman zu schreiben, momentan mangelt es ihr allerdings noch an Inspiration. Als sie daher eine alte Fotobox durchstöbert, entdeckt Ela eine Postkarte von ihrem bereits verstorbenen Opa Werner. Sie erkennt, dass sie aus einem britischen Gefangenenlager stammt. Nur warum wusste sie bisher noch gar nichts über dieses Kapitel in Werners Leben? Und weshalb hat Lisa bei all ihren Erzählungen die Kriegsjahre eigentlich immer ausgelassen?
Manuela Inusa
Hortensientage
Roman
Für Oma Lisa und Opa Werner
Ich weiß, ihr schaut vom Himmel herab
und lächelt
Man lebt zweimal:
das erste Mal in der Wirklichkeit,
das zweite Mal
in der Erinnerung.
Balzac
Heute
Sommer 2024
Es ist ein warmer, sonniger Tag in Hamburg. Ich bin auf dem Weg zu meinem veganen Lieblingsrestaurant in der Langen Reihe, um dort eine gute Freundin zu treffen. Wir wollen die Veröffentlichung meines neuen Romans feiern, den ich frisch gedruckt in meiner Handtasche trage. Es ist ein ganz besonderer Roman, und allein die Tatsache, dass er nach all den Jahren nun endlich erschienen ist, erwärmt mein Herz und zaubert mir ein breites Lächeln aufs Gesicht.
Als ich gleich hinterm Hauptbahnhof das neue Ohnsorg-Theater mit der bronzenen Statue von Heidi Kabel davor passiere, muss ich natürlich an meine Oma Lisa denken, die nicht nur viele Jahrzehnte lang mit Begeisterung das alte Ohnsorg-Theater besucht hat, sondern die auch eine große Liebhaberin von Heidi Kabel, ihrer Schauspielkunst und ihren Liedern war.
Doch eigentlich benötige ich gar keine Statue, um an meine Oma zu denken, denn das tue ich sowieso tagtäglich. Es braucht nur eine bestimmte Melodie, den Duft von Nelken, den Geschmack von Mandarinen oder ein Sprichwort, das sie gerne benutzt hat – und schon ist sie wieder allgegenwärtig.
Ich schreite voran und bin ganz nostalgisch wegen all der Erinnerungen, und ich denke wieder an das Buch, das ich dabeihabe. Meine Oma wäre stolz auf mich, dass ich es wirklich geschafft habe, mit meinen Werken bei einigen der renommiertesten deutschen Verlage unterzukommen. Und dass sie nun in allen Buchhandlungen ausliegen, für jedermann sichtbar und erhältlich. Sie hat sich immer gewünscht, dass meine Geschichten in die Welt hinausgehen und von vielen Menschen gelesen werden. Ich bin traurig, dass sie nicht hier sein kann, um meine Erfolge mit mir zu feiern. Doch ich bin auch glücklich, weil ich jemanden hatte, der an mich geglaubt hat, und zwar mit ganzem Herzen. Jemanden, der mich gelehrt hat, was im Leben wirklich wichtig ist und dass man an seinen Träumen festhalten soll. Dass sie eines Tages wahr werden können, wenn man nur daran glaubt.
Ich habe nie aufgehört zu träumen und zu glauben – und zu lieben. Weil am Ende die Liebe doch das Wichtigste ist.
Das haben meine Großeltern mich gelehrt. Meine Oma Lisa und mein Opa Werner.
Die beiden waren zwei ganz besondere Menschen, ein Liebespaar, das seinesgleichen suchte. Wie zauberhaft sie zueinander waren, wie wundervoll ihre Liebesgeschichte. Viel besser noch als viele, die man aus Romanen oder Filmen kennt.
Ich liebe meine Großeltern an jedem Tag und möchte ihnen danken für jedes weise Wort, für ihre Wärme und Güte. Dafür, dass sie mich die kleinen Dinge schätzen gelehrt haben und dass sie immer für mich da waren, aufmerksam und geduldig. Ich möchte meiner Oma dafür danken, dass sie mir das Marmeladekochen beigebracht hat und mit mir in Paris war, und dass sie stets so viel mehr gegeben als genommen hat. Und meinem Opa danke ich dafür, dass er mit mir gesungen und mir das Gärtnern beigebracht hat, und dass er mir immer das Gefühl von Geborgenheit vermittelt hat.
Ich sehe die beiden noch immer in ihrem Schrebergarten. Meine Oma auf ihrem Sonnenstuhl und meinen Opa mit einer Schaufel in der Hand, weil er wieder einmal ein paar Blumen pflanzt. Ich höre die beiden bei Festen lauthals ihre Lieblingslieder singen. Und ich höre sie Geschichten erzählen. Geschichten von früher, als sie noch jung waren und das ganze Leben vor sich hatten. Sie waren wahre Geschichtenerzähler, und ich glaube, ich habe das von ihnen. Und deshalb fand ich, dass ich nun endlich einmal eine Geschichte über die beiden erzählen sollte, über meine Oma Lisa und meinen Opa Werner, die nicht nur das Leben, sondern auch ihre Heimatstadt Hamburg geliebt haben. Die es verdient haben, dass die Welt von ihnen erfährt. Die niemals in Vergessenheit geraten sollen.
Vielleicht wird es keine Statue am Hamburger Hauptbahnhof von meinen Großeltern geben, aber es gibt dieses Buch, und ich weiß, es hätte sie glücklich gemacht.
Heimtage
Sommer 2012
Es ist Mittwochvormittag, und ich besuche meine Oma. Ich besuche sie nicht nur mittwochs, aber es hat seit meiner Jugend kaum einen Mittwoch gegeben, an dem ich nicht bei ihr war.
Die Tür steht halb offen, und als ich ihr Zimmer betrete, finde ich sie auf ihrem Bett sitzend an. Sie betrachtet das Bild an der Wand, das meine Tochter für sie gemalt hat. Darauf sind die beiden zu sehen, wie sie Hand in Hand in Omas Schrebergarten stehen, von bunten Blumen umgeben. Der Apfelbaum ist auch mit drauf, und sofort fällt mir das alte Lied ein, das meine Großeltern so oft mit mir gesungen haben, als ich ein kleines Mädchen war.
»Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun, ruck zuck övern Zaun, ein jeder aber kann dat nich, denn er muss aus Hamburg sein …«
Ein Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus. Die guten alten Zeiten …
Ich trete zu ihr. »Hallo, Oma«, sage ich.
»Ela. Wie schön, dass du da bist.«
Oma nennt mich seit jeher Ela, genau wie der Rest meiner Familie. Als ich noch ganz klein war, konnte ich meinen eigenen Namen – Manuela – nur schwer aussprechen und habe mir diese Abkürzung anscheinend selbst einfallen lassen. Zumindest haben mir das meine Eltern und Großeltern immer so erzählt. Tja, und irgendwie ist das wohl bei allen hängen geblieben.
Meine Oma sieht zu mir hoch und lächelt zurück. Sie freut sich, mich zu sehen. Sie freut sich immer.
Als Nächstes schüttelt sie mir die Hand, wie sie es meistens tut, und ich gebe ihr einen Kuss auf die Wange. Dann setze ich mich zu ihr aufs Bett und bedaure wie so oft, dass sie jetzt hier sein muss. Dass sie ihr Zuhause aufgeben musste. Den Ort, an dem sie so viele Jahre mit meinem Opa glücklich war. Aber es gab keine andere Lösung. Nachdem sie zweimal schwer gefallen war, konnten wir sie nicht länger allein leben lassen. Ich hätte sie so gerne zu mir geholt, aber wir wohnen zu viert in einer viel zu kleinen Wohnung, noch dazu im dritten Stock ohne Fahrstuhl. Es wäre nicht gegangen. Und dennoch tut es mir leid, obwohl es das eigentlich gar nicht müsste. Weil meine Oma sich hier wohlfühlt, sehr sogar. Und das erleichtert mich ungemein.
»Wie geht es dir?«, erkundige ich mich.
»Wunderbar«, sagt Oma. Das sagt sie fast immer. »Und dir?«
»Auch gut.« Ich sehe zum Bett von Omas Zimmernachbarin Lotti hinüber, das leer ist. Sie wird wohl im Gang sitzen, vielleicht auch beim Friseur. Auf jeden Fall haben wir das Zimmer für uns.
»Was machen deine Bücher?«, möchte Oma wissen.
Ich seufze leicht. »Die laufen ganz gut«, antworte ich.
Ich bin Autorin, oder wenigstens versuche ich, eine zu sein. Ich habe bereits einige Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien veröffentlicht, dazu ein Kinderbuch und ein paar Kurzromane im Selbstverlag. Mein großer Traum ist aber ein richtiger Roman, einer, der bei einem bekannten Verlag unterkommt und viele Leser erreicht. Während ich die letzten Jahre darauf hingearbeitet habe, habe ich mich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Ich habe zwar eine schulische Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin absolviert, finde aber nichts ohne Berufserfahrung und in Teilzeit. Also habe ich stattdessen alles Mögliche gemacht: in einem Callcenter gearbeitet, beim Bäcker Brötchen verkauft, in verschiedenen Unternehmen Kleidung ausgepackt und Hygieneprodukte verpackt. Es war nie das Wahre, aber ich habe mich damit getröstet, dass es nur übergangsweise ist. Bis ich es eines Tages als Autorin schaffe. Und nun bin ich endlich so weit, mit meinen Veröffentlichungen einigermaßen über die Runden zu kommen, keine lästigen Nebenjobs mehr machen zu müssen und mich ganz aufs Schreiben konzentrieren zu können.
»Das klingt aber nicht so toll«, sagt Oma, der mein Seufzer anscheinend nicht entgangen ist.
»Es läuft wirklich ganz gut, keine Sorge. Es ist nur so, dass ich einfach nicht diese eine perfekte Idee finde, nach der ich schon eine ganze Weile suche.«
»Ach, die wird schon noch kommen«, redet Oma mir gut zu. »Manchmal muss man nur die Augen weit offen halten und findet das, was man sucht, ganz unverhofft.«
Ich lächle Oma an. »Ich kann’s ja mal versuchen.«
»Ich bin mir sicher, es wird dir gelingen«, sagt sie und streicht sich durch ihr weißes Haar, das immer noch voll ist. Dann erkundigt sie sich nach meinem Mann und meinen Kindern.
»Denen geht’s bestens. Ich soll dich von ihnen grüßen.«
Meine Oma lächelt mich an, einfach nur das. Und ich bin dankbar. Dass sie noch da ist. Dass sie sich von dem letzten Sturz und dem leichten Herzinfarkt erholt hat. Dass ich noch weitere dieser Momente mit ihr haben darf.
»Ich musste gerade an das alte Lied denken, das du und Opa früher immer mit mir gesungen habt«, sage ich.
»Welches denn?« Es waren viele.
»Das vom Äpfelklauen.«
Omas Augen fangen an zu funkeln. »Aaah. An de Eck steiht’n Jung mit’n Tüdelband«, sagt sie.
»Genau das.«
»Das hat auch mal Heidi Kabel gesungen«, erzählt sie mir.
»Ja, ich weiß.« Natürlich, denn sie hat es mir schon mehr als einmal erzählt.
Oma summt die Melodie und schwankt dabei leicht hin und her. Ich wünschte, sie könnte tanzen wie früher.
»Was gibt es Neues?«, frage ich sie, als sie mit Summen fertig ist.
»Nicht viel. Inge ging es die letzten Tage nicht so gut.«
Inge ist nur eine der vielen Heimbewohnerinnen, die meine Oma ins Herz geschlossen hat. Sie hatte noch nie Probleme damit, neue Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Sie ist ein so viel offenerer Mensch, als ich es jemals war.
»Das tut mir leid«, sage ich und rufe mir Inge ins Gedächtnis, die die meiste Zeit über in ihrem Rollstuhl im Gang sitzt. Sie spricht nie, ich glaube nicht, dass sie es noch kann.
»Sie wird schon wieder«, sagt Oma.
Ich hole die Schokolade aus meiner Handtasche, die ich Oma mitgebracht habe, und sie freut sich darüber und bittet mich, sie in ihr Fach zu legen.
»Ich hab auch die Bilder von der Einschulung dabei«, sage ich und reiche Oma einen Umschlag.
Mein Sohn Kimmy, der eigentlich Hakim heißt, ist jetzt ein Erstklässler. Und meine Tochter Leila wurde ebenfalls eingeschult, sie ist aufs Gymnasium gekommen. Die beiden haben wie ich ein ganz besonderes und enges Verhältnis zu Oma Lisa, die sie auch nur Oma nennen statt Uroma. Ich freue mich so sehr, sie im Leben meiner Kinder zu wissen, mit ihrer Weisheit, ihrem Humor und ihrem großen Herzen.
Oma sieht sich die Fotos an, von ihrem Urenkel mit seiner riesigen blauen Spiderman-Schultüte, und von ihrer Urenkelin in ihrem hübschen lila Kleid, den neuen Hannah-Montana-Rucksack auf dem Rücken.
»Toll«, sagt sie. »Die werde ich später Lotti zeigen.« Sie legt die Bilder auf den Beistelltisch und sieht mich an. »Du, Ela, ich wollte gleich mal raus in den Gang, gucken, was da so los ist heute. Kommst du mit?«
»Klar«, erwidere ich und stehe auf. Oma tut es mir gleich, wenn auch sehr viel langsamer. Ich schiebe ihr den Rollator hin, und sie hält sich mit beiden Händen daran fest. Dann navigiert sie ihn vor sich her, nach draußen, während ich die Tür aufhalte und ihr folge. In die Welt außerhalb ihres Zimmers, in der sich nun ihr geselliges Leben abspielt. Die sie sogar in Jogginghose und Hausschuhen betreten kann. Das Heim verlässt sie nicht sehr häufig, und das braucht sie auch gar nicht, weil es hier alles gibt: einen Friseur, ein Café, den Gang, in dem immer ein paar Freunde anzutreffen sind.
»Hallo, Lisa«, ruft Gerda ihr zu. Sie ist auch eine Freundin meiner Oma, vielleicht ihre beste Freundin hier. Gerda ist um die achtzig und hat bräunlich gefärbte Haare. Sie ist eine ganz Liebe, ich mag sie sehr und bin froh, dass Oma sie hat. Hier im Heim, wo sie eigentlich nie hinwollte, wo sie sich aber inzwischen so zu Hause fühlt, auch dank Menschen wie Gerda.
»Hallo, Gerda«, erwidert Oma. »Guck mal, meine Enkelin ist zu Besuch.«
Gerda lächelt mir freundlich zu, ich lächle zurück und grüße sie.
»Wie geht es dir, Gerda?«, fragt Oma, nachdem sie sich auf den freien Stuhl neben sie gesetzt hat. »Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich dich das beim Frühstück schon gefragt habe, aber wie sagt man so schön: Doppelt hält besser!«
Ich setze mich ebenfalls dazu und lausche dem Gespräch.
»Mein Knie tut weh«, sagt Gerda. »Ich soll morgen abgeholt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.«
»Ach herrje«, sagt Oma. »Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass du noch mal unters Messer musst.«
»Ja, das hoffe ich auch.«
»Ich drück die Daumen«, sagt Oma und blickt sich im Gang um.
Ich weiß, hier sitzt sie gerne. Es ist nicht weit von ihrem Zimmer, und sie ist mitten im Geschehen und bekommt mit, was um sie herum passiert. Wer Besuch bekommt. Wer was Neues zu berichten hat. Wer sich für immer verabschiedet hat. Es waren viele in letzter Zeit.
»Hallo, Marie!«, ruft Oma Marie zu, als diese den Gang entlanggelaufen kommt. Sie läuft ihn immer wieder auf und ab, als würde eines Tages am Ende etwas anderes auf sie warten.
Marie sagt nichts, sie lächelt nur. Dann ist sie auch schon wieder weg.
Ich sehe der zierlichen kleinen Person nach. Marie ist schon neunundneunzig und noch ganz ohne Gehhilfe unterwegs, was ich wirklich bewundernswert finde. Sie hat eine Tochter, die ebenfalls hier im Heim wohnt und mit der sie sich ein Zimmer teilt. Diese ist Mitte siebzig und heißt Rosi. Rosi trägt die gleiche schlichte Kurzhaarfrisur wie ihre Mutter und ist ein wenig mollig, weil sie Süßigkeiten über alles liebt. Sie fragt immer nach Bonbons, auch jetzt kommt sie wieder herbei.
»Hast du Bonbons?«, fragt sie mich.
Ich weiß, in meiner großen schwarzen Handtasche habe ich noch eine halbe Packung Kaubonbons von den Kindern, an diesem Tag habe ich jedoch nur die kleine braune dabei. »Nein, Rosi, heute leider nicht. Aber beim nächsten Mal bringe ich dir wieder welche mit, ja?«
»Na gut«, sagt Rosi und geht den Nächsten fragen.
»Also, Gerda, was gibt es Neues?«, erkundigt Oma sich bei ihrer Freundin und sieht sich dabei neugierig im Gang um.
»Ach, nur das Übliche. Gisela erzählt immer noch allen, dass sie eine Gräfin sei.« Sie deutet hinüber zu der eleganten Frau, die erst seit zwei Monaten bei ihnen ist und die ihr Butterbrot mit Messer und Gabel isst. Das hat zumindest Oma mir erzählt.
Oma schaut ebenfalls zu ihr und zuckt die Schultern. »Na, wenn es sie glücklich macht.«
»Ansonsten kommt meine Tochter gleich zu Besuch. Wir wollen uns vor dem Mittagessen noch ein bisschen ins Café setzen«, fährt Gerda fort.
»Oh, das ist ja schön«, sage ich, und das finde ich wirklich. Denn ich weiß, nicht jeder hier kriegt Besuch.
»Ja, ich freue mich für dich«, sagt Oma.
»Kommt doch gerne mit«, schlägt Gerda vor, doch Oma schüttelt gleich den Kopf.
»Nein, nein, geht nur allein. Vielleicht beim nächsten Mal.«
»Wie du willst«, sagt Gerda, und ich glaube, sie ist ein bisschen erleichtert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie die wenigen Stunden, die sie mit ihrer Tochter hat, allein mit ihr verbringen möchte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Oma ihr Angebot deshalb abgelehnt hat. Sie würde ihr das niemals nehmen wollen.
In dem Moment wird Inge in den Gang geschoben. Olga, die Pflegerin, stellt sie neben dem offenen Zimmer für das Pflegepersonal ab, und ich kann Omas Augen strahlen sehen. Inge ist ihr die Liebste von allen. Ich habe nie genau verstanden, wieso, aber schon seit Omas erster Woche hier scheint die beiden etwas Besonderes zu verbinden, das nur Oma und Inge kennen.
»Oh, da ist meine Tochter auch schon«, sagt Gerda und fängt an zu winken. »Huhu, Erika!«
Gerdas Tochter kommt auf sie zu, umarmt sie herzlich und begrüßt uns flüchtig. Dann gehen die beiden davon, und Oma steht ebenfalls auf. »Einen Moment, Ela«, sagt sie, bevor sie ihren Rollator rüber zu Inge schiebt.
»Hallo, meine Süße«, sagt sie kurz darauf zu ihrer Freundin und streichelt deren Wange. Mir wird ganz warm ums Herz.
Inge starrt vor sich hin, wie sie es immer tut.
Oma zieht sich mühsam einen Stuhl heran, und ich eile ihr zu Hilfe. Während Oma sich zu Inge setzt, gehe ich zu meinem Platz zurück und beobachte die beiden.
»Wie geht es dir heute?«, erkundigt Oma sich bei Inge.
Inge ist still, wie sie es immer ist. Doch das macht Oma nichts aus. Weil sie weiß, dass Inge sie hört und sich über ihre Gesellschaft freut.
»Heute habe ich leider keine Banane für dich dabei«, sagt Oma bedauernd.
Inge liebt Bananen, sie sind das Einzige, was sie überhaupt ein wenig aus der Reserve lockt.
»Aber ich habe ein paar Minuten für dich, vielleicht freust du dich ja darüber genauso.«
Inge schweigt weiter, während Marie noch immer den Gang auf und ab läuft. Sie scheint überhaupt nie müde zu werden.
Ich beobachte die Menschen und frage mich, was sie wohl alles erlebt haben. Was ihnen in ihrem langen Leben widerfahren ist, das Gute wie das Schlechte. Sie sind alle mindestens siebzig oder achtzig, Oma ist bereits siebenundachtzig, und sie hat viel durchgemacht.
Als sie noch ein kleines Mädchen war, wurde sie von ihrer Mutter in ein Kinderheim gegeben, weil diese überfordert war. Ihren Vater hat sie nie gekannt. Das hat Oma mir erzählt, ohne dabei sehr emotional zu werden. Vielleicht, weil sie sich nach all den Jahren damit abgefunden hat, vielleicht aber auch, weil es ihr letztendlich zu einem besseren Leben verholfen hat. Denn zum Glück wurde sie nach nicht allzu langer Zeit von einem Ehepaar aufgenommen, das sie behandelte, als wäre sie die eigene Tochter. Das Paar hatte schon drei Kinder, und so wuchs Oma mit zwei Brüdern, Artur und Walter, und einer Schwester, Annemarie, auf. Damals wohnten sie in Hamburg-Billstedt auf einem ziemlich großen Stück Land, auf dem sie Kartoffeln und jede Menge Gemüse anbauten und sogar ein paar Hühner und Kaninchen hielten. Sie hatten auch einen wunderschönen Blumengarten, in dem Rosen und Hortensien blühten. Ihr Pflegevater Johannes war Schaffner bei der Straßenbahn, ihre Pflegemutter Anna Wäscherin, Oma hat mir oft von ihnen erzählt. Sie hat mir allgemein sehr viele Geschichten aus ihrer Kindheit und auch aus ihren jungen Erwachsenenjahren erzählt. Ich glaube, es gibt nur wenige Enkelkinder, die so viel über ihre Großeltern wissen wie ich, und ich habe es immer als Segen empfunden, so ein inniges und vertrautes Verhältnis zu ihnen zu haben. Mein Opa Werner war genauso ein Geschichtenerzähler. Als Kind habe ich seine Geschichten oft sogar noch lieber gemocht, weil sie frecher und abenteuerlicher waren. Opa war derjenige von beiden, der immer etwas mit mir unternommen hat. Der im Urlaub mit mir auf Erkundungstour gegangen ist, während Oma sich lieber am Ostseestrand gesonnt hat. Der mit mir Hoppe, hoppe, Reiter gespielt hat, bis ich vor Lachen nicht mehr konnte. Der mich stundenlang auf meinem Schlitten durch den Schnee hinter sich hergezogen hat, bis mir die Füße eingefroren waren. Ich denke so gerne an diese Zeiten zurück und vermisse meinen Opa ganz schrecklich. Und ich weiß, Oma geht es genauso.
Nach ein paar Minuten kommt sie zurück zu mir, setzt sich und atmet schwer aus.
»Alles gut?«, frage ich.
»Ach, weißt du, der Tag ist nicht mal halb rum, und doch bin ich schon erschöpft. Wenn man älter wird, erschöpft einen das Leben, so ist das nun mal.«
Ja, das kann ich mir vorstellen. Um Oma auf andere Gedanken zu bringen, frage ich sie: »Magst du mir nicht von früher erzählen? Das fände ich wirklich schön.«
Ihr Gesicht erhellt sich, und alle Erschöpfung scheint von ihr zu weichen. Denn meine Oma liebt es, mir von früher zu erzählen, wie sie es immer nur nennt, und ich tue das auch. Es ist eine meiner schönsten Erinnerungen, wie ich als kleines Mädchen mit Oma in der Küche oder im Garten saß und sie mir von ihrer eigenen Kindheit, von ihren Geschwistern, Freundinnen oder meinem Opa erzählt hat. Manchmal auch von meinem Vater, als er noch ein kleiner Junge war, von ihrer Arbeit im Schuhladen oder von den Reisen, die sie unternommen hat. All diese Geschichten sind sehr fröhlich, oftmals richtig humorvoll, und sie haben mich schon immer aufgeheitert. Und Oma auch.
»Von meiner Kindheit?«, fragt sie.
Ich nicke. »Wenn du möchtest.«
»Na gut«, sagt sie und schließt für einen Moment die Augen. Und ich weiß, dass sie sich in eine andere Zeit versetzt. In eine Zeit, in der sie jung und das Leben unbeschwert war.
Salmis
Sommer 1935
»Was wollen wir heute machen?«, fragte ich meine beste Freundin Uschi eines Tages nach der Schule.
Wir waren zehn Jahre alt, gingen auf eine reine Mädchenschule und verbrachten die Nachmittage meistens damit, uns nach Jungs umzusehen. In unserer Nachbarschaft gab es Gott sei Dank genügend davon.
»Wollen wir den Heinrich-Jungen einen Streich spielen?«, schlug Uschi vor.
»Ich würde lieber ein bisschen Geld verdienen«, entgegnete ich. »Ich hab so Lust auf eine Tüte Salmis.« Die gab es für fünf Pfennig im Gemischtwarenladen. Wir hatten nicht oft das Vergnügen, etwas Süßes zu naschen, selbst in unserem Nikolausstiefel befanden sich meist nicht mehr als eine Apfelsine und ein Dauerlutscher, dabei hätte ich sterben können für eine Handvoll Himbeerbonbons, Pfefferminzbruch oder eine Schaumzuckermaus. Aber Salmis – die mochte ich am allerliebsten.
»Woran hast du gedacht? Willst du wieder Alteisen sammeln?«, fragte Uschi.
Das taten wir ab und zu, der Alteisenhändler gab uns immer ein paar Pfennig dafür. Doch es war auch gefährlich. Der Horst hatte sich kürzlich eine Infektion durch den Rost geholt, hatten wir gehört.
Ich spielte mit einer Strähne meines blonden, zu einem Bob geschnittenen Haares. »Ich dachte da eher an Pferdeäpfel«, teilte ich meiner Freundin mit.
Die hatten wir zwar bisher noch nicht selbst gesammelt, aber ich wusste von anderen Kindern, dass man so ganze zwanzig Pfennig von den Landwirten bekommen konnte, die die Pferdescheiße als Dünger einsetzten. Es hieß, dass dadurch die Kohlköpfe doppelt so groß und die Rettiche doppelt so lang wurden. Soviel ich wusste, hatte mein Vater diese Art des Düngens bisher noch nicht ausprobiert, aber vielleicht konnten wir ihn ja davon überzeugen, dass auch die Kartoffeln fünfmal so groß würden.
»Iiih, Lisa, das ist eklig! Ich fasse doch keine Pferdeäpfel an!«, sagte Uschi entsetzt.
»Na, anfassen sollst du sie ja auch nicht. Wir holen uns zwei Schaufeln aus dem Schuppen, heben sie damit auf und tun sie in einen Eimer. Was hältst du davon?«
»Hmmm … Auf Salmis hätte ich schon auch Lust«, sagte Uschi und musste nicht lange überlegen. »Na gut, lass es uns tun. Aber wenn meine Mutter mich später ausschimpft, weil ich nach Pferdemist rieche, bist du schuld!«
»Ich nehme alle Schuld auf mich«, sagte ich lachend, und wir liefen die Straße hinunter und zu unserem Hof.
Bepackt mit Eimern und Schaufeln, machten wir uns auf die Suche. Schnell hatten wir hier und da ein paar Pferdeäpfel entdeckt, die die Tiere auf der Straße abgelassen hatten, und sie in unsere Eimer manövriert, die immer schwerer wurden. Weshalb wir uns mit nur halbvollen Eimern auf zu meinem Vater machten, der uns aber nur auslachte.
Also versuchten wir es beim Nachbarn, Herrn Rothschild, der Gurken anbaute. Er lachte ebenfalls und hielt sich die Nase zu, als wir bei ihm ankamen und unsere Engelsgesichter aufsetzten. Doch er war gütig und gab uns jeder ein Fünfpfennigstück, mit dem wir uns gleich auf den Weg zum Gemischtwarenladen machten. Dort kauften wir uns jeder ein Tütchen Salmis, diese leckeren, kleinen, salzigen Lakritzen in Karo-Form, die wir uns sofort mit Spucke auf die Handrücken klebten, um die nächste halbe Stunde immer mal wieder daran zu lecken und besonders lange etwas davon zu haben.
Ein paar Jungs kamen herbei. Sie sangen das plattdeutsche Lied An de Eck steiht’n Jung mit’n Tüdelband, in dem es darum ging, Äpfel zu klauen.
Es konnte sich nur um Werner Peinemann und seine Freunde handeln, die nämlich wirklich gerne die Äpfel der Nachbarn klauten. Erst vor ein paar Tagen hatte ich gehört, dass Werner eine Tracht Prügel von seinem Vater bekommen hatte, weil er wieder welche stibitzt hatte.
»Habt ihr da Salmis?«, fragte Werner, der uns jetzt neidisch beäugte. Er war ein Jahr älter als wir, auch wenn er nicht viel größer war.
»Haben wir«, sagte Uschi schnippisch.
»Bekommen wir welche ab?«, fragte Werners Freund Karl. Der Horst war ebenfalls mit dabei, er schien seine Infektion überstanden zu haben.
»Geht doch selber Pferdeäpfel sammeln!«, meinte Uschi und leckte provozierend an ihren Salmis.
Dass Werner sich vor Scheiße nicht ekelte, wussten wir beide. Jeder kannte die Geschichte, wie er in eine Zeitung gekackt, alles schön verschnürt und dieses Paket dann einer Frau beim Gang über die Brücke von unten in den Einkaufskorb geworfen hatte. Ihr Gesicht beim Auspacken mochte ich mir nicht einmal vorstellen.
Doch ich musste nur für eine Sekunde in Werners blaue Augen schauen – und er hatte mich!
»Na gut, aber jeder nur einen«, sagte ich und gab jedem der drei Jungen genau einen Salmi.
»Danke, Lisa.« Werner lächelte mich strahlend an. »Hast was gut bei mir.«
»Das merke ich mir«, sagte ich und schlenderte zusammen mit Uschi davon. Dabei sangen nun wir: »Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun …«
Und die Welt war in Ordnung.
Blumen
Bei meinem nächsten Besuch ist die Tür zu Omas Zimmer zu. Ich klopfe an und warte, dass jemand »Herein!« ruft. Nachdem dies geschehen ist, trete ich ein. Oma und Lotti liegen beide in ihren Betten.
»Oh, ist alles in Ordnung?«, frage ich und hoffe, dass keine von ihnen krank ist. Heute ist so ein schöner Sommertag, nicht zu heiß, aber dennoch sonnig und wolkenlos. Eigentlich hatte ich vor, Oma zu einem Spaziergang zu überreden. Ich beuge mich zu ihr runter und gebe ihr einen Kuss.
»Uns geht’s gut«, beruhigt Oma mich sogleich. »Wir haben uns nur ein bisschen ausgeruht und unterhalten.«
»Ach so. Ich hoffe, ich störe nicht?« Das hoffe ich wirklich, denn gerade heute brauche ich ein bisschen Oma-Time. Ich stecke ein wenig in der Krise, würde ich sagen, und ich hoffe, dass meine Oma mir vielleicht mit einem guten Ratschlag oder auch einfach nur mit ihrer Nähe weiterhelfen kann.
»Nein, nein, Ela. Du störst doch nie«, sagt sie, und ich bin erleichtert. »Außerdem ging es um gar nichts Wichtiges. Wir haben nur über die leckeren Kartoffelpuffer von gestern geredet und darüber, dass wir uns freuen würden, wenn es öfter welche gäbe.«
Ich weiß, meine Oma liebt Kartoffelpuffer. Das hat sie schon immer. Als sie noch ein Kind war, hat ihre Pflegemutter Anna sie oft gemacht. Sie waren billig, denn die Familie baute ja Kartoffeln an. Und auch später hat Oma sie noch gerne gegessen. Fast jedes Mal, wenn wir zusammen auf dem Hamburger Dom, dem größten Volksfest des Nordens, waren, hat sie sich welche gekauft. Drei Stück mit Apfelmus, schön kross mochte sie sie am liebsten.
»Gab es dazu Apfelmus?«, frage ich, und Oma nickt.
»Oh ja.«
»Sie hat sich löffelweise was davon auf die Puffer gehäuft«, verrät Lotti lachend. »Die halbe Schüssel war leer.«
Ich muss auch lachen. Ja, das klingt nach meiner Oma. Wenn sie sonst auch äußerst bescheiden ist, kann sie bei diesem Gericht einfach nicht widerstehen.
»Ich hab dir Blumen mitgebracht«, sage ich und halte Oma die Nelken entgegen.
»Oh, wie hübsch. Nelken mag ich gerne. Ich hab auch welche in meinem Garten gehabt, einmal um das ganze Blumenbeet herum«, erzählt sie Lotti, während ich die verwelkten Sommerastern entsorge, die Vase neu mit Wasser befülle und die Nelken hineinstelle.
»Ich mag am liebsten rote Rosen«, erzählt Lotti.
»Die hatte ich auch. Gleich neben meiner Eingangstür.«
»Dein Garten muss ja wirklich schön gewesen sein.«
»Oh ja, das war er«, erwidert Oma und sieht dabei ein bisschen traurig aus, wie immer, wenn sie von ihrem Garten spricht, der nun wie so vieles andere nur noch eine Erinnerung ist.
Ich platziere die Blumen auf ihrem Beistelltisch, und Oma rückt die Füße ein bisschen zur Seite, um mir Platz am Ende ihres Bettes zu machen. Ich hätte auch einen der Stühle nehmen können, die am Fenster um den runden Tisch herum stehen, begnüge mich aber mit dem Bett. Vielleicht möchte Oma nicht, dass ich so weit weg sitze.
»Mögen Sie Kartoffelpuffer auch so gerne?«, fragt Lotti mich dann. Ah, wir sind also wieder zurück bei diesem Thema.
Obwohl Kartoffelpuffer nicht zu meinen Leibspeisen gehören, antworte ich: »Klar, wer mag die nicht?«
»Gisela!«, informiert Oma mich. Die Gräfin.
»Oh, ehrlich?«
»Sie hat gemeint, das sei ein Arme-Leute-Essen«, sagt Oma, und Lotti verdreht die Augen.
»Ich habe die hübschen Bilder von der Einschulung gesehen«, sagt Lotti dann. »Und von der Schultüte mit dem lustigen Spinnenmann.«
Ich muss schmunzeln. »Ja, mein Kleiner hatte sich so eine gewünscht, er liebt den Spinnenmann«, erzähle ich.
»Ja? Und was mag er noch?«
Da muss ich nicht lange überlegen. »Am allerliebsten mag Kimmy Fußball. Er spielt seit Kurzem auch in einer Mannschaft.«
»In unserer Familie mögen alle Männer Fußball«, unterrichtet Oma ihre Mitbewohnerin. »Das war schon immer so.«
»Und das wird sich auch nicht ändern«, sage ich, weil ich an meinen fußballverrückten Vater denke und an meinen Mann, der ebenfalls ein Fan ist. Mein fast fünf Jahre jüngerer Bruder Christian ist zwar nicht wirklich fußballbegeistert, aber das machen die anderen mit ihrer Leidenschaft locker wett. Mir graut es schon ein bisschen vor der nächsten WM, wenn die drei wieder einen ganzen Monat lang nichts als Fußball im Kopf haben werden.
»Was habt ihr denn jetzt Schönes vor?«, fragt Lotti dann. »Es sind noch zwei Stunden bis zum Mittagessen.«
»Ich wollte Oma eigentlich fragen, ob sie Lust auf einen Spaziergang hat«, sage ich.
Aber Oma scheint nicht allzu enthusiastisch. Vielleicht ist sie heute doch ein bisschen schlapp, nicht, dass sie es zugeben würde. Die meiste Zeit über gibt sie sich nämlich äußerst tapfer, egal, welche Gebrechen sie gerade begleiten. »Können wir uns nicht einfach draußen auf die Bank setzen?«, fragt sie.
»Na sicher, das können wir auch machen.«
Ich hole Omas Rollator, helfe ihr aus ihren festen Hausschuhen und in die Straßenschuhe, und überlege, ob sie eine leichte Jacke überziehen sollte. Ich beschließe, dass es besser ist, ausziehen kann sie sie immer noch. Also nehme ich die hellblaue Strickjacke aus dem Schrank und helfe ihr auch da hinein.
»Viel Spaß euch!«, wünscht Lotti, und ein bisschen tut es mir leid, dass wir sie zurücklassen müssen. Aber sie sitzt im Rollstuhl und hat einige Krankheiten, weshalb ich mir nicht zutraue, sie mitzunehmen. Wahrscheinlich hätte man mich auch gar nicht gelassen.
Oma und ich biegen im Gang nach rechts ab. Auf dem Weg zum Fahrstuhl grüßt sie etliche Bewohner. Wir fahren nach unten, treten aus der Tür und gehen die paar Meter bis zur nächsten freien Bank. Oma wirkt erschöpft. Das Laufen fällt ihr immer schwerer. Ohne Rollator geht es gar nicht mehr. Dabei ist sie vor wenigen Jahren noch Fahrrad gefahren. Und sie hat sich um ihren Schrebergarten gekümmert, wo sie stets den ganzen Sommer verbracht hat. Oma hat ihren Garten geliebt und hätte sich niemals davon abhalten lassen, in jedem Jahr von Mai bis Oktober in das kleine Gartenhaus zu ziehen. Manchmal auch schon im April, wenn das Wetter mitspielte. Je eher, desto besser, Hauptsache, sie konnte wieder in die Sonne, zu ihren Blumen und zu ihren Gartenfreunden, mit denen sie Feste gefeiert, Lieder gesungen und auch mal einen gehoben hat. Viele Jahre war sie Mitglied in einem Seniorenverein, fuhr mit auf Ausflüge und Reisen, und jeden Montagnachmittag ging sie zur fröhlichen Seniorenrunde. Bis sie nicht mehr konnte. Bis sie ihre Leichtigkeit verlor und manchmal auch vergaß, dass Montag war.
Ich weiß, wie sehr ihr das alles fehlt, und ich spreche sie deshalb nicht sehr häufig darauf an. Doch hin und wieder tut sie das von selbst, heute sogar schon zum zweiten Mal.
»Guck mal, Ela, all die Blumen!«, sagt sie und zeigt zu den Hortensien, die in der Nähe der Bänke gepflanzt sind. »Wir hatten im Garten ja auch Hortensien. In Blau und in Rosa.«
»Ja, ich erinnere mich.« Ich sehe sie noch vor mir.
»Ich vermisse meinen Garten«, sagt Oma betrübt, und ich nehme ihre Hand.
»Ich vermisse ihn auch.«
Ich bin in diesem Garten groß geworden. Habe unzählige Tage und Nächte dort verbracht. Als meine Mutter damals nach meiner Geburt wieder arbeiten gehen wollte, hat sie eine Einigung mit meiner Oma getroffen. Sie würden beide drei Tage die Woche arbeiten, und die jeweils andere würde mich dann an diesen Tagen betreuen. Wenn meine Mutter also ins Büro fuhr, war ich bei meiner Oma. Im Winter in ihrer Zweizimmerwohnung in Hamburg-Hamm, im Sommer im Schrebergarten auf der Billerhuder Insel. Es waren schöne Tage, ich denke unglaublich gerne daran zurück.
»Wer wohl noch alles da ist?«, fragt Oma.
»Das weiß ich leider nicht.« Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht viele sind. Als Oma im letzten Jahr ihren Garten endgültig aufgegeben hat, waren die meisten ihrer Freunde bereits verstorben. Ich weiß noch, dass sie ein Adressbuch hatte und nach und nach immer mehr Namen durchstreichen musste. Es war unglaublich traurig, das mit anzusehen.
Omas Blick ruht auf den lila Hortensien. »Kennst du eigentlich das Lied von Marlene Dietrich?«, fragt sie. »Sag mir, wo die Blumen sind?«
Ich muss überlegen. Mein ganzes Leben habe ich immer, wenn ich bei meiner Oma war, den Radiosender NDR 1 Welle Nord mitgehört, auf dem sie hauptsächlich Schlager spielten, hin und wieder auch Volksmusik, einen Evergreen oder einen deutschen Popsong. »Ich glaube schon«, sage ich.
Und plötzlich fängt Oma ganz unverhofft zu singen an. Und ich höre ihr zu.
»Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? …«
Sie singt immer weiter, und das Lied wird mit jeder Strophe tragischer. In der dritten geht es darum, wo die Männer sind – sie sind in den Krieg gezogen –, und in der vierten darum, dass sie dort gefallen sind. Es ist herzzerreißend. Ich weiß jetzt, dass ich es kenne, aber noch nie auf den Text geachtet habe.
»Das ist so traurig«, sage ich, als Oma mit Singen fertig ist.
»Der Krieg war ja auch traurig«, erwidert sie.
»Unglaublich, dass du ihn miterlebt hast.«
»Ja, es waren harte Zeiten.« Mehr sagt Oma nicht. Sie mag es nicht, über den Krieg zu reden. Und vor allem nicht darüber, was den Juden und anderen Verfolgten damals widerfahren ist. Immer, wenn ich sie als Jugendliche darauf angesprochen habe, ist sie dem Thema ausgewichen. Hat gesagt, dass sie das alles damals gar nicht so mitbekommen hätten. Ich vermute, es ist eine Art Schutzhaltung, die viele Menschen dieser Generation sich zugelegt haben. Denn zuzugeben, dass sie sehr wohl mitbekommen haben, wie etliche ihrer Mitschüler, Kollegen und vielleicht sogar Freunde verschwanden, wäre kaum zu ertragen gewesen. Sie wollten die Schuld nicht auf sich nehmen, da war es leichter, die Augen zu verschließen.
Ich nehme es Oma nicht übel. Ich habe diese Zeiten nicht miterlebt und will mir nicht anmaßen, über irgendwen zu urteilen. Im Grunde kann ich doch nicht einmal ansatzweise nachvollziehen, welche Schmerzen dieser Krieg verursacht hat.
»Lass uns über was Fröhlicheres reden«, sage ich und erzähle ihr von Kimmy, der am Wochenende ein Fußballspiel hatte.
»Schön, dass es ihm Spaß macht«, sagt Oma. »Vielleicht wird er ja der nächste Klinsmann oder Matthäus.«
Ich muss lächeln. Klar, dass Oma die aktuellen Fußballspieler nicht kennt. »Ja, er träumt jetzt schon von einer großen Karriere.«
»Und was macht Leila?«, erkundigt sich Oma. Meine Tochter wird im November elf.
»Die trifft sich am liebsten mit ihren Freundinnen, hört Musik, guckt Fernsehen oder beklagt sich über die nervigen Jungs.«
Oma schmunzelt. »Musik und Jungs. Da hat sich also seit damals nicht viel verändert, was?«
»Wahrscheinlich nicht«, sage ich, da ich ja Omas Jugendgeschichten kenne. Wir reden noch ein bisschen über meine Kinder, dann fragt Oma nach meinen Büchern.
»Woran schreibst du denn gerade?«, möchte sie wissen. Oma ist immer so interessiert an dem, was ich tue, was ich einfach wundervoll finde. Und sie ist sehr stolz auf mich, zeigt meine schmalen Werke all ihren Heimfreundinnen und sogar den Pflegerinnen und erzählt ihnen, dass ihre Enkelin Schriftstellerin ist.
»Ich schreibe gerade an einer Geschichte für die diesjährige Weihnachtsanthologie vom piepmatz-Verlag«, erzähle ich. Ich war auch schon in der letztjährigen mit dabei. Der piepmatz-Verlag ist ein sehr kleiner Verlag, aber es ist eine gute Gelegenheit, dazuzulernen und mich schreibtechnisch weiterzuentwickeln.
Oma lacht. »Wir haben doch August!«
»Ja, ich weiß. Aber so ist das nun mal. Die Geschichten müssen frühzeitig geschrieben werden, um dann pünktlich zu Weihnachten zu erscheinen.«
»Na, andererseits ist wieder Nikolaus, bevor man sich’s versieht«, sagt Oma. Und ich weiß, sie freut sich jetzt schon auf die Lebkuchen. Sie sieht mich an. »Und? Was ist mit der einen großen Idee? Hast du sie schon gehabt?«
Ich schüttle den Kopf. »Nein, leider nicht. Und ich weiß nicht, ob ich sie jemals haben werde.«
»Nun lass mal den Kopf nicht hängen, Ela. Irgendwann wird sie dir schon kommen.«
Ich sehe nun selbst zu den Hortensien, weiß nicht, wie ich Oma das fragen soll, was ich sie gern fragen möchte. Nämlich, ob sie mir nicht weiterhelfen kann. Immerhin hat sie so ein langes, erfülltes Leben hinter sich, ist so vielen Menschen begegnet und hat selbst die eine große Liebe gekannt. Und das ist es, worüber ich schreiben möchte. Ich würde so gerne eine wunderschöne Lovestory zu Papier bringen, mit der ich es endlich mal ein bisschen weiter schaffe als nur auf die Verkaufsseite eines Onlineanbieters. Mein allergrößter Traum ist es, eines Tages in eine Buchhandlung zu gehen und dort mein Buch liegen zu sehen. Ich glaube, ich würde vor Stolz platzen und selbst alle vorrätigen Bücher kaufen. Aber nein, nein, die sollen doch von anderen Menschen gelesen werden. Das ist es ja, was ich unbedingt möchte, das ist es, worauf ich an jedem einzelnen Tag hinarbeite.
Ich überlege noch immer, wie ich Oma um Hilfe bitten soll, als sie anfängt, von Gerda zu erzählen. Ich habe den Moment verpasst. Aber das ist okay, denn im Grunde weiß ich ja, dass ich es selbst schaffen muss. Nur ich allein kann mir aus dieser Krise heraushelfen.
»Wie geht es denn Gerda?«, frage ich also. »Muss ihr Knie nun operiert werden?«
»Ja, leider. Sie hat ein bisschen Angst davor.«
»Das kann ich mir vorstellen, die Arme.«
Oma berichtet mir auch noch von ihren anderen Heimfreundinnen, dann sagt sie, dass sie mal auf die Toilette muss. »Meine Blase ist nicht mehr die beste, das weißt du ja. Aber das geht uns allen hier so. Die meisten müssen sogar schon Windeln tragen.«
Ich frage mich, wie es mir mit siebenundachtzig ergehen wird, falls ich überhaupt so lange lebe. Ob ich noch so agil sein werde wie meine Oma und so voller Erinnerungen. Ob ich zurückblicken und sagen kann, dass ich mein Leben auf die bestmögliche Weise gelebt habe. Und ich frage mich plötzlich, ob Oma das sagen kann oder ob es da Dinge gibt, die sie gern anders gemacht hätte, Dinge, die sie vielleicht sogar bereut. Sosehr ich ihre fröhlichen Geschichten mag, habe ich in letzter Zeit oft das Gefühl, als gäbe es da noch viel mehr. Diese andere Art von Erinnerungen, die Oma sicher auch begleiten, Geschichten, die sie mir nie erzählt hat. Und da sie nun mal schon auf die neunzig zugeht, weiß ich auch, dass die Zeit langsam knapp wird. Vielleicht werde ich sie demnächst mal bitten, mir etwas zu erzählen, das ich noch nicht kenne, aber gerade ist nicht der richtige Moment dafür, denn die Toilette ruft.
»Dann lass uns reingehen«, sage ich und erhebe mich. Ich gehe neben Oma her, und mein Blick fällt auf ein Centstück, das am Boden liegt. Natürlich hebe ich es auf, denn mein Opa hat immer gesagt: »Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.«
Oma lächelt mich an. Wahrscheinlich hat sie gerade dasselbe gedacht.
Wir steuern auf die Toilette zu, die sich unten im Gebäude in der Nähe des Eingangs und des Cafés befindet. Während Oma kurz verschwindet, gehe ich zu dem Bücherregal rüber. Es hat seinen Platz neben der Leseecke, die aus mehreren Sofas besteht und fast immer leer ist. Aber Bücher werden öfter mal welche mitgenommen, die Bewohner können sie sich ausleihen und wieder zurückstellen, wann immer sie wollen. Hin und wieder kommen auch ein paar neue hinzu, Spenden von Verwandten oder vom Heimpersonal. Es haben sich wieder welche dazugesellt, wie ich jetzt sehe. Ich nehme eins von Nicholas Sparks in die Hand, das ich bereits gelesen habe. Er ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren, ich habe alle seine Bücher im Regal stehen. Wie sehr wünschte ich, ich könnte schreiben wie er. Große Liebesgeschichten, die Menschen auf der ganzen Welt berühren.
Als Oma zurückkommt und mich bei den Büchern findet, sagt sie: »Vielleicht steht da ja auch mal ein Buch von dir.«
»Ja, das wäre schön«, sage ich und versuche, mir nicht anmerken zu lassen, wie betrübt ich gerade mal wieder bin.
Oma sieht mich aufmunternd an. »Du wirst es schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Eines Tages wird ganz Deutschland deine Geschichten lesen.«
»Glaubst du das wirklich?«, frage ich.
Oma nickt. »Ich bin fest davon überzeugt.«
»Ich hoffe, du hast recht«, sage ich und senke ein wenig verlegen meine Stimme, weil gerade jemand vorbeikommt und das Ganze mit angehört haben könnte.
»Du musst mehr Vertrauen in dich haben«, sagt Oma, als der Mann mit seinem Rollator ein paar Schritte weitergegangen ist. »Also, ich habe es.«
Ich drücke meine Oma sachte. »Danke, Oma.«
»Ach, wofür denn?«, sagt sie, und im nächsten Moment: »Gehen wir hoch? Ich will mal gucken, was im Gang so los ist.«
»Na klar«, entgegne ich, weil ich weiß, wie sehr sie sich auf neuen Tratsch freut.
Zitroneneis
Mein Kleiner rennt zu Omas Tür und in ihr Zimmer, bevor ich ihn aufhalten kann. Als ich reinkomme, sehe ich, wie er Oma so fest drückt, dass ich Angst habe, er könnte ihr wehtun. Leila geht ein wenig behutsamer vor.
»Hallo, Oma«, sagt sie.
»Hallo, ihr Süßen! Wie schön, dass ihr da seid!« Oma strahlt übers ganze Gesicht. Sie freut sich immer so, wenn ich die Kinder dabeihabe. Sie verbringt gerne Zeit mit ihnen, ist an ihrem Leben interessiert, freut sich, wenn sie davon erzählen. Und sie erzählt ihnen im Austausch dieselben Geschichten, die sie mir damals erzählt hat.
Früher, als sie noch in ihrer Wohnung beziehungsweise im Schrebergarten gewohnt hat, haben wir sie jeden Mittwochnachmittag besucht. Jetzt kommen wir meist am Wochenende, oft zusammen mit meinem Vater und manchmal mit meinem Mann. Da aber heute Mittwoch ist, und ich es vormittags wegen eines Termins nicht geschafft habe, sind wir also jetzt hier. Ich habe Oma gestern auf ihrem Handy angerufen, um sie darüber zu informieren.
Lotti liegt in ihrem Bett und schläft, weshalb ich die Kinder bitte, leise zu sein.
»Wie geht es dir, Oma?«, frage ich, nachdem auch ich sie begrüßt habe.
»Na, wunderbar, jetzt, wo ihr da seid«, antwortet sie.
»Wir haben dir Hamburger Speck mitgebracht«, sage ich und hole ein Tütchen mit den süßen rot-weißen Schaumzuckerquadraten hervor, die sie als Kind schon so geliebt hat.
»Oh, da freu ich mich aber.« Oma nimmt ihn entgegen. »Wart ihr auf dem Dom?«, erkundigt sie sich.
Ich nicke. »Ja, am Samstag. Papa war auch mit dabei.«
Oma wirkt ein wenig bedrückt, wahrscheinlich weil sie selbst nicht mehr zum Hamburger Dom