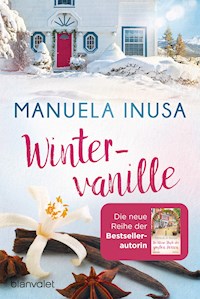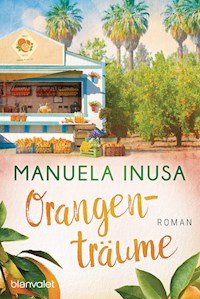9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Echte Liebesgeschichten haben kein Ende
Als Nathalie in der Psychiatrie Lucas kennenlernt, ist da sofort etwas Besonderes zwischen ihnen. Beide spüren es und doch können beide es nicht zulassen. Nathalie nicht, weil sie nach dem Unfalltod ihres kleinen Bruders unter der Last der Schuldgefühle verstummt ist. Lucas nicht, weil er den Glauben daran verloren hat, dass ihn irgendwer auf dieser Welt noch brauchen könnte. Erst als die beiden beginnen, einander, dem Leben und der Liebe wieder zu vertrauen, zeigt sich für sie Hoffnung auf Heilung und einen Neuanfang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
MANUELA INUSA
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
TRIGGERWARNUNG:
In diesem Buch werden Themen wie Suizid, Suizidgedanken und Ähnliches angesprochen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Mai 2021
© 2021 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagkonzeption: Suse Kopp, Hamburg
unter Verwendung eines Fotos von © Trevillion Images/Mark Owen
MP · Herstellung: BB
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-26267-9V002
www.cbj-verlag.de
Wie zwei Spatzen,
die auf demselben Ast gelandet sind,
haben wir uns gefunden.
EINS
Oh, bitte, sag mir doch jemand,
wie ich diesen Schmerz ertragen soll!!!
Hier bin ich. Vor meinem Teller mit Kartoffelmatsch, den Erbsen, die ich noch nie mochte, und den zwei Fleischbällchen mit Sauce, die so weich sind, dass man sie problemlos mit der Plastikgabel zerteilen kann. Denn Messer sind hier nicht erlaubt. Natürlich nicht. Sonst wäre dieser Ort sicher nur noch halb so belebt und ich hätte endlich mal den Fernseher für mich allein. Nun ja, wenn ich selbst dann überhaupt noch da wäre, was ich bezweifle.
Wer bin ich?
(Therapie-Übung 8)
Mein Name ist Nathalie Amelia Jefferson, ich bin sechzehn Jahre, elf Monate und sechzehn Tage alt und seit genau siebenunddreißig Tagen hier. Hier, an diesem Ort, den sie so hübsch Mount Hopeful Medical Center genannt haben, obwohl es weit und breit keinen Berg gibt. Und was soll eigentlich diese Bezeichnung »Medical Center«? Hört sich eher nach einer Praxis an, in der man sich einen eingewachsenen Zehennagel operieren lässt, oder? In Wahrheit ist es aber das, was es nun mal ist, das, was die Eltern der Jugendlichen, die hier einsitzen, allerdings nicht so offensichtlich benannt wissen wollen. Wer will schon seinen Freunden oder Arbeitskollegen oder der Verwandtschaft sagen müssen: »Mein Kind ist in der Psychiatrie« – da könnten sie sich ja gleich selbst umbringen.
Genau deswegen sind die meisten von uns aber nun mal hier. Eben weil wir exakt das versucht haben: uns umzubringen. Wir in der Abteilung F sind die besonders harten Fälle. Das Mount Hopeful besteht aus vier Gebäuden, ich bin in besagtem Haus F untergebracht. Das ist noch so eine Sache, die niemand versteht. Es gibt ein Haus A, ein Haus B, ein Haus C und dann das Haus F. Wo verdammt noch mal sind die Gebäude D und E? Wollten sie uns auf diese Weise so weit wie möglich von den anderen fernhalten, auch wenn unser schönes Haus nur einmal quer über die Wiese ist?
Das »schön« war übrigens ironisch gemeint, ich hoffe, das ist klar. Angeblich bringe ich ja Sarkasmus eher schlecht rüber, meistens werde ich falsch verstanden, wenn ich einen blöden Witz machen will. Immer geht es nach hinten los und ich kann es trotzdem nicht bleiben lassen. Als mich zum Beispiel meine Geschichtslehrerin Mrs Holiday mal fragte – damals, als ich noch ein ganz gewöhnlicher Teenager war und zur Schule ging –, wie weit ich mit meinem Aufsatz über den Amerikanischen Bürgerkrieg sei, antwortete ich: »Es macht so viel Spaß, dass ich gar nicht mehr mit dem Schreiben aufhören kann.« Die Gute hat es direkt ernst genommen und überall rumerzählt, ich sei eine »unglaublich motivierte Schülerin«. In Wahrheit brauchte ich für den Vier-Seiten-Aufsatz nicht mal zwei Stunden und hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, als ich ihn dann abgab. Und doch konnte ich es nicht sein lassen. Gerade mal zwei Tage später sagte ich meinem Stiefvater Daniel beim Einkaufen im Discounter, dass die knallpinken Häschen-Hausschuhe, die sie im Angebot hatten, »der Hammer« wären. Und tadá: Am nächsten Abend nach der Arbeit hat er mich damit überrascht. Am Dinnertisch. Vor Mom und Henry. Natürlich tat ich so, als ob sie mir gefallen würden, um Daniels Gefühle nicht zu verletzen, aber Moms Blick war einmalig! Denn Mom weiß, dass Knallpink nun wirklich die letzte Farbe ist, die ich tragen würde.
Ich war noch nie ein Girlie. Keines dieser Mädchen, die sich vor dem Unterricht ihre Nägel lackieren und in der Pause sofort zu den Toiletten rennen, um sich den Lippenstift und den Eyeliner nachzuziehen. Ich habe mich im Leben nur einmal geschminkt, und das auch nur, weil Mom drauf bestanden hat. Das war an dem Abend, an dem der Abschlussball der Junior Highschool stattfand. Ich habe mich schrecklich gefühlt und bin früh nach Hause gegangen. Nicht nur wegen der roten Lippen, sondern auch, weil ich viel lieber in meinem Zimmer sitzen und lesen wollte. Ich war schon immer eine Leseratte, wie meine Grandma Amelia (ja, ich bin nach ihr benannt) es ausdrückt. Ich hingegen nenne es einfach bücherbegeistert. Da ist doch nichts Schlimmes dabei, oder? Das ist es schließlich, was die Lehrer von einem wollen! Lest, lest, lest – Lesen bildet! Leider teilen die meisten anderen Mädchen in meinem Jahrgang meine Vorliebe nicht und haben mich als langweiligen Nerd abgestempelt. Im letzten Jahr, bevor ich hier landete, hatte ich lediglich zwei richtige Freunde: Annie und Freddie, die beiden einzigen Mitglieder im Buchclub neben mir. Ich habe sie seit zweiundvierzig Tagen nicht gesehen.
Ich kann verstehen, dass mich hier niemand besucht. Ich kann verstehen, dass meine Grandma mich nicht mehr ansehen kann. Ich kann verstehen, dass niemand mehr weiß, wie er mit mir umgehen soll. Ich kann verstehen, dass alle Welt wünschte, ich wäre unsichtbar, würde nicht mehr existieren, wäre an seiner Stelle gestorben. Ich kann es so gut verstehen, denn mir geht es nicht anders. Ich wünschte, meine Existenz hätte ein Ende.
Und genau deshalb bin ich ja hier.
ZWEI
Wir alle denken, wir leben unendlich, obwohl wir im Grunde doch wissen, dass dieses Leben morgen schon vorbei sein kann. Für mich war es das gestern schon.
Das Leben ist trotz allem lebenswert. Das hat mir schon die Therapeutin erzählt, zu der mich Mom auf Anraten unseres Hausarztes zweimal die Woche geschleppt hat, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und auch Dr. Fynn, die Psychiaterin hier in der Klinik, will mir andauernd weismachen, dass es doch keinen Sinn hat aufzugeben. Dass es doch trotz allem so viel Schönes gibt, die Erinnerungen, die wundervollen Momente, die ich erlebt habe und die auch die Zukunft sicher wieder hervorbringen wird.
Wem wollen sie etwas vormachen?
Glauben sie denn wirklich, die schönen Momente, von denen sie sprechen, könnten mich überzeugen weiterzumachen? Wissen sie denn nicht, dass es ganz genau diese Erinnerungen sind, die mich von innen heraus umbringen, jeden Tag, mit jeder Sekunde ein bisschen mehr?
Ich bin eine Mörderin.
Wie soll so jemand an eine glückliche Zukunft glauben? Denkt Dr. Fynn denn ehrlich, dass ich eines Tages aus diesem Gebäude spazieren werde, vollständig genesen, und fröhlich über Blumenwiesen tanzen werde? Wenn dem wirklich so sein sollte, sorry, aber dann hat die Gute echt ihren Job verfehlt.
Doc Fynn ist mir egal. So, wie mir alle anderen egal sind: die netten Schwestern, die sich solche Mühe geben, die immer freundliche ältere Dame an der Essensausgabe, die Therapeuten in der Beschäftigungstherapie, die anderen Mädchen und Jungen, die auch alle entweder selbstmordgefährdet sind oder mindestens einen Suizidversuch hinter sich haben. Wie genau sie es angestellt haben, ist mir ebenfalls egal. Es hat immerhin nicht funktioniert und kann mir in keiner Weise weiterhelfen.
Niemand kann mir weiterhelfen. Niemand, außer mir selbst, sagt Dr. Fynn. Sie sagt sowieso sehr viel während der täglichen Therapiestunde, in der ich kein einziges Wort von mir gebe. Manchmal frage ich mich, ob sie nicht irgendwann die Lust verliert. Sie könnte genauso gut mit der Grünpflanze reden, die auf ihrem Schreibtisch steht oder mit ihrem Kaffeebecher, der immer voll ist. Wie die Frau überhaupt noch schlafen kann, falls sie es denn tut, ist mir ein Rätsel. Allerdings könnte ich mir bei Doc Fynn auch gut vorstellen, dass sie so eine ist, die überhaupt nie schläft, eine, die immer für ihre Patienten da ist, Tag und Nacht. All der Einsatz ist wirklich bemerkenswert, und doch bewirkt er bei mir gar nichts. Ich will nicht reden, weder mit ihr noch mit meiner Mutter oder irgendwem sonst. Ich habe seit fünfundneunzig Tagen kein Wort gesprochen und werde nie wieder sprechen. Ich kann nicht. Wenn ich redete, würde ich mich vielleicht wie ein lebendiges Wesen fühlen, und das will ich nicht. Innerlich tot, das will ich sein. Ich habe nichts anderes verdient. Ich bin tot seit dem Abend, an dem mein kleiner Bruder Henry starb.
An dem ich ihn sterben sah.
DREI
Ich werde dich lieben, bis kein einziger Stern am Himmel mehr leuchtet.
Doc Fynn sagt, ich soll mich mitteilen, und wenn nicht ihr, dann meinem Tagebuch oder irgendeiner Person meiner Wahl. Sie will, dass ich »nicht mehr alles in mich hineinfresse«, und deshalb gibt sie mir ständig irgendwelche Aufgaben. Ich soll nach und nach aufschreiben, wer ich bin, was mich ausmacht, wer ich sein will. Was ich mir von der Zukunft erhoffe oder wo ich mich in einem Jahr sehe. Heute soll ich erzählen, woher ich komme.
Ich hole an diesem Freitagvormittag also mein Tagebuch heraus, setze mich auf mein Bett und beschließe spontan, statt immer nur dumm vor mich hin zu schreiben, meine Worte wirklich mal an jemanden zu richten. Ich entscheide mich für den Sänger meiner Lieblingsband Coldplay, weil mir sonst gerade niemand einfällt.
Woher komme ich?
(Therapie-Übung 9)
Lieber Chris Martin,
ich soll mich dir mitteilen und dir erzählen, woher ich komme. Und das tue ich hiermit, ich hoffe, du langweilst dich nicht zu sehr.
Okay … womit fange ich an? Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich sechs war. Damals lebten wir in einer Kleinstadt in Montana namens Helena und mich traf es nicht wirklich überraschend, dass Mom und Dad künftig getrennte Wege gehen wollten, denn sie stritten, seit ich denken konnte, und wahrscheinlich war es das Beste so. Dad zog dann keine zwei Monate später nach New York, wo er noch heute lebt und in einer Anwaltskanzlei arbeitet. Mom musste nach der Trennung wieder anfangen zu arbeiten. Das schöne Hausfrauendasein hatte also ein Ende und sie fand eine Stelle in der Versandabteilung einer Papierfabrik. Eigentlich waren wir von da an immer pleite, aßen billige Burger aus dem Drive-In, wenn sie mich nachmittags von der Schule abholte, und kauften unsere Kleidung nur noch bei Walmart oder Target, was ich nicht sonderlich schlimm fand. Ganz im Gegenteil, ich liebte die Supermarktbesuche mit ihr, bei denen ich aussuchen durfte, was wir in der kommenden Woche essen würden. Meistens entschied ich mich für Ravioli oder SpaghettiOs aus der Dose. Mikrowellen-Mac & Cheese waren damals eine weitere meiner Lieblingsmahlzeiten. Zur Schule bekam ich Erdnussbutter-Marmeladensandwiches und kleine Apfelsaftkartons mit, und abends beim Fernsehen gönnten wir uns oft eine Tüte der supermarkteigenen Chipsmarke, die unter einem Dollar zu haben war.
Ich liebte unser Leben. Nur Mom und ich, wir beide gegen den Rest der Welt. Als Mom irgendwann die Hypothek für unser Haus nicht mehr aufbringen konnte, beschlossen wir, in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Auch dort gefiel es mir, und in den folgenden zwei Jahren gab es nur uns beide und meinen liebsten TV-Helden: SpongeBob Schwammkopf.
Und dann eines Tages passierte es. Mom verkündete mir, sie hätte eine Stelle als Vertriebsleiterin bei einem Bleistifthersteller angeboten bekommen und wir müssten nie wieder Billigchips essen. Weder verstand ich damals, was überhaupt so schlimm daran sein sollte, Billigchips zu essen, noch was dieser neue Job bedeutete. Das wurde mir erst so richtig klar, als wir einen Monat später unsere gesamten Sachen packten, sie in unser Auto stopften und durchs halbe Land bis nach Milwaukee, Wisconsin fuhren, wo wir von nun an leben sollten.
Der Roadtrip war cool, wir überquerten drei Staatsgrenzen, hielten einmal, um in einem Motel zu übernachten, aßen Burger und Pommes in einem Fast-Food-Restaurant am Highway und sangen im Auto unsere liebsten Songs laut mit.
Die neue Wohnung in Milwaukee war toll, sie befand sich in der fünften Etage eines achtstöckigen Hochhauses und hatte ganze vier Zimmer – ein Luxus nach der mickrigen Zweizimmerwohnung in Helena, in der wir die letzten drei Jahre gehaust hatten. Wir richteten uns ein, Mom fing ihre neue Arbeit an, und ich besuchte eine neue Schule, wo ich zwar nicht gleich Freunde fand, es aber eine supernette Englischlehrerin gab, die uns die besten Bücher zu lesen gab, wie zum Beispiel Tom Sawyer’s Abenteuer und In 80 Tagen um die Welt. Schon damals war Lesen meine große Leidenschaft. Ich hatte beim Umzug einen riesigen Koffer nur mit Büchern vollgepackt, lieber hätte ich meine Kleider zurückgelassen als meine literarischen Schätze.
Weil ich nun noch ein wenig einsamer war, wurden Betty und ihre Schwestern, Huckleberry Finn und Anne von Green Gables meine besten Freunde.
Ein paar Monate vor meinem zwölften Geburtstag war es dann aber vorbei mit der Einsamkeit, das war nämlich der Moment, in dem Mom mir von Daniels Heiratsantrag erzählte und dem Geschwisterchen, das in ihrem Bauch heranwuchs.
Daniel war Buchhalter in ihrer Firma und sie trafen sich bereits seit gut einem Jahr. Mom hatte ihn mir schon vorgestellt, und ich fand den Mann mit dem Schnurrbart und den gestreiften T-Shirts, die er unter seinen Sakkos trug, lustig. Dass er nun aber mein neuer Vater werden und es aus und vorbei mit der Zweisamkeit sein sollte, fand ich weniger witzig. Und dann nahm Daniel auch noch unseren Nachnamen an, damit wir alle gleich hießen und eine richtige Familie sein konnten.
Ich hätte kotzen können. Ich wollte keinen neuen Dad, immerhin habe ich schon einen, auch wenn ich ihn nur selten sehe. Ein- oder zweimal im Jahr kommt er mich besuchen, und in den Sommerferien verbringe ich immer vier Wochen bei ihm in New York, wo seine Freundin Isabelle, eine Künstlerin, mich mit in den Central Park nimmt, während er in der Kanzlei ist, und wo ich mir jedes Jahr ein neues New-York-T-Shirt aussuchen darf.
Für Mom aber stand damals schon fest: Daniel war der Richtige und mit ihm wollte sie alt werden. Zwei Monate später fand die Hochzeit statt. Weitere drei Monate später wurde mein kleines Brüderchen geboren, das die beiden unwitzigerweise Henry nannten. Auf meine Vorschläge, ihn Justin (nach Justin Bieber) oder Pharrell (nach Pharrell Williams, Happy war zu der Zeit mein Lieblingssong) zu nennen, gingen sie gar nicht erst ein.
Zuerst war ich unglaublich eifersüchtig auf Baby Henry, denn ich befürchtete, Mom würde von nun an nur noch ihm ihre Zeit und Liebe schenken. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, wie unglaublich Henry sein würde – das süßeste Baby auf der ganzen Welt. Er war so lieb, weinte so gut wie nie, quengelte nicht rum, sondern strahlte einen einfach nur mit seinen wunderschönen großen Augen an.
Ich war hoffnungslos verliebt.
Je älter Henry wurde, desto unzertrennlicher wurden wir. Ich war die perfekte Babysitterin. Wenn Mom mal einkaufen gehen oder zur Bank musste, war ich sofort zur Stelle und übernahm. Ich zeigte Henry, wer SpongeBob Schwammkopf war und gab ihm mehr Kekse, als gut war. Wir tanzten zusammen zu meinen Lieblingssongs und lachten manchmal so lange, bis unsere Bäuche wehtaten. Henrys Lieblingsessen war Spaghetti mit Tomatensauce und Würstchenscheiben, und sein Lieblingscharakter aus SpongeBob war Patrick. Außerdem entwickelte Henry eine Liebe zu den Sternen, die von nirgendwo zu kommen schien. Auf einmal war sie da. Henry wollte beim Weihnachtsplätzchenbacken nur noch Sterne ausstechen, er wollte sich im Dunkeln leuchtende Sterne über sein Bett kleben, wie sie auch im Mittagsschlafraum seines Kindergartens hingen, und er liebte alle Lieder, in denen von Sternen gesungen wurde. Sterne faszinierten ihn.
Wer hätte ahnen können, dass sie ihm eines Tages so zum Verhängnis werden würden?
Ich packe das Tagebuch beiseite, ziehe meine Beine an und lege meine Stirn auf die Knie. Wenn ich jetzt daran denke, dass Happy einmal mein Lieblingssong war, scheint es so irreal wie die Tatsache, dass ich einmal eine heile Familie hatte. Es scheint Lichtjahre her, ja, sogar aus einem anderen Universum, einem anderen Leben. Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich einmal glücklich war. Denn ich habe vergessen, wie das geht, glücklich sein.
Ich habe vergessen, was es heißt, zu leben.
VIER
Wenn Kakteen mit ihren Stacheln, so unnahbar und verletzend, deine besten Freunde sind, was sagt das dann über dich aus?
»Wie fühlst du dich heute?«, fragt Doc Fynn, als ich ihr an diesem Nachmittag gegenübersitze. Sie mustert mich mit ihren blauen Augen über die Brille hinweg, die farblich zu ihrer bordeauxroten Bluse passt. Ihre blonden Haare sind wie immer zu einem strengen Dutt gesteckt.
Erwartet sie wirklich eine Antwort? Zumindest sieht sie mich so an. Als hätte ich ihr in den letzten fünfunddreißig Tagen immer eine Antwort gegeben, statt vor mich hin zu schweigen.
Die ersten drei Tage nach dem Selbstmordversuch lag ich auf der Krankenstation in Haus A, danach haben sie mich hierher ins Haus F verlegt. Das Haus F besteht aus drei Ebenen, in der zweiten sind die Mädchen untergebracht, in der dritten die Jungen. Wir treffen dreimal am Tag zum Essen in der Cafeteria aufeinander, wie sie den Speisesaal nennen, der sich neben den Behandlungszimmern unten im Erdgeschoss befindet. Nur hat man nicht wie in einer richtigen Cafeteria die Auswahl zwischen mehreren Gerichten, sondern muss das essen, was es gibt. Dabei kann man natürlich kleine Wünsche äußern, um statt Reis, Bohnen und Hühnchen lieber Reis und zwei Portionen Bohnen oder auch dreimal Hühnchen zu bekommen. Aber ich äußere nie irgendwelche Wünsche. Ich äußere ja gar nichts. Ich nehme das, was man mir auf den Teller füllt, und auch davon esse ich so gut wie nichts.
Ich esse seit dem Vorfall nicht mehr regelmäßig. Schlafe schlecht. Jedes Mal, wenn ich es doch schaffe einzudämmern, träume ich schreckliche Sachen und wache völlig panisch und schweißgebadet auf. Dr. Fynn weigert sich, mir Schlafmittel zu verschreiben, auch wenn meine Mutter sie mehrmals darum gebeten hat. Doc Fynn meint, es würde sich alles legen, wenn ich endlich über das Erlebte sprechen, wenn ich nicht mehr alles in mich hineinfressen würde.
Da liege ich lieber die Nächte wach.
Auch jetzt erwartet sie also wieder, dass ich rede. Nachdem wir uns gut fünf Minuten lang schweigend angestarrt haben, seufzt sie und sagt: »Wie lief es mit der Aufgabe, die ich dir gestern mitgegeben habe?«
Ich zucke die Achseln.
»Hast du sie erledigt?«
Ich nicke. Bin kurz besorgt, dass Doc Fynn mein Tagebuch sehen will. Das hat sie bisher noch nie verlangt, und ich habe ganz bestimmt nicht vor, es ihr zu geben. Lieber zerreiße ich es in Fetzen.
Doch Doc Fynn nickt nur zufrieden und lächelt mich dann an.
»Wie ich höre, hat deine Mutter morgen Geburtstag.«
Ja, das hat sie.
Da sie mich weiter anstarrt, nicke ich irgendwann.
»Möchtest du sie sehen?«
Ich schüttle den Kopf.
»Möchtest du ihr einen Brief schreiben?«
Wieder schüttle ich den Kopf. Ich wüsste nicht, was ich schreiben sollte.
»Eine Karte vielleicht? Du könntest einfach Happy Birthday draufschreiben. Oder nur deinen Namen. Sie würde sich bestimmt freuen.« Wie aus dem Nichts holt Doc Fynn drei fröhliche Glückwunschkarten hervor und hält sie mir hin.
Ich suche die am wenigsten fröhliche aus, eine mit roten Rosen drauf. Ich klappe sie auf und schreibe mit dem Kugelschreiber, den Doc Fynn mir hinhält, meinen Namen auf die dünne weiße Pappe. Ich lege die Karte auf den Schreibtisch, der zwischen meiner Seelendoktorin und mir steht, und sehe zum Fenster hin. Sie blickt in dieselbe Richtung.
»Was siehst du, Nathalie?«
Ich antworte nicht.
»Die Bäume?«
Sie sind kahl, es ist Januar.
»Den Himmel?«
Er ist bedeckt mit grauen Wolken.
»Nathalie. Bitte glaube nicht, dass ich nicht weiß, wie es in deinem Innern aussieht.«
Tsss … Ja, klar!
»Ich erlebe so viele junge Menschen wie dich. Jungen und Mädchen, die genauso Schlimmes durchgemacht haben.«
Sicher.
»Sie alle haben den Lebenswillen verloren. Aber ich versuche, ihnen deutlich zu machen, dass, auch wenn die Welt in diesem Augenblick für sie ganz schwarz aussieht, so wie die Wolken dort draußen am Himmel …« Sie deutet mit dem Zeigefinger zum Fenster, dabei fällt mir ihr abgebrochener Nagel auf. »… auf die Dunkelheit auch immer wieder Licht folgt. Die schwarzen Wolken verziehen sich und die Sonne kommt zum Vorschein. Auch wenn es für dich gerade nicht vorstellbar ist, wirst du sehen, dass ich recht habe. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, doch eines Tages wird deine Welt wieder hell leuchten. Vertraue mir.«
Die Dunkelheit ist seit siebenundneunzig Tagen mein ständiger Begleiter. Zumindest erkennt Doc Fynn sie in mir. Womit sie aber völlig falsch liegt, ist die Hoffnung auf Sonnenschein.
Doc Fynn faselt noch ewig so weiter, bis die Stunde zu Ende ist und ich endlich wieder in mein Zimmer darf. Als ich mich erhebe, um zu gehen, deute ich mit einem fragenden Gesichtsausdruck auf ihren abgebrochenen Nagel.
»Das? Oh. Den habe ich mir beim Öffnen einer Dose Champignoncremesuppe abgebrochen.«
Ich finde die Vorstellung, dass die elegante Dr. Caroline Fynn sich eine Dosensuppe aufwärmt und sie allein an ihrem eleganten Küchentresen isst, traurig. Während ich von Schwester Agnes zurück auf meine Station begleitet werde, denke ich darüber nach. Denke über Doc Fynn nach, die höchstens Ende dreißig ist und wirklich immer die Ruhe bewahrt, auch bei den Aggressivsten und Abgewracktesten von uns. Ich frage mich, ob sie wohl keine Kinder hat, keinen Ehemann, nicht mal eine harmlose Affäre oder einen Hund? Sie hat nichts davon je erwähnt. Ich beschließe, falls ich jemals wieder anfangen sollte zu sprechen, sie danach zu fragen.
Wahrscheinlich werde ich die Antwort nie bekommen.
Das Leben ist das Leben ist das Leben ist Dunkelheit ist Traurigkeit ist Einsamkeit ist Champignoncremesuppe ist eine Tüte Billigchips ist eine Dose SpaghettiOs ist ein Teller Erbsen ist eine Plastikgabel ist dieser Ort.
Ich klappe mein Tagebuch zu, das eher ein Notizheft ist, da ich dort keine Einträge in der Art von »Liebes Tagebuch …« reinschreibe, sondern neben den Aufgaben, die Doc Fynn mir gibt, vor allem meine Gedanken. Gedanken, die mir in der Dusche, beim Mittagessen oder auch in der Therapiestunde kommen. Ich weiß nicht, warum ich sie aufschreibe. Wahrscheinlich vermisse ich es doch, auf irgendeine Weise zu kommunizieren. Und wenn ich in mein Tagebuch schreibe, spreche ich ja nur mit mir selbst. Anderen will ich mich nicht mitteilen, ich habe ihnen nichts zu sagen.
Ich hab gerade mein Buch in der Tasche des Cardigans versteckt, der in meinem Schrank hängt, und mich zurück aufs Bett gesetzt, als Schwester Claudia an meine Zimmertür klopft, die sowieso halb offen steht. Es ist nicht erlaubt, diese zu schließen, sie wollen ja keine Tür öffnen und dann eine Leiche finden müssen. Das kann ich verstehen, es ist wahrscheinlich schwer genug, mit Scheintoten zu tun zu haben.
Schwester Claudia lächelt mich an. Sie ist jung, höchstens fünfundzwanzig, und hat langes blondes Haar. Seit letzter Woche trägt sie einen neuen Ring, der vielleicht ein Verlobungsring ist. Ich kann sie nicht fragen.
»Kommst du bitte mit? Die Beschäftigungstherapie fängt gleich an.« Sie wartet an der Tür, bis ich vom Bett aufstehe und meine Schuhe anziehe. Zusammen gehen wir noch ein paar andere Mädchen von ihren Zimmern abholen und begeben uns zu sechst in den Bastelraum, wo wir heute malen wollen. Sollen. Müssen. Denn weigern wir uns, bei der Beschäftigungstherapie mitzumachen, verlieren wir Punkte, verlieren wir Privilegien. Bei mir wären es meine Bücher, die sie mir wegnehmen würden, also lasse ich die blöde Bastelstunde über mich ergehen, tauche meinen Pinsel in blaue und grüne und gelbe Farbe und mache einen auf Picasso. Ich streiche mit dem Pinsel über das riesige Blatt Papier und bin gedanklich überhaupt nicht da. Irgendwann ertappe ich mich dabei, wie ich die Form eines Sterns male. Sofort verwische ich ihn wieder. Er hat hier nichts zu suchen. Henry hat hier an diesem trostlosen Ort nichts zu suchen. Er war nichts als Fröhlichkeit.
Ich drehe mich um, als ich Schreie höre.
Brenda hat wieder einen ihrer Anfälle. Sie deutet wild gestikulierend auf Tamaras Bild und ist total hysterisch, schreit immer wieder: »Penis! Penis!« Anscheinend denkt sie, Tamara hätte einen Penis gemalt, dabei versichert die ihr immer wieder, dass es nur ein Kaktus ist.
Tamara ist bipolar und steht voll auf Kakteen. Einmal hat sie sich in einer ihrer euphorischen Hochphasen im Fernsehzimmer neben mich gesetzt und mir ungelogen über eine Stunde von den Kakteen erzählt, die sie zu Hause in ihrem Zimmer auf der Fensterbank, der Kommode und dem Nachttisch stehen hat. Und wie gerne sie auch hier welche in ihrem kahlen, unpersönlichen Zimmer hätte. Aber natürlich erlauben sie einem keine. Die haben Stacheln, und alles, was auf irgendeine Art spitz ist, ist verboten. Ich frage mich zwar, wie man sich mit einem Kaktus umbringen sollte, aber das ist eine genauso gute Frage wie die, was zum Teufel einem eine Pinzette anhaben könnte. Das Spitzeste, was ich besitze, ist mein Kugelschreiber. Und wahrscheinlich hätten sie mir den auch schon weggenommen, wenn Doc Fynn es nicht als therapeutisch anerkannt hätte, dass ich in mein Tagebuch schreibe. Auch wenn es kein richtiges Tagebuch ist, nenne ich es so, weil kein Tag vergeht, an dem ich nicht hineinschreibe. Manchmal vergeht nicht mal eine Stunde.
Brenda schreit noch immer. Der Grund, warum sie schreit und weshalb sie überall Penisse sieht, ist, dass ihr Stiefvater sie jahrelang sexuell missbraucht hat, bis sie sich selbst rettete und von einer Brücke sprang. Leider war die nicht hoch genug, und der Fluss darunter trug Brenda mit sich davon, bis irgend so ein Doofkopf sie fand und ihrem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machte.
Sie hätte sich eine höhere Brücke suchen sollen.
Jedes Jahr springen etliche Menschen erfolgreich von der Golden Gate Bridge in San Francisco. Seit der Eröffnung der Brücke im Jahr 1937 waren es über 1.600, darunter 1945 ein Vater, der seiner fünfjährigen Tochter befahl zu springen, bevor er ihr folgte, außerdem 1993 der 46-jährige Victoria’s-Secret-Gründer Roy Raymond, und 1977 Marc Salinger, der 28-jährige ehemalige Golf-Caddie von Präsident Kennedy. Von Letzterem sollte ich Amber mal erzählen, die denkt, sie lebe in den Sechzigern. Gerade malt sie ein Portrait von First Lady Jackie Kennedy mit extrem hochtoupierten Haaren und scheint nicht einmal zu hören, dass Brenda das ganze Gebäude zusammenschreit. Nachdem ein paar Pfleger kommen und sie mit sich nehmen, ist es wieder ruhig. Ich tunke meine Pinselspitze in schwarze Farbe und streiche damit über mein Blatt Papier. Das war’s mit Picasso.
Die Dunkelheit hat mich zurück.
FÜNF
Wie kann sich diese Erde weiterdrehen, wenn sie das ohne
dich tun muss? Wie können Autos weiterfahren,
Vögel weiterfliegen, Fische weiterschwimmen,
Menschen weiterlachen, wenn du so fehlst?
Du fehlst.
»Natty, Natty, guck mal! Ich hab dir ein Bild gemalt!«
Henry kommt ganz aufgeregt angelaufen und rennt mich fast um. Er hält mir ein Blatt Papier hin.
»Oh, das ist ja der Hammer!«, sage ich, und diesmal ist es nicht ironisch gemeint. Alles, was mein kleiner Bruder macht, ist für mich der Hammer. Er ist der Hammer. Er ist der größte Schatz auf Erden. Ich nehme das Bild in die Hand und betrachte es genauer. Es zeigt gelbe Farbkleckse.
»Das sind Sterne, Natty. Für dich.« Ganz stolz blickt er zu mir hoch, ein riesiges Strahlen im Gesicht.
Natürlich sind es Sterne. Henry ist zurzeit fasziniert von ihnen. Ob der Song A Sky Full of Stars von der Band Coldplay, den ich in letzter Zeit sehr häufig höre und zu dem Henry und ich manchmal durch die Wohnung tanzen, schuld daran ist? Henry kann den Text fast vollständig mitsingen – es hört sich total süß an. Völlig schief und die Hälfte der Wörter falsch, aber es ist einfach ZU niedlich. All meine Freunde sind absolut hin und weg von Henry. Nun ja, die beiden Freunde, die ich habe, sind es. Wenn Annie mich zu Hause besucht, kann sie gar nicht aufhören, Henry zu knuddeln. Und das Gute ist, er lässt sich knuddeln. Er liebt es zu kuscheln.
Er strahlt mich immer noch an.
»Das ist ein ganz tolles Sternenbild«, sage ich, obwohl man wirklich keinen einzigen Stern ausmachen kann. Aber ich weiß ja, dass es welche sein sollen. In Henrys Augen sind es welche.
»Ja?«, fragt er vorsichtshalber noch mal nach.
»Oh ja«, bestätige ich, lege das Bild beiseite und hebe Henry hoch, wirble ihn durch die Luft und fange dann an, mit ihm zu tanzen.
»Tanzen ohne Musik?«, fragt er.
»Du hast recht. Das geht gar nicht. Was soll ich anmachen?«
»SpongeBob!«
»Im Fernsehen oder die CD?« Henry hat zum vierten Geburtstag eine CD mit Liedern von SpongeBob und seinen Freunden bekommen. Er liebt SpongeBob genauso wie ich früher.
»Beides!«
Ich lege die CD rein und drücke auf Play. Wir tanzen wie wild durch die Wohnung und singen die witzigen Songs mit, die ich schon auswendig kann. Langsam gehen sie mir auf die Nerven, aber für Henry tue ich alles. Alles! Wir tanzen, bis wir völlig außer Puste sind und lassen uns dann auf die Couch fallen. Ich greife nach der Fernbedienung und mache SpongeBob an. Zum Glück können wir uns inzwischen Pay-TV leisten. Ohne Netflix wäre ich aufgeschmissen.
Henry ist völlig begeistert. Wie immer. Er kommentiert alles und ruft »Patwick!« und »Gawy!« und »Mr Kwabs!«, weil er das R immer noch nicht richtig aussprechen kann. Ich betrachte ihn und bin glücklich, einfach nur, weil ich seine Schwester sein darf. All die Jahre war ich immer allein. Wenn Mom unterwegs war, bin ich in all der Stille fast wahnsinnig geworden. Wären meine Buchhelden nicht gewesen, hätte ich überhaupt niemanden gehabt. Jetzt habe ich einen Menschen aus Fleisch und Blut bei mir, der mich dazu auch noch vergöttert, der mir Sternenbilder malt und meine Lieblingssongs zu seinen macht. Der die Stille mit SpongeBob-Liedern und Lachen füllt.
Henry. Mein Sonnenschein.
Samstagmorgen. Ich wache auf und weine. Das ist nichts Neues. Denn ich habe wie so oft von Henry geträumt. Doc Fynn würde sich wahrscheinlich riesig freuen, wenn ich ihr von meinen Träumen erzählen würde. Sie würde sie von vorne bis hinten analysieren wollen. In dem Traum von letzter Nacht kamen Sterne vor, Henry, wie er mir von einem Stern aus zuwinkt. Was könnte das bedeuten, was könnte Doc Fynn darin erkennen? Dass Henry irgendwo hoch oben im Himmel ist und über mich wacht, oder zumindest, dass ich mir das wünsche? Oder dass ich wirklich langsam verrückt werde, es vielleicht schon bin? Dass ich nicht ohne Grund hier bin? Dass ich hierher gehöre?
Ehrlich gesagt, bin ich manchmal ganz froh, hier zu sein. Hier lässt man mich die meiste Zeit in Ruhe. Niemand zwingt mich zu reden. Ich muss Henrys Sachen nicht sehen, sein Zimmer, seinen Plüsch-Patrick und seinen Plüsch-Gary, die zu Hause noch immer auf dem Bett sitzen. Wie Mom sich wohl fühlen muss, wenn sie in sein Zimmer geht? Und ja, das tut sie hin und wieder, ich habe es gesehen. Hinter der verschlossenen Tür konnte ich ihr Schluchzen hören. Sie tat mir leid, ich hätte sie danach immer gerne umarmt, aber ich konnte nicht.
Ich konnte es nicht ertragen zu wissen, dass ich Schuld an ihrem Kummer habe.
Wie Daniel sich wohl fühlt? Daniel ist schon älter, weit über fünfzig und er hatte bereits einen Sohn, Jason. Der ist in Afghanistan gefallen, mit gerade mal neunzehn. Und jetzt hat Daniel seinen zweiten Sohn verloren. Ist kinderlos. Dank mir. Ich werde ihm nie wieder in die Augen blicken können. Es passt mir also ganz gut, dass er nach den ersten beiden Versuchen, mich hier zu besuchen, aufgegeben hat. Ich habe Schwester Claudia auf einen Zettel geschrieben, dass ich ihn nicht sehen will, und sie hat es ihm erklärt. Es ist besser so. Ich bringe Unglück. Mit mir sollte man sich nicht einlassen, nicht einmal in meine Nähe kommen. Ich bin ein Todesengel, oder so was in der Art.
Als ich acht war, fuhren wir zu unserem jährlichen Weihnachtsbesuch bei Grandma Rose. Sie war Dads Mutter und lebte wie wir in Montana, in Melville, etwa zweieinhalb Stunden von Helena entfernt. Auch wenn meine Eltern geschieden waren, wollte Mom unbedingt, dass ich auch weiterhin Kontakt zu ihr hielt. Sie war noch gar nicht so alt, Mitte sechzig, glaube ich. Da sie sich an dem Tag ein wenig schwach fühlte, fuhr Mom für sie einkaufen und ließ mich bei ihr. In der Zeit bekam sie einen Herzinfarkt und starb, noch ehe der Krankenwagen da war, den Mom rief, nachdem ich panisch ihre Nummer gewählt hatte. Damals fühlte ich mich schrecklich, doch alle sagten mir, es sei ein Zufall gewesen, unvorhersehbar, ich hätte richtig gehandelt und überhaupt nichts tun können.
Damals glaubte ich ihnen. Damals klang es aufrichtig.
Wenn sie mir das Gleiche jetzt sagen, klingt es so verlogen, dass ich mich frage, ob irgendwer sich selbst abnimmt, was er da erzählt.
Wir kennen doch alle die Wahrheit.
Es ist noch lange nicht Morgen. Ich versuche wieder einzuschlafen, aber es will mir nicht gelingen. Also liege ich wach und denke an Henry. Ein Song kommt mir in den Sinn, Fix You von Coldplay, und ich singe ihn leise vor mich hin. Wünschte, jemand würde mich heilen.
Ich weine, habe aber keine Lust aufzustehen und nach einem Taschentuch zu suchen. Ich habe mich an die Tränen gewöhnt, an meine nassen Wangen. Und so geht diese Nacht auch irgendwann zu Ende, wie jede verdammte Nacht davor.
Ich stehe auf und ziehe mich an, gehe ins Gemeinschaftsbad, wo ich pinkle, mir die Zähne putze und meine dunkelbraunen Haare kämme, die jetzt kurz sind. Früher gingen sie bis über die Schultern, früher war ich gar nicht mal so hässlich. Zu Weihnachten, als hier jeder einen Wunsch äußern durfte, habe ich mir einen neuen Haarschnitt gewünscht. Am Weihnachtsmorgen kam Schwester Claudia mich holen, um mir im Schwesternzimmer die Haare zu schneiden. Da, wo immer noch mindestens eine andere Schwester anwesend ist. Wo sich der Alarmknopf befindet. Wo sie ziemlich sichergehen können, dass ich Schwester Claudia nicht die Schere entreiße, um irgendwas Schlimmes damit anzustellen.
Claudia hat mir meinen Wunsch, alles komplett abzuschneiden, nicht erfüllt. Stattdessen hat sie mir einen ziemlich coolen kinnlangen Bob verpasst. Ich tröste mich damit, dass er ganz schön schief geworden ist.
Ich bin an diesem Morgen die Erste im Bad, wie so oft. Als es eine Stunde später klingelt, was das Zeichen dafür ist, dass wir runter zum Frühstück sollen, begebe ich mich langsam zur Tür, wo alle anderen schon warten. Die meisten freuen sich auf die Mahlzeiten, weil das eine prima und für einige – wie mich – die einzige Gelegenheit ist, die Jungen zu sehen. Wir dürfen sogar mit ihnen an einem Tisch sitzen und uns mit ihnen unterhalten, das ist ja hier kein Gefängnis, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Mein eigener Körper allerdings fühlt sich 24 Stunden am Tag an wie ein Gefängnis.
In der Cafeteria fällt mir sofort ein neues Gesicht auf. Ich frage mich, warum dieser Junge wohl hier ist. Ich beobachte ihn. Er ist ziemlich groß, hat dunkles Haar und trägt einen dunkelblauen Hoodie. Die anderen Typen habe ich nie weiter beachtet, aber der Neue hat irgendwas an sich, das mein Interesse weckt. Er ist nicht umwerfend oder so, nicht wie Chuck aus meiner Highschool, der so gut aussieht, dass es einen fast blendet. Oh Gott, hört sich das schmalzig an, aber so ist es halt, Chuck ist eine Zehn. Dieser hier ist höchstens eine Sieben, und dennoch zieht er mich in seinen Bann. Er hat etwas in seinen Augen, das mir bekannt vorkommt. Ich sehe das Gleiche, wenn ich in den Spiegel blicke. Eine Leere, die man nicht beschreiben kann – er ist mir auf Anhieb sympathisch.
Er sieht zu mir rüber, ich wende schnell meinen Blick ab. Hole mir an der Essensausgabe eine Schüssel Porridge und setze mich zu Amber. Sie lächelt mich an. Amber lächelt immer. Sie lebt in ihrer eigenen rosaroten Blase. Ich beneide sie zutiefst.
Als ich den Löffel gerade zum zweiten Mal zum Mund führe, bemerke ich aus den Augenwinkeln, dass der Neue mich schon wieder – oder noch immer – anstarrt. Ich bemühe mich, nicht in seine Richtung zu sehen und mir meine Verwirrtheit nicht anmerken zu lassen. Ich bin so abgelenkt, dass mir erst beim vierten Löffel auffällt, dass es Porridge mit Zimtgeschmack ist. Ich mag keinen Zimt. Früher ja. Heute erinnert er mich nur an glückliche Weihnachtstage, die in so weite Ferne gerückt sind, dass sie völlig irreal erscheinen. Letztes Weihnachten war trostlos. Ich war schon hier, Mom kam mich an Heiligabend besuchen. Mom redete, ich schwieg. Sie versuchte, nicht zu weinen, ich bekam mal wieder einen Heulanfall. Schwester Claudia brachte mich in mein Zimmer, und dort blieb ich bis zum nächsten Morgen, an dem mir der Wunsch nach einer neuen Frisur erfüllt wurde.
Schwester Margaret geht herum und verteilt kleine Becher mit Pillen. Ich muss zum Frühstück mein Antidepressivum nehmen, Fluoxetin. Zum Abendessen noch mal. Außerdem bekomme ich Vitamine und manchmal etwas gegen Verstopfung, weil ich so unregelmäßig esse. Einige der anderen müssen eine ganze Handvoll Tabletten schlucken.
Ich schiebe die Schüssel Porridge von mir. Ich habe mehr gegessen als sonst. Oft esse ich gar nichts. Wenn das mehr als einmal am Tag vorkommt, drohen sie damit, mir meine Bücher wegzunehmen. Dann esse ich ein paar Bissen. Ich schmecke überhaupt nichts. Ich fühle auch nichts. Ich komme mir vor wie einer der Zombies aus The Walking Dead. Ob die wenigstens etwas schmecken, wenn sie über die Lebenden herfallen?
So langsam reicht es mir. Er starrt mich immer noch an, und jetzt lächelt er auch noch. Am liebsten würde ich aufstehen und gehen, doch wir müssen warten, bis alle fertig sind.