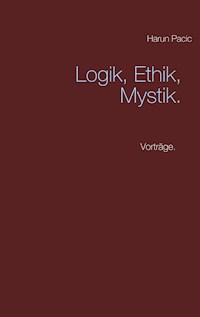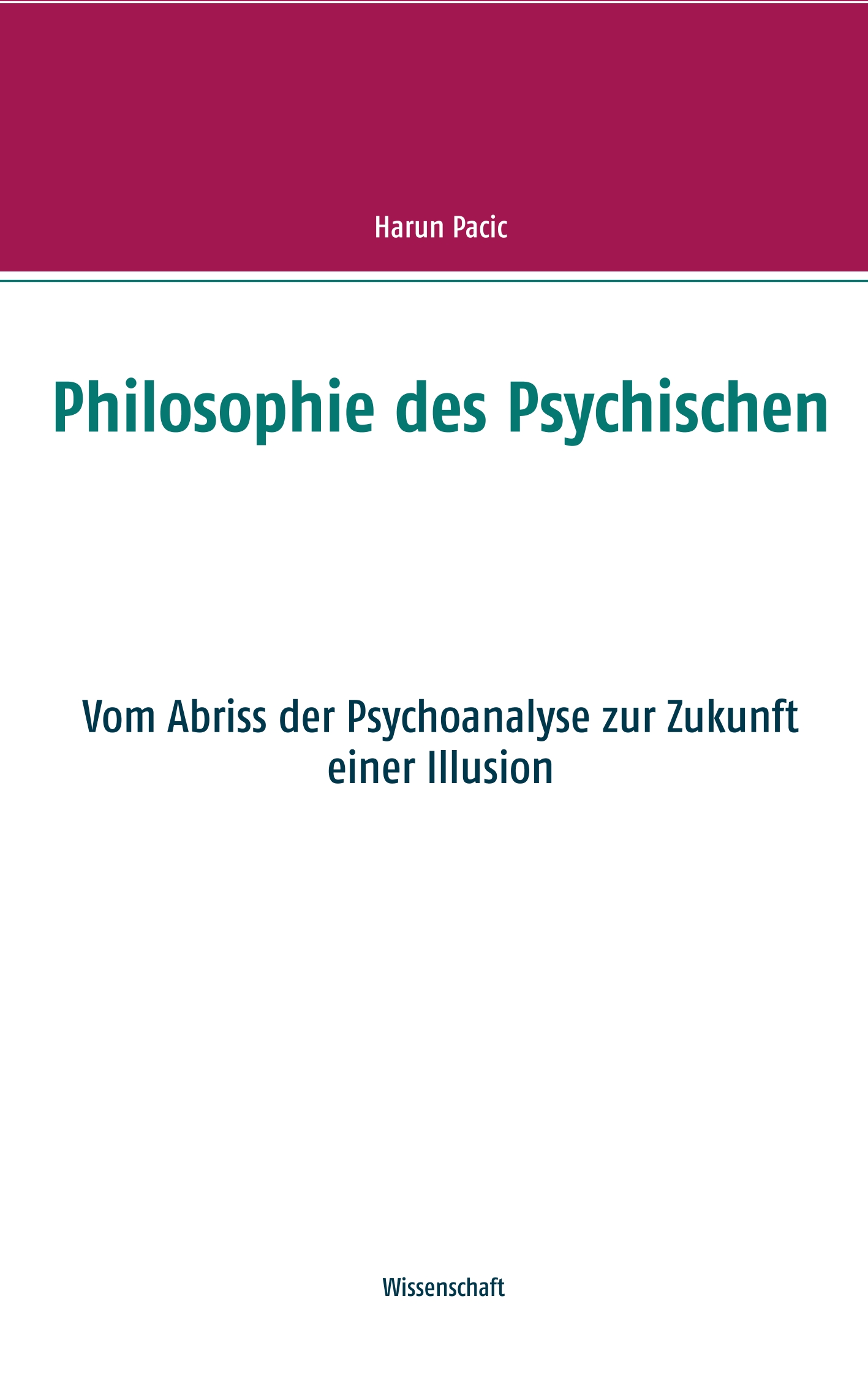Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine Ausdeutung der Politeia von Platon, des Essay on Man von Ernst Cassirer und des Zarathustra von Friedrich Nietzsche sowie eine Aufbereitung der von Kurt Walter Zeidler geleisteten Vermittlungen zwischen dem antiken und dem neueren Idealismus für Ansätze zu einer Rechtslehre des Idealismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Platonische Staatslehre
Mensch, Kultur und Recht
Wie sprach Zarathustra?
Versuch über die Vernunft
Vorwort
ERHALTUNG UND GESTALTUNG ist eine Auswahl von interdisziplinär ausgerichteten Vorträgen an der FH des BFI Wien, die insofern verbunden sind, als sie im Rahmen eines „Methodencoachings“ zum Verfassen einer Masterthesis im Fachbereich Rechtslehre darauf vor bereitet haben, sich selbst zu fragen, wie das Recht gedacht werden kann.
Der erste Vortrag deutet die POLITEIA von Platon, der zweite AN ESSAY ON MAN von Ernst Cassirer, der dritte den ZARATHUSTRA von Friedrich Nietzsche aus.
Der vierte Vortrag diente dazu, die von Kurt Walter Zeidler geleisteten VERMITTLUNGEN zwischen dem antiken und dem neueren Idealismus für Ansätze zu einer Rechtslehre des Idealismus aufzubereiten.
Platonische Staatslehre
Der „vernünftige“ Mensch wird wohl „auf die Verfassung in sich selbst schauen“, schließt Platon in der Politeia, „denn auf Erden gibt es ihn, glaube ich, nirgends“, den im sokratischen Geiste gegründeten Staat, doch vielleicht „gibt es ihn im Himmel als Musterbeispiel für den, der ihn betrachten und danach sein eigenes Leben einrichten will.“1
1.
POLITEIA – der Staat – ist im Grunde ein Werk über den Begriff der Gerechtigkeit, deren Wesen Platon sokratisch zu ergründen gesucht hat.2 Das erste von 10 Büchern dieser antiken Schrift eröffnet eine Reihe von Gesprächen, die Aufschluss darüber zu geben gedacht sind, ohne abschließend dazu Stellung zu nehmen; zuletzt befasste er sich damit in den Nomoi – einer Arbeit über die Gesetze.3
Zuerst wird Gerechtigkeit mit Glaub- und Vertrauenswürdigkeit gleichgesetzt, wobei erkannt wird, dass jegliche Schädigung ungerecht sei. Die Frage wird aufgeworfen, ob Gerechtigkeit gleichbedeutend mit Wahrheit sei und darin bestehe, das, was man empfangen habe, zurückzugeben (331c).
Mit Wahrheit ist wohl Wahrhaftigkeit, somit Glaubwürdigkeit gemeint, denn es geht darum, ob man stets die Wahrheit zu sagen habe oder u. U. davon absehen dürfe, vielleicht sogar müsse. Bei der Rückgabe geht es nicht nur um empfangene geldwerte Güter, denn es ist auch von der Schuldigkeit gegenüber Göttern die Rede, sodass wohl Anvertrauenswürdigkeit thematisiert wird (331e). Gerechtigkeit wird dezidiert als Tüchtigkeit bezeichnet (335c), überdies wird bzgl. des „Hirten“ gesagt, ihm sei einzig und allein aufgegeben, bestmöglich für das ihm Anvertraute zu sorgen (345d). Erörtert und zurückgewiesen wird die überkommene Auffassung, man solle den (echten) Freunden nützen, (echten) Feinden indes schaden (332 ff.), denn wer gerecht sei, sei gut – und Güte sei gewiss nicht zum Bösen berufen (335e).
Wer behaupte, das Recht dürfe beliebig geändert werden, verkenne die Ausrichtung der Politik auf das Allgemeinwohl. Diskutiert wird die Meinung, das Gerechte sei bloß der Vorteil des Stärkeren (338c): Was der Herrscher zu Recht setze; was die Regierung, die an der Macht sei, verordne, das sei zwar zu befolgen (339a-c). Da aber niemand unfehlbar hinsichtlich des Vorteils und überdies die Staatskunst als Kunst nicht auf ihren eigenen Vorteil bedacht sei, sei jeder Stärkere dazu berufen, darauf zu achten, was dem jeweils Schwächeren zuträglich und angemessen sei (341a, 342c, 342e).
Wer dem guten Leben wohlgesonnen sei, mithin glücklich sein wolle, müsse wissen, welches Verhalten gesollt sei. Es sei keineswegs so, dass die Gerechtigkeit bloß gutmütige Einfalt, Schwäche und Laster sei (348b-c), stattdessen sei sie Tugend und Wissen (350d), sie sei stärker als Ungerechtigkeit (351a). Von Schlechtigkeit und Unwissen beherrscht könne kein Staat erfolgreich sein, denn Zwiespalt, Hass und Kämpfe würden ihn schwächen, wohingegen Eintracht und Liebe der Gerechtigkeit entspringen (351b, 351d).
Sodann wird erörtert, ob die „Gerechten“ besser leben und glücklicher seien als „Ungerechte“ (347e, 352d). Das Leben sei Aufgabe der Seele (353d), die von der fähigen Seele gut erfüllt werde: wer gerecht sei, d. h. wer gut lebe, sei selig – glücklich (353e, 354a). Eine gute Geisteshaltung halte zum gerechten Verhalten an: Gerechtigkeit wird als Gut gesehen, welches „der Seele innewohnt“ (357a-357b).
Das zweite Buch greift den nachfolgenden Erwägungen über geregelte Lebensverhältnisse vor, indem es Rückschlüsse auf die Möglichkeit rationaler Begründung; auf die Regel zur Etablierung von Regeln in Aussicht stellt, d. i. die „Heautonomie“ der Vernunft: Angedacht ist die Einheit der „theoretischen“ und „praktischen“ Vernunft.4
Wird vernünftige (rationale) Begründung auf die empirische Begründung einerseits und auf die formallogische Begründung andererseits beschränkt, so mündet sie – in Ermangelung der Verknüpfung von Logik und Empirie – zwangsläufig in einen infiniten Begründungsregress, verfängt sich in einem logischen Zirkel oder endet mit einem dogmatischen Abbruch des Begründungsverfahrens.5 Diese drei Einwände gegen die Möglichkeit rationaler Begründung hat Hans Albert als „Münchhausen-Trilemma“ bezeichnet.6 Um den „tautologischen Leerlauf“ der formalen Logik ebenso zu überwinden wie die „bloße Faktizität“ empirischer Feststellungen, bedarf es nach Kurt Walter Zeidler einer geregelten Verknüpfung von Logik und Empirie, wobei der Zusammenhang von „Fall und Regel“ zugleich der Zusammenhang dreier Schlüsse sei: Induktion, Deduktion und Abduktion.7
Platon lehrte, dass die „Idee“ bei jeder begrifflichen Bezugnahme setzend zu suchen sei.8 Die platonische Ideenschau ist nach Zeidler keine metaphysische, sondern stehe in seinem Höhlengleichnis für das begriffliche Erkennen der Zusammenhänge, die in der Höhle zunächst vorstellungshaft an Gegenständen und als Gegenstände angeschaut würden, um dann im „Ausgang“ aus der Höhle den Überstieg zur Logik der Ideenverknüpfung anzudeuten, die Aristoteles mit der Syllogistik zu bewerkstelligen versucht habe.9 Die „drei Formen“ bei Aristoteles zeigen die Einheit dreier logischer Grundhandlungen auf: Eine Regel wird exekutiert, indem ein Fall darunter subsumiert wird (Deduktion); sie wird formuliert, indem Fälle antizipiert werden (Induktion); und sie wird exemplifiziert, indem „etwas“ als Fall identifiziert wird (Abduktion).10
Aufgeworfen wird von Platon in der Politeia nicht die Frage, welche Regelung gerecht sei, sondern was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit eigentlich seien (358b). Das „Wesen“ und der „Ursprung“ (358e) der Gerechtigkeit könnten vielleicht – lesen wir darin – in einem „größeren Gebilde“ leichter erfasst werden (368e), weshalb „in Gedanken die Entstehung eines Staates“ betrachtet werde (369a).
Das dritte Buch erweist die gesellschaftliche Arbeitsteilung als Vorbedingung politischer Gemeinschaft – Staatlichkeit gründet auf Freiheit und Gleichheit.
Bereits im zweiten Buch wird gesagt, der Staat entstehe, „weil keiner von uns sich selbst genügt, sondern viele andere nötig“ haben (369b). Ein „üppiger“ Staat (372d-373d) sei kein sog. Schweinestaat (369e-372d), der sich darauf beschränke, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung (369d) arbeitsteilig zu befriedigen.
Wachse die Bevölkerung an und würden Nahrungsmittel knapp, so erhöhe sich die Gefahr von Unsicherheit, woraus die Herausbildung eines „Wächterstandes“ folge (373d-376c).
Das dritte Buch handelt von der Ausbildung der Wächter (376c-412b), wobei die althergebrachte Dichtung und mit ihr die tradierten Mythen einer kritischen Prüfung unterzogen werden (392c); in diesem Zusammenhang wird gesagt, dass „der Gott“ so dargestellt werden müsse, wie er „wirklich“ sei, nämlich „gut“ und „unwandelbar“ (379a, 380d-383c). Auch Musik wird für ihre Erziehung instrumentalisiert (398c-403c), zur Herausbildung einer „dem Charakter nach wahrhaftig schön und gut“ gestalteten „Denkungsart“ (400d), die nicht von Begierden getragen, sondern von Liebe erfüllt sei (402d-403c). Eine ausgewogene Körper- und Seelsorge beuge „Einseitigkeit“ vor, fördere sowohl Gesundheit als auch gütliche Einigungen im Konfliktfall (405a-410a).
Die Regierung werde nicht aus dem „Nährstand“, sondern aus der Reihe der Wächter „ausgewählt“ (412 ff.). Die Stände stehen für soziale „Funktionen“, nicht für „Klassen“. Dies verdeutlicht die sog „edle Lüge“, dass die Erde die „wahre Mutter“ aller (414b-e) sei und die soziale Stellung sich aus Entfaltung dessen ergebe, was Gott der Seele bei ihrer Erschaffung „beigemischt“ habe.
Es geht um die „geschwisterliche“ Ermöglichung der Selbstverwirklichung (415a-c), nicht um Macht oder Reichtum (415d-417b, 422a). Es geht, wie im fünften Buch das Plädoyer für Wächterinnen im Staatsdienst, also für Gleichberechtigung und deshalb für die „gemeinsame“ Ausbildung von Knaben und Mädchen, verdeutlicht (415b ff.), um bürgerliche Freiheit und persönliche Gleichheit.
Das vierte Buch weist Gerechtigkeit als Festhalten an Treu und Glauben aus. Die Staatsgründung ziele nicht darauf ab, „dass ein einzelner Stand besonders glücklich sei, sondern womöglich der ganze Staat“ (420b). Der Staat gleiche der Seele, die dann wohlgeordnet sei, wenn der Mensch gewillt sei, das, was ihn körperlich antreibt, vernünftig zu binden (441a-444e).
Gerechtigkeit wird als Ordnung, Freundschaft und Harmonie betrachtet und mit der Tugend in Verbindung gesetzt, die „so etwas wie Gesundheit, Schönheit und edle Haltung der Seele“ sei; ungerechtes Handeln sei dieser Haltung entgegengesetzt (443c-444e). Es wird nicht auf gesatztes Recht (427a), sondern auf Grundwerte fokussiert (427d-441c), die zum Inbegriff dessen führen, was wechselseitig erwartet werden darf. Diese berechtigte Erwartungshaltung kann: Handeln nach Treu und Glauben genannt werden.
Wer festen Halt suche, finde ihn – so wird uns im fünften Buch versichert – in der Philosophie, im Lichte der „Idee des Guten“.
Was als berechtigt gelten kann, wird am Familienbegriff mit Bezug auf Freuen und Kinder (449c-464c) sowie am Begriff des Staatsvolkes mit Bezug auf Griechen und „Barbaren“ (469a-471c) dargelegt, wobei die Ausführungen darauf hinauslaufen, dass es nicht darum geht, Althergebrachtes fortzuführen oder Neues festzusetzen, sondern die Frage nach der Geltung des Rechts, der Rechtfertigung von Normen, der Gerechtigkeit als wissenschaftliche Frage zu begreifen, mithin eine vernünftige Antwort darauf zu suchen: Erkenntnis anstelle bloßer Meinung oder Bekenntnis. Das zeigt sich insb. darin, dass die Forderung erhoben wird, „politische Macht und Philosophie“ mögen „in eins zusammenfallen“ (472b-480a).
Philosophie blicke „auf Geordnetes, ewig Gleichbleibendes, bei dem es kein gegenseitiges Unrechttun und kein Unrechtleiden gibt, wo sich alles in einer vernünftigen Ordnung befindet“ (500c). Um zu prüfen, was gerecht, tugendhaft sei, müsse der anstrengende Weg zur Idee des Guten, die das höchste Wissen darstelle, beschritten werden. Durch sie werde „das Gerechte und alles sonst brauchbar und nützlich“ (504d-505a). Angestrebt wird nicht das „scheinbar“, sondern das „wahrhaft Gute“ (505d-e). Die Frage nach dem Wesen des Guten wird jedoch vorerst beiseitegelassen (506e). Die Idee sei das, was etwas „seinem Wesen nach ist“, also die Einheit in der Vielheit, die zwar nicht gesehen, aber gedacht werden könne (506b).
Das sechste Buch verdeutlicht das Gesagte im Sonnen- und im Liniengleichnis; das siebente Buch enthält das Höhlengleichnis.
Wie sich die Sonne „zum Gesichtssinn und zum Gesehenen“ verhalte, so verhalte sich auch die Idee des Guten „in der Welt der Gedanken“ zum Verstand und zum Gedachten (508a-c): sie verleihe der Erkenntnis die Wahrheit und den Erkennenden das Erkenntnisvermögen (508e). Das Gute überschreite insofern das Sein, als es der Grund des Seienden sei (509b).
Erläutert wird das Verhältnis von sensibler und intelligibler Welt mittels einer Linie, die in zwei ungleiche Abschnitte geteilt sei, die wiederum im selben Verhältnis geteilt seien: den größeren Teil des größeren Teils nehmen Vermutungen über das uns Vermittelte, den kleineren selbst gebildete Meinungen ein, worüber sich im größeren Teil des kleineren Teils das Nachdenken darüber erhebe, was aus dem Vorausgesetzten formal richtig abgeleitet werden könne, während der kleinere Teil des kleineren Teils für die eigentliche Erkenntnis stehe – für „den voraussetzungslosen Urgrund des Ganzen“, welcher „durch die Dialektik geschaut“ werde (509d-511d).
Würden Menschen in einer Höhle gefesselt und zeitlebens bloß die Schatten von künstlichen Dingen sehen und nebulose Stimmen hören, ohne die Sprechenden zu sehen, die sie hinter einer Mauer vor einem Feuer vorbeitragen, das die Schatten an die Wand werfe, so würde die Gefangenen „nichts anderes für wahr halten als die Schatten der verfertigten Gegenstände“ (514a-c). Wer befreit und gezwungen würde, den steilen Weg hinaus ins Freie zu gehen, würde allmählich die natürlichen Dinge und zuletzt die Sonne selbst wahrnehmen, nach der Rückkehr in die Höhle müsste sich dieser Mensch aber wieder umgewöhnen und stieße dort bei den Mitmenschen auf Unverständnis, sogar auf Hass (514d-517a). Die Schau der Dinge in der Außenwelt entspreche dem Aufstieg der Seele in die Welt des Denkbaren, wo die Sonne für die höchste Idee stehe – die Idee des Guten (517b-c).
Hierbei gehe es um Bildung und Umbildung im Sinne einer Erziehung, die nicht vergeblich versuche, jemandem Wissen „einzupflanzen“. Stattdessen helfe sie bei der „Umwendung“ der Seele für das Erschauen des Guten (518b-d). Wissen sei nicht erzwingbar (536e-537a), weshalb „das Denkvermögen“ selbst „in Bewegung“ gesetzt werden sollte (524e).
Nach Zeidler hat Erkenntnis als „jemandes vermittelbares Wissen von etwas“ Bezug auf das Erkenntnisobjekt als Vorgabe und auf Sprache (Bestimmtheit, Darstellbarkeit, Mitteilbarkeit) sowie auf das Erkenntnissubjekt, das sie als Aufgabe vollziehe (leiste). Was daraus resultiert – das Wissen, das sich ergibt – sei demnach dreifach vermittelt.11 Alles, was es gibt, sind vor diesem Hintergrund Gegenstände der Erkenntnis, Umstände der Erfahrung und Zustände des Erlebens, die durch Begriffe bezeichnet, dargestellt bzw ausgedrückt werden, wodurch die drei Aspekte des empirisch Zutreffenden, des formal Richtigen (Gültigen) und des (zeugnishaft) Geltenden als drei Momente des Begriffs der Wahrheit, die in Korrespondenz-, Kohärenzbzw Konsens- oder Diskurstheorien einseitig gespiegelt wird, eröffnet werden.12
Das achte Buch zeigt auf, dass die Politik mit der Gesinnung verknüpft sei. Timokratie (547c-550c), Oligarchie (550c-555b), Demokratie (555b.562a) und Tyrannis (562a-567b) sind darin als ineinander übergehende Verfallsformen der Aristokratie angeführt (544e), wobei der „Charaktertypus“ eruiert wird, der ihnen entspricht.
Im neunten Buch wird daraus gefolgert, dass der Staat glücken könne, falls wir gut gesinnt, d. h. rechtschaffen seien.
Wer vernünftig sei, sei auf das Gesetz bedacht (587a), das uns beistehe, uns „eine Art Verfassung“ gebe, „damit wir nach Möglichkeit alle einander gleich werden und Freunde, geleitet von ein und demselben Prinzip“ (590d-e). Schauen wir „auf die Verfassung in uns selbst“ (591e), so halten wir am „Göttlichen und Vernünftigen“ fest (590d). Dies gilt unabhängig davon, ob wir „nun den Ring des Gyges besitzen oder nicht“. Die Parabel vom Ring des Gyges, der ihn unsichtbar gemacht haben soll, findet sich im zweiten Buch (459d-360b); sie steht im Kontext von Überlegungen zur Nützlichkeit des bloßen Scheins der Gerechtigkeit, die zur Sprache gebracht wurde, weil Besonnenheit und Gerechtigkeit für „beschwerlich und mühevoll“ gehalten werden (364a, vgl. X, 612b).
Die Gespräche klingen am Ende in Theologie aus, denn das zehnte Buch ist auf Hoffnung bedacht. Der „Modellstaat“ sei kein „frommer Wunsch“, sondern „irgendwie möglich“ (540d). Man könne sein Leben auf Erden nach diesem Musterbeispiel im Himmel einrichten (592b).
Der gerechte Mensch sei wahrhaft glücklich und falls es ihm zu Lebzeiten nicht gut ergehe, dürfe er doch hoffen, dass seine Werke im Jenseits nicht verloren gehen (610e, 611a-b, 615a-b, 621c, 331a). Platon hat seinen Timaios als Fortsetzung „des gestrigen Gesprächs“ (Politeia) verstanden.13
2.
Hans Kelsen dachte, dass „Gerechtigkeit“ für Platon „das göttliche Geheimnis“ sei.14 Er erblickte das Wesen der platonischen Gerechtigkeit in der „Vergeltung“, die – soweit sie sich nicht im Laufe des Lebens des guten oder bösen Menschen selbst verwirkliche – „in ein Jenseits oder in ein zweites Leben im Diesseits verlegt“ werde;15 der Glaube daran zwinge zur Annahme einer Postexistenz der Seele und seine Erkenntnislehre nötige zur Annahme ihrer Präexistenz.16 Das „Gute“ sei für Platon „die höchste, unsichtbare Gottheit“, weswegen sich die Frage nach ihrem Wesen verbiete.17
Die Gottheit, die in den Nomoi dem Staat vorsteht, ist indes eine solche, die nur insofern über uns „herrscht“, als wir „die Vernunft“ haben.18 Christina Schefer sah die „ungeschriebene Lehre“, „Prinzipienlehre“ Platons auf „das Eine“, das „höchste Gute“ als Formursache und auf die „Unbestimmte Zweiheit“, das sog „Große-und-Kleine“ als Materialursache ausgerichtet, wobei „Apollon“ symbolisch für „das Eine“, für „die unsagbare Erfahrung eines lebendigen Gottes“ stehe.19
Ada Neschke-Hentschke erklärte, dass alle, die die Vernunft haben, eine „göttliche Instanz“ hätten, „einen Gott, der in ihnen herrscht“, wobei das, was „Gott“ heiße, „die vernünftige Einsicht im Menschen“ sei.20 Kelsen bestätigte den Verweis auf die Vernunft, indem er darlegte, dass im Sinne Platons gerecht handle, „wer von der Vernunft geleitet“ sei.21
Platons Idee des Guten liest sich als Versuch, die Vernunft als „das Denken selbst“ zu denken. Neschke-Hentschke hielt fest, die Vernunft sei i. d. Z. „das der objektiven Sachordnung der Dinge entsprechende Identifikations-, Unterscheidungs- und Verbindungsvermögen“ i. S. d. Vermögens, die „unsterblichen Formen“ zu erkennen, „die die Dinge zu dem machen, was sie eigentlich sind.“22 Zeidler hat die „Formen“ mit dem „Schließen“ in Verbindung gebracht und die Vernunft i. S. eines begründenden und sich selbst begründenden Denkens als „forma formarum“, „Prinzip aller Prinzipien“ oder „Regel aller Regeln“ bezeichnen; als „dreifältigen Schluss“, der die „Einheit der drei Momente: Unbedingtheit, Allgemeinheit und Gesetzmäßigkeit“ vermittele und „die drei Schlüsse: Deduktion, Indiktion und Abduktion“ als Glieder der „ursprünglichen logischen Einheit“ zu erkennen gebe.23 Hans Krämer meinte, bei Platon wirke das Gute als Grund und Ursprung von Ordnung und Einheitlichkeit in aller Vielheit. Das Wesen des Guten sei „die Einheit selbst“.24
Mit der „dialektischen“ Denkungsart hat Platon an gedacht, was Zeidler eine „schlusslogische Letztbegründung“ nennt.25 In der Politeia wird kein Idealstaat begründet, denn die Gesetze sind nicht so endgültig, dass sie Kritik aus schließen; sie gelten als Inbegriff geregelter Verhältnisse, soweit sie abduktiv bezeugt, deduktiv stabilisiert und induktiv bewährt sind.26
Clemens Kauffmann sagte, der Versuch, die Gesetzgebung auf vernünftige Grundlagen zu stellen, dürfe „nicht mit dem Versuch verwechselt werden, die Philosophie in eine praktischpolitische Funktion einzusetzen“.27 Stattdessen wird ein Staatsmodell