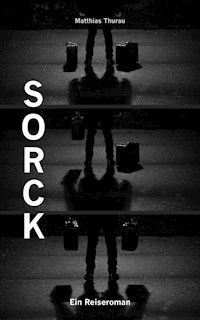4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was halten wir aus? Wann zerbrechen wir? Manchmal wollen wir alles in Schutt und Asche legen, nur um zu vergessen oder erinnert zu werden … Ich werde dir nicht sagen, dass du dich in die 29 Erzählungen dieses Bandes fallen lassen sollst. Sich fallen lassen in Geschichten, die von Erschütterungen handeln, die das Leben bereichern, ärmer machen oder zerstören? Wie spannend. Auch werde ich dich nicht marketingwirksam dazu einladen, die Figuren zu den Epizentren ihrer eigenen Geschichten zu begleiten und mitzuerleben, wie sie durch die Erschütterung von Körper, Geist und Realität stärker, freier, euphorisch werden oder einfach nur kaputt gehen. Nein. Dieses Buch ist anders. 29 Geschichten, ja. Erschütterungen? Definitiv. Aber: Lass dich nicht fallen, niemals, sondern beiße dich fest! Nutze die Stille für eigene Gedanken! Werde wütend, traurig, laut und erschüttert! Erschüttert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Matthias Thurau
Erschütterungen. Dann Stille
Erzählungen
Inhaltswarnungen / Content Notes befinden sich am Ende des Buches.
Vorwort: Mit schütterer Stimme
Erschütterungen können laut sein, leise oder tonlos. Doch immer haben sie Konsequenzen. Häuser werden zu Schutt und Leben zu Tragödien. Liebe zerfällt zu Asche und das Fleisch der Liebenden gleich mit. Danach herrscht Stille. Eine Stille so kalt, dass man aus tiefster Seele schreien möchte, nur um den Dampf aufsteigen zu sehen, ein Zeichen der eigenen Wirkung auf die Welt.
Manchmal ist die Stille zärtlich und nimmt die Menschen auf. Dann verschwinden sie für einen Moment oder für immer. Das könnte man Frieden nennen. Ich weiß es nicht.
Erschütterungen. Dann Stille. ist meine erste Sammlung von kürzeren Erzählungen. Eine Idee dahinter ist, dass ich hiermit die 3 »großen« Kategorien literarischer Veröffentlichungen erfolgreich hinter mich gebracht habe: Roman, Lyrik, Kurzgeschichten. Von nun an bin ich frei für Neues, für Anderes oder für mehr vom Bisherigen.
Selbstverständlich ist der wichtigere Grund für das Buch die Anhäufung von mehr und mehr kurzen Erzählungen, die nach Öffentlichkeit verlangten. Sie wollen gelesen werden. Manchen Geschichten konnte ich es mit Gewalt unmöglich machen, aber andere haben es verdient und diese finden sich hier versammelt.
Die 29 Geschichten in Erschütterungen. Dann Stille. stammen aus den letzten 2-3 Jahren. Die meisten allerdings sind 2020 entstanden. Der Spinner ist das Ergebnis eines brutalen Ausschlachtens meines allerersten Romanmanuskripts, das Extrakt sozusagen. Caspars Schiffe und Eine Ziege, Vater wurden ursprünglich für eine andere Anthologie verfasst. Die beiden Der Tod in Porto-Texte sind im gleichen Urlaub geschrieben worden, spielen in Porto und drehen sich um den Tod, haben aber darüber hinaus keine Verbindung miteinander. Der Tod in Porto II ist also nicht die Fortsetzung von Der Tod in Porto I.
Obwohl einige der Geschichten surreal und verdreht sind, wie man es von mir gewohnt ist, gibt es doch einige weniger schwierige und dafür vielleicht authentischere und emotionalere Texte. Sie fühlen sich an, als seien sie näher dran. Woran? Am Leben? Damit stellt Erschütterungen. Dann Stille. möglicherweise eine Verbindung her zwischen meiner bisherigen Prosa (Sorck: Ein Reiseroman, Das Maurerdekolleté des Lebens) und meiner Lyrik (Alte Milch: Gedichte). Beinahe kann man zusehen, wie ich meine Stimme entwickele und immer mehr zu mir, zum eigenen Stil finde. Die Idee gefällt mir. Meine Stimme wird fester.
Erschütterungen wollen uns manchmal zum Schweigen bringen. Wir richten uns auf und sprechen trotzdem. Kratzig und gebrochen am Anfang, mit schütterer Stimme, bevor wir endlich den Schmutz abgeschüttelt haben und schreien, schreien.
Am Fluss
Kruppke stoppte seine Arbeit und sah mir ins Gesicht.
»Babykatzen? Wirklich?« Er überlegte.
»Wie im Zeichentrickfilm?«
»Ja, einen kleinen, jaulenden Sack voll Kätzchen.«
Mein Gedächtnis spielte mir die Szene noch einmal vor. Die Frau, die Brücke, das Fiepen vor und nach dem Aufklatschen aufs Wasser, dann Stille. Langsam trieb der Sack flussabwärts und verschwand. Ich ersparte Kruppke die Details. Auch wenn er keineswegs so aussah, hatte er einen weichen Kern. Manchmal geradezu matschig. Hätte ich ihm alles genau geschildert und ihm noch etwas zugeredet, hätte ich ihm nur noch eine Adresse geben müssen und er hätte den gerechten Zorn Gottes zur Katzenfrau getragen. Doch das war nicht mehr nötig.
»Ich sagte: 'Hör'n se mal! Das sind doch Lebewesen!'« Kruppke nickte zustimmend. Ich hatte das eigentlich nicht gesagt.
»Und dann habe ich sie angemault und ihr den Tierschutz auf den Hals gehetzt.« Kruppke lachte.
»Richtig so, Schmitt!«
Ein bisschen malte ich die Geschichte noch aus. Ich erzählte, wie dumm sie geguckt hätte und dass andere Leute mitbekommen hätten, was los gewesen sei, und dass es der Frau unangenehm geworden wäre und sie weg gewollt hätte, aber nicht gelassen worden wäre, und dass die Polizei gekommen wäre, um zu sehen, was sich abspielte, und sie alles in die Akten aufgenommen hätten und all das. Damit beruhigte ich Kruppkes Gemüt wieder. Die scheinbare Gerechtigkeit löschte sein Gedächtnis. Für ihn war es, als wären die Kätzchen nie verreckt. Aber sie waren verreckt, sie waren ersoffen in dem kleinen scheiß Fluss in der Altstadt. Oder etwas weiter unten, nachdem sie sich müde gestrampelt hatten. Vermutlich war es noch vor der alten Mühle geschehen.
Als Kinder hatten wir dort Verstecken gespielt. Ich hatte mich am Wasserrand versteckt und war tiefer und tiefer die Böschung hinabgekrochen, als die anderen Kinder näher kamen, um mich zu finden. Schließlich war ich zu den Schaufeln des Mühlrades gelangt, die noch immer im Fluss steckten, aber sich schon lange nicht mehr bewegten. Wenige Meter entfernt hatte ich die anderen wispern gehört. Sie konnten mich nicht sehen. Jemand schmiss einen Stein ins Wasser. Da fiel mir etwas auf. Am Holz des Mühlrades hatte sich etwas verfangen. Ich beugte mich herab und schnappte mir den Sack, sicher einen Schatz gefunden zu haben, und schleppte ihn hinter mir her die Böschung empor. Was auch immer darin war, wollte ich stolz präsentieren. Doch die anderen waren schon wieder weitergezogen, gelangweilt vom Spiel. Also löste ich die Schnüre am Sack alleine, packte ihn an den unteren Zipfeln, kippte den Inhalt auf platt getretenes, gelbes Gras und starrte darauf. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, was ich sah. Zähnchen, die aus brackigem Fell ragten. Krumme Gliedmaßen, mit Krallen, die sich in anderen, fremden Beinchen vergraben hatten, panisch. Noch immer war der Sack nicht leer. Ohne vom Haufen toter Kätzchen fortzusehen, schüttelte ich den Beutel kräftig aus, geistesabwesend starrend, bis ein weiterer kleiner Körper nass auf die Geschwisterchen klatschte. Krallen, die sich in Schnüre verheddert hatten. Erst dann verstand ich wirklich. Ich drehte mich um, stützte mich auf die Knie und kotzte so schlimm wie noch nie. Als ich mir mit dem Ärmel den Mund abgewischte, sah ich, dass ich den Sack noch immer in der Hand hielt. Fest verkrampfte, kalte Finger. Ich schüttelte den Stoff los und rannte nach Hause.
Kruppke kannte die Geschichte nicht. Er war damals mit den anderen weitergezogen. Deshalb war er zufrieden mit etwas Empörung und der Überzeugung, dass Polizei und Tierschutz ihre Sache schon erledigen würden. Doch es geschah nichts von alledem.
Das mit den Kätzchen, in der Kindheit und auch jetzt nochmal, passierte wirklich. Die Frau war echt. Sie hatte einen roten Anorak getragen, von dessen Saum zwei Bänder, die dazu dienten, ihn enger zu schnüren, lustig baumelten. Ich hatte an ein Katzenspielzeug denken müssen. Als ich auf die Brücke gekommen war und verstand, was ich hörte und sah, war ich im Herzen wie gelähmt. Ich stellte die Frau nicht zur Rede. Ich sagte gar nichts, sondern ging weiter auf sie zu. Dann blieb ich doch stehen. Direkt vor ihr. Sie schaute mir ins Gesicht. Plötzlich sagte sie: »Die wollte niemand. Was hätte ich tun sollen?« Langsam schaute ich mich um. Linksherum und rechtsherum. »Ist schon richtig«, sagte ich, »niemand wollte sie.« Dann packte ich den unteren Saum ihres Parkas, zog ihn ihr bis über den Kopf, knotete die beiden Bänder oben zusammen und schmiss die Frau über die Brüstung ins Wasser. Der improvisierte Jackensack schien für den Moment zu halten. Und schon war sie weg.
Am nächsten Tag fuhr ich zur alten Mühle raus. Die Frau war nicht zu finden. Vermutlich hatte sie sich irgendwo ans Ufer schleppen können und kurierte zuhause den Schock aus. Auch den Sack mit den Kätzchen fand ich nicht. Nicht am Mühlrad und nicht in der Böschung. Gut für sie, dachte ich, gut für sie.
In der Nähe hörte ich ein Kind kotzen.
Der Sturm im Bierglas
He that's born to be hanged need fear no drowning. – Sprichwort aus elisabethanischer Zeit
Am Anfang war ein Sturm. Kein Zauberer, kein Schauspiel, keine Geister und kein Caliban. Ein Sturm. Ertrinkende und Idioten, so weit das Auge reichte. Wir hatten uns in die Bar zurückgezogen und schauten hinaus. Wir, das waren mein Freund und ich. Draußen rannten manche mit durchnässten T-Shirts durchs Gewitter, andere schwankten besoffen von Pfütze zu Pfütze und einer tanzte. Das ist alles Traum und Geschichte. Ich war müde.
Meine Gedanken wanderten zum ersten Mal, da ich Singin' in the Rain gesehen hatte, wanderten zum Wohnzimmer, zum Bier und den Zigaretten meiner Mutter, zu gemütlichen Abenden, die manchmal dunkel geendet hatten.
Ein Donnerschlag riss mich zurück in die Gegenwart. Ich drehte mich um und wurde mir meiner Umgebung bewusst. In so einer Kneipe hatte meine Mutter ihr Leben lang gearbeitet und mich manchmal mitgenommen. Altes, dunkles Holz, ein langer Tresen, Stühle mit Sitzflächen aus rot bezogenem Leder, das längst gerissen war, Lebenslinien auf allen Gegenständen und Gesichtern. Dort am Zapfhahn hatte sie gestanden und ich saß auf dem letzten Barhocker links, vor mir die Malsachen und immer mal wieder ein Betrunkener, der mir mit siffigen Fingern durch die Haare wuschelte und mir ein paar Pfennig zusteckte im armseligen Versuch, meiner Mutter zu gefallen.
Ich hatte den Geruch geliebt. Zuhause roch es ähnlich. Bier, Zigarettenrauch, Schweiß und Salzbrezeln. Wenn sie Zeit hatte, stellte Mama mir neuen Saft hin, schaute für einen Moment auf meine Bilder und strich mir über die Wange. Ihre Hände waren zuhause rau, doch hier waren sie weich vom Spülwasser. Immer fühlte ich mich wohl in Kneipen, zu wohl.
Als meine Mutter starb, feierten wir ihr Leben in ihrer Bar für eine Nacht. Alle kamen hin, alle tranken. Sie feierten ihr Leben für eine Nacht. Ich feierte ihr Leben ein Leben lang, suchte ihre Wärme auf jedem Barhocker, ihre Zustimmung in jedem Schnaps und ihren gütigen Blick in jedem Bier. Seit damals bin ich immer müder geworden, mit einer kurzen Pause dazwischen.
In einer Kneipe wie dieser fand ich nicht mehr ihren, aber einen anderen gütigen Blick. Mein Freund verliebte sich in meine traurigen Augen, hatte er einmal gesagt. Als er verstanden hatte, was mit mir los war, gingen wir nicht mehr in Kneipen. Zum ersten Mal wurde ich nüchtern. Er sorgte dafür, dass es mir trotzdem gut ging, dass es mir endlich gut ging. Morgens stand ich auf und hasste die Welt nicht mehr, sondern war hellwach, aktiv, zufrieden. Vielleicht hatte ich meine traurigen Augen verloren. Jedenfalls verließ er mich.
Wieder begann es von vorn. Ich suchte ihn in jeder Kneipe, jedem Schnaps, jedem Bier und wurde immer müder. Niemals war ich so müde wie jetzt. Meine Erinnerungen verwischen. Am Ende war ein Sturm. Nur ich war vollkommen ruhig.
Ich steige auf einen Stuhl, schaue ein letztes Mal ins Gewitter und springe ab, um wieder schlafen zu können.
Der Mitatmer
Er atmet mit mir, durch meinen Mund, durch meine Nase, immer knapp vor dem Gesicht. Er atmet meinen Atem, isst die Krümel aus den Mundwinkeln, leckt mir die Sauce von den Lippen und lässt sie bitter schmecken. Er kommt mit wenig aus. Manchmal vergesse ich ihn fast. Dann ruft er sich leise in Erinnerung, wackelt mir liebevoll an den Zähnen, kreischt wie Reifen in den Ohren. Ich würde mich gern wegdrehen und nicht immer diese Augen sehen. Wie ein dünner Film auf den Pupillen, wie Schwimmer in den Augen. Sieht man ihn einmal, verschwindet er nicht mehr. Nur manchmal ist da ein Schimmern, ein Umriss. Er steht zwischen mir und der Welt. Er atmet meinen Atem, erstickt meine Stimme und kommt mit wenig aus. In einem langsamen Tanz hält er mich umschlungen, presst mir die Luft aus den Lungen, führt mich spazieren wie einen Hund und dreht sich manchmal wie die Reflexion der Sonne in einem Fenster, das man öffnet. Doch immer sind die Augen auf mich gerichtet. Ich werde langsam blind. Er ist so nah. Seit damals. Seit damals ist er geblieben. Wie ein Zerrspiegel aus Dunst, der mir direkt vor den Augen schwebt. Fahre ich Auto, ist es am schlimmsten. Ich fahre nicht mehr mit dem Auto. Beinahe kann ich seine Haut erkennen, seine Kälte spüren. Der Mitatmer ist eingestiegen. Ich habe ihn eingeladen. Wie ein Reh. Scheinwerferkegel, dunkle Straße, wie ein Reh. Er war plötzlich auf der Straße wie ein Reh und dann auf der Windschutzscheibe. Nur für einen Moment. So kurz. Er sah mir in die Augen. So schnell. Dann flog er weiter. Er flog und schlug auf und er schrie und ich drückte das Pedal durch, doch er blieb bei mir. Er blieb. Er steht mir direkt vor den Augen. Er atmet meinen Atem. Bitte, nicht mehr. Er ist so nah. Es tut mir leid. Er will nicht gehen …
Der Tod in Porto I: Die Springer
Ich erzähle Ihnen mal was, während Sie auf Ihr Essen warten.
Noch vor wenigen Jahren stand mein Hotel kurz vor dem Bankrott. Das war eine schlimme Zeit. Als ich damals nach Porto zog, steckte ich den Großteil meines Vermögens in den Kauf und den Aufbau des Hotels. Seitdem lebe ich davon, aber reich bin ich nie geworden. Anfangs lief alles sehr gut. Schließlich ist Porto eine Touristenstadt.
Was die Menschen aus aller Welt anzog, waren die vielen alten Gebäude, Kirchen hauptsächlich, und natürlich das Wetter. Irgendwann wurde das wohl zu wenig. Außerdem, ist man ehrlich, sah man etwas abseits der Hauptwege zu viele dreckige Gassen und verfallende Häuser. Armut verbreitete sich trotz Tourismusgeschäft und Besucher wurden angebettelt. Das wiederum machte die Stadt weniger attraktiv. Jahr für Jahr kamen weniger Menschen her. Das spürte man am Umsatz und konnte es mit bloßem Auge erkennen.
Ich saß schon immer gerne hier auf der Terrasse vor dem Eingang des Hotels, wenn an der Rezeption gerade nichts zu tun war. Von hier aus kann ich den Douro überblicken, die Ponte Luiz und das alte Kloster auf dem Hügel sehen.
Früher war die Brücke immer voller Touristen. Zu jeder Uhrzeit. Bei jedem Wetter. Ein ständiger Strom fotografierender Menschen. Doch das ließ immer weiter nach. Arbeitslosigkeit und Armut wurden größer.
Die Einheimischen versuchten alles, um irgendwie Geld zu machen. Dabei hatten sie es auf die Touristen abgesehen. Taschendiebstähle nahmen zu, Prostitution auch. Rund um die Statue von Pedro IV kauerten morgens die Hungrigen und warteten auf die Touristen, die noch kein Geld ausgegeben und volle Taschen hatten. Passend zu den vernachlässigten und schlickig werdenden Steinen auf dem Platz machten die jammernden und schmutzigen Bettler einen erbärmlichen Eindruck. Porto zerfiel zu Ruinen und wenn die Stadt vorher in Touristenströmen zu ertrinken schien, ersoff sie nun in Armut. Die Elendsgesichter vermehrten sich wie die streunenden Katzen. Klar, da kamen nochmal weniger Familien her. Sogar die Suff- und Partyurlauber wurden seltener.
Eines Tages machte ich einen Spaziergang über die Brücke, oben wo die Bahnen fahren, und lief in Richtung der Klosterfestung, als mir ein weinender Mann auffiel, ein Einheimischer, nicht viel älter als Sie es sind. Er stand am Geländer mit seinem Sohn, der zehn oder elf Jahre alt war, und schaute auf die Stadt und den Nebel hinter der nächsten Brücke. Die Touristen versuchten ihn zu ignorieren oder blickten ihn neugierig an. Viele hielten lieber Abstand. Nach ein paar Worten zum Kind, die ich nicht verstand, stieg er auf das Geländer, bekreuzigte sich und sprang.
Ein Aufschrei ging durch die Menge, alle stürmten zum Rand der Brücke und schauten hinab. Der Douro hatte die Leiche des Mannes bereits verschluckt, obwohl er aufgeschlagen sein musste wie auf Beton.
In der Stille, die plötzlich herrschte, vernahm man deutlich eine einzige Stimme. Das Kind weinte. Auf dem Boden kauerte der Knabe und zitterte, schrie und jaulte herzerweichend. Als er zusammengebrochen war, fiel ihm die Mütze vom Kopf und lag nun mit der Innenseite nach oben auf dem Boden. Aus Hilflosigkeit zog eine dicke Frau ihr Portemonnaie und legte einen Schein in die Mütze. Ich war fassungslos und wollte zu ihr gehen und ihr meine Meinung sagen, als auch die Umstehenden in den Taschen zu kramen begannen. Ihre Gesichter waren vom Kind abgewandt, ihre Finger waren geschäftig auf der Suche nach Geld und die Mütze füllte sich. Sie zahlten, um so schnell wie möglich verschwinden zu können, ohne dabei herzlos zu wirken.
Später schlurfte der Kleine halb orientierungslos über eine verwaiste Brücke davon. Er hatte innerhalb von fünfzehn Minuten seinen Vater verloren und genug Geld verdient, um sich und den Rest der Familie für mindestens einen Monat zu ernähren.
Dieser Tag veränderte die Stadt. Die Erzählung vom Sprung des Mannes und dem Geld, das sein Sohn damit verdient hatte, verbreitete sich unter den Einheimischen und den Touristen.
Nur Tage danach tauchte ein zweiter Springer auf, der ebenfalls ein Kind mitbrachte, um es nachher kassieren zu lassen. Es funktionierte und auch das sprach sich herum. Aus den dunkelsten Winkeln der Stadt tauchten die Verzweifelten auf, die nichts mehr anzubieten hatten als ihr eigenes Leben. Sie tauschten es für das Weiterleben ihrer Liebsten ein.
Die Besucher, die fleißig zahlten, zogen ihren eigenen Gewinn daraus. Sie wirkten geschockt, aber hatten doch ein unglaubliches Urlaubserlebnis zu berichten, mit dem sie alle anderen übertrumpfen konnten. Und darum geht es doch heutzutage, oder? Wir müssen einander überflügeln mit Erlebnissen. Früher machte man Sightseeing oder Entspannungsurlaube. Dann fingen die Menschen an, auf Telefone zu starren und Busrundfahrten ironisch auf Facebook zu liken. Das reicht schon lange nicht mehr. Wenn sich die Einheimischen in den Tod stürzten, hatte man wenigstens Anteil an etwas Seltenem und Unfassbaren, ohne sich selbst zu gefährden.
Allen Springern und ihren Angehörigen war klar, dass es nur um Geld ging. Den Touristen irgendwann auch. Doch nach ein oder zwei Reinfällen beim Abkassieren wurde den Einheimischen bewusst, dass sie ein enormes Risiko eingingen: Es gab pro Sprung nur eine einzige Möglichkeit, um Geld zu machen. Danach musste ein neuer Springer her. Logisch. Fiel die Ausbeute gering aus, war ein Mensch umsonst gestorben oder wenigstens unter Preis.
Die Selbstmörder begannen zu rechnen. Längst waren auch Vermittler aufgetaucht, die Sprünge organisierten, Springer suchten und an jedem Toten mitverdienten. Diese Kreaturen taten nichts anderes, als zu rechnen. Tod gegen Bares. Aber wir mussten ja alle irgendwie leben, nicht wahr?
Es entwickelte sich dahin gehend, dass das Spiel offener wurde. Keiner tat mehr so, als wäre da nicht gerade jemand gestorben, damit seine Angehörigen Geld verdienen konnten. Von da an gab es den Tod nur noch per Vorkasse.
Gut sichtbar stellte sich jemand auf die Brüstung der Brücke oder der Plattform hoch oben am Kloster. Dann ging ein schluchzendes Kind herum und sammelte Geld. Das Schluchzen war nicht gespielt. Es handelte sich immer noch um tief verzweifelte Menschen, die keine andere Chance sahen, ihre Familien zu ernähren, als sich selbst zu töten und vorher die Kinder zu zwingen, Geld einzusammeln. Kamen genügend Einnahmen zusammen, gab es einen Menschen weniger. Wenn nicht, entstand richtiges Chaos. Entweder sie gaben mürrisch das Geld zurück und ärgerten sich also darüber, dass ein Angehöriger noch lebte. Oder sie versuchten zu flüchten. Das aber ließ alle anderen Springer unglaubwürdig erscheinen und die Vermittler hetzten die Fortgelaufenen, bis sie sich für einen Bruchteil der erhofften Einnahmen umbrachten. Das System funktionierte.
Einmal sah ich einen Springer auf dem Vorplatz der alten Festung nach der Sammlung ein paar Schritte zurücktreten und beten.