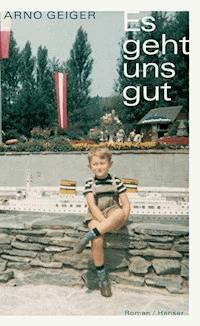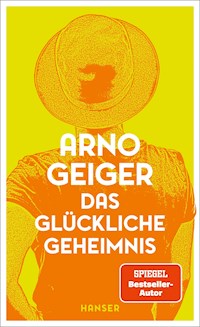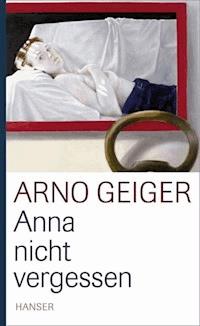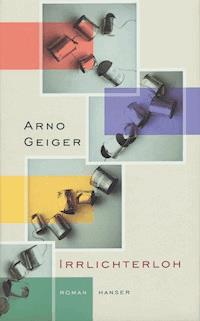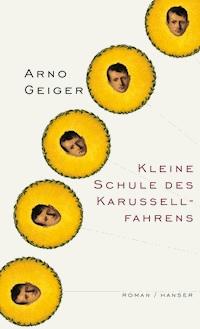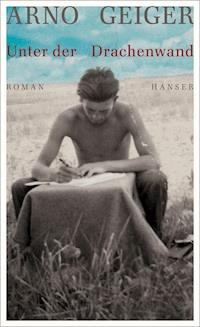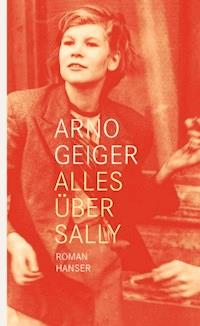Hanser eBook
Arno Geiger
Es geht uns gut
Roman
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24230-2
© 2005/2012 Carl Hanser Verlag München
Satz: Greiner & Reichel, Köln
E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Inhalt
Montag, 16. April 2001
Dienstag, 25. Mai 1982
Mittwoch, 18. April 2001
Samstag, 6. August 1938
Sonntag, 29. April 2001
Dienstag, 1. Mai 2001
Weißer Sonntag, 8. April 1945
Mittwoch, 2. Mai 2001
Dienstag, 12. Mai 1955
Donnerstag, 3. Mai 2001
Montag, 7. Mai 2001
Samstag, 29. September 1962
Dienstag, 22. Mai 2001
Donnerstag, 31. Dezember 1970
Donnerstag, 31. Mai 2001
Freitag, 1. Juni 2001
Freitag, 30. Juni 1978
Freitag, 8. Juni 2001
Donnerstag, 14. Juni 2001
Montag, 9. Oktober 1989
Mittwoch, 20. Juni 2001
Es geht uns gut
Montag, 16. April 2001
Er hat nie darüber nachgedacht, was es heißt, daß die Toten uns überdauern. Kurz legt er den Kopf in den Nacken. Während er die Augen noch geschlossen hat, sieht er sich wieder an der klemmenden Dachbodentür auf das dumpf durch das Holz dringende Fiepen horchen. Schon bei seiner Ankunft am Samstag war ihm aufgefallen, daß am Fenster unter dem westseitigen Giebel der Glaseinsatz fehlt. Dort fliegen regelmäßig Tauben aus und ein. Nach einigem Zögern warf er sich mit der Schulter gegen die Dachbodentür, sie gab unter den Stößen jedesmal ein paar Zentimeter nach. Gleichzeitig wurde das Flattern und Fiepen dahinter lauter. Nach einem kurzen und grellen Aufkreischen der Angel, das im Dachboden ein wildes Gestöber auslöste, stand die Tür so weit offen, daß Philipp den Kopf ein Stück durch den Spalt stecken konnte. Obwohl das Licht nicht das allerbeste war, erfaßte er mit dem ersten Blick die ganze Spannweite des Horrors. Dutzende Tauben, die sich hier eingenistet und alles knöchel- und knietief mit Dreck überzogen hatten, Schicht auf Schicht wie Zins und Zinseszins, Kot, Knochen, Maden, Mäuse, Parasiten, Krankheitserreger (Tbc? Salmonellen?). Er zog den Kopf sofort wieder zurück, die Tür krachend hinterher, sich mehrmals vergewissernd, daß die Verriegelung fest eingeklinkt war.
Johanna kommt vom Fernsehzentrum, das schiffartig am nahen Küniglberg liegt, oberhalb des Hietzinger Friedhofs und der streng durchdachten Gartenanlage von Schloß Schönbrunn. Sie lehnt das Waffenrad, das Philipp ihr vor Jahren überlassen hat, gegen den am Morgen gelieferten Abfallcontainer.
– Ich habe Frühstück mitgebracht, sagt sie: Aber zuerst bekomme ich eine Führung durchs Haus. Na los, beweg dich.
Er weiß, das ist nicht nur eine Ermahnung für den Moment, sondern auch eine Aufforderung in allgemeiner Sache.
Philipp sitzt auf der Vortreppe der Villa, die er von seiner im Winter verstorbenen Großmutter geerbt hat. Er mustert Johanna aus schmal gemachten Augen, ehe er in seine Schuhe schlüpft. Mit Daumen und Zeigefinger schnippt er beiläufig (demonstrativ?) seine halb heruntergerauchte Zigarette in den noch leeren Container und sagt:
– Bis morgen ist er voll.
Dann stemmt er sich hoch und tritt durch die offenstehende Tür in den Flur, vom Flur ins Stiegenhaus, das im Verhältnis zu dem, was als herkömmlich gelten kann, mit einer viel zu breiten Treppe ausgestattet ist. Johanna streicht mehrmals mit der flachen Hand über die alte, aus einer porösen Legierung gegossene Kanonenkugel, die sich auf dem Treppengeländer am unteren Ende des Handlaufs buckelt.
– Woher kommt die? will Johanna wissen.
– Da bin ich überfragt, sagt Philipp.
– Das gibt’s doch nicht, daß die Großeltern eine Kanonenkugel am Treppengeländer haben, und kein Schwein weiß woher.
– Wenn allgemein nicht viel geredet wird –.
Johanna mustert ihn:
– Du mit deinem verfluchten Desinteresse.
Philipp wendet sich ab und geht nach links zu einer der hohen Flügeltüren, die er öffnet. Er tritt ins Wohnzimmer. Johanna hinter ihm rümpft in der Stickluft des halbdunklen Raumes die Nase. Um dem Zimmer einen freundlicheren Anschein zu geben, stößt Philipp an zwei Fenstern die Läden auf. Ihm ist, als würden sich die Möbel in der abrupten Helligkeit ein wenig bauschen. Johanna geht auf die Pendeluhr zu, die über dem Schreibtisch hängt. Die Zeiger stehen auf zwanzig vor sieben. Sie lauscht vergeblich auf ein Ticken und fragt dann, ob die Uhr noch funktioniert.
– Die Antwort wird dich nicht überraschen. Keine Ahnung.
Er kann auch den Platz für den Schlüssel zum Aufziehen nicht nennen, obwohl anzunehmen ist, daß ihm der Aufbewahrungsort einfallen würde, wenn er lange genug darüber nachdächte. Er und seine Schwester Sissi, der aus dem Erbe zwei Lebensversicherungen und ein Anteil an einer niederösterreichischen Zuckerfabrik zugefallen sind, haben in den siebziger Jahren zwei Monate hier verbracht, im Sommer nach dem Tod der Mutter, als es sich nicht anders machen ließ. Damals war das Ministerium des Großvaters längst in anderen Händen und der Großvater tagelang mit Wichtigtuereien unterwegs, ein Graukopf, der jeden Samstagabend seine Uhren aufzog und dieses Ritual als Kunststück vorführte, dem die Enkel beiwohnen durften. Grad so, als sei es in der Macht des alten Mannes gestanden, der Zeit beim Rinnen behilflich zu sein oder sie daran zu hindern.
Philipp betrachtet zwei Fotos, die links und rechts der Pendeluhr arrangiert sind, ebenfalls über dem Schreibtisch. Johanna öffnet derweil den Uhrenkasten, um hineinzuschauen (wie eine Katze in eine finstere Stiefelöffnung schaut). Hinterher zieht sie am Aufbau des Schreibtischs kleinere Schubladen heraus.
– Wer ist das? fragt sie zwischendurch.
– Das rechts ist Onkel Otto.
Zum linken Foto sagt Philipp nichts, Johanna muß auch so Bescheid wissen. Aber er nimmt das Foto von der Wand, damit er es aus der Nähe betrachten kann. Es zeigt seine Mutter 1947, elfjährig, abseits der Dreharbeiten zum Film Der Hofrat Geiger, wie sie der Donau beim Fließen zusieht. Ein Ausflugsboot steuert flußabwärts, hinter Dieselqualm. Im Off singt Waltraud Haas zur Zither Mariandl-andl-andl.
– Wollte deine Mutter auch später noch Schauspielerin werden? fragt Johanna.
– Ich war zu jung, als sie starb, daß ich mich mit ihr darüber unterhalten hätte.
Und er weiß auch nicht, wen er statt seiner Mutter fragen soll, denn sein Vater schaut ihn großäugig an, und er selbst besitzt nicht die Entschiedenheit, weiter zu bohren, vermutlich, weil er gar nicht bohren will. Zu unangenehm ist es ihm, daß er von seiner Mutter das allermeiste nicht weiß. Jedes Nachdenken Stümperei, beklemmend, wenn er sich den Aufwand an Phantasie ausmalt, der nötig wäre, sich auszudenken, wie die Dinge gewesen sein könnten.
Er wischt den Gedanken weg und sagt, damit Johanna ihn reden hört:
– Mir kommt trotzdem vor, ein wenig waren sie alle Schauspielerinnen. Alle dieser Waltraud-Haas-Typus, blond, nett und optimistisch. Nur die Männer waren nicht wie die Männer im Heimatfilm. Ich nehme an, das war die spezielle Tragik.
– Und weiter?
– Dazu habe ich längst alles gesagt. Die Ehe meiner Eltern war nicht das, was man glücklich nennt. Ein ziemlich lausiges Weiter.
Er macht eine Pause und benutzt die Gelegenheit, seine Hand in Johannas Nacken zu schieben.
– Ich finde es ausgesprochen sinnlos, hier etwas nachholen zu wollen. Da denke ich lieber über das Wetter nach.
Philipp küßt Johanna, ohne auf Widerstand oder Erwiderung zu stoßen.
Über das Wetter vom Tag, das Johanna in ihren Haaren mitbringt, über das Wetter der kommenden Tage, das aus den Ausdrucken, den Tabellen und Computersimulationen in ihrer Tasche zu erschließen sein müßte.
– Über das Wetter statt über die Liebe statt über das Vergessen statt über den Tod.
– Sonst fällt dir nichts ein? fragt Johanna, die Meteorologin, halb lachend, wobei sie ungnädig-gnädig den Kopf schüttelt. Und weil das etwas ist, was Philipp an ihr kennt, fühlt er sich ihr einen Moment lang näher. Ebenfalls halb lachend, aber säuerlich, hebt er die Schultern, wie um sich zu entschuldigen, daß er nichts Besseres anzubieten hat oder anbieten will.
– Aber was rede ich, fügt Johanna hinzu, familiäre Unambitioniertheit ist bei dir ja nichts Neues.
Andererseits hat Philipp schon öfters versucht, ihr beizubringen, daß sie die Sache nicht ganz von der richtigen Seite betrachtet. Schließlich ist es nicht seine Schuld, daß man vergessen hat, ihn in puncto Familie rechtzeitig auf den Geschmack zu bringen.
– Ich beschäftige mich mit meiner Familie in genau dem Maß, wie ich finde, daß es für mich bekömmlich ist.
– Schaut aus wie Nulldiät.
– Wonach immer es ausschaut.
Er hängt das Foto, das seine Mutter als Mädchen zeigt, an den Nagel zurück, als Hinweis, daß er es vorziehen würde, den Rundgang durchs Haus in einem anderen Zimmer fortzusetzen. Er geht zur Tür. Als er sich nach Johanna umblickt, schüttelt sie den Kopf. Mißbilligend? Frustriert? Na ja, er weiß aus eigener Erfahrung, manchmal redet man wie gegen eine Wand. Schluck’s runter, denkt er. Johanna fixiert ihn für einen Moment, dann will sie wissen, ob sie die Pendeluhr geschenkt haben könne.
– Meinetwegen.
– Liegt dir vielleicht doch an dem Zeug?
– Nein. Nur hab ich nicht einmal Lust, es zu verschenken.
– Dann laß es, mein Gott, ich muß die Uhr nicht unbedingt haben.
– Weil du schon eine hast.
– Weil ich schon eine habe, stimmt genau.
Und wieder das Stiegenhaus, Herrenzimmer, Nähzimmer, die Veranda, Stiegenhaus, die teppichbelegte Treppe, zwei Hände beim flüchtigen Polieren einer Kanonenkugel, die in jeder anständigen Familie den Punkt markieren würde, bis zu dem man sich zurückerinnern kann.
Was Philipp jetzt einfällt, ist, daß ihn die Großmutter während einer der wenigen Begegnungen zurechtgewiesen hat, bei der nächsten Ungezogenheit werde man ihn auf die Kanonenkugel setzen und zu den Türken zurückschicken. Eine Drohung, die ihm deutlich im Gedächtnis geblieben ist, sogar mit dem großmütterlichen Tonfall und einer Ahnung ihrer Stimme.
Sie gehen das Obergeschoß ab, den Nachgeschmack von Streitereien im Mund, flüchtig und ohne viel zu reden, was sie voreinander mit dem Hinweis rechtfertigen, sie seien hungrig geworden. Also wieder nach unten. Johanna hilft in der Küche den Tisch abräumen, der noch genauso ist, wie Philipp ihn vorgefunden hat, samt dem durchgefaulten Apfel in der hellblauen Obstschale. Doch anschließend besteht Johanna darauf, draußen zu frühstücken, auf der Vortreppe. Dort ist es mittlerweile noch wärmer geworden (in dieser befremdlich heilen Gegend aus Villen und unbegangenen Bürgersteigen). Johanna holt sich trotzdem ein Kissen zum Unterlegen. Da sitzen sie, Philipp mit lang ausgestreckten, Johanna mit eng angezogenen Beinen, und Philipp versucht den abweisenden Eindruck, den er während des Rundgangs erweckt hat, abzumildern, indem er von den halbvermoderten Stühlen erzählt, die an mehreren Stellen entlang der Gartenmauer postiert sind. Sehr mysteriös. Ein Stuhl zu jedem Nachbarsgrundstück, damit man hinübersehen kann. Philipp berichtet, wieviel Honig es im Keller gebe und wie viele Sorten selbstgemachter Marmelade.
– Ich mag keine Marmelade, schmollt Johanna, die aufs Reden nicht mehr scharf ist.
Sie spuckt Olivenkerne in den Abfallcontainer. Sie horcht dem hallenden Geräusch hinterher, das die Kerne beim Aufprall auf dem schrundigen Metall erzeugen. Philipp indes, voller Unruhe, die er sich nicht zugeben will, vertreibt sich die Zeit, indem er die Tauben beobachtet, die Kurs auf die Kunstdenkmäler der Bundeshauptstadt nehmen oder auf den Dachboden, der neuerdings ihm gehört. Reges Kommen und Gehen.
– Ein Wahnsinn, murmelt er nach einiger Zeit.
Und noch mal, nickend:
– Ein Wahnsinn. Ist doch irre, nicht?
Wenig später verabschiedet sich Johanna. Sie küßt Philipp, bereits mit einer Wäscheklammer am rechten Hosenbein, und verkündet, daß es so mit ihnen nicht weitergehen könne.
– Typisch, fügt sie hinzu, nachdem Philipp aufgesehen hat, als wolle er zu einer Antwort ansetzen, dann aber nichts herausbrachte: Keine Antwort, somit auch kein Interesse, nicht anders als für deine Verwandtschaft.
– Dann haben wir das auch besprochen.
Er sieht nicht ein, worüber Johanna sich beklagen will. Immerhin ist sie es, die es nicht schafft, sich von Franz zu trennen. Sie ist es auch, die einen gewissen Stolz an den Tag legt, wenn sie behauptet, in einer der bestgeführten zerrütteten Ehen Wiens zu leben. Er braucht keine Geliebte, die nur jedes zweite Mal mit ihm schläft. Und das wiederum hält Philipp Johanna vor.
Sie zieht die Brauenbögen spöttisch hoch, verabschiedet sich nochmals, diesmal ohne Kuß, als wolle sie so den Kuß von vorhin zurücknehmen. Sie will losfahren, doch in dem Moment hebt Philipp das Hinterrad am Gepäckträger hoch, so daß Johanna ins Leere tritt. Die Fahrt ist leicht und ohne Wegweiser, ohne Anfang und ohne Ende, auf der allerstabilsten Straße, die man sich vorstellen kann. Immer geradeaus. Nicht zu verfehlen. Es kümmert Philipp nicht, daß Johanna sich beschwert:
– Laß los! Laß los, du Idiot!
Er läßt nicht los, er spürt den Rhythmus ihrer Tritte wie einen Pulsschlag in den Händen.
– Was für eine schöne Reise am Fleck! Man wird nie wissen wohin!
Johanna klingelt wie verrückt.
– Laß los! schreit sie: Du Idiot!
Er sieht auf ihren hin und her rutschenden Hintern. Er denkt, er denkt an vieles, an ihren Körper und daran, daß sie auch diesmal nicht gevögelt haben und daß sie auf der Stelle treten, und wenn nicht beide, dann wenigstens er.
– Schau doch! Wie leer die Straßen sind, die Grundstücke, die Bahnsteige! Die Hände, die Taschen, die Tage!
– Ich muß zu meinem Termin! Ich muß die Bilder von der Karottenernte schneiden! Für die Vorhersage am Abend! Es ist ganz nutzlos, was du machst! Denk über das Wetter nach! Mein Gott! Aber nicht, daß du dich übernimmst! Und mich laß! Laß looos!
Wenn man sich etwas vorgenommen hat, das ist Philipps Meinung, darf man sich trotzdem nicht daran klammern, so schwer es auch fällt. Also setzt er das Hinterrad ab und schiebt Johanna kräftig an, indem er hinter ihr herläuft. Sie verliert beinahe das Gleichgewicht und korrigiert mehrfach den Kurs. Die Briefträgerin tritt beiseite, als Philipp und Johanna durch das offene Tor auf die Straße biegen. Doch in Wahrheit klingelt Johanna nur für ihn.
– Komm wieder! ruft er, als er mit ihrem Tempo nicht mehr Schritt halten kann. Er winkt ihr hinterher. Die Speichen ihres Rades blitzen in der Sonne. Johanna sticht klingelnd in die erste Seitengasse und klingelt noch, während Philipp sich eine Zigarette ansteckt und überlegt, warum sie ihn besucht hat. Warum? Warum eigentlich? Er kommt zu keinem Ergebnis. Einerseits will er sich keine falschen Hoffnungen machen (sie hält ihn für nett, aber harmlos und hat sich deswegen schon einmal für einen anderen entschieden). Andererseits will er nicht unhöflich sein (er hat Besseres zu tun, als an einem vom Wetter begünstigten Montag unhöflich zu sein). Also setzt er sich zurück auf die Vortreppe, über den Schenkeln die großmütterliche Post, die nach wie vor einlangt, obwohl die Adressatin schon seit Wochen tot ist, und wechselt in Gedanken das Thema.
Er malt sich ein fiktives Klassenfoto aus, mit vierzig Kindern in den Bänken, lauter Sechs- und Siebenjährige, die weder von den Jahren, in denen sie geboren, noch von den Orten, an denen sie aufgewachsen sind, zusammenpassen. Einer der Buben hat als Erwachsener im zweiten Türkenkrieg gekämpft und von dort eine Kanonenkugel mitgebracht, ein anderer, dritte Reihe türseitig, ist Philipps Vater noch mit Milchzähnen. Auch dessen Mutter sitzt als Mädchen in derselben Klasse. Einer wird später ein erfolgreicher Ringkämpfer, Albert Strouhal, ein anderer, Juri, ist der Sohn des sowjetischen Stadtkommandanten. Philipp geht die Reihen durch und fragt sich: Was ist aus ihnen geworden, aus all diesen Toten, die täglich mehr werden? Das Mädchen mit den Zöpfen, die Kleine, die wie die andern Kinder ihre weißen Hände vor sich auf dem Pult liegen hat? Sie hat sich nie getraut aufzuzeigen, wenn sie aufs Klo mußte. Sie heißt Alma. Als junge Frau hat sie einen Verwaltungsjuristen in der Elektrizitätswirtschaft und späteren Minister geheiratet. Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen. Das eine, der Bub, ist 1945 im Alter von vierzehn Jahren in der Schlacht um Wien umgekommen, das jüngere, ein Mädchen, hatte in dem Hans-Moser- und Paul-Hörbiger-Film Der Hofrat Geiger einen kleinen Auftritt. Auch das Mädchen ist eine reizende Mitschülerin. Auf dem Foto sitzt sie in der zweiten Reihe an der Wand. Sie hat sich sehr jung für einen sechs Jahre älteren Burschen entschieden und sich dessentwegen mit ihren Eltern überworfen. Der Bursch? Den hatten wir schon, ebenfalls türseitig, in der Bank dahinter. Ein netter Kerl, wenn auch nicht ganz der richtige zum Heiraten. Als junger Mann hat er Spiele erfunden und mit diesen Spielen bankrott gemacht, obwohl eines dieser Spiele ganz erfolgreich war: Wer kennt Österreich?
Und der da, in der ersten Bank der Fensterreihe: Das bin ich. Ich bin auch einer von ihnen. Aber was soll ich über mich sagen? Was soll ich über mich sagen, nachdem ich über all die andern nachgedacht habe und dabei nicht glücklicher geworden bin.
Dienstag, 25. Mai 1982
Im Halbschlaf registriert sie das Aussickern der Finsternis und gleichzeitige Zunehmen des Lichts, das in das große Zimmer voller dunkler Möbel schlüpft. Es wäre praktisch, über eine Automatik zu verfügen, mittels deren sich, vom Bett aus, ein Fenster öffnen ließe: Raus mit der schalen Luft, dem Gemisch aus Atem, Roßhaarmatratze und gründlich verbrannter Milch. Ihr Mann hat vor drei Tagen, als sie mit dem Kulturkreis in Kalkwang war, einen halben Liter Milch acht Stunden lang gekocht. Die Milch war bei Almas Heimkehr in schwarzen Klastern an Topf und Herd sedimentiert, und abgesehen von der Mühe und der Zeit, die es kostete, den Herd mit Stahlwolle und Scheuermittel sauber zu bekommen (der Topf wanderte geradeaus in den Müll), vermutet Alma, daß der Geruch so rasch aus dem frisch gestrichenen Haus nicht hinausgehen wird. Sie selbst wird den Geruch heute vielleicht nicht mehr wahrnehmen, kann sein. Aus Gewohnheit. Aber jeder, der ins Haus tritt, hat dieses Alte-Leute-Aroma in der Nase. Befürchtet sie. Gut, mag sein, sie sieht das zu pessimistisch, mag sein, sie ist überempfindlich, weil ihr diese Dinge zu Bewußtsein bringen, daß es irgendwann nicht mehr weitergehen wird. Der Nagelzwicker im Kühlschrank, das schmutzige Unterleibchen, das Richard ausziehen sollte, unter dem übergestreiften frischen. Die Pizza mitsamt der Plastikhülle im Backrohr. Eigentlich harmlos. Und trotzdem: beängstigend, grauenvoll kommt ihr das vor, weil anzunehmen ist, daß es schlimmer werden wird. Irgendwann wird Richard fragen, ob Der Wolf und die sieben Geißlein eine Geschichte von Kindsmord ist. So Sachen hat sein Vater gegen Ende gefaselt. Oder er wird, wie Alma es beim Besuch im Seniorenheim erlebt hat, anfangen zu krähen, wenn ein Gockel im Fernsehen es vormacht. Abwarten, das wird gewiß noch geboten. Früh genug. Unruhig dreht sie sich im Bett. Nach mehreren unbefriedigenden Versuchen, eine bequemere Lage zu finden, bleibt sie halb auf dem Bauch liegen, den rechten Arm abgewinkelt oberhalb des Kopfes, den linken quer über der Brust, die Finger rechts an Hals und Ohr, die Decke zwischen den Beinen, damit die Schenkel einander nicht berühren. Almas Kopf liegt wangenseitig am Bettrand, zur Hälfte über der Bettkante, damit das Gesicht etwas von der kühlen Luft abbekommt, die unter dem Bett steht. Einige Minuten noch. Abwarten.
Dies.
Es ist der Hochzeitstag von Ingrid, ihrer Tochter, und zugleich der Sterbetag ihrer Mutter. Erst als Alma beim Begräbnis Geburts- und Sterbejahr auf dem provisorischen Holzkreuz eingebrannt sah, begriff sie, daß ihre Mutter fast hundert Jahre gelebt hatte. Hundert Jahre. Muß man sich durchs Gehirn laufen lassen. Almas Mutter sah als Kind, wie ihr Vater, Almas Großvater, neben einer Glaskugel arbeitete, um das Licht zu verstärken, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Sie spielte am unregulierten Wienfluß im Bereich, wo jetzt die U-Bahn fährt, und nahe beim Karlsplatz ging sie auf dem Weg zur Arbeit über die Elisabethbrücke, die mit den Statuen geschmückt war, die mittlerweile im Arkadenhof des Rathauses stehen. Manchmal erzählte sie von einer Nähmaschine mit Fußantrieb, auf der sie als Mädchen lernen durfte. Damals ein halbes Wunderding. Bis zuletzt holte Almas Mutter voller Stolz ein auf dieser Maschine genähtes Unterkleid hervor, das war, als die Menschen bereits Atombomben geworfen und vom Weltraum aus die Erde gesehen hatten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!