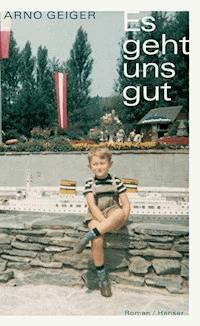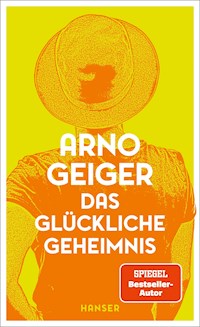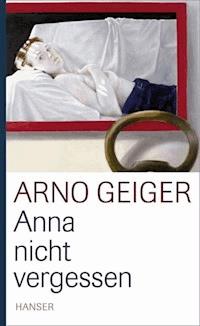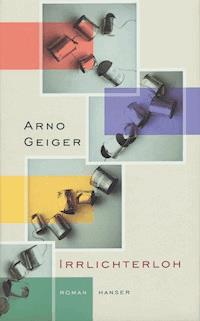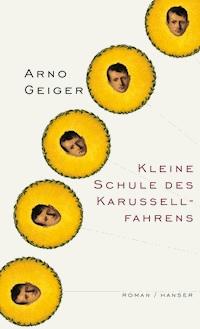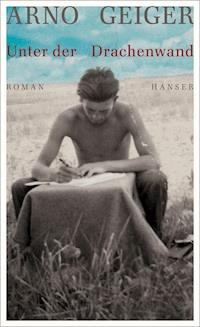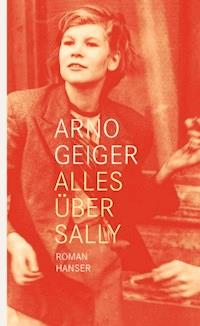Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Arno Geiger, Meister sprudelnder Sprachphantasie, beweist in "Schöne Freunde", dass er es versteht, Romane zu schreiben, die zwar die Untiefen der menschlichen Seele berühren, aber doch durch und durch komisch sind. "Schöne Freunde" ist ein Roman über das Ende der Kindheit - ein ganz eigener, unvergleichlicher Ton in der Gegenwartsliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Arno Geiger, Meister sprudelnder Sprachphantasie, beweist in »Schöne Freunde«, dass er es versteht, Romane zu schreiben, die zwar die Untiefen der menschlichen Seele berühren, aber doch durch und durch komisch sind. »Schöne Freunde« ist ein Roman über das Ende der Kindheit — ein ganz eigener, unvergleichlicher Ton in der Gegenwartsliteratur.
Arno Geiger
Schöne Freunde
Roman
Carl Hanser Verlag
Inhalt
1 Abschiede
2 Auf dem Schiff
3 Die Suche
4 Das Verschwinden
Liste der Toten und Vermissten
Ich schreibe mit unsichtbarer Tinte, es genügt jedoch, die weiße Seite anzuhauchen, damit auch die unsichtbare Schrift verschwindet.
(Jaroslav Seifert, Der Halleysche Komet)
1 Abschiede
Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir vor dem großen Tor gestanden sind. Ich weiß nicht, ob ich es vergessen oder nie gewußt habe. Ich erinnere mich nicht, je mit jemandem darüber gesprochen zu haben. Trotzdem glaube ich, daß alle darüber Bescheid wissen. Der Akkordeonspieler müßte es wissen, aber er hat keinen Kopf dafür. Alle andern, die es wissen müßten, sind verschwunden. Sie sind aus dem Dorf verschwunden. Sie sind vom Schiff verschwunden. Sie sind aus der Imbißstube verschwunden. Oder sie sind geblieben. Im Dorf. Auf dem Schiff. In der Imbißstube.
Dann bin ich verschwunden.
Wenn ich einen Ausgangspunkt suche, gelange ich zur Ankunft des Beamten, der den Auftrag hatte, das Unglück zu untersuchen, ich gelange nicht zum Unglück selbst. Am Abend des Tages, an dem ein Teil der Grube eingestürzt war, hielt ein Geländewagen vor dem großen Tor. Der Akkordeonspieler fiel in eine rasche Tonfolge. Der Chauffeur des Wagens ließ das Seitenfenster herunterfahren, aber nicht, um eine Münze in meine Kappe zu werfen, sondern um uns anzuschreien. Wir sollten verschwinden. Ich wußte nicht, wie der Mann dazu kam, uns anzuschreien und zu verlangen, daß wir verschwinden sollten. Ich öffnete das Tor trotzdem, ich habe nie einen Unterschied gemacht.
Ich beschreibe das Tor. Ich beschreibe es, weil niemand anders es beschreibt. Ich beschreibe es vorsichtig, um mich nicht allzu sehr zu täuschen: Ein großes und sehr hohes Tor. Ich glaube, es war alt, aus schwarzem oder schwarz gefärbtem Eisen, manchmal rostig oder schorfig, ich weiß es nicht, ich habe mich nie so recht dafür interessiert. Ich stand dort jeden Tag mit Ausnahme Sonntag. Oben zur Mitte hin war das Tor ansteigend geschwungen. Die Gitterstäbe endeten in Lanzettenspitzen, die teils verbogen, teils abgebrochen waren, doch auch in diesem Fall weiß ich nicht warum. Rechts ein Portierhaus mit einer dicken Frau darin, Frau Berber. Links ein Zaun, der rechts zum Portierhaus zurückkehrte, aber so, daß ich den ganzen Zaun hätte abgehen müssen, um zu erfahren, auf welchem Weg. Das Gelände war vollständig eingezäunt, und den Zaun entlang wuchsen Brennesseln, jedenfalls so weit ich es vom großen Tor aus sehen konnte. Nur links, wo wir gestanden waren, erstreckten sich zwei Meter festgetretener Dreck.
Die Straße war eine lange Straße, vermutlich älter als das große Tor und voller Schlaglöcher, die sich bei Regen in Pfützen verwandelten. Die Straße führte an den alten Villen, an der Arbeitersiedlung und an den neuen Villen vorbei zu einer Kreuzung und von dort in die Berge oder zur Stadt. Die Stadt habe ich die längste Zeit nicht gekannt. Zur Arbeitersiedlung ging ich regelmäßig und saß an Küchentischen, wo ich Limonade trank. Zu den alten Villen kam ich jede Woche sonntags bei Sonnenaufgang, denn dank meiner Bekanntschaft mit den Kindern des Platzwärters Zimek durfte ich für die Frauen und Männer am Tennisplatz den Balljungen machen. Zwecks Linie oder Geheimtraining (Ausdruck Platzwärter Zimek) spielten immer einige schon sehr zeitig, praktisch mit dem Hellwerden. Ehepaar Doktor Bianchi, Ehepaar Doktor Kornatz, Ehepaar Doktor Grüneisen. Die Frauen spielten regelmäßig. Am Schauplatz ihrer und ihrer Gatten Erholung, Sündenbüßung und Hinzufügung neuer Sünden habe ich gelernt, was mir später Halt, Erfolg und Glück ermöglichen sollte: Tennisspielen, Umgang, geistige Struktur und Satzbau.
Ich beschreibe den Tennisplatz. Drei sorgfältig instand gehaltene Sandplätze mit vielen Vorschriften und ebenfalls einem Zaun rundherum, der höher war als der Zaun beim Bergwerk. Nach dem Spiel brachte die Frau des Platzwärters Zimek Käse-Wurstplatten und Kaffee mit einem Schuß Likör oder Cognac und achtete genau darauf, daß ich nicht aufaß, was die Frauen übrigließen. Ich sprang den Bällen hinterher und warf sie jedem zu, der winkte oder die Hand in meine Richtung hob. Zuweilen bekam ich Geld für diese Dienste, doch habe ich nie danach gefragt oder den Eindruck vermittelt, daß ich welches wollte. Lieber lieh ich mir mit Hilfe der Zimekkinder und in Abwesenheit der Tennisspieler deren Rackets aus und schlug einen Ball in die Luft oder gegen eine Wand. Ich habe oft daran gedacht, wie sehr mir diese Fertigkeiten in meinem späteren Leben von Nutzen sein würden. Denn später wollte ich die junge Angestellte lieben und glücklich machen.
Ich habe die junge Angestellte vor dem großen Tor und im Büro des Direktors kennengelernt, wohin uns der Direktor an langweiligen Tagen rief. Er führte ein Telefonat mit dem Portierhaus, Frau Berber, und bestellte uns in sein Büro. Dort saß er in seinem nach hinten gekippten Direktorensessel, die Hände im Genick, Blick zum Fenster, und hörte dem Akkordeonspieler beim Spielen zu. Die junge Angestellte brachte Papiere oder Kaffee und meistens, wieheißtesgleich, Genever. Doch eines Tages kam die junge Angestellte in der Früh nicht mehr zum großen Tor, und auch im Büro des Direktors habe ich sie nach dem Tag ihres Ausbleibens nicht wieder gesehen.
Von diesem Tag an waren die Dinge verändert. Als ob allen Hunden die Sehnen durchgeschnitten worden wären (Ausdruck Frau Berber). Alles wurde lose, und die Gleichgültigkeit, die schon dagewesen war, schlug so richtig durch. Defektes Gerät wurde nicht mehr repariert und auch nicht weggeschafft. Hans Ohm, der Wäschereibetreiber, der bis dahin eher mehrmals als gar nicht gekommen war, brachte nur noch alle zwei Tage saubere Handtücher. Der Direktor rief plötzlich öfter als zuvor im Portierhaus an, der Akkordeonspieler spielte länger und schöner, und ich bekam mehr Geld, manchmal viel Geld. Die junge Angestellte fehlte. Sie hielt mein Herz fest. Mein Herz hatte schon davor begonnen, sie zu lieben, doch erst ab dem Tag ihres Ausbleibens ließ die Konstruktion dem Herz keinen Ausweg mehr. Als die junge Angestellte verschwunden war, stellte ich mir vor, wie glücklich wir sein würden, wenn ich erst ein Mann war, sie zurückkehrte oder ich sie wiederfand. Mit Ungeduld wartete ich, daß einer oder alle der eben genannten Umstände eintraten, was aber nie geschah, zu welchem Ende auch immer. Mit Ungeduld wartete ich deshalb darauf, daß wir zum Direktor gerufen wurden, denn ich glaubte, daß der Direktor ebenso gerne an die junge Angestellte dachte wie ich und daß er wußte, wo sie geblieben war.
Am Tag des Grubenunglücks besuchten wir das Büro des Direktors zum allerletzten Mal. Dann traf der Beamte ein, der den Auftrag hatte, das Unglück zu untersuchen, und wieder war alles verändert. Sehr viele Wagen passierten das große Tor, Krankenwagen, Feuerwehren, eilig aufgestellte Hilfsmannschaften. Dutzende Leichen von Arbeitern wurden auf einem defekten, seit einiger Zeit auf dem Gelände deponierten Förderband aufgebahrt und täglich abtransportiert, bis keine neuen Leichen mehr hinzukamen. Das war nach gut einer Woche. Die fehlenden Arbeiter wurden für tot erklärt und der Zugang zu den eingebrochenen Stollen zugeschüttet. Für zwei weitere Tage lag die Zeche still.
Während dieser Tage wurde aufgeräumt. Viele Lastwagen fuhren durch das große Tor und wieder hinaus, und die Feuerwehr legte eine Schlauchleitung zum Löschteich, damit mehr Waschwasser zur Verfügung stand. Ich gebe zu, das Wasser des Löschteichs immer für schwarz gehalten zu haben, und anders als schwarz kann ich mir das Wasser des Löschteichs auch nicht denken, kohlrabenschwarz unter einer grünen Schleimhaut. Trotzdem gelang es den Frauen und Männern, den Hof mit Hilfe des Teichwassers sauberzuwaschen. Sie wuschen mit Schläuchen, Eimern, Bürsten und Lappen. Weil die Bürsten keine Stiele hatten, wuschen sie den Hof auf Knien. Auch aus den Türen des Verwaltungsgebäudes schwappte stundenlang Spülwasser und Schaum, und am Ende des zweiten Tags war der Teich leer.
Beim Nachhausegehen sagten die Arbeiter, die Aufräumarbeiten seien beendet und der Direktor sei entlassen. Gefeuert. Auch die Portierfrau sei entlassen, gefeuert und raus aus der Wohnung, weil sie seit Jahren das große Tor nicht mehr geöffnet habe.
Frau Berber weinte laut. Sie schrie, daß alle mit ihr zufrieden gewesen seien. Alle. Nie habe jemand am großen Tor länger als nötig warten müssen, und Verspätungen habe sie immer gewissenhaft in die Verspätungsliste eingetragen. Sie wollte nicht gehen. Sie wollte bleiben. Alle wollten bleiben. Sie drückte mich, der ich das große Tor immer geöffnet hatte, an ihren großen Busen, so daß ich keine Luft bekam. »Wohin, mein Kleiner?« schrie sie, während ihr dicker Körper unter Krämpfen zuckte. Ihre Tränen sickerten durch meine Haare, rannen vor zur Stirn und zu den Ohren. Das kitzelte und war so ungewohnt, daß ich mich loswand und einen Meter Abstand zwischen mich und die Portierfrau brachte. Von dort schaute ich sie unsicher an.
Frau Berber sagte, ab morgen würde kein Musiker mehr vor dem großen Tor geduldet, auch damit habe es ein Ende. »Aus.« Ich schüttelte den Kopf. »Nicht möglich.« Ich wollte es nicht glauben, wir standen auch am nächsten Morgen, wo wir immer gestanden waren, vor dem großen Tor. Menschen kamen jedoch nur wenige, denn die Arbeiter und Angestellten hatten diesen Tag frei bekommen, damit sie sich von den Schrecken der vergangenen Tage erholen konnten. Rauf und runter blieb die Straße nahezu leer, nur ein paar weinende Frauen brachten Blumen und gingen sogleich wieder weg, als sei der Ereignisvorrat dieses Tages mit den Blumen und Tränen erschöpft. So setzten wir uns zurück auf den Streifen Gras vor dem Portierhaus und warteten weiter, ich weiß nicht worauf. Fahnen wehten auf Halbmast. Die Sonne stieß sich am gesäuberten Zechenhof, wo nichts mehr war, worin sie sich hätte spiegeln können. Gegen Mittag jedoch fuhr, vom Verwaltungsgebäude kommend, der Geländewagen über den gesäuberten Hof der Zeche und hielt auf das große Tor zu. Der Direktor und der Beamte, der den Auftrag gehabt hatte, das Unglück zu untersuchen, saßen im Fond. Frau Berber, die bereits Koffer gepackt hatte, stürzte aus dem Portierhaus und stieß mich beiseite, weil sie das Tor eigenhändig öffnen wollte, überzeugt, es mit einem Test zu tun zu haben, der ihr bei Bestehen das Hierbleiben ermöglichen würde. Wieder wurde mir bewußt, daß sich die Dinge verändert hatten. Der Direktor gab mir diesmal kein Geld. Der Akkordeonspieler spielte nicht. Ich schaute mich um: Der Akkordeonspieler stand auf der Stoßstange des davonfahrenden Wagens, das Instrument geschultert, und klammerte sich an den Reservereifen. Ich lief hinterher. Der Wagen rumpelte in ein Schlagloch. Der Riemen des Akkordeons öffnete sich, das Instrument gab mit jedem heftigen Federn des Wagens dissonante Töne von sich. Ich lief sehr schnell, ein richtiger Zátopek-Lauf (Ausdruck Arbeiter Kowarik), obwohl mir die Socken vorne aus den Sandalen rutschten. Doch mein wöchentliches Training am Tennisplatz kam mir zugute. Ich erreichte die Hand des Akkordeonspielers, die Hand zog mich ohne Anstrengung hoch, und der Wagen fuhr rumpelnd mit uns davon.
Die Töne des Instruments vom großen Tor bis zur Stadt sind mir noch gegenwärtig. Oft höre ich sie aus einer beliebigen Melodie heraus, und dann denke ich an die alten Villen mit den großen Gärten und an den Tennisplatz, der rechterhand an dem Wagen vorbeiglitt. Dann denke ich an die Platzwärterkinder, Zimek, an die Käse-Wurstplatten und daran, daß ich die junge Angestellte liebe und daß ich sie irgendwann finden will.
Ich habe Talent fürs Tennisspielen, für Umgang, geistige Struktur und Satzbau. Und eine Nase für das Wetter. Als der Tennisplatz hinter uns zurückblieb, sagte ich in Gedanken der jungen Angestellten zum ersten Mal, daß ich sie liebe. Ich sagte es absichtlich in der abgegriffensten Münze, in der ich es oft am Tennisplatz, am Löschteich, in den Gärten der Villen und an den Küchentischen der Arbeiter gehört hatte, meistens schlampig gebraucht. Ich kenne alle Nuancen und bin ein leidenschaftlicher Fachmann auf diesem Gebiet. Auf der Stoßstange stehend, gelang es mir deshalb, die drei Worte auf eine Weise zu sagen, daß am Ende drei Punkte stehenblieben, die alles ausdrückten, was über das Gesagte hinaus zu der jungen Angestellten zu sagen war. Ohne die Sonntage am Tennisplatz und am Teich wäre das undenkbar gewesen.
Einmal (was ist einmal), als der Sand am Tennisplatz knöchelhoch spritzte, so regnete es, rief mich mein Freund, der Wäschereibetreiber Ohm, in den Serviceraum, wo er eine Saite an seinem Schläger wechselte. Er bahnte gerade ein nicht ungefährliches Verhältnis mit einer der am wichtigsten verheirateten Frauen am Tennisplatz an (Ausdruck der rothaarigen Zimektochter). Und da ich schon zu anderen Gelegenheiten einen verläßlichen Nachrichtenaustausch übernommen hatte, erhielt ich auch an diesem Tag einen Auftrag. Aufträge hatten den Vorteil, daß ich zum Dank und wohl auch zur Tarnung Süßigkeiten zugesteckt bekam. Aber um vieles lohnender war, daß ich Erfahrungen bezüglich Frauen und Bewegungssicherheit in heiklen Situationen sammeln konnte; so nannte der Wäschereibetreiber Ohm, der Armausrenker, ganz gewöhnliches Bluffen.
Nachdem ich die Nachricht des Wäschereibetreibers und Armausrenkers, eine Verabredung am Löschteich, aufmerksam gelesen und wieder verschlossen hatte, überbrachte ich sie der wichtig verheirateten Frau. Wichtig war deren Mann, der Betriebsrat Kreisler, dessen Auffassung von gerechter Verteilung in Liebesdingen auf einem anderen Fundament basierte als im beruflichen Alltag (Ausdruck Wäschereibetreiber Ohm). Ziemlich brisant. Frau Kreisler, die Buchhalterin, stammte aus Belgien, sie redete mit einem starken Akzent, der mit gefiel. Deshalb bezog auch ich zum verabredeten Zeitpunkt Stellung, denn ich wollte wissen, wie es sich anhörte, wenn die Buchhalterin Kreisler dem Armausrenker Ohm sagte, was der Sterblichkeit einen Hauch Ewigkeit verleiht und die Fleischlichkeit mit Poesie verklärt (Ausdruck Frau Doktor Grüneisen).
Die Buchhalterin kam pünktlich. Der Wäschereibetreiber hingegen ließ auf sich warten, länger als höflich, fand ich. Ich rechnete jeden Moment damit, daß die Buchhalterin auf dem Absatz kehrtmachen und mit dem Schirm in die Büsche dreschen würde. Aber erstaunlicherweise geschah ganz etwas anderes: Als ihr das Warten zu dumm wurde, sagte sie das, worauf ich schon nicht mehr gehofft hatte, zu den Bäumen statt zum Wäschereibetreiber, und nicht nur einmal, sondern zwanzigmal. Sie sagte es unter ihrem Schirm beim vom Regen gepunkteten Löschteich. Sie sagte es, um die Abwesenheit des Wäschereibetreibers zu vertuschen und um sich die Tatsache, daß sie soeben versetzt worden war, ein bißchen leichter zu machen. Was weiß ich. Es sprudelte nur so aus ihr heraus, mit Isch und Disch, nur das mittlere Wort korrekt prononciert, eine Rose zwischen zwei Dornen. Sie sagte es mit einer Zigarette im Mundwinkel, zärtlich, mit buchhalterischer Sachlichkeit, erstaunt, unsicher, spöttisch, amüsiert, von Schluchzern begleitet, dann als hätte sie es jahrelang aufgespart, und wieder, im Sekundenwechsel, wie nicht ernsthaft, ins Leere hinein, daß es richtig chinesisch wurde, obwohl die Buchhalterin recht geübt erschien: Mal überzeugend, dann weniger, und zwischendurch immer wieder unter Lachen. Ein schönes, ein rauchiges Lachen. Ich hätte stundenlang zuhören können. Ich hätte am liebsten selber einen Verführungsversuch unternommen, so ging mir das nahe. Aber zu spät. Schon verlöschte die Zigarette im Teich, der Regen wurde lauter. Noch ehe ich den Mut gesammelt hatte, der nötig gewesen wäre, um in die Situation einzugreifen, entfernte sich die Buchhalterin Richtung Tennisplatz. Ich folgte ihr mit Blicken. Sie wurde kleiner.
Wie auch die letzten Siedlungshäuser kleiner wurden, als der Geländewagen des Untersuchungsbeamten die Straße zur Stadt hinunterstaubte. Die Häuser büßten ganz allmählich ihre Farben ein und existierten in gewissem Sinne nicht mehr, obwohl sie weiterhin eine wahrnehmbare Abweichung im allgemeinen Grün gewesen wären. Und Grau. Und Blau.
Also wandte ich mich wieder nach vorn und schaute durch das Heckfenster zum Direktor, der ebenfalls nicht mehr zurückschaute. Er saß rechts hinter dem Beifahrersitz, eine Tasche auf den Knien, und spuckte in kurzen Abständen zum Fenster raus, was uns jedesmal reflexartig die Köpfe einziehen ließ. Gelegentlich unterhielt sich der Direktor mit dem Untersuchungsbeamten. Die beiden redeten mal einander zugeneigt, Kopf an Kopf, dann jeder in seine Ecke hinein, wovon ich wegen des Motorenlärms aber nichts verstehen konnte, so daß auch nichts zu lernen war. Schade. Denn ich hielt den Direktor für klüger als andere und glaubte, daß er über alles Bescheid wußte, worüber ich im unklaren war. Seine Nähe gab mir Sicherheit und Hoffnung. Entgegen jeder Hoffnung. Noch ehe die Stadt hinter einer Krümmung der Erde hervorkam und größer wurde, wußte ich, daß ich beim Direktor bleiben wollte.
Ich beschreibe den Direktor. Er war mindestens fünfzig, groß, dick, grau, in Anzug, Hemd, ohne Krawatte. Er redete nicht viel. Am Morgen kam er im Wagen zum großen Tor, warf eine Münze in meine Kappe, ebenso abends, wenn er nach Hause fuhr, um seine freien Stunden mit ichweißnichtwas zu verbringen, jedenfalls nicht mit Gartenarbeit, denn sein Garten war verwahrlost, und das Gestrüpp konnte sich keine besseren Tage wünschen, weil der Direktor seinen Garten nie betrat. Er schaute kaum je zum Fenster raus. Selbst am Tennisplatz zeigte sich der Direktor selten und wenn, dann nur als Zaungast. Zu diesen Gelegenheiten redete er nicht viel, machte auch den Frauen keine Komplimente in Sachen Frisur oder Vorhand. Einmal (was ist einmal) sagte Frau Doktor Bianchi: »Der Direktor ist nicht ganz bei Trost.«
Auf diese Behauptung konnte die Antwort nur lauten: Der Direktor ist unglücklich verliebt, das liegt auf der Hand, sonst würde er nicht alles verlottern lassen. Ich bin ebenfalls unglücklich verliebt, und zwar in dieselbe Frau, und bin somit der einzige auf diesem Tennisplatz, der am gebrochenen Herzen des Direktors mitfühlen kann. Ich verstehe seine Leiden. Während der Direktor vorzugsweise in sein Glas schaut, schaue ich, wann immer ich kann, in den leeren oder leer werdenden Himmel.
Wenn das große Tor geschlossen war und niemand von welcher Seite auch immer darauf zusteuerte, schaute ich regelmäßig in den leeren oder leer werdenden Himmel, es sei denn, es entfernte sich soeben eine junge Angestellte, die mit ganz geradem Rücken auf ihrem Fahrrad saß, dann schaute ich zunächst der jungen Angestellten hinterher und erst anschließend in den leeren oder leer werdenden Himmel. Meine freie Zeit, vorausgesetzt, ich hielt mich nicht am Tennisplatz auf, um meine Talente weiterzubringen, nutzte ich hinter dem Löschteich, zu dem vom Tennisplatz aus ein Weg führte. Dort gab es eine kaputte Schubkarre ohne Rad, in die ich mich legte, um von dort ebenfalls in den leeren oder leer werdenden Himmel zu schauen. Hatte ich auf diese Weise die Zuversicht gewonnen, auf ein Gelingen meiner Absichten zu hoffen (Ausdruck Arbeiter Stoffan), dachte ich über die Eidechsen nach, die im Dorf sehr verbreitet waren, sogar in den Häusern. Mit den Eidechsen beschäftigte ich mich deshalb, weil ich glaubte, mit ihrer Hilfe irgendwann (was ist irgendwann), wenn ich ein Mann mit starken Armen geworden war, eine Frau glücklich machen zu können: die schöne junge Angestellte und Bürokraft des Direktors, die eines Tages nicht zum großen Tor gekommen und dann für immer ausgeblieben war.
Was dann?
Dann habe ich auf sie gewartet, eine ganze Zeitlang und noch darüber hinaus. Das ist das ganze Dann.
Der Chauffeur des Untersuchungsbeamten parkte den Wagen in einer stickigen Tiefgarage. Der Akkordeonspieler und ich stiegen krumm von der Stoßstange und schüttelten rasch unsere Glieder aus, ehe wir dem Untersuchungsbeamten und dem Direktor in einen Lift und zurück auf die Straße folgten. Wir blieben dicht hinter den beiden, wie Schatten, und während der Akkordeonspieler lose Tonfolgen produzierte, hörte ich aufmerksam auf das Gespräch, das der Direktor und der Untersuchungsbeamte im Gehen führten. Anfangs brachte diese Unterhaltung wenig, was ich nicht schon gewußt hatte oder mir selber hätte denken können, auch keine neuen Ausdrücke. Doch nachdem die beiden neben einem totgefahrenen Mann stehengeblieben waren, wechselten sie das Thema und kamen auf die Opfer des Unglücks zu sprechen. Der Untersuchungsbeamte drehte den toten Mann mit einem Fußtritt auf den Rücken. Die Augen des Toten starrten in den Dunst über der Straße, erstaunt, als glaubten sie nicht, was passiert war.
»Wir haben einundsechzig Tote«, sagte der Untersuchungsbeamte. Der Direktor sprach es mit veränderter Stimme nach: »Einundsechzig.« »Die auf Ihre Kappe gehen«, fügte der Untersuchungsbeamte hinzu. »Man muß es nicht notgedrungen so sehen«, erwiderte der Direktor in einem sehr nüchternen Ton, der den Untersuchungsbeamten verstummen ließ.
Die Männer betrachteten den Toten und wußten nicht, wie sie verbleiben sollten. Es entstand eine Pause, die der Direktor mit einem neuerlichen Themenwechsel beendete.
»Kommen Sie, gehen wir in die Bar, mir ist flau im Magen, ich brauche einen Schluck.«
Doch auch diesen Vorschlag schlug der Untersuchungsbeamte aus. Er nahm Haltung an, drückte dem Direktor den Karton mit den Untersuchungsakten in die Hand und sagte mit großer Entschiedenheit: »Den Weg in die Zentrale spare ich mir, den Weg zum Hafen sowieso. Es spricht nichts dagegen, daß Sie, ein Mann, der technische Studien betrieben hat, diese Lauferei allein erledigen. Liefern Sie die Akten ab, besteigen Sie Ihr Schiff und Adieu.« Mit diesen Worten sprang der Untersuchungsbeamte über den Toten hinweg auf die andere Straßenseite. Der Direktor rief noch: »Wie können Sie mich alleine lassen? Wer garantiert Ihnen, daß ich dorthin gehe, wohin ich nicht will, sondern lediglich muß?« Aber das Taxi, in das sich der Untersuchungsbeamte geschwungen hatte, war bereits weitergefahren, um den Anschluß an die Kolonne der Autos nicht zu verlieren. »Wie können Sie mich alleine lassen?« wiederholte der Direktor. Er schloß die Augen. Es schüttelte ihn etwas, ich sage, eine unbestimmte Angst. Ich hörte den Puls des Direktors. Ich glaube, der Puls applaudierte der Sinnlosigkeit der gestellten Fragen. Denn von Fragen, die ein Untersuchungsbeamter nicht in Betracht zieht, darf sich der Kopf eines Direktors nicht irritieren lassen.
Trotzdem schien der Direktor irritiert.
Ich beschreibe deshalb den Hund, dem der Direktor, sowie er seinen inneren Halt zurückgewonnen hatte, in den Hintern trat. Ein überaus häßlicher Hund von zweifelhafter Rasse, sehr häßlich, du meine Güte, mager und jung. Sein Fell war ganz gelb, hatte aber keine nackten Stellen oder Schwären, seine Häßlichkeit war allgemeiner Natur. Der Hund zerrte am rechten Schuh des am Straßenrand liegenden Toten. Er biß in den Schnürsenkel und in die Ferse des Schuhs, dessen Leder Schimmel ansetzte, so feucht war die Hitze. Der Direktor schwitzte, und die Schweißperlen blieben ihm in einer kleistrigen Konsistenz auf Stirn und Oberlippe stehen. Er blickte um sich. Der Akkordeonspieler spielte. Ich hielt den Passanten meine Kappe hin, rannte hinter den Passanten her, turnte zwischen Beinen. Alles erfolglos. Als ich, neben einer Frau herlaufend, wieder in die Nähe des Direktors kam, der im Zug der Passanten ein Hindernis war, faßte mich der Direktor mit unerwartetem Geschick am T-Shirt und zog mich zu sich heran, daß mir der Stoff des T-Shirts in die Achsel schnitt und die Nähte knackten. Ich dachte, der Direktor wolle mich ohrfeigen oder treten. Aber nein. Er überreichte mir den Karton mit den Untersuchungsakten und wischte sich die verschwitzten Hände an den Seiten der Hose ab. Unmittelbar darauf gab er den Bemühungen des gelben Hundes die notwendige Richtung, indem er den schon erwähnten Fußtritt gegen dessen Hintern ausführte. Der Hund überschlug sich beinahe und sprang in großen Sätzen davon. Im Laufen beutelte er den ergatterten Schuh, bis die Einlegesohle herausfiel, was dem Hund etwas Materie zum Denken gab.
Um ein Haar hätte der Direktor seine Tasche vergessen, eine blaue Sporttasche mit Hand- und Schulterträgern, Außenfächern breitseits und längsseits. Ich machte den Direktor auf die vergessene Tasche aufmerksam. »Danke.« Der Direktor hängte sie sich über die Schulter und ging an der Bar vorbei, die er zuvor noch hatte betreten wollen. Ich folgte ihm, mir folgte der Akkordeonspieler. Der Direktor drehte sich wiederholt nach mir um, vermutlich mehr nach dem Karton als nach mir. Einmal fiel er fast hin, so eilig hatte er es, taktgenau in die aufgebrachte Akkordeonmusik zu stolpern. Aber wenig später wechselte die Musik in ein anderes Tempo, und der Direktor blieb stehen, oder umgekehrt, wir waren bei der Zentrale angelangt.
Der Direktor setzte sich auf den Karton, den ich ihm mit Erreichen der Zentrale zurückgegeben hatte, und solange er dort saß, lief ich mit meiner Kappe vor dem Gebäude auf und ab. Aber die Leute in dieser Stadt besaßen entweder keine Münzen oder kein Verständnis für Musik, was mir beides unbegreiflich war. Ich freute mich entsprechend, daß sich wenigstens der Direktor seiner Liebe zur Musik erinnerte. Nach einer Weile sprang er von seinem Karton auf und leerte mit beiden Händen seine äußeren Jackentaschen in meine Kappe. »Verdammte Diebe!« sagte er in ich weiß nicht welchem Ärger, stemmte den Karton mit den Unterlagen in die rechte Hüfte und drang durch den Klimavorhang des Portals in die Eingangshalle der Zentrale, in ein Halblicht, das ich angesichts der erbarmungslos einförmigen Grelle der Straße für wohltuend hielt.