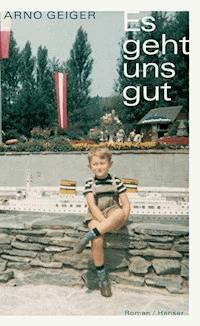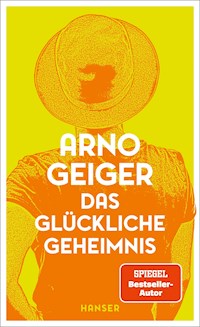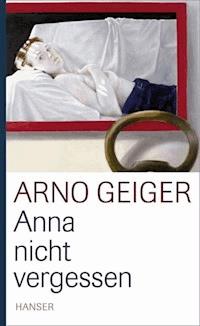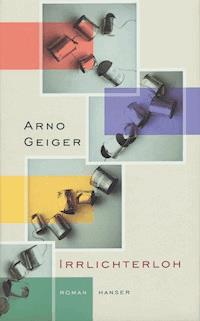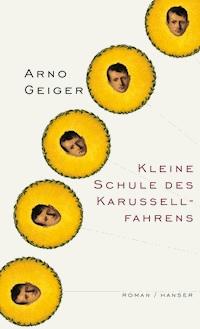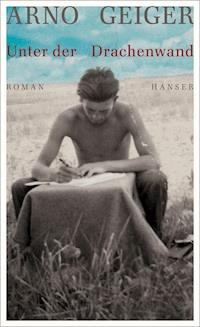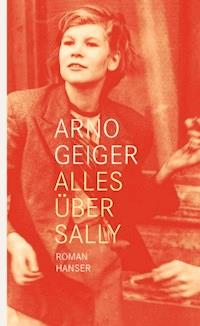Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was bleibt, wenn man nicht mehr ist, was man ein Leben lang war? Der neue große Roman von Arno Geiger über das, worauf es im Leben wirklich ankommt: die Freundschaft, die Liebe und das Loslassen
„In jedem Menschen steckt ein zurückgetretener König.“ Karl hat sich in ein abgelegenes Kloster in Spanien zurückgezogen. Er ist krank und wartet auf sein Ende. Doch dann begegnet er dem elfjährigen Geronimo, und gemeinsam beschließen sie, davonzureiten, nachts, auf Pferd und Maulesel. Sie geraten in wilde Abenteuer, finden Weggefährten auf dem Weg nach Laredo. Karl lernt kennen, was er trotz Macht, Ruhm und Reichtum bisher nicht hatte: Freundschaft, Liebe, Unbeschwertheit und die Freiheit, die es bedeutet, nur im Moment zu leben. "Reise nach Laredo" ist ein fantastischer, magischer Roman über das Loslassen, über das, worauf es im Leben ankommt – und vor allem eine mitreißende Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Was bleibt, wenn man nicht mehr ist, was man ein Leben lang war? Der neue große Roman von Arno Geiger über das, worauf es im Leben wirklich ankommt: die Freundschaft, die Liebe und das Loslassen. Nominiert für den österreichischen Buchpreis 2024.»In jedem Menschen steckt ein zurückgetretener König.« Karl hat sich in ein abgelegenes Kloster in Spanien zurückgezogen. Er ist krank und wartet auf sein Ende. Doch dann begegnet er dem elfjährigen Geronimo, und gemeinsam beschließen sie, davonzureiten, nachts, auf Pferd und Maulesel. Sie geraten in wilde Abenteuer, finden Weggefährten auf dem Weg nach Laredo. Karl lernt kennen, was er trotz Macht, Ruhm und Reichtum bisher nicht hatte: Freundschaft, Liebe, Unbeschwertheit und die Freiheit, die es bedeutet, nur im Moment zu leben. »Reise nach Laredo« ist ein fantastischer, magischer Roman über das Loslassen, über das, worauf es im Leben ankommt — und vor allem eine mitreißende Geschichte.
Arno Geiger
Reise nach Laredo
Roman
Hanser
I know I’ve done wrong.
The Streets of Laredo
So gegen zehn Uhr am Vormittag in dem Hof, in dem sich die Sonnenuhr befindet, soll der Privatmann Karl mittels einer Hebevorrichtung in einen Zuber mit heißem Wasser gehoben werden. Sein Leibarzt, Henri Mathys, der glaubt sich auszukennen mit dem, was ratsam ist, murmelt verärgert:
»Das kann nicht gutgehen, das ist Selbstmord.«
So ein Bad ist ein Bett, ein Leintuch, ein Leichentuch, eine Leiter. Karl denkt: Der Tod könnte schön sein, wenn man gelebt hat.
Eine Zeitlang starrt er zu Boden, als versuche er wieder und wieder mit dumpfer Verwunderung zu begreifen, dass seine Beine ihn nicht tragen, wie sie ihn früher getragen haben. Dicht neben ihm, bereit zum Auffangen, steht wachsam der Sekretär, Willem Van Male, er weiß, dass man im Alter nicht fallen darf. Er wartet auf Karls nächsten Schritt, alle, die sich im Garten des Klosters eingefunden haben, warten auf den nächsten Schritt. Sie wissen, dass sich das Leben ändert.
Es ist ein schöner Tag für den Anfang. Der Wahnsinn des Sommers klingt ab. Im gleißenden Licht umschwirrt eine Fliege Karls Gesicht, er hat keine freie Hand, weil er an den Oberarmen festgehalten wird. Heftig bläst er durch die Nase, worauf ein Tropfen in seinen Bart fällt. Dann steht er wieder für einige Momente unbeweglich und versucht, die Fliege nicht zu beachten, er ist gut darin, Dinge nicht zu beachten. Die Fliege verschwindet als schwarzer Punkt im Gegenlicht.
Gebückt und steifbeinig wie ein Kavallerist nach mehreren Tagen im Sattel setzt Karl einen Fuß vor den anderen. Er ist jetzt bei der Hebevorrichtung, die sein Uhrmacher Juanelo Turriano entworfen hat, um das Unvermögen von Karls Beinen auszugleichen: eine lange Stange, die mittig in einer zweieinhalb Meter hohen, in den Boden eingelassenen Gabel aufliegt. Unter dem hinteren Ende der Stange stehen drei Knechte, die himbeerfarbene Mütze eines der Knechte verleiht der Szene etwas Absonderliches. Karl hätte im Traum nicht an so eine Mütze gedacht. Seltsam, dass immer etwas ganz anders ist als erwartet. Warum eigentlich? Wozu? Wer kann das beantworten?
Die Hände der Knechte sind klobig wie in der Bauernsage, sie greifen in Riemen, die zu der Stange hinaufführen. Am vorderen Ende hängt ein lederner, nach Art einer Schaukel gefertigter Sitz, in den Karl sich sinken lässt, nachdem sein Leibdiener ihm die blutigen Binden von den Beinen und den schwarzen Umhang von den Schultern genommen hat. Karl klammert sich mit beiden Händen an die nach oben laufenden Seile, er versucht das Zittern der knotigen Finger zu unterdrücken, die Adern in den Händen schwellen an, die Gelenke sind von der Gicht zerfressen.
Alles an diesem Mann ist merkwürdig, auch seine Nacktheit, als habe er es längst verlernt, sich unter den Augen der anderen befangen zu fühlen. Er weiß, dass alle ihn anstarren und sich Gedanken machen über seinen verbrauchten Körper, das stört ihn nicht, es ist ihm lebenslange Gewohnheit, keinen schönen Anblick zu bieten.
Während er langsam in die Luft gehoben wird, denkt er, die Menschen verstehen nichts von Nacktheit, deshalb muss man den Körper verhüllen. Aber wenn man alles verhüllen wollte, wovon die Menschen nichts verstehen, was bliebe dann von der Welt? Karl weiß, dass die Entblößung das Unvollkommene am Menschen zum Vorschein bringen soll, bei ihm ganz besonders, das eigentliche Wahre. Es geschieht dies in dem sicheren Gespür, dass Wahrheit und Schönheit oft nichts miteinander zu tun haben. Schönheit ist selten wahr und Wahrheit selten schön. Leider. Aber das Hässliche gewinnt bisweilen eine gewisse Erhabenheit, wenn es unverhüllt gezeigt wird, sine ornamentum. Karl denkt: Soll mich sehen, wer will.
In der Tat ist das Publikum zahlreich. Das Bad bringt etwas Abwechslung in die endlosen, langweiligen Tage, in den sturen Rhythmus einer ans Klosterleben angelehnten Ordnung. Die lähmende Atmosphäre der vergangenen anderthalb Jahre ist konzentriert in einem Moment von wenig Belang: Alle Blicke sind auf denjenigen gerichtet, der blicklos sitzt. Aber man könnte hier bald jeden beliebigen Augenblick herausnehmen mit demselben Fazit, dass alle Blicke auf denjenigen gerichtet sind, der blicklos sitzt. So vergeht die Zeit.
Das Manöver des Hochhebens vollzieht sich mit unnatürlicher, beinahe schmerzhafter Behutsamkeit. Alles geschieht in äußerster Anspannung, die verhalten vorgebrachten, den Vorgang koordinierenden Kommandos, die Muskelkontraktionen der Knechte. Oberst Luis Quijada, der Majordomus, testet zum wiederholten Mal die Temperatur des Wassers, entweder ist er unschlüssig oder er hält einen plötzlichen Temperaturwechsel für möglich. Langsam schwebt Karl durch die milde Septemberluft, seine geschwollenen Beine, auf denen die Krampfadern ein bläuliches Geflecht aus krakeligen Linien und Knoten bilden, hängen schlaff nach unten, weiß grundiert, haarig, im harten Kontrast zum entzündlichen Rot der von Gicht gekrümmten Zehen. Karls Kopf ist herabgesunken, das Kinn auf der faltigen, hängenden Altmännerbrust. Wäre nicht zwischendurch ein zustimmendes Brummen zu hören, könnte man meinen, der Mann döse vor sich hin.
In der zurückliegenden Nacht hat Karl fast nichts geschlafen. Einmal eingeschlafen, war er in dunkle Traumschächte gefallen, und noch im Fallen hatte er mit den Mächten der Finsternis gerungen. Mühsam sich hinaufkämpfend, war er in den nächsten Traumschacht gestürzt, immer aufs Neue, bis er sich, wach liegend, dem Wahnsinn nahe gefühlt hatte, erschöpft, als habe er die ganze Nacht gegen sich selbst Karten gespielt um den Einsatz, dass der Verlierer sterben muss.
Wie an jedem anderen Tag verrichtete er in der Früh als erstes seine Gebete, und während des Betens war ein so trauriger Mief aus seinem Brusthaar hochgestiegen, ein Geruch nach Alter und Enttäuschung, dass Karl dem Kammerdiener aufgetragen hatte, man solle Vorbereitungen treffen für ein Bad im Garten. Der Kammerdiener, erschrocken über Karls Aussehen, schaltete den Leibarzt ein, Henri Mathys — der hielt einen Vortrag über die Gefahren des Waschens, das Waschen sei ein Vergnügen, das man jederzeit den andern überlassen solle, es sei nichts, was das Dasein verlange. Doch Karl, der seit Wochen nur mit Puder abgerieben worden war, in seiner kuriosen Dickköpfigkeit, er hat nun einmal einen solchen Charakter, er besitzt eine besondere Ader, Dinge anzufangen, von denen man später sagen würde, sie seien schiefgegangen — er ließ es sich nicht ausreden. Lieber wolle er, was an ihm sterblich sei, waschen, als diesen Geruch den ganzen Tag hinter sich herzuziehen wie eine Fahne. Und natürlich, es war etwas dran, es stieg ein starker Geruch von Karls Haut auf, ein Geruch, bei dem man meinen konnte, da schwitze einer die Alpträume aus, die er in der Nacht geträumt hat.
Mathys verwies auf das Wechselfieber, das vor einigen Tagen zurückgekommen war. Das Fieber meldete sich ab und zu, es kam und ging wie eine Mutter, die Branntwein trinkt, wie ein halbzahmer, manchmal zum Haus schleichender Fuchs. Aber so lange das Fieber nicht schlimmer wurde, wollte Karl es nach Möglichkeit nicht beachten, es war sinnlos, mit Mathys darüber zu debattieren, er fühlte sich nicht fiebrig, nur matt.
Oberst Quijada senkt den rechten Arm zum Zeichen, dass man Karl in den Zuber herablassen solle, und Karl sieht im Ärmelloch von Quijadas Jacke das leuchtend gelbe Innenfutter. Absinkend senkt auch er wieder den Kopf, immer tiefer, seine Zehen nähern sich der Wasseroberfläche. Dampf legt sich an den schlaffen Körper. Die Aufregung legt sich ebenfalls. Karl vernimmt Tuscheln, er verspürt ein kurzes Verlangen, den Kopf in Richtung des Tuschelns zu wenden, kann sich aber nicht aufraffen.
Es sind die abseits wartenden Frauen, die das heiße Wasser bereitet haben, sie stehen mit roten Händen und beobachten den Vorgang. Ihre Körper stecken in groben Kleidern, knöchellang, aber kurz genug, um das Arbeiten nicht zu behindern. Die Frauen sind jung, auch ziemlich hübsch, haben kräftige, immer in Bewegung befindliche Arme, es sei denn, ein Arm hält den andern fest. Jetzt, in diesem Moment, reden sie mit ausholenden Gesten, damit die rot angelaufenen Hände schneller abkühlen. Karl nimmt die Frauen beiläufig wahr, sein Kopf ist noch immer ganz wirr. Was die Frauen über ihn reden? Es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn natürlich schon, es sind die Dinge, die einem niemand ins Gesicht sagt, die interessant zu wissen wären. Doch im Moment fehlt sogar die Kraft, Neugier zu empfinden. Es wundert ihn selbst, aber die Spannkraft seiner Imagination, die ihm nachts so zusetzt, ist tagsüber ganz lahm.
Die Frauen versuchen, nicht ständig hinzusehen, doch das Schauspiel dieses selten gesehenen Körpers zieht die Blicke an, man könnte sich keinen traurigeren Anblick denken, und es wird hier ja sonst nichts geboten. Die Frauen tun sich selber leid, dass sie in einem solchen Nest festsitzen, die nächste Stadt, Stadt ist zu viel gesagt, Jarandilla, dort ist auch nichts los. — Karl hat siebenundvierzig ihm dienstbare Menschen in die Einsamkeit von Yuste geführt, um sich selbst zu befreien, und statt frei zu sein, ist er mürrisch wie ein seit Jahren angebundener Bär. Die Siebenundvierzig, allesamt nicht von hier, sind abgeschnitten von dem, was ihnen wichtig ist. Sie versuchen, dem alten Mann das Gefühl zu geben, er sei der Mittelpunkt von allem, doch in Wahrheit warten sie auf seinen Tod. Eine der Frauen sagt:
»Schon traurig, wie er dahergehumpelt kommt, es macht ganz ausgesprochen den Eindruck, dass er am Ende ist.«
Sie senkt den Blick, es ist nicht erbaulich, auf den Tod eines Menschen zu warten, gegen den man im Grunde nichts hat. Die andere, ein Stück größer, mit vielen dunklen Haaren, die mit Hilfe eines roten Tuchs kronenartig aufgetürmt sind, hat Heimweh, sie lässt sich zu der Prognose hinreißen, Karl werde mindestens noch fünf Jahre leben.
»Wie soll man denn da noch Lust haben?«
Sie presst die Kiefer zusammen, unter den Ohren drücken die Knochen nach außen, ihr gerötetes Gesicht bekommt einen resignierten Zug. Die Aussicht auf fünf weitere Jahre in Yuste verursacht ihnen allen Beklemmungen.
Karl hat zehnmal mehr gelebt als andere und zehnmal weniger. Sein Körper sieht aus wie der eines Greises. Jemand, der so aussieht, ist fast so alt wie die Welt. Das erstaunlichste aber ist Karls Gesicht. Hässlich von jeher, haben Alter und Krankheit es auf eine Art verwüstet, die Respekt einflößt. Wenn Karl die besagten weiteren fünf Jahre lebt, wird sein Gesicht am Ende noch, was es nie gewesen ist, nämlich schön.
Man schreibt das Jahr 1558, Karl ist nicht so alt wie die Welt, aber so alt wie das Jahrhundert, ziemlich genau. Von den sechzig Jahren, die eins vielleicht zu leben hat, hat Karl achtundfünfzig heruntergebogen, kaum zu glauben, was für ein alter Sack er geworden ist.
Seine Füße tauchen bis zu den Knöcheln ins heiße Wasser, und sofort beginnen die Füße sich zu bewegen. All das viele Wasser, das in der Früh noch im Bach geflossen und kalt gewesen ist und sich seither in etwas Heißes verwandelt hat —. Oberst Quijada versenkt ein letztes Mal seine rechte Hand darin, um sicherzugehen. In jeder denkbaren Form ist Wasser eine Bedrohung. Nach hinten, wo die Frauen stehen, macht Quijada eine Schweigen gemahnende Geste. Er fragt Karl, ob die Temperatur angenehm ist, die Worte erreichen Karl als Geräusch, wie ihn das Rauschen der Blätter erreicht. Er sucht im Gesagten nicht nach Strukturen, die aus Lautfolgen Wörter machen und aus Wörtern Sätze. Es reicht zu wissen, dass neben den Bäumen und dem Wind auch Oberst Quijada existiert, der im Übrigen ein anständiger Kerl ist.
»Sie sollen bedankt sein«, sagt Karl, er sagt das oft, es ist an niemand Bestimmten gerichtet. Er schließt die Augen und hört unwirklich das Blätterrauschen. Und während das heiße Wasser seine Beine und dann seine Wirbelsäule hochsteigt und der im Wasser befindliche Teil des Körpers sich dehnt, denkt er daran, warum er nach Yuste gekommen ist.
Er hat seine Kronen abgelegt in der Absicht, sich vor Gott in höchst eigener Person zu verantworten. Voraussetzung war, dass er herausfinden musste, wer diese höchst eigene Person ist ohne die abgelegten Kronen. Er hatte angenommen, dass ihm das rasch gelingen werde. Doch seit zwei Jahren kann er sich keine befriedigende Antwort geben, es fällt ihm nicht viel dazu ein. Er erkennt nur, dass er nichts Wichtiges über sich weiß und dass wenig Zeit bleibt, dahinterzukommen. Manchmal meint er, das Königtum habe ihn verbraucht und besitze weiterhin alle Macht, und er selbst ist abgereist nach Yuste als leerer Knochen. Selbstbetrachtung, Gewissensprüfung, innerer Frieden — Wörter ohne Beziehung zu seinem Befinden, das mit Teilnahmslosigkeit besser beschrieben ist. Er versteht sich nicht, er begreift sich nicht, er, dem auf Erden ungeheure Macht gegeben war wie keinem seit Dschingis Khan, ist den ganzen Tag mürrisch auf hilflose Art. Juan Regla, sein Beichtvater, sagt, in jedem Menschen stecke ein zurückgetretener König, in jeder Wäscherin stecke eine zurückgetretene Königin, deshalb seien die Menschen so mürrisch.
Verwirrt schüttelt Karl den Kopf. Er sitzt auf dem im Zuber angebrachten Brett, der Wind fährt durch sein dünnes Haar, das Blond ist stumpf geworden, durchzogen von Grau. Aber das Wasser ist für sein Empfinden bestimmt nicht zu warm, Quijada hat nochmals gefragt. Hat Karl geantwortet? Schon möglich. Warum auch nicht? Und nun? Er ist gerne im warmen Wasser, es hat eine besänftigende Wirkung, es lindert den Schmerz.
Ohne die Hand vorzuhalten, gähnt Karl, sein Mund steht sowieso immer offen, und jeder schaut hinein, auch so eine Nacktheit, von der niemand etwas versteht. Die Möglichkeit zur Diskretion hat nie bestanden, seine Kinnlade, die ein Schließen des Mundes nur unter Mühe zulässt, ist wie vom Hufschmied mit dem schweren Hammer vorgetrieben in einem ansonsten gleichmäßigen Gesicht. Trotzdem ist die Kinnlade Teil des Ganzen, wie jemand selbstverständlich zur Familie gehört, obwohl alle andern ihn nicht mögen.
In dem aufsteigenden Wasserdampf träumt Karl vor sich hin. Müdigkeit und Erschöpfung weben um seine Gedanken ein dünnes Gespinst aus Unschärfe und Seltsamkeit. Als er erneut die hellen Stimmen der Frauen hört, denkt er: Zurückgetretene Königinnen, ja, damit hängt es zusammen, deshalb sind die Menschen so mürrisch.
Ihm fällt ein, dass im Frühjahr seine Schwestern zu Besuch waren. Eleonore und Maria. Maria, auf die er sich immer hatte verlassen können, wie überhaupt auf die Frauen in der Familie immer Verlass ist, man kann nicht genug Schwestern und Töchter haben. Maria fragte ihn, warum er gleich so gereizt reagiere. Wenn es ihn störe, dass sie von etwas keine Kenntnis besitze, solle er ihr die Angelegenheit erläutern. Dann schaute sie ihn eindringlich an.
Für einige Sekunden erscheint ein Mönch in einem Fensterbogen der zweiten Etage des hinter dem Garten aufragenden Klosters, der Mönch steht dort mit vor dem Bauch gefalteten Händen und schaut auf die Szenerie herab. Dann schlägt er ein Kreuz und geht weiter. Karl kann sich die Namen der Mönche nicht merken.
Dort hinten wachsen in großen Töpfen Pflanzen, deren Samen die Schiffe aus Neuspanien gebracht haben, die Blüten groß, empfindlich, übelriechend. Auf dem oberen Rand eines der Töpfe sitzt ein magerer Hühnervogel, langbeinig, der Körper schwarz gefiedert, der Hals weiß, kleiner roter Kopf. Mit dem rechten Bein reibt der Vogel sein linkes Bein und glotzt Karl an. Als Karl ein Stück Seife nach dem Vogel wirft, ohne zu treffen, stellt der Vogel den weißen Federkragen auf. Für einen kurzen Moment erinnert der Vogel mit seiner weißen Halskrause an einen flämischen Ratsherrn. Karl spricht den in Brügge geborenen Mathys auf den Vogel an. Aber entweder Mathys versteht ihn nicht, weil Karl das Gesagte vernuschelt hat, oder er ist weiterhin beleidigt.
In Karls Haushaltung gehört Mathys zur Majorität derer, die Tagebuch führen und Berichte verfassen. Alles, was Karl tut und sagt, wird festgehalten für die Mit- und Nachwelt, ein Recht auf Vergessen existiert nicht. Sogar wenn er schläft, steht er unter Beobachtung. Vielleicht sitzt da einer und macht sich Notizen, wenn Karl im Traum redet, alles wird vermerkt. Etwas zu sagen, das nicht sofort die Runde macht und kommentiert wird: das wäre Freiheit.
Weil er Mathys versöhnlich stimmen will, sagt Karl etwas, von dem er glaubt, dass Mathys es in einem seiner Berichte wird verwenden können:
»Das Linksliegenlassen der Welt ist eine anspruchsvolle Sache.«
Doch Mathys zuckt abermals die Achseln.
Nachdem der Leibdiener ihm eine neue Seife gereicht hat, versucht Karl weiter daran zu denken, dass die meisten Schreibkundigen in seinem Haushalt Buch führen über denjenigen, der nicht weiß, wer er ist. Ihm kommt ein kleines Gespräch in den Sinn, das er mit Willem Van Male hatte, dem Sekretär. Karl lehnt sich zurück und blickt in den Himmel. Wie seit anderthalb Jahren beinahe jeden Tag kreisen auch an diesem Vormittag Geier über dem Berg, wahrhaftige Geier, ungeheuer große, elegante, beeindruckende Tiere mit schönem Gefieder und hässlichen, viel zu kleinen Köpfen. Karl hatte Willem Van Male gefragt, warum die Köpfe der Geier so klein sind. Und nach einigem Nachdenken hatte Van Male geantwortet:
»Zum Fressen von Aas braucht es keinen Verstand.«
»Man soll es sich in Erinnerung rufen, wenn ich tot bin«, hatte Karl angemerkt.
Verschiedentlich hat er bei den Leuten hier durchblicken lassen, dass er nicht die Absicht hat, noch viel älter zu werden, ihm ist klar, sie glauben ihm nicht, sie glauben, er hat vielleicht die Möglichkeit zu sterben, wird sich im letzten Moment aber anders besinnen und noch eine Weile damit fortfahren, sich langsam zugrunde zu richten. Dabei ist ihm alles lieber als diese Gleichförmigkeit der Tage, die träge dahintrotten — wie Wanderer, die sich innerlich schon aufgegeben haben, obwohl sie noch Fuß vor Fuß setzen, jeden Tag ein Stück weniger gesund, in beharrlich wachsender Abgestumpftheit.
Der ehemalige Kaiser und König lässt seinen Leib tiefer in den Zuber gleiten, bis der Kopf unter Wasser ist. Geräusche dringen gedämpft von außen her, Stimmen, etwas stößt gegen den Zuber, ein Pochen, das sich gleichmäßig im Wasser verteilt, bis es so verdünnt ist, dass Karl es nicht mehr hört. Er kommt wieder hoch, das Wasser läuft ihm in die Augen, er bekreuzigt sich. Er sieht die Frauen vor der Brunnenstube, die seit Monaten den eingespielten Trott gehen, etwas widerwillig, er nimmt es ihnen nicht übel, an ihrer Stelle würde er auch so empfinden. Wenn in der weiteren Umgebung nicht manchmal ein kleines Verbrechen oder ein Ehedrama die Gemüter aufschrecken würde, kämen alle um vor Langeweile. Es betrübt ihn, dass er in den Plänen so vieler ein Hindernis darstellt. Diese Menschen haben ihre eigenen häuslichen Angelegenheiten, und Karl weiß nichts davon, ein Ergebnis der Zurückhaltung, mit der die Leute antworten, wenn Karl das Wort an sie richtet. Seine eigene Schüchternheit schüchtert die Leute ein, sie glauben, er fragt nur aus kalkulierter Höflichkeit oder aus höflichem Kalkül. Aber er weiß, dass die Reisekisten als Kommoden in gemieteten Zimmern stehen, die Kisten lassen sich nicht mehr öffnen, denn das hiesige Klima hat das Holz aufquellen lassen, wie es schlechte Launen, schlechte Gewohnheiten und Gesichter hat aufquellen lassen. Gedunsene Gesichter blicken in aufgequollene Reisekisten. Für diejenigen, die aus Granada kommen, ist Yuste wie ein nasser Fetzen. Manchmal hört Karl durchs offene Fenster die Frauen singen. Wenn er im Garten in seinem ebenfalls vom Uhrmacher entworfenen Spezialstuhl ruht, hört er die Köchin singen, er hört die Wäscherinnen singen. Gegenstand der Lieder ist die Abwesenheit von etwas, Gott weiß, wovon sie alle träumen, Liebe, Glück, Jugend, Zuhause, es geht um große Entfernungen, die unüberwindbar sind. Wenn die Gicht es zulässt, spielt Karl die einfachen Melodien auf seinem Klavichord. Er fährt sich mit dem Stück Seife, das seine rechte Hand umklammert, in die linke Achselhöhle. Zunächst leise, dann gut vernehmbar, beginnt er zu singen, eines dieser Lieder, so vor sich hin. Alle halten inne, alle lauschen. Die Männer blicken zu Boden. Die Frauen heben die Köpfe. Der Himmel ist leer. Der König lebt noch.
Später sitzt Karl in dem Spezialsessel auf der Terrasse neben dem Klosterteich, wo die Sonne seit dem frühen Morgen das Gras wärmt. Karl ist vollständig in Schwarz gekleidet, damit sein Empfinden einen äußeren Ausdruck hat. Auf dem Bauch, unter den Händen, liegt das schwarze Barett. Er fühlt sich jetzt besser als in der Früh, es hat damit zu tun, dass ein Mensch, wenn er gebadet ist, für einige Zeit von sich eine bessere Meinung hat. Auch die Zukunft ist nicht mehr so klein und dumm. In dieser Verfassung hält Karl es sogar für möglich, dass seine Gedanken ihre frühere Genauigkeit wiedererlangen. Wie eine Eidechse liegt er in der Wärme und sammelt die noch fehlende Kraft, er sagt sich: Bis es so weit ist, werde ich nichts denken, es bringt nichts, ich fange immer an zu schwitzen, wenn ich mir Halbgedanken mache. Halbgedanken sind schlimmer als nichts, man kennt sich dann noch weniger aus als ohne Gedanken.
Der Uhrmacher Juanelo Turriano hat polierte Fassdauben unter die Füße des Sessels montiert. Die linke Daube quietscht rhythmisch, als Karl in dem Sessel zu schaukeln beginnt. Er starrt nach oben, Spinnfäden fliegen in der Luft, der Himmel ist leicht bewölkt, der stockende, zögerliche Wind weht etwas frischer. Kein Laut von den Fröschen im Teich, vielleicht sind sie ebenfalls stumpfsinnig geworden. Der Teich stinkt nach Wechselfieber, Alpträumen, allmählichem Tod. Yuste ist das Ende der Welt.
Von dem Schaukeln ist Karl, als wanke die Erde, kippe nach vorne und zurück, was er in seinem Innern auszugleichen versucht. Er bemüht sich nach Kräften. Aber je mehr er schaukelt, desto stärker hat er das Gefühl, alles bewege sich auf unnatürliche Weise, langsam und schwankend, der Berg mitsamt dem Kloster, an einem schwülen, langweiligen Tag. Sein ganzes Leben schwankt. Sogar das ferne Lachen der Frauen, die hinten im Hof den von ihm beschmutzten Zuber reinigen, das schwach hörbare Geräusch der Bürsten — alles erreicht ihn in pulsierenden Wellen. Dann der einmalige Aufschrei eines Hasen, der hügelab geschlagen wird, vielleicht von einem Fuchs. Die nächsten Sekunden zählen für den Hasen unvergleichlich mehr als für Karl, er hört kein weiteres Geräusch:
»Das war’s«, stellt er fest.
Nachher liegt er wieder bewegungslos, nur die Schmerzen bewegen sich, sie gehen von den Zehen in die Knie und von den Knien ins Kreuz und zurück in die Knie. Er fragt sich, ob er die Schmerzen verwünschen soll oder sich ihnen überlassen. Das liegt natürlich weit auseinander.
Die mit einem Läutwerk versehene Uhr in Karls Arbeitszimmer schlägt dreimal, man hört es durch die offenstehenden Fenster. Henri Mathys, der Leibarzt, kommt aus seinem Versteck, jedenfalls ist er ganz plötzlich da.
»Scheren Sie sich zum Teufel, ich möchte allein sein.«
»Sie wollen nicht allein sein, Sie sind verzweifelt.«
»Ja, verzweifelt.«
»Also darf ich bleiben?«
»Eine Minute.«
Bekleidet mit einer leuchtend roten Jacke und darüber einem bodenlangen schwarzen Mantel mit Marderkragen, der die Blässe des Gesichts zusätzlich betont, stellt Mathys die friedfertige Miene eines Menschen zur Schau, der die Sinnlosigkeit seiner Bemühungen einsieht. Man erreicht nichts bei jemandem, der sich aufgegeben hat. Während sie reden, fühlt Mathys Karls Puls. Er sagt:
»Es geht Ihnen jetzt besser?«
»Ja, hoffentlich! Ich bin bis oben voll mit Laudanum.«
»Es ist damit nicht zu spielen, gesund ist das nicht.«
»Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden Möglichkeiten, ganz gesund oder eine zusätzliche Krankheit, ich würde mich, ohne zu zögern, für die zusätzliche Krankheit entscheiden. Die ganz Gesunden leben auch nicht länger, weil Dummheit auf Dauer tötet.«
»Ich bitte Sie, seien Sie vernünftig, ich lege es Ihnen nahe, es geht Ihnen jeden Tag ein bisschen schlechter.«
Karl schaut seinem Arzt herausfordernd in die Augen, er scheint mitteilen zu wollen, dass er nichts gibt auf eine Gesundheit, die er nicht einmal als Kind besessen hat. Und der Rest der Welt kann sich ohnehin nichts Besseres wünschen, als dass er bald vollständig abtritt. Warum es in die Länge ziehen?
Die zugestandene Minute ist vorbei. In der kurzen Zeitspanne ist das Gesicht des Arztes grau und leer geworden. Das Reden macht Mühe, wenn man um seine Wirkungslosigkeit weiß. Mathys denkt: Lohnt es sich, gegen eine Wand zu reden, damit man später behaupten kann, man habe nicht resigniert? Und wie sich das wohl anfühlt? Einerseits die Verkörperung eines Reichs und seiner ganzen Geschichte, andererseits auch nichts anderes als jeder und jede, ein leicht zu beschädigender, durch und durch beschädigter Mensch?
Seit zwei Jahren versucht Mathys, Karl zu überreden, er solle Diät halten. Zunächst war Mathys auf den allerbesten Willen gestoßen, ohne das Geringste zu erreichen, und mittlerweile fehlt auch der gute Wille mit den vorstellbaren Folgen. Es ist wohl tatsächlich, wie Karl in den vergangenen Monaten mehrfach von sich gegeben hat, eine tägliche Erniedrigung vor sich selbst, wenn man sich jeden Morgen dasselbe vornimmt, ohne es zu verwirklichen. Karl sagt: Vorsätze, zu oft nicht verwirklicht, hören auf, Vorsätze zu sein, und verwandeln sich in Lügen. Karl lügt nicht gern. Er sagt: Gute Vorsätze, die man nicht einlöst, sind schlimmer als schlechte Gewohnheiten. Obendrein hat Karl Angst, den Verstand zu verlieren, wenn er nach den vielen Abschieden, die er geleistet hat, auch seine Tafelfreuden aufgibt. Eine berechtigte Angst, selbst in Mathys Augen. Denn der zurückgetretene König benötigt etwas, das ihm das Gefühl gibt, er sei weiterhin er selbst. Deshalb frisst und trinkt er. Mathys weiß es. Karl weiß es nicht. Bisweilen fragt Karl nach den möglichen Gründen für seine Zügellosigkeit, und Mathys gibt falsche Antwort.
Nur der Teufel stirbt vom Fasten, sagt das Sprichwort. Mathys denkt: Der Teufel und ein Mensch, der kein Gefühl hat für sich selbst.
Wenn Karl einschläft, schaut er so unglaublich alt aus — und er schläft ziemlich oft ein. Immer ist er aus irgendeinem Grund müde oder fiebrig und atmet auch unregelmäßig, was Mathys nicht gefällt. Solange Karl eingenickt ist, verweilt Mathys ohne Anspannung, in Erwartung von nichts. Alles ist vorhersehbar, nur nicht die Häufigkeit der Wiederholungen, die das Vorhersehbare zu durchlaufen hat bis zu Karls Tod. Eine Frage der Zeit mit nur dem einen Haken, dass die Frage nach der Zeit die wesentliche Frage ist und vorerst nicht zu beantworten.
Es reißt Karl die Lider auf, er weiß nicht, dass er einige Minuten geschlafen hat. Er hebt den Kopf mit einem Blick, als interessiere es ihn, wo er sich befindet. Er betrachtet etwas im Rücken von Mathys, etwas Austauschbares. Mathys weiß, dass man dem alten Mann Zeit lassen muss. Am Himmel fliegen Flamingos. Wenn Karl dem Flug der Flamingos zusieht, entspannt er sich. Er vergisst Mathys, der ihn langweilt. Dort hinten auf einem Baum würgt eine Krähe, sich tief nach vorne beugend, ihren eigenen Namen heraus. Karl senkt den Blick, er sieht in seinem Schoß die gichtigen Hände und stellt so die eigene Anwesenheit wieder her. Wer solche Hände hat, der existiert.
»Stehen Sie bequem?«, fragt er.
»Ja«, sagt Mathys.
Das ist gelogen. Mathys lügt oft, im Gegensatz zu Karl. Die Unbequemlichkeit, stehen zu müssen, während hier einer liegt und schaukelt in einem quietschenden Stuhl, den ein Uhrmacher konstruiert hat, dann auch die Unbequemlichkeit, ein Gespräch führen zu müssen, mit einem, der gar kein Interesse hat an einem Gespräch, all diese Unbequemlichkeiten, sinnlos, sie alle aufzuzählen.
Von den Flamingos auf die Flamen kommend, fragt Karl ohne Interesse:
»Was hört man aus Flandern?«
»Die Windmühlen drehen sich.«
Als Karl sich die Windmühlen bildlich vor Augen ruft, wird ihm abermals schwindlig, er hätte Lust zu lächeln, doch Mathys schaut ihn verdrossen an, ein Ausdruck, der einem das letzte Körnchen Lebensfreude vergällt. Da überkommt Karl ein schlechtes Gewissen, er weiß, dass er selbst oft unwirsch ist, ein zurückgetretener König. Und wie aus weiter Ferne hört er sich sagen:
»Mathys, wenn es so weit ist, ich bitte Sie, lassen Sie mich nicht allein.«
»Natürlich nicht.«
»Versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht im Stich lassen?«
»Ich verspreche es, Mynheer.«
»Bestimmt?«
»Sicher.«
»Manchmal sage ich Dinge, die nicht gut sind.«
»Nie.«
»Das behaupten Sie nur, weil es Ihnen unangenehm ist. Aber in Ihr Tagebuch schreiben Sie, dass ich manchmal böse bin.«
»Jeder hat solche Momente, es ist daran nichts Besonderes.«
»Es tut mir leid. Bitte lassen Sie mich nicht im Stich.«
»Niemals, das wissen Sie.«
»Danke.«
Auch derlei Gespräche gab es schon oft. Karl lässt sich tief in seine Kissen sinken, ein Seufzen unterstreicht den müden Ausdruck seines Gesichts. Und Mathys geht plötzlich auf, dass dieser Mann, zu dem einst die ganze Welt mit Liebe oder Wut aufgeblickt hat, am Ende seiner Erdentage dasteht mit nichts. Zwischen lauter Einsamkeiten. Und niemand, der ihn aus seiner Verlassenheit befreien kann.
Jetzt befindet sich Karl schon wieder kurz vor dem Einschlafen, die Fähigkeit, verständlich zu sprechen, kommt ihm abhanden, er murmelt:
»Ich weiß, ich kränke Sie oft.«
Bei Karl bemächtigt sich die Müdigkeit zuerst der Zunge, wohingegen bei den meisten Menschen zuerst das Denken betroffen ist, das denkt Mathys, während Karl anfängt, Grimassen zu schneiden, um sich des Schlafs zu erwehren. Karl nuschelt:
»Ich möchte allein sein. Bitte, lassen Sie sich nicht aufhalten.«
Mathys’ Gesicht hellt sich auf, die Erleichterung ist ihm anzusehen. Karl spürt ein Gefühl der Kränkung, er sagt sich, man kann es mir nicht recht machen.
Nachdem Mathys sich seines Huts vergewissert hat, lächelt er gezwungen und sieht zu, dass er wegkommt. Er geht zu seinem Pferd, bindet es los und schwingt sich mit wehenden Mantelschößen in den Sattel. Eine Zeitlang hört Karl die Hufschläge beim Hinuntersteigen auf dem mit groben Steinen gepflasterten Weg. Und wieder empfindet er die vertrauten Symptome, die ihm manchmal Angst machen und manchmal Freude, die Sehnsucht nach Normalität, nach Gefühlen, die er vielleicht nie hatte: Unbeschwertheit, Leichtigkeit, Gelassenheit.
Es reißt ihm den Kopf wieder hoch. Ein Stück Schatten ist auf seine Beine gewandert, die unter einer großen Decke aus Katzenfell liegen, gegen die Gicht. Seine Beine sind ihm fremd. Da sitzt er im Spezialstuhl, schaukelt unter monotonem Quietschen, sieht trübe auf die Seerosen im Teich, die so zart sind, dass Karl Sorge hat, die Blütenblätter könnten Druckstellen bekommen vom Hinsehen. Er sitzt in der diesigen Sonne, ein milder Septembertag, zu seiner Linken der ordentliche, mit der Schnur gezogene Obstgarten, eine dreifache Litanei. Dann die Klostermauer vor gereckten Eichen und Zypressen. Zur Rechten der Vorgarten und das nach eigenen Plänen gebaute Haus, ein vorgeschobener Posten. Vorgeschoben bezogen auf was? Dahinter die Klosterkirche von Yuste.
Yuste. Er ist seit anderthalb Jahren in Yuste und wartet auf eine Veränderung. Seit anderthalb Jahren ist er in dem verdammten Yuste und wird hierbleiben, bis er tot ist. Also hoffentlich nicht mehr lange. Der Ort verursacht ihm Unbehagen, aber er wüsste nicht, wo er lieber wäre. Manchmal geht er in Gedanken andere Orte durch, ohne viel dabei zu empfinden. Er sieht die Orte, aber er sieht nicht sich selbst an diesen Orten. Sich am falschen Ort zu fühlen, ohne dass man weiß, wo man lieber wäre, Mathys hat recht, das ist Verzweiflung.
Gott beschütze uns vor dem, was wir uns wünschen. Karl wollte sich von allen Ämtern zurückziehen und endlich die Person sein, die er nie sein durfte. Aber die Person ist nicht mitgekommen. Wo sie geblieben ist, auf den Schlachtfeldern, in den Geschichtsbüchern, am andern Ufer der Geschichte? Er weiß es nicht. Juan Regla, sein Beichtvater, sagt, Karl sei König gewesen, bevor er eine Persönlichkeit habe sein können. Jetzt ist Karl kein König und keine Persönlichkeit mehr. Und obwohl Fray Regla ihm widerspricht — die Vorstellung, ohne die Kronen nichts mehr zu sein, hat etwas Lähmendes, ein Äquivalent zur Gicht, die ihm das Gehen beinahe unmöglich macht. Der Rücktritt hat nicht die erhoffte Befreiung gebracht.
Wie kaum je atmete Karl auf, als er in Yuste eintraf. Alle freuten sich, ihn einmal richtig aufatmen zu hören. Doch auf die Erregung des Rücktritts folgte die Beklemmung des Stillstands, eine merkwürdige, düstere Empfindung der Entfremdung, das Gefühl, dass nach Beendigung der Laufbahn nicht die Persönlichkeit hervorgetreten ist, sondern die Leere.
Es heißt, der Mensch ist das, was ihm bleibt, nachdem er alles verloren hat. So verhält sich die Sache, es ist ein wenig peinlich.
Jetzt liegt Karl in seinem Stuhl, den Blick hinunter in die Vera gerichtet, eine Aussicht, die ihm nichts bedeutet. Dort unten gibt es gelbliches Grün, eine sich selbst langweilende Straße und einige Höfe, von denen er meint, er könne sie mit den Stiefelspitzen herumschieben. Fernab steigt über den schwarzen Waldzacken weißer Rauch von einem Kohlenmeiler auf. Und je länger Karl in die Ebene hinuntersieht, desto sinnloser wird alles, desto weiter rücken die Dinge in der Landschaft auseinander. Die Welt wird im Hinsehen groß und quälend, er hat das Gefühl, die Sonne werde in seinem Leben eines Tages tatsächlich nicht mehr untergehen.
Weil ihm schwer zumute ist, betet er ein wenig außerhalb der Reihe. Er hat feste Betzeiten, aber manchmal betet er außerhalb der Reihe. Er betet, schaukelt, schläft ein, wacht wieder auf. Wenn du keinen Namen hättest / keine Geschichte / keine Lebenserinnerung / keine Familie / einfach nur du selbst / nackt im Gras? / Wer wärst du dann?
Ob auch Seerosen im Fieber träumen? Die Sonne wird glasig, der Wind bekommt eine dicke Zunge. Es riecht faulig nach Erinnerungen. Karl ist des Nachdenkens leid. Zu viele Halbgedanken.
Er sucht in dem Sessel nach einer behaglichen Lage, er weiß, sein Körper hat keine Seite mehr, auf der er schmerzfrei liegen kann, alle Seiten sind verkehrt, er weiß schon lange nicht mehr, wie er sich entscheiden soll, das erfolglose Drehen und Wenden. Er hört das Rufen eines Namens, gleich darauf die gewissenhafte, besänftigende Antwort einer Kinderstimme. Zerstreut oder um der Zerstreuung willen wendet Karl den Kopf, er folgt der Kinderstimme mit den Augen und sieht auf der steinernen Mauer, die das Kloster gegen die Außenwelt abgrenzt, einen blonden Jungen, der zu ihm herüberspäht. Auch Karl richtet einen vorsichtig spähenden Blick auf den Jungen, auf seinen illegitimen Sohn, der um seine Abkunft nicht weiß.
Obwohl der Junge beim Majordomus aufwächst, Oberst Quijada, hat Karl nichts mit ihm zu tun. Er kennt ihn vom Sehen, Geronimo — damit das Kind einen Namen hat. Aber später, wenn Karl tot ist, wird der Junge einen anderen Namen bekommen, so hat Karl es in seinem Testament verfügt.
Durch das Okular seines Fiebers mustert Karl sein jüngstes Kind, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Alle äußern sich mit Sympathie über den Jungen, nur der Gärtner nicht, weil Gärtner ein grundsätzliches Unbehagen empfinden beim Anblick von Elfjährigen, die so unauffällig durch die Gärten schleichen, dass man ihrer kaum gewahr wird. Und tatsächlich hat der Junge dort, wo er sitzt, nichts verloren, auf der Krone der Klostermauer. Es bleibt unklar, wie lange Geronimo seine Beine dort schon baumeln lässt.
Mit der rechten Hand macht Karl ein Zeichen. Den Körper stark verdrehend, blickt der Junge hinter sich, ein wenig verwirrt, wie um sich zu vergewissern, ob das Zeichen einem der dort stehenden Bäume gilt. Dort sieht er achselzuckende Zypressen. Der Blick des Jungen geht zurück zu Karl, der seine Geste in reduzierter Form wiederholt, ein Zucken von Hand und Zeigefinger, kaum wahrnehmbar, doch Geronimo sieht es genau. Was jetzt? In nachmittäglicher Unentschlossenheit ordnet der Junge seine Beine, ordnet seine Gedanken, ehe er sich von der Mauerkrone abstemmt. Was will die Krähe?, denkt das Kind und springt in den Garten, darauf achtend, dass die auf dem Rücken getragene Armbrust nicht anstößt. Geronimo riecht den Mörtelstaub an seinen Händen, als er, sich von der Mauer zum Garten wendend, eine blonde Strähne zur Seite schiebt. Der Mann ist ein bisschen komisch, findet er, er kennt ihn recht gut, weil er ihn manchmal beobachtet, immer missmutig, immer schwarz gekleidet, schwärzer als alle andern. Was besagt diese Schwärze? Schwarze Empfindungen? Schwarze Gedanken? Schwarze Aussichten? Ein alter Mann.
Dem Jungen ist in jeder Bewegung anzusehen, dass er eins ist mit seinem Körper. Langsam kommt er über das struppige Gras. Und während er sich nähert, nimmt Karl sich vor, mit ihm über einfache Dinge zu reden, über normale Dinge, wie viel der Junge im vergangenen Jahr gewachsen ist zum Beispiel. Der Junge sieht erstaunlich unfertig aus, sehr kindlich, wer weiß, es wird sich von heute auf morgen ändern, Karl wird es womöglich nicht mehr erleben. Geronimo beugt vor dem alten Mann das Knie. Karl bedeutet ihm, sich zu erheben. Wie es sich für einen Pagen gehört, schweigt Geronimo, bis Karl das Wort ergreift. Der Atem des Alten geht unnatürlich, als sei hier einer gerannt und habe sich fast erholt. Aber manchmal muss er einen Zwischenschnaufer machen, der dort nicht hingehört.
»Rücken gerade«, sagt Karl, und der Junge streckt gefügig das Kreuz, streckt die Arme und legt sie an die Seiten, er ist derlei gewohnt.
»Erzähl mir etwas von dir.«
»Gibt nichts, Señor.«
»Du wohnst jetzt unten in Cuacos?«
»Ja.«
»Gefällt es dir?«
»Man sieht nur Ochsen.« Die Stimme ist noch kindlich, ohne jedes Anzeichen, dass sie bald brechen will. Und etwas Zweites kommt Karl zu Bewusstsein: Der Junge redet nicht so tief wie die spanischen Kinder. Man hört ihm die fremdländische Herkunft an.
»Hast du Freunde?«, fragt Karl.
»Nein.«
»Gar keine?«
»Nur den Schwindligen.«
»Wer ist der Schwindlige?«
Er macht mit dem Kopf eine unbestimmte Bewegung in eine wenig bestimmte Richtung:
»Dort, wo ich früher war, bei meinen früheren Eltern. Ich habe gehört, er ist im Manzanares ertrunken.«
»Wer?«
»Der Schwindlige. Es war unklug von ihm, in den Manzanares zu springen. Ich bin froh, dass ich nicht an seiner Stelle bin.«
Eigentlich falsch, denkt Karl, dass der Junge sich hier herumtreibt, und man lebt aneinander vorbei. Der Junge gehört unter Leute. Ich müsste mich um ihn bemühen. Niemand in der Familie weiß etwas vom anderen. Was weiß der König von seinem Vater? Was weiß der Vater von seinem Sohn? Traurig. Aber das wird sich jetzt nicht mehr ändern.
»Mir ist auch oft langweilig«, sagt Karl.
»Man kann es sich vorstellen, dass einem das ewige Liegen bald langweilig wird.«
Die kleine Bemerkung muntert Karls Geister auf. Er lacht. Er hat schon lange nicht mehr gelacht, es fühlt sich an wie ein Abenteuer.