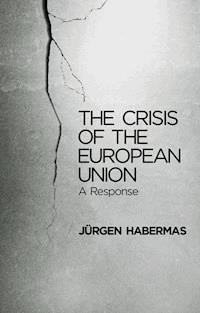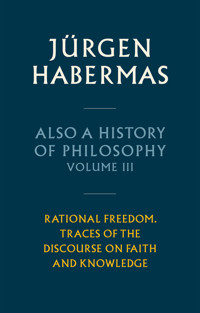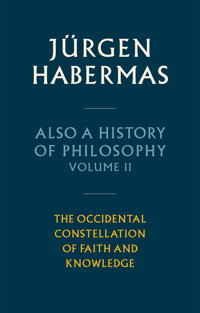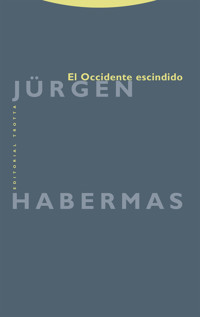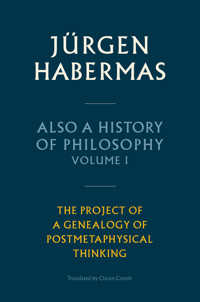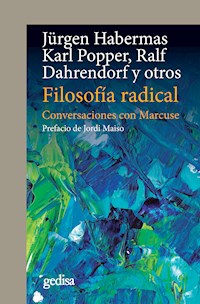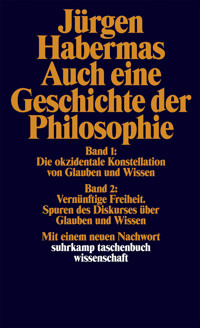23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch gibt Jürgen Habermas Auskunft – über die Motive seines Denkens, die Umstände, unter denen es sich entwickelte, und die Veränderungen, die es im Lauf der Jahrzehnte erfuhr. Er erzählt vom Entstehungsprozess seines Werks, von wegweisenden Lektüren und prägenden kollegialen Begegnungen. So entsteht das Bild eines reichen Beziehungsgeflechts, das sich über große Teile der intellektuellen Landkarte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart erstreckt.
Im Rückblick auf zahlreiche Stationen seines Denkwegs spricht Habermas unter anderem über seine generationsspezifische Ausgangssituation, über Schlüsselerlebnisse mit seinen akademischen Lehrern, über zeitgeschichtliche Tendenzen und politische Überzeugungen sowie die eigenen wissenschaftlichen Arbeiten und deren Rezeption. An sein jüngstes Großwerk Auch eine Geschichte der Philosophie anschließend, werden außerdem zentrale Begriffe und argumentative Strategien aus dem Habermas-Kosmos aufgerufen und kritisch verhandelt. Und immer wieder wird deutlich, worum es diesem Philosophen im Grundsatz geht: um »die Begründung des Quäntchens Vernunftvertrauen und der Pflicht zum Gebrauch unserer Vernunft«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
3Jürgen Habermas
»Es musste etwas besser werden …«
Gespräche mit Stefan Müller-Doohm und Roman Yos
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2024
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-78057-2
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
1 Anfänge einer wissenschaftlichen Biografie
2 Frankfurt, eine neue Welt, und das alte Heidelberg
3 Von der Positivismuskritik zur Kritik funktionalistischer Vernunft
4 Nachmetaphysisches Denken und detranszendentalisierte Vernunft
5 Nachbetrachtungen zu
Auch eine Geschichte der Philosophie
6 Im philosophischen Diskurs mit Freunden und Kollegen
Anmerkungen
1 Anfänge einer wissenschaftlichen Biografie
2 Frankfurt, eine neue Welt, und das alte Heidelberg
3 Von der Positivismuskritik zur Kritik funktionalistischer Vernunft
4 Nachmetaphysisches Denken und detranszendentalisierte Vernunft
5 Nachbetrachtungen zu
Auch eine Geschichte der Philosophie
6 Im philosophischen Diskurs mit Freunden und Kollegen
Editorische Notiz
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
185
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
249
7
1
Anfänge einer wissenschaftlichen Biografie
9Herr Habermas, Sie haben einmal gesagt, man müsse im Leben etwas tun, worein man seine Grundintentionen legen kann. Was sind Ihre Grundintentionen und inwiefern waren sie leitend für Ihre Theorieentwicklung und Ihren beruflichen Werdegang? Konkret gefragt: Was hat Sie bewogen, sich 1949 in Göttingen für ein Studium der Philosophie einzuschreiben?
Meine Generation konnte 1949 auf das Ende des Zweiten Weltkrieges als eine historisch umwälzende Zäsur zurückblicken. Bei Studienbeginn hatten wir vier Jahre lang Zeit gehabt, um uns im Rückblick die Tiefe dieses Einschnittes der NS-Herrschaft bewusstzumachen und uns über das klar zu werden, was hinter der Alltagsnormalität gesteckt hatte, in der wir damals aufgewachsen waren und gelebt hatten. Das fiel uns leichter als vielen der Älteren. Denn ohne eigenes Verdienst waren wir in unserem Alter empfindlich genug, um die Abgründigkeit der scheinhaften Normalität zu spüren, die hinter uns lag. Wir hatten ja keine eigenen Handlungen, keine Unterlassungen zu verantworten – Erinnerungen an Situationen schuldhafter Verstrickung, die sich gegen jene Einsicht hätten sperren können. Das hat Helmut Kohl mit der 10»Gnade der späten Geburt« getroffen. Schon die nur wenig Älteren hatten andere Erfahrungen zu verarbeiten. In dieser Hinsicht habe ich, nebenbei bemerkt, die Jahrgangsdifferenzen zwischen den am Historikerstreit beteiligten Parteien immer für aufschlussreich gehalten. Inmitten eines durch und durch fragwürdig gewordenen nationalen Milieus haben sich dem Orientierungs- und Aufklärungsbedürfnis, dem Wissenwollen der jüngeren Jahrgänge keine psychologischen Hindernisse in den Weg gelegt. Es war eine intuitive Einsicht, die den kritischen Teil unserer Jahrgänge von der zementierten Mentalität rings um uns herum getrennt hat: Die Nazis waren kein Fremdkörper im Gewebe einer »im Kern gesunden« Kultur gewesen – kein Spuk, der glücklicherweise nun vorbei war. Vielmehr hatten sie sich aus jenem dunkelsten Erbe unserer Kultur bedienen können, das selbst große Geister der Nation wie Thomas Mann zu Beginn des Ersten Weltkrieges gegen den »Geist von 1789« mobilisiert hatten. Nur das konnte die Ansteckungskraft der Nazis bis in die Luftschutzkeller hinein erklären. In den Zeitschriften und der Literatur der frühen Nachkriegsjahre bis zur Währungsreform gab es ja noch Impulse, sich über den Zivilisationsbruch, der damals noch nicht so genannt wurde, Rechenschaft abzulegen. Deshalb hat sich mir damals ein Philosophiestudium gewissermaßen von selbst aufgedrängt. Dazu gehörten dann freilich auch ein Familienhintergrund, der das fördern konnte, und ein Vater, der das gerne bezahlen wollte.
Die Wahl des Studienfaches sollte man aber nicht zu hoch hängen, auch wenn man bei der Entscheidung für 11das Philosophiestudium keinen bestimmten Beruf, und damals ganz sicher nicht den des Professors, vor Augen haben konnte, sondern nur die Befriedigung eines Interesses. 1949 studierten fünf Prozent eines Jahrgangs, heute sind es fünfzig. Das Studium ließ einem mehr Freiheiten als heute. Man studierte nicht einfach ein Fach, sondern eher Gegenstände und Themen, über die man im Rahmen der philosophischen Fakultät Näheres erfahren konnte. Und im Laufe eines solchen gewissermaßen selbst zusammengestellten Studiums suchte man sich dann – ohne je eine Zwischenprüfung abgelegt zu haben – die beiden für die Doktorprüfung erforderlichen Nebenfächer aus. Zum Studium der Philosophie war ich schon vor dem Abitur entschlossen.
Wie ist es zu diesem Entschluss gekommen? Uns interessiert, was Sie uns über Ihre damalige Lebenssituation und im Besonderen Ihren Weg zur Philosophie mitteilen können. Gab es da besonders prägende Erlebnisse? Denn als Jugendlicher wollten Sie Mediziner werden, oder?
Der ursprüngliche Wunsch, Arzt zu werden, überhaupt die intensivere Beschäftigung mit der Anatomie des Menschen und der Entschluss des zwölf Jahre alten Jungen zur Ausbildung als »Feldscher« im sogenannten Jungvolk, alles das hing doch wohl eher mit der pubertären Beunruhigung durch die Problematik meiner Gaumenspalte zusammen, deren ich mir plötzlich bewusst geworden war. Bis dahin hatte ich mit meinem Freund Jupp Dörr eine eher geschützte Kindheit und Jugend – trotz einiger bedrü12ckender Erlebnisse auf dem Schulhof – mehr oder weniger naiv ausgelebt. Jene medizinischen Interessen haben sich allerdings nach dem Ende des Krieges ins Theoretische verschoben, auch unter dem Einfluss des Biologieunterrichts. Der Lehrer, der damals mein Interesse geweckt hat, war nach dem Krieg von einer Napola (!) zu unserer Schule zurückgekehrt – er musste also ein Nazi gewesen sein. Aber er führte uns kenntnisreich und durchaus schon mit einem wissenschaftlichen, von offensichtlichen Konnotationen der »Rassenbiologie« inzwischen gereinigten Anspruch in die Genetik und in die Darwin'sche Evolutionstheorie ein. Mein Interesse hat sich dann freilich über die Biologie hinaus ins Anthropologische ausgeweitet. Mir fiel beispielsweise, das war nach der Währungsreform, ein Buch von Schultz-Hencke1 in die Hände, eine Art Lehrbuch der unter den Nazis angepassten Psychoanalyse; und während der letzten zwei Jahre auf dem Gymnasium durfte ich die Psyche abonnieren. Es waren also diese im weiteren Sinne anthropologischen Interessen, die sich in den Jahren vor dem Abitur mit der Lektüre von Kants und Herders Geschichtsphilosophie verbunden haben. Hinzu kam die – übrigens auch durch das Buch eines alten Nazis wie Otto Friedrich Bollnow vermittelte – Existenzphilosophie Sartres, der vor allem mit seinen Theaterstücken unsere ganze Generation in Atem gehalten hat, dann natürlich die marxistische Literatur aus der Kommunistischen Buchhandlung auf der Bahnhofstraße in Gummersbach und – gewissermaßen als Gegengift – der in Kreisen meines Vaters beliebte Ordoliberalismus von Walter Eucken und Wilhelm Röpke.
13Das alles habe ich in ungaren privaten »Aufsätzen« verarbeitet, mit denen ich unseren persönlich eindrucksvollen und von mir verehrten Lateinlehrer Klingholz, einen der wenigen Nichtnazis unter unseren Gummersbacher Lehrern, traktiert habe und dem ich damit gehörig auf die Nerven gegangen bin. Mein Onkel Peter Wingender, ein Studienrat, der auch Philosophie unterrichtete, sorgte mit Kants Prolegomena und anderen »seriösen« Lektüreempfehlungen dafür, dass sich der Wust an Aufregendem nicht im nur Interessanten verlepperte. Wenn man in einer solchen, intellektuell auf einen einstürmenden Welt lebte, bedurfte es, um Philosophie studieren zu wollen, keiner bewussten Entscheidung mehr, keiner »Grundintention«. Natürlich war mir das Riskante einer Existenz, die man mit einem solchen Fach wählte, bewusst. Dieses Gefühl materieller Unsicherheit hat mich lange begleitet. Ich bin mir auch, als ich dann wider Erwarten doch Professor werden konnte, meiner Fähigkeiten und Leistungen, ja meines Berufs keineswegs sicher gewesen. Erst während meiner letzten Frankfurter Zeit in den achtziger und neunziger Jahren stellte sich bei mir allmählich das Gefühl ein, meinen Beruf als Hochschullehrer und Wissenschaftler einigermaßen zu beherrschen.
Aber gab es denn nicht so etwas wie ein »innerliches« Motiv für Ihre Studienwahl? Ein Bedürfnis etwa, mit eigenen Wertorientierungen ins Reine zu kommen?
Das entspricht eher einem platonischen Selbstverständnis von Philosophie, das ich nie geteilt habe. Deshalb ha14be ich mich selbst auch immer im Verdacht gehabt, kein »richtiger« Philosoph zu sein, keiner, wenn Sie mir das Klischee gestatten, der von der Kontemplation der je eigenen Lebenssituation ausgeht und nach tiefen, metaphysisch gültigen Einsichten strebt. Ich habe meine Motive eher im Marxismus und im Pragmatismus wiedererkannt. Ich halte das Streben, die Welt um ein Winziges besser zu machen oder auch nur dazu beizutragen, die stets drohenden Regressionen aufzuhalten, für ein ganz unverächtliches Motiv. Daher bin ich mit der Bezeichnung »Philosoph und Soziologe« ganz zufrieden.
Nur »Philosoph« wäre Ihnen suspekt?
Das war lange nur ein Gefühl. Nachdem ich aus dem engeren Kreis meiner Kollegen fast als Einziger übrig geblieben bin, denke ich manchmal darüber nach. Gewiss, niemand sonst hat sich so unverhohlen, wenn auch keineswegs unvermittelt an einen der großen Metaphysiker, eben Thomas, angeschlossen wie Robert Spaemann, der mich in seiner Fähigkeit, aus dem close reading klassischer Texte Funken zu schlagen, an Leo Strauss erinnert. Aber auch in meinem engeren Umkreis sind die verschiedenen theoretischen Entwürfe bei aller Nüchternheit von Motiven geleitet, die mehr oder weniger in der Tradition der »großen Philosophie« verwurzelt sind. Wenn Sie mir grobe Vereinfachungen gestatten: Bei Karl-Otto Apel verrät schon die Leidenschaft für die Letztbegründung der Moral, dass er davon überzeugt war, wir sollten es mit dem nachmetaphysischen Denken nicht zu weit treiben – 15das war ja auch der Kern unseres Dissenses gewesen. Bei Dieter Henrich liegt das metaphysische Ursprungsmotiv auf der Hand: Die Vergewisserung des vorreflexiven Mit-sich-Vertrautseins öffnet unser Bewusstsein für den tragenden Ursprung aus dem Allumfassenden. Michael Theunissen hat zeitlebens mit religiösen Motiven gerungen, zunächst im Anschluss an Kierkegaard, dann auf Wegen seiner intersubjektivistischen, junghegelianisch inspirierten Hegel-Interpretation und zuletzt mit seinem Versuch einer Rückkehr zum späten Heidegger, die ich allerdings als weniger produktiv empfunden habe. Und selbst der philosophisch Klarste und Nüchternste von uns allen, Ernst Tugendhat, hat schon seine Sprachphilosophie als Übersetzung von Aristoteles verstanden. Und erst recht verrät sich ein metaphysischer Anspruch von Tugendhats Ethikentwürfen in seiner späten Wendung zur Mystik: Allein das Versinken in der überwältigenden Anschauung des Kosmos soll den Egozentrismus des auf seinen Interessen beharrenden Subjekts brechen können; anders glaubte er Kants universalistische Begriffe von Gerechtigkeit und vernünftiger Freiheit nicht retten zu können. Bei mir wird man ähnlich »tiefe« Motive nicht finden. Mich bewegt das Problem, wie ein fragiles und bisher immer wieder zerreißendes soziales Zusammenleben gelingen kann. Ob der eigene Tod ein philosophisches Motiv ist? Auch die Naturabhängigkeit des Menschen denke ich eher anthropozentrisch: mit Bezug auf den evolutionären Sprung zum völlig neuen Modus der sprachlichen Vergesellschaftung. Mein »letztes« Motiv ist, wenn Sie wollen, die befreiende Kraft des Wortes, die sich nur in den rezi16prok-egalitären Anerkennungsverhältnissen einer vollständig individuierenden Vergesellschaftung ganz entfalten könnte. Nähe und Ferne, Ja und Nein, Emanzipation und Regression, Zustimmung und Widerspruch, Selbstsein und Abhängigkeit sind kommunikative Erfahrungen von Individuen, die nur auf dem Wege der Sozialisation sie selbst werden und die sich nur in der Balance zwischen jenen Polen aufrechthalten können, wenn sie sich in sozial halbwegs integrierten Verhältnissen vorfinden. Diese Intuition, aus der ich meine Philosophie und Gesellschaftstheorie entwickle, gewinne ich, historisch betrachtet, aus der Anknüpfung an Philosophen, die nach Kant, Fichte, Schelling und Hegel nicht zögern, eine religiöse Intuition restlos ins Säkulare zu überführen. Mit dieser Intention einer gelingenden, einer nicht verfehlten Individuierung durch Vergesellschaftung denke ich eher aus biblischen als aus griechischen Motiven.
Das hört sich schon nach einer grundlegenden Intuition an.
Da wir schon dabei sind, lassen Sie mich noch etwas Nüchternes hinzufügen. Die Intuition einer gelingenden oder nichtverfehlten Form der sozialen Integration hat mich zu einer Theorie des kommunikativen Handelns inspiriert und erklärt mein Interesse an der linguistischen Wende. Mir war nicht von Anfang an klar, dass nur der von Humboldt bis Wittgenstein entwickelte Gedanke der sprachlichen Konstitution der menschlichen Existenzweise, das heißt der Lebensform von »Homo sapiens«, 17der linguistischen Wende den Sinn eines Paradigmenwechsels verleiht. Demgegenüber hatte diese für führende Analytiker wie Carnap, Quine oder Davidson bloß einen methodischen Sinn. Zudem erhält das Paradigma auch erst durch die von den Pragmatisten George Herbert Mead und William James ins Spiel gebrachte Gleichursprünglichkeit und reziproke Ermöglichung von Individuierung und Vergesellschaftung das dialektische Moment, das dem dynamischen Spannungsgeflecht der Beziehungen zwischen erster, zweiter und dritter Person innewohnt. Die Ich-Du-Beziehung stellt sich im Rahmen einer Wir-Beziehung von Ja- und Nein-sagenden Handlungssubjekten her, die sich – im Bewusstsein des gemeinsamen Hintergrundes ihrer Sprache und des damit eröffneten Raums der Gründe – objektivierend auf etwas in der Welt beziehen, um sich darüber zu verständigen. Ich nenne diese Beziehung in einem intuitiv einleuchtenden – also noch nicht wie bei Hegelkrisenhaften – Sinne »dialektisch«, weil sich die Heranwachsenden erst in dem Maße als »Ich« erfahren und Selbstbewusstsein ausbilden, wie sie unter den Blicken einer zweiten Person, auf die sie sich jeweils als ein »Du« beziehen, lernen, diese Blicke zu übernehmen und selbst auf sich zu richten. Aber nicht nur das Selbstbewusstsein ist durch die Beziehung zum Anderen vermittelt. Die Verständigung über kommunikatives Handeln und Diskurs zielt über die gegenseitige Kritik von Geltungsansprüchen auf Einverständnis und ist insofern selbst ein buchstäblich dialektischer Prozess. Gleichzeitig nötigt dieser die kommunikativ handelnden Subjekte zu Ja- oder Nein-Stellungnahmen, die sie individuell ver18antworten. Und in lebensgeschichtlich relevanten Zusammenhängen stärkt diese Verantwortung nicht nur das Bewusstsein von individueller Selbstständigkeit und Unvertretbarkeit, sondern prägt auch die Züge individueller Unverwechselbarkeit.
Zurück zur Biografie und Ihrer sozusagen »ersten« Universität: warum Göttingen?
Nach dem Abitur ergab sich der Studienort einfach daraus, dass damals Martin Heidegger und Nicolai Hartmann als die beiden führenden Philosophen galten, bei denen »man« studieren musste. Ich wusste beispielsweise nicht einmal, dass es in Frankfurt eine Universität gab. Gegen Freiburg sprach, dass mich dort die nach dem Krieg noch obligatorischen Aufräumarbeiten – nach dem durch den Krieg »verlorenen« Schuljahr – weitere Monate, vielleicht ein ganzes Semester »gekostet« hätten, während ich in Göttingen nur ein »Aufnahmegespräch« bei Hartmann zu absolvieren hatte. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich diesem wenig interessierten Prüfer nur etwas über meine Rilke-Lektüre erzählen müssen. Mein erstes Semester fiel übrigens zeitlich zusammen mit dem Wahlkampf zum 1. Deutschen Bundestag; und trotz meiner zunächst eher moralischen als politischen Reaktionen auf die Verbrechen der Nazizeit, in der wir schließlich aufgewachsen waren, hatte ich mich während der letzten Schuljahre nach Kriegsende bis zum Abitur doch wohl so weit politisiert, dass ich kaum eine der Göttinger Wahlveranstaltungen ausgelassen habe. Ich erinnere mich lebhaft an 19die radikale Enttäuschung eines jungen Mannes, der bis dahin seine Vorstellungen von Demokratie vorwiegend aus Büchern erworben hatte. Die erste frontale Begegnung mit der realen Demokratie war ein Schock. Der wurde nicht etwa durch die Begegnung mit Otto Ernst Remer ausgelöst, jenem Oberst, der am 20. Juli 1944 die Verschwörer in Berlin verhaftet hatte und nun als Vorsitzender der rechtsradikalen Deutschen Reichspartei auftrat. Erschüttert haben mich damals die Protagonisten des BHE, der Deutschen Partei und der CDU, weil sie ebenso rechtsradikal auftraten. Es waren Oberländer, Seebohm und Merkatz, die ich als rechthaberische und beleidigte, gegen die Besatzungsmächte aufbegehrende Parteiredner kennenlernte – und die wenig später alle im ersten Kabinett Adenauer wieder auftauchten! Mit ihrer gewissenlosen Suada ließen sie jedes Gefühl für den notwendigen Bruch mit der Nazizeit vermissen. Ich habe das Gejohle des Saales noch im Ohr, das ausbrach, als ich beim Anstimmen der ersten Strophe des Deutschlandliedes aus dem Saal stürmte. Musste denn nicht jeder denselben Gedanken haben, dass diese Nationalhymne zwölf Jahre lang mit dem Horst-Wessel-Lied, der nationalsozialistischen Parteihymne, zu einer unauflöslichen Einheit verschmolzen worden war? Eine gewisse Hemmung gegen unsere in ihrem historischen Ursprung ja eher unverdächtige Nationalhymne ist in diesem Missbrauch begründet. Ich habe den Widerstand gegen Nationalhymnen überhaupt übrigens bis heute behalten. Noch in der Bundesversammlung von 1994, als Johannes Rau gegen Roman Herzog kandidierte und unterlag, habe ich den 20neben mir sitzenden Peter Glotz, der ja das abschließende Ritual kannte, gebeten, mir den Zeitpunkt zu signalisieren, damit ich rechtzeitig vor der Deutschlandhymne den Saal verlassen konnte. Wenn ich an die Erfahrungen meines ersten Semesters denke, werden die politischen Selbstverständlichkeiten wieder lebendig, mit denen damals das intellektuelle Bedürfnis nach philosophischer Aufklärung gewissermaßen durchtränkt war: Es musste etwas besser werden, und es lag an uns, ob sich die Welt zum Besseren verändern würde.
Welches Bild von der Philosophie der Nachkriegszeit hatten Sie damals? Stimmen Sie Dieter Henrich zu, der von einem eigenen Generationenprofil der Post-45er-Philosophen gesprochen hat, das sich unter anderem in einer spezifischen Sicht auf die Gegenwart geäußert habe?
Henrichs Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Generation teile ich, finde aber die Abgrenzung der Philosophen von anderen Fachkollegen in dieser Hinsicht nicht ganz einfach. Meine Frau und ich haben im freundschaftlichen Umgang mit den Soziologen und Historikern unseres Alters eine ganz ähnliche Mentalität kennengelernt. Ich denke, dass sich unter den wacheren und stärker profilierten Geistern in allen Fächern der philosophischen Fakultät ein gemeinsames Generationsprofil herausgebildet hat. Nach der Korruption der eigenen Traditionen stand alles unter dem Verdacht der Vergiftung, musste alles durch den Filter von Skepsis, Misstrauen und Kritik hindurch. Als Philosophieprofessoren haben wir später gegen die 21feierliche Geste der platonistischen Tradition ein nüchternes, unprätentiöses Verständnis von unserer Berufsrolle durchgesetzt, vor allem ein Bewusstsein von der Fallibilität unserer Aussagen und Theorien. Der Anspruch auf einen privilegierten Zugang zur Wahrheit, wie Heidegger ihn nach wie vor zelebrierte, war einfach lächerlich. In der Philosophie haben sich viele von uns auch bemüht, sich Methode und Geist der analytischen Philosophie anzueignen. Alsbald machte ja sogar der bis dahin verachtete Pragmatismus in Deutschland Karriere. Diese vorbehaltlose Öffnung nach Westen hat auch das Philosophieren in Deutschland gründlich verändert. Und meine Generation, sage ich nicht ganz ohne Stolz, hat dafür die Türen geöffnet.
Aus jeweils verschiedenen Gründen habe ich mich im Kreis der philosophischen Freunde Karl-Otto Apel, der noch im Krieg gewesen war, Ernst Tugendhat, Dieter Henrich und Michael Theunissen am nächsten gefühlt. Jeder von uns hat aus Motiven, die ich schon erwähnt habe, bis zum Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre sein eigenes Projekt entwickelt. Rückblickend nehme ich an, dass wir uns alle mit einer gewissen Neugier gegenseitig beobachtet haben. Blumenberg war ein Einzelgänger. Jacob Taubes lernte ich erst Anfang der sechziger Jahre kennen. Die nicht uninteressanten Münsteraner Kollegen, vor allem Spaemann, Lübbe und Marquard, habe ich damals eher aus der Perspektive ihrer Zugehörigkeit zur Ritter-Schule wahrgenommen. Enger war mein Kontakt mit der »Erlanger Schule« von Paul Lorenzen, vor allem mit den »Konstanzern«, also mit Friedrich 22Kambartel und Jürgen Mittelstraß, später auch mit Peter Janich. Zu dieser Philosophengeneration gehörte natürlich auch Albrecht Wellmer. Mit ihm, meinem ersten »Schüler«, der freilich schon ein Mathematikstudium abgeschlossen hatte, als er zum Philosophiestudium nach Heidelberg kam, hat sich bald ein sehr freundschaftliches Verhältnis hergestellt, das sich – wie in anderen Fällen – auch auf die Familien erstreckte. Albrechts jahrelange Lehre an der New School war übrigens folgenreich. Er hat dort die Schüler inspiriert, die – neben Thomas McCarthy und dessen Schülern – für die Begründung der »Critical Theory« in der USA entscheidend wurden. Dort ist ja die Frankfurter Tradition heute lebendiger als in Deutschland. Für mich bildeten in den USA seit den frühen siebziger Jahren die Freundschaften mit Dick Bernstein, Dick Rorty und vor allem mit Tom McCarthy, mit dem sich ein enger und bis heute anhaltender Arbeitszusammenhang entwickelt hat, den Beginn von zahlreichen anderen Kontakten.
Wenn wir zunächst die Zeit vor »Achtundsechzig« betrachten: Was fällt Ihnen im Umfeld der deutschen Kollegen aus Ihrer Generation besonderes auf?
Rückblickend erkenne ich, was bei uns in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit, neben den fachlichen und persönlichen Qualitäten, über die freundschaftliche Nähe oder über eine gewisse Distanz im Verhältnis zu den Fachkollegen entschieden hat: das Politische an der philosophischen Ausrichtung. Aus meiner Sicht ging ein politi23scher Riss durch unsere Generation, und zwar zwischen denen, die einen mehr oder weniger radikalen Aufbruch, einen neuen Anfang wollten, und denen, die – wie exemplarisch Hermann Lübbe – voll auf den herrschenden Antikommunismus setzten und Leute wie mich eher als Gefahr für eine »gesunde« oder »wehrhafte« Demokratie ansahen. Im Geiste eines reluctant modernism hatte man ja in Münster schnell wieder Kontakte mit Carl Schmitt aufgenommen. Im aufgeheizten Klima des Kalten Krieges, aber vor allem im Zuge der polarisierenden 68er-Bewegung, hinderte das gemeinsame Bekenntnis zum Wortlaut des Grundgesetzes die rechte Seite nicht daran, linke Kollegen als innere Feinde zu beargwöhnen; und wir wiederum waren auch nicht zimperlich in der Wortwahl unserer Repliken. Der öffentlich geführte Streit, der letztlich auf verschiedene Einstellungen zur NS-Vergangenheit zurückging, hat sich freilich erst im Zuge der Studentenbewegung entzündet. Diese auch von der FAZ und ihrem Herausgeber Joachim Fest geschürte Auseinandersetzung2 wurde in der Philosophie wie in vielen anderen geisteswissenschaftlichen Fächern eher unter den Angehörigen meiner Generation als unter unseren Lehrern ausgetragen. Ganz anders verhielt es sich in der Soziologie, wo sich die zurückgekehrten Emigranten und die alten Nazis gegenüberstanden.
Hier verstanden sich nicht nur jene »Jungen Soziologen«, die sich seit der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre mit dem Schwerpunkt Industriesoziologie unter Ludwig von Friedeburgs Regie jedes Jahr in Frankfurt trafen, gegenüber den politisch und wissenschaftspolitisch ausge24prägten Lagern in Münster, Köln und Frankfurt als eine zusammengehörige und kooperationswillige Generation. Diese Entdramatisierung der Gegensätze zwischen den »Schulen« war umso leichter, als dieser Richtungsstreit zwar durch verschiedene politische Lebensschicksale konnotiert, aber von Haus aus keineswegs nur politisch begründet war. In der Profession habe ich im Laufe der Jahre engere Beziehungen zu Heinrich Popitz und Ralf Dahrendorf, Renate Mayntz und Rainer Lepsius, zeitweise auch zu den Plessner-Schülern Christian von Ferber und Christian von Krockow und natürlich zu Niklas Luhmann entwickelt, wobei dieser eher ein Solitär war. Und über meinen Freund Uli Wehler sind Ute und ich – die freundschaftlich-kollegialen Beziehungen bestanden ja meistens auch zwischen den Ehepaaren – auch noch in einen engeren Kreis von Historikern hineingerutscht, die sich wie Hans und Wolfgang Mommsen, Jürgen Kocka oder Heinrich August Winkler mit Themen der politischen oder der sozialen Zeitgeschichte beschäftigten.
Alle unsere gleichaltrigen Kollegen waren, ganz unabhängig von ihrem Fach, durch die Tatsache geprägt, dass sie als Heranwachsende einen historischen Bruch erfahren hatten. Nun wird zwar eine Generation durch eine solche gemeinsame Erfahrung konstituiert, aber gleichzeitig unterscheiden sich die Generationsgenossen voneinander dadurch, wie sie auf diese Erfahrung reagieren. Das ist ein von unseren Zeithistorikern unaufgearbeitetes Thema, wie beispielsweise die Veröffentlichungen zum 100. Geburtstag von Reinhart Koselleck zeigen, was nicht 25heißen soll, dass ich nicht selber aus dessen innovativen Beiträgen zu Historik und Geschichtstheorie etwas gelernt hätte. Der Antrieb zu einem als alternativlos empfundenen neuen Anfang und das kritische Bewusstsein, dass die deutschen Traditionen nicht mehr ungefiltert fortgeführt werden können, waren eben vorwiegend im liberalen und linken Spektrum verbreitet.
Aber was zeichnete die Situation junger Philosophen in der Nachkriegszeit im Unterschied zu späteren Jahrzehnten (auch gegenüber heute) aus?
Sie beharren auf Ihrer Frage nach dem Generationsprofil junger Philosophen in der Nachkriegszeit. Ich glaube gar nicht, dass sich dieses so klar von dem der nächsten Generation, der unserer »Schüler«, wenn Sie so wollen, unterscheiden lässt. Vielleicht waren wir noch durch einen homogeneren Bildungsprozess geprägt. Die Spezialisierung war noch nicht so weit gediehen. Man las noch dieselben Bücher. Aktuell waren für uns dieselben großen Texte, weil wir bei den philosophischen Heroen der zwanziger Jahre gewissermaßen in die Lehre gegangen sind. Phänomenologie, Hermeneutik und die Philosophische Anthropologie waren neben der Tradition des Deutschen Idealismus ein Muss – von Kant und Hegel über Dilthey, Husserl und Heidegger bis zu Scheler, Plessner und Gehlen. Das hat uns noch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit mit dem Geist einer Epoche vertraut gemacht, in der die deutsche Philosophie zum letzten Mal eine Weltphilosophie gewesen ist. Wie schon erwähnt, waren wir 26freilich die erste Generation, die sich von dem entsprechenden Anspruch gelöst hat. Wir haben uns von dem Getragenen des großen idealistischen Anspruchs unserer Lehrer, von der Attitüde des philosophischen Schlüsselhalters verabschiedet. Wir haben nicht nur kleinere Brötchen gebacken, sondern haben auch eher in einem selbstkritischen Bewusstsein gearbeitet und gelehrt. Selbst gegenüber den linken und liberalen Lehrern wie Adorno und Gadamer ist dieser Mentalitätsunterschied der Nachgeborenen deutlich – beim einen weniger, beim anderen krasser. Zudem war uns klar, dass dem genuin deutschen Curriculum etwas fehlte. Wir mussten insbesondere von der angelsächsischen Philosophie eine Menge lernen – den analytischen Stil der Argumentation, den Wert des fallibilistischen Bewusstseins, die Sensibilität für das Gewicht der Empirie, die Öffnung gegenüber den Sozialwissenschaften usw. Schrittmacher für unsere gewissermaßen selbstständig unternommenen Lernprozesse war damals die Rezeption von Carnap und der Wiener Schule einerseits, die des späten Wittgenstein andererseits. Und für einige von uns waren Peirce und der Pragmatismus bahnbrechend. Nicht nur in der Politik und dementsprechend in der politischen Theorie, auch im Herzen der Philosophie gab es eine Öffnung nach Westen.
Nach zwei Semestern in Göttingen und einem in Zürich haben Sie den längsten Teil Ihres Studiums bis zur Promotion in Bonn verbracht. Gab es für Sie rückblickend etwas Besonderes, das Ihr Philosophiestudium dort auszeichnete?
27Eine Lebensgeschichte besteht aus vielen Kontingenzen und wenigen bewusst entschiedenen Weichenstellungen. In Göttingen hatte mich Nicolai Hartmann gelangweilt, vor allem hatte ich dort keine Kontakte gefunden; und gegenüber dem frostigen Norden war mir das rheinische Bonn vertrauter. Attraktiv fand ich, was mir Manfred Hambitzer, ein Gummersbacher Bekannter, der in Bonn zum Freund wurde, von den lebhaften Diskussionen in seiner Bonner Theatergruppe erzählte. Die Wahl des Studienortes war dieses Mal persönlich begründet. Aber Erich Rothacker war immerhin ein bekannter Philosoph, von dessen Schriften ich allerdings nur vage Vorstellungen hatte. Und obwohl auch er ein Nazi der ersten Stunde gewesen war – man erfuhr diese Dinge erst nach und nach –, erwies sich meine eher zufällige Entscheidung als ein Glücksfall: in persönlicher Hinsicht, weil ich dort Ute getroffen habe, die mein Leben seither bestimmt, aber auch in akademischer Hinsicht, weil ich in Rothackers Mittwochsseminar in ein ungewöhnlich anregendes und lehrreiches Diskussionsmilieu geraten bin. Von Rothacker selbst, der gleichzeitig eine Psychologie-Professur innehatte, habe ich keine philosophischen Theorien gelernt. In seinen Vorlesungen wurde ich jedoch in das breite Spektrum der gelehrten deutschen Historischen Schule eingeführt, und in seinen psychologischen Seminaren hörte ich zum ersten Mal von jenen reichen empirischen Forschungen, auf die sich seit den zwanziger Jahren die Diskussion in der philosophischen Anthropologie gestützt hatte. Vor allem aber im philosophischen Seminar war sozusagen der Gedanke selbst in Bewe28gung – auf die dortigen Diskussionen geht unter anderem mein Interesse an der Sprachphilosophie zurück. Die Soziologie hatte ich als Fach damals noch nicht im Blick.
Sie trafen dort auf Ihren langjährigen Weggefährten Karl-Otto Apel, der bei aller sachlichen Differenz in Ihrer beider Theorien von ganz ähnlichen Lektüren und systematischen Problemstellungen beeinflusst war.
Das war zunächst eine ganz asymmetrische Beziehung zu dem schon promovierten Älteren, der den ganzen Krieg als Soldat mitgemacht hatte. Als wir uns dann persönlich näher kennenlernten – ich bekam später als Doktorand ein Zimmer, das neben seinem lag –, war er für mich wie ein Mentor, von dem ich lernte. Vor allem hat er mir eine existentialistisch intonierte kantische Lesart von Sein und Zeit vorgeführt, die mir sehr entgegenkam. Dieses Buch hatte ich natürlich schon in Göttingen gelesen. Apel ist nie ein besonders politischer Mensch gewesen, aber in seiner Person begegnete mir damals der erste, der gewissermaßen vorlebte, wie die Philosophie das Welt- und Selbstverständnis der Gegenwart ausdrücken kann. Die Philosophie sollte im Leben orientieren. Allerdings war Apels Zeitdiagnose noch ziemlich weit weg von jenem provozierenden Tagesgeschehen, über das mich meine kritische Morgenlektüre der FAZ – Studentenabonnement von der Buchhandlung Bouvier – auf dem Laufenden hielt. Erst die Lektüre von Heideggers Einführung in die Metaphysik, das mir Apel an einem Wochenende im Sommer 1953 in die Hände drückte, hat 29dann mit einem Schlag die Wand zwischen dem Philosophiestudium und dem brennenden politischen Tagesgeschehen – Heinemann gegen Adenauer! – eingerissen.3
Können Sie uns einen näheren Einblick in Ihre kollegial-freundschaftliche Beziehung zu Apel geben, die früh entstand, lange währte und vor allem in den 1980er Jahren erneut sehr intensiv geworden zu sein scheint, als Sie beide in Frankfurt mit Ihren jeweiligen Ausarbeitungen der Diskursethik befasst waren?
Um eine in der Tat lange und komplexe Beziehung kurz zu skizzieren, auch um Ihre Vermutung, ob nicht für »Frankfurt« viel zu viel Apel und Kant in mir steckt, zu beantworten, muss man das Bonner Verhältnis zwischen Student und Mentor von den drei folgenden Phasen eines nicht nur im formellen Sinne kollegialen, sondern freundschaftlichen Verhältnisses unterscheiden. Nach meiner Promotion 1954 hatte ich Apel