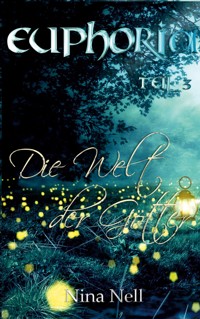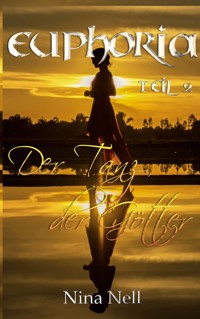
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Euphoria
- Sprache: Deutsch
Lucy ist zum ersten Mal in ihrem Leben glücklich, denn sie lebt endlich das Leben, das sie sich schon immer erträumt hat. Aber bald schon scheint alles wieder aus den Fugen zu geraten, als ihre beste Freundin von einer schicksalhaften Krankheit heimgesucht wird. Daran zweifelnd, dass es Miriam schaffen kann, sich von dieser Krankheit zu befreien, begibt sich Lucy auf eine Reise nach Lumenia, um Hilfe zu suchen. Doch ihre Reise stürzt sie erneut in einen Strudel aus Verschwörung, Kampf und Leid - denn ihre sich stetig entwickelnden Fähigkeiten scheinen sich immer mehr in einen Fluch zu verwandeln, der sie in einen tiefen Abgrund stürzen wird, wenn sie nicht lernt, mit ihrer wachsenden Kraft umzugehen. Doch sie hat glücklicherweise Nikolas an ihrer Seite und ihre Freunde aus Lumenia, die sie und Miriam dabei unterstützen, ihr Leben Stück für Stück zu entwirren und das Leid für immer hinter sich zu lassen. Doch auch sie ahnen nichts von der geheimen Verschwörung, auf die Lucy gestoßen ist. Und in der sie eine größere Rolle spielt, als sie selbst ahnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1 Die Wahrheit
2 Heimliche Beobachter
3 Benommen
4 Erschöpfung
5 Gehilfe
6 Abschied
7 Ahnung
8 Fremde Welt
9 Eine dramatische Entwicklung
10 Miriam
11 Geheimnisse
12 Die Weihnachtsfeier
13 Eine lange Nacht
14 Albträume
15 Leid
16 Hilfe
17 Plan B
18 Ein schwieriger Sprung
19 Paco
20 Erinnerungen
21 Der Sohn des Königs
22 Verschwörung
23 Nichts passiert
24 Evolution
25 Familiendramen
26 Neue Kräfte
27 Verhängnis
28 Spitzel
29 Glaube
30 Ein unbeschwertes Leben?
31 Der Tanz der Götter
Hinweise
Klappentext
Weitere Informationen
Der Kampf gegen die Wirklichkeit ist des Leides bester Freund. Die Akzeptanz sein ärgster Feind. Und doch die Erlösung und sein letztendliches Schicksal.
1
Die Wahrheit
Ü»berall auf der Welt treten seltsame Wetterphänomene auf«, erklang die Stimme der Nachrichtensprecherin aus dem Fernseher. Dabei sah man verwackelte Bilder von Nebelschwaden, die durch einen Ort zogen. Es sah unheimlich aus. »Führende Wissenschaftler erklären die plötzlich auftretenden Unwetter und Nebelschwaden mit dem Klimawandel.«
Lucy lauschte aufmerksam der Nachrichtensprecherin, sah sich die Bilder interessiert an und schnappte nebenbei hier und da ein paar Gedankenfetzen der Gäste auf, die mit ihr im Café saßen. Sie mischten sich in das Geklapper von Geschirr, in das das Mahlgeräusch der Kaffeemaschine und in das leise Gemurmel der Leute, die sich unterhielten. Eine Frau, die ganz hinten im Raum saß, verfluchte innerlich ihren Mann, der offenbar fremdging. Sie starrte in ihre Tasse und biss die Zähne vor Wut so sehr zusammen, dass ihre Kiefermuskeln hervor traten. Lucy bekam die Wucht ihrer Emotionen ungefiltert zu spüren. Ein Mann, der nur zwei Tische weiter saß, fluchte ebenfalls in Gedanken. Er schimpfte jedoch auf die Bedienung, die ihm kalten Kaffee gebracht hatte. Und ein Junge, er war vermutlich erst 16 oder 17, lauschte ebenfalls aufmerksam den Nachrichten. Genauso wie Lucy. Doch er lachte innerlich über die Meldungen, was Lucy ein wenig stutzig machte. Sie löste ihren Blick von dem Fernsehgerät, das neben der Theke an der Wand hing und sah den Jungen an. Er lachte nicht nur in Gedanken, sondern auch in Wirklichkeit. Er amüsierte sich über die Naivität der Menschen, zu glauben, dass diese Unwetter etwas mit dem Klimawandel zu tun hätten. Er wusste es besser. Und er hätte es gern in die Welt hinaus geschrien. Aber niemand hätte ihm geglaubt. Verschwörungstheoretiker!, hätten sie geschrien. Oder ihn gar ausgelacht. Seine Emotionen waren noch überwältigender, als die der betrogenen Frau von dem anderen Tisch. Sie waren kraftvoll, verzweifelt und stürmisch. Und sie fühlten sich ganz anders an, als die Emotionen all der anderen Leute hier. Viel konzentrierter und geordneter.
Lucy sah ihn interessiert an. Irgendetwas war besonders an diesem Jungen. Sie konnte seine Besonderheit jedoch nicht deuten, was ihre Aufmerksamkeit nur umso mehr fesselte. Neugierig betrachtete sie ihn. Er trug ein seltsames, sehr klobiges Lederarmband, das fast die Hälfe seines rechten Unterarmes einnahm. Und bis auf seine hellblaue Jeans und die blauen Streifen an seinen Sneakers, trug er ausschließlich weiße Kleidung. Als sie in sein Gesicht sah, spürte sie seine Emotionen noch deutlicher. Sein Gesichtsausdruck wirkte erschreckend verzweifelt. Und sie spürte diese Gefühle bis ins Mark. In seinem Kopf schimpfe er über die Ahnungslosigkeit der Menschen und er war sich sicher, dass die Dummheit der Menschheit der Untergang der Welt sein würde.
Darauf hätte Lucy am liebsten ein »Amen« ausgerufen. Dieser Meinung war sie ebenfalls schon lange. Doch sie wurde jetzt von Miriam abgelenkt, die ihr gegenüber saß und die den Jungen mit der Wucht ihrer Gedanken und Gefühle noch bei weitem übertraf. Sie schleuderte ihr nicht nur erschreckende Emotionen, sondern auch die übelsten Katastrophengedanken entgegen, die Lucy durch die kurze Ablenkung glücklicherweise für einen Moment hatte ausblenden können. Doch jetzt, wo sie Miriam wieder ins Gesicht sah, bohrten sie sich erneut in ihren Kopf. Sie schnappte nach Luft. Lucy hätte ihre Gedanken gar nicht lesen müssen, um zu erfahren, was sie gerade von ihr hielt. Es war ihr deutlich vom Gesicht abzulesen. Miriam sah sie mit einem Blick an, der ihr äußerst unangenehm war. Schrecken lag darin. Und ernsthafte Zweifel, ob sie noch ganz bei Sinnen war.
»Bist du total verrückt geworden??« Endlich sprach Miriam die Worte aus, die ihr so deutlich im Gesicht standen.
Lucy seufzte und wandte sich von dem Gedankengeplapper der anderen Leute so gut es ging ab, um sich auf Miriam konzentrieren zu können. Es fiel ihr schwer. Die Gedanken und Emotionen ihrer Umgebung prasselten von Tag zu Tag intensiver auf sie ein. Manchmal fühlte sie sich, als würde sie davon erschlagen werden. Doch als sie Miriam konzentriert in die Augen sah, verwandelte sich das Geplapper in ein zwar etwas nerviges, aber leiseres Hintergrundgeräusch. Sie konnte Miriams Reaktion ja verstehen. Schließlich hatte sie ihr bisher nicht eine Silbe von Nikolas erzählt.
»Du ziehst mit einem Kerl zusammen, den du kaum kennst??«
Ein paar Leute drehten sich um, als sie Miriams schrille, fassungslose Stimme hörten.
»Ich kenne ihn«, entgegnete Lucy etwas peinlich berührt und starrte dabei auf ihre Kaffeetasse, an der sie sich die Hände wärmte. Er hat mir das Leben gerettet, hätte sie am liebsten hinzugefügt. Außerdem kann ich hören, was er denkt und fühlen, was in ihm vorgeht. Aber sie hielt den Mund. Obwohl sie wusste, dass sie ihr irgendwann die Wahrheit sagen musste. Sie würde sich nicht mit der abgedroschenen Geschichte zufriedengeben, die sie sich für sie ausgedacht hatte. Keine Frau zieht einfach mit einem Mann zusammen, den sie gerade erst kennengelernt hat und mit dem sie nichts weiter verband als Verliebtheit, Leidenschaft und eine seltsame, unergründliche Vertrautheit. Das war wirklich irre. Aber zwischen Lucy und Nikolas gab es mehr. Viel mehr.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Lucy und hob den Kopf, um ihrer Freundin ein sanftes, vertrauenswürdiges Lächeln zu schenken. »Das wird schon gutgehen.«
Miriam zog die Augenbrauen so hoch, dass sich tiefe Furchen in ihrer Stirn bildeten und dann schnaubte sie entsetzt. Ihr Blick war erschreckend. Lucy wusste nicht, ob sie gleich ihr Handy nehmen und einen Seelenklempner anrufen oder ihr links und rechts eine verpassen würde, um sie zur Vernunft zu bringen. Sie sah aus, als würde sie beides tun wollen.
»Du ziehst mit einem wildfremden Mann zusammen, der dir gerade ein Haus geschenkt hat und ich soll mir keine Sorgen machen?? Willst du mich verarschen?«
»Das ist schon in Ordnung«, verteidigte sich Lucy. »Das Haus ist ein Geschenk von…« Sie biss sich auf die Lippe und senkte wieder den Kopf. Sie durfte Alea nicht erwähnen. Doch sie hätte ihr so gern gesagt, dass sie es gewesen war, die Nikolas dieses Haus geschenkt hatte. Damit er einen Platz zum Wohnen hatte, während er auf Lucy aufpasste. Wie sollte sie Miriam erklären, dass sie nicht nur mit ihm zusammen wohnte, weil sie total verknallt in ihn war, sondern weil er der Einzige war, der ihre Kräfte in Schach halten konnte? Sie seufzte schwer. Und sie wurde immer nervöser. Sie hatte zwar gewusst, dass dieses Treffen nicht leicht werden würde, aber dass Miriam mit einer solchen Ablehnung reagierte, hatte sie nicht erwartet.
»Von wem?«, fragte Miriam auf einmal.
Lucy sah zu ihr auf.
»Von wem ist das Haus??«, drängte sie. Sie wirkte wütend.
Lucy ließ den Blick durch die Cafeteria schweifen und suchte verzweifelt nach einer Idee. Dabei fiel ihr auf, dass der Fernsehbildschirm neben der Theke auf einmal wild flackerte. Verflucht, dachte sie. Sie musste sich beruhigen. Unauffällig sah sie auf Miriams Handy, das neben ihr auf dem Tisch lag. Sie hoffte, dass sie es nicht schon wieder kaputt gemacht hatte. Es war schließlich nagelneu. Ihr altes – das ebenfalls neu gewesen war – hatte sie vor einer Woche geschrottet, als sie sich für Weihnachtseinkäufe getroffen hatten. Sie schaffte es immer noch nicht, ihre Gefühle so zu kontrollieren, dass sie keinen Schaden in ihrer Umgebung anrichteten. Besonders dann nicht, wenn sie nervös wurde. Die Lampe über ihrem Tisch flackerte kurz. Dann flackerte die Lampe am Nachbartisch. Lucy atmete tief ein und versuchte, Nikolas' Rat zu befolgen. Sie durfte die Gefühle, die in ihr aufkamen, nicht verdrängen. Doch es funktionierte nicht. Und als der Junge mit dem verzweifelten Blick das Flackern bemerkte und sie dann ansah, war es gänzlich vorbei. Er sah aus, als wüsste er ganz genau, dass sie diejenige war, die das Flackern verursachte. Sie fühlte sich ertappt. Erschrocken erwiderte sie seinen Blick. Und die Worte in seinem Kopf erschreckten sie noch mehr.
Eine Übersinnliche?, fragte er sich. Gehört sie auch zu X?
Lucy sah ihn irritiert an. Was meinte er mit X? Und wieso wusste er, dass sie diejenige war, die gerade dabei war, den Laden lahmzulegen? Doch plötzlich wurde sie erneut von Miriam abgelenkt.
»Ich will ihn sehen!«, sagte Miriam wütend.
Lucy löste ihren Blick von dem Jungen und stutzte. »Was??«
»Den Typen. Ich will ihn sehen und ihn zur Rede stellen. Vielleicht erzählt er mir ja, was hier verflixt noch mal los ist. Du tust es ja nicht.«
Sie hatte die Worte noch nicht zu Ende gesprochen, da stand sie schon auf, zog sich energisch ihren Mantel über, steckte ihr Handy ein und griff nach ihrer Handtasche, wobei sie Lucy einen auffordernden Blick zuwarf. Diese nahm noch einen letzten Schluck Kaffee und stand dann ebenfalls auf.
»Er wird dir dasselbe sagen wie ich«, sagte sie vorsichtig und knöpfte ihren Mantel zu. Dabei sah sie noch einmal den Jungen an. Er konzentrierte sich gerade auf die Lampen. Sie flackerten überraschenderweise nicht mehr. Hatte er das bewirkt?
»Na hoffentlich kann er wenigstens besser lügen als du«, sagte Miriam bissig und ging.
Lucy machte ein schuldbewusstes Gesicht, als Miriam ihr die Tür aufhielt. Sie wandte sich noch einmal um und sah, wie jemand am Fernseher herum hantierte. Er hatte jetzt völlig den Geist aufgegeben. Der Bildschirm war schwarz. Lucy verschwand lieber schnell aus dem Café.
Während sie wortlos durch die Straßen gingen, überlegte sie, wie sie ihre beste Freundin doch noch davon abbringen konnte, tatsächlich mit ihr nach Hause zu fahren, um Nikolas auszufragen. Sie wollte ihn nur ungern mit den Gedanken konfrontieren, die Miriam sich machte. Schließlich konnte er sie so deutlich hören wie sie. Er konnte den ständigen Gedankenstrom der Menschen um ihn herum zwar auch abstellen, aber die Wucht, die auf Grund der Wut und der Sorge hinter Miriams Gedanken steckte, würde selbst seine Mauer zum Einsturz bringen. Sie würde ihm diese verrückten Bilder, die sie sich ununterbrochen ausmalte, geradezu um die Ohren hauen. In ihrem Kopf war die Geschichte schon längst klar. Für sie war Nikolas ein Irrer, der Lucy mit einem gigantischen Geschenk locken wollte, um seine psychisch kranken Spielchen an ihr ausleben zu können. Er würde sie womöglich verführen, danach umbringen und schließlich zerstückeln und in das Gemäuer dieses Hauses eingießen. Dass man Lucy mit einem Haus locken konnte, war sonnenklar. Miriam war sich sicher, dass Lucy eine seelisch labile Phase durchlebte und blind vor Liebe war. Sie musste ihre Freundin vor diesem Irren beschützen, der ihre Situation – damit meinte sie ihren seelischen Knacks, den sie ihrer Meinung nach seit der Sache im Sommer hatte – schamlos ausnutzte. Sie wollte ihre Freundin beschützen.
Lucy seufzte schwer, als sie stumm in die Bahn einstiegen. Miriams Gedanken zu lauschen, war nicht nur anstrengend, es war wie ein Horrortrip durch die Welt der Psychothriller. Sie hätte nie geglaubt, dass sie mindestens genauso viele Horrorszenarien im Kopf hatte wie sie selbst. Sie hatte immer gedacht, sie sei die Katastrophentante in dieser Freundschaft. Aber doch nicht Miriam! Miriam war der positivste Mensch, den sie kannte. Doch seit sie wieder Gedanken hören konnte, lernte sie sie auf eine ganze andere Weise kennen. Miriam las ganz offensichtlich zu viele Krimis. Als Lucy hörte, wie sie in Gedanken ein Szenario mit der Polizei durchspielte, um auf alles vorbereitet zu sein, entschied sie sich, ihre Gedanken zu unterbrechen.
»Hör zu«, seufzte sie. »Ich kann verstehen, dass du dir Sorgen machst, aber es gibt absolut keinen Grund dafür. Nikolas ist ein sehr netter und einfühlsamer Mensch und…«
»Die sind alle zuerst nett und einfühlsam«, entgegnete Miriam. »Und dann entpuppen sie sich als Psychokiller. Ich habe wirklich gedacht, dass du vernünftiger bist, Lucy. Du benimmst dich wie ein verknallter Teenager!«
Nun ja, damit hatte sie nicht unrecht. Sie fühlte sich auch wie ein verknallter Teenager. Und vielleicht war sie wirklich ein bisschen naiv. Als er wieder aufgetaucht war, hatte sie sofort ihre Wohnung gekündigt und sich dann unmittelbar in diesem Traumhaus eingerichtet. Ja, das war wirklich ein bisschen verrückt, wenn man es neutral betrachtete. Sie hätte wahrscheinlich genauso reagiert, wenn Miriam solchen Blödsinn gemacht hätte. Aber Nikolas war anders. Er war ja schließlich nicht von dieser Welt. »Er ist kein Psychokiller«, sagte Lucy vollkommen überzeugt.
»Und woher weißt du das? Was weißt du denn schon von ihm? Wer ist er? Was macht er beruflich?«
Lucy stockte und wich ihrem Blick aus. Sollte sie ihr sagen, dass er Gardist war? Dann würde sie ihr aber weitere Fragen stellen und sie konnte ihr wohl kaum erzählen, dass er seinen Job in der anderen Welt (wie klang denn das?) aufgegeben hatte, um mit ihr zusammen sein zu können. Sie konnte ihr vielleicht sagen, dass er im Ausland einen Job als Gardist gehabt hatte. In Italien zum Beispiel. So wie sie es zu Anfang auch vermutet hatte. Aber wo? Und für wen?
»Siehst du! Du weißt es nicht. Du weiß gar nichts von ihm und fragst mich, warum ich ihn verurteile? Er könnte sonst wer sein!«
»Natürlich weiß ich, was er von Beruf ist«, sagte Lucy und schickte ein überspitztes »Tze!« hinterher, um die Selbstverständlichkeit ihrer Worte zu untermalen. Danach überlegte sie schnell, welcher Beruf zu ihm passen würde. Sie betrachtete die Menschen in der Straßenbahn und hoffte auf irgendeine Idee. Aber ihr fiel nichts ein. Gardist war einfach der Beruf, der perfekt zu ihm passte. Vielleicht noch Polizist, aber das hätte jetzt wirklich wie aus der Luft gegriffen geklungen.
»Weißt du nicht«, murmelte Miriam überzeugt, wandte den Blick seufzend von ihr ab und lehnte sich resignierend in ihrem Sitz zurück. In dem Moment stieg ein älterer Herr in die Bahn ein und setzte sich neben Miriam. Seinen Aktenkoffer stellte er zwischen seine Beine. Er sah wie ein typischer Professor aus und als Lucy den Bruchteil eines Satzes aus seinem Kopf wahrnahm, in dem er über die Hausaufgaben nachgrübelte, die er seinen Schülern aufgegeben hatte, kam ihr eine Blitzidee.
»Er ist Lehrer.«
Miriam hob den Kopf und sah sie skeptisch an. »Lehrer?«
Das war einfach perfekt! Genau dieser Gedanke war ihr nämlich gekommen, als sie gemeinsam durch das Land gejagt worden waren. Während sie sich auf der Flucht näher gekommen waren, hatte er ihr so viel beigebracht. Und er tat es noch immer. Er war ein Lebenslehrer! Das war er wirklich.
»Was für ein Lehrer?«
Wieder stockte sie. Spontan fiel ihr Motivationstrainer ein. Er verstand es wirklich, einem die Ängste und Sorgen zu nehmen und einem klarzumachen, wie mächtig man war. »Äh...«, machte sie grübelnd.
Zum Glück mussten sie jetzt aussteigen. Lucy sprang auf und stieg schnell aus. Aber Miriam ließ nicht locker. Den ganzen Weg von der Bahnstation bis zum Nobelviertel löcherte sie sie mit Fragen, schimpfte, meckerte und regte sich über Lucys Naivität auf. Irgendwann sagte Lucy, er würde an einer Universität unterrichten und eine Doktorarbeit über die Macht des Geistes schreiben. Das ließ Miriam für einen kurzen Moment verstummen. Schließlich war sie eine selbsternannte Expertin, was diese Art von Wissenschaft anging. Als sie sich dann wieder gefasst hatte und nach Luft schnappte, um weiter zu reden, unterband Lucy weitere Fragen mit den Worten: »Den Rest kannst du ihn ja selbst fragen.«
Miriam schnaubte. Und während sie die lange Strecke entlang gingen, der Schnee unter ihren Füßen knirschte und die Idylle in diesem Stadtteil ein wenig ihre Gemüter beruhigte, kramte Miriam in ihrer Handtasche und umfasste mit einem festen Griff ihre Waffe. Sie hatte zur Selbstverteidigung immer ein Kubotan dabei.
Lucy rollte mit den Augen, als sie das mitbekam. Sie sah Miriam an und sagte mit aller Deutlichkeit: »Er ist nicht gefährlich.«
Miriam hob eine Augenbraue. »Sagt das naive, dumme Ding, dass mit 'nem Wildfremden zusammen gezogen ist.« Dann betrachtete sie Lucy eine Weile und wirkte dabei sehr besorgt. »Menschen sind grausam, Lucy. Selbst der netteste Mensch kann sich irgendwann als Monster entpuppen. Ich verstehe dich nicht«, fuhr sie fort. »Du malst dir schon dein Leben lang mögliche Katastrophen aus und dann rennst du so blind in eine offensichtliche Falle? Bei deinem Glück ist der Typ womöglich Jack The Ripper!«
Lucy musste lachen, als sie sich Nikolas als Jack The Ripper vorstellte. »Du wirst sehen«, sagte sie dann mit beruhigender Stimme, »dass er ein ganz wunderbarer und anständiger Mensch ist.« Und dabei beließ sie es. Miriam musste ihn selbst kennenlernen. Dann würde sie schon sehen, dass Nikolas ihr niemals etwas antun würde.
Es dauerte etwa eine halbe Stunde, bis sie die Straße erreichten, in der Lucy neuerdings wohnte. Während sie an all den Häusern vorbei gingen, wartete Miriam gebannt, wann Lucy mit der Sprache heraus rücken würde, welches Haus es denn nun war. Und als sie dann am Ende der Straße ankamen und Lucy schließlich das Gartentor öffnete, lachte Miriam hämisch. »Natürlich ist es das größte und schönste von allen«, sagte sie spöttisch. »Wie könnte es anders sein?!«
Lucy reagierte nicht auf ihren Kommentar. Sie genoss einfach den Augenblick, denn es entlockte ihr jedes Mal ein Lächeln, ihr Haus zu sehen. Ihr Haus. Den Palast ihrer Träume. Als sie den Schlüssel aus ihrer Handtasche kramte, öffnete sich jedoch bereits die Tür.
Und da stand er. Der Mann ihrer Träume – im Haus ihrer Träume. Groß und selbstbewusst thronte er im Türrahmen, auf seinen Lippen sein altbekanntes, schelmisches Lächeln, das sogar 80-jährige Frauen dahinschmelzen ließ. Das hatte sie selbst erlebt! Gestern, als eine Nachbarin vorbei gekommen war, um sie in der Nachbarschaft zu begrüßen. Lucys Herz raste los und sprang Nikolas in die Arme, noch bevor sie die Tür erreicht hatte. Sie vergaß fast, dass ihre beste Freundin noch hinter ihr stehen musste und Nikolas womöglich gerade kritisch beäugte. Oder ihn sogar versuchte, mit ihren Blicken zu töten. Sofort klärte Lucy ihn in Gedanken darüber auf, dass sie ihn gerade zu einem Lehrer ernannt hatte.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie hat mich verrückt gemacht mit ihrer Fragerei, dachte sie ihm entgegen und küsste zur Begrüßung sein Schmunzeln.
Sie spürte in seinen Gefühlen nicht den Hauch von Ärger über ihre verrückte Idee. Nur Verständnis und ein wenig Amüsement. Später würde er sie damit bestimmt aufziehen. Er sah sie mit seinen eisblauen Augen amüsiert an, nickte kurz und wandte sich dann Miriam zu.
Als Lucy sich umdrehte, stand Miriam schon neben ihr. Und wie vermutet, musterte sie Nikolas äußerst kritisch und auch ein wenig herablassend. Das war ihre Art, einen gewissen Abstand zu wahren. Und nach ihren Gedanken zu urteilen, war das auch mehr als notwendig. Nicht nur, weil sie befürchtete, er könne ihrer besten Freundin etwas antun. Sondern hauptsächlich deswegen, weil sie ihn durchaus sympathisch fand und mit aller Macht gegen diese Tatsache anzukämpfen versuchte. Einen Mörder durfte sie doch nicht sympathisch finden! Um das zu erreichen, malte sie sich abermals die unfassbarsten Horrorgeschichten aus. Und es funktionierte. Ihre Abneigung ihm gegenüber stieg an. Lucy konnte sie bis ins Mark fühlen. Sie fing regelrecht an, ihn zu hassen, weil sie sich vorstellte, wie er Lucy die gemeinsten Dinge antat.
Nikolas lächelte sanft, jedoch zeichnete sich in seinem Gesicht auch Schrecken und Fassungslosigkeit über ihre erschreckenden Gedanken und Vorstellungen ab. Lucy konnte sich noch daran erinnern, wie er reagiert hatte, als sie ihn für einen Killer gehalten hatte. Damals hatte ihn das sehr verletzt.
Sie macht sich nur Sorgen um mich, erklärte sie ihm in Gedanken. Dann stellte sie die beiden vor: »Miri, das ist Nikolas. Niko, das ist meine beste Freundin, Miriam.«
Sie gaben sich die Hand.
»Freut mich sehr, dich endlich kennenzulernen«, sagte Nikolas freundlich. »Lucy spricht ständig von dir.«
Miriam reagierte nicht auf seine Worte. Sie ließ seine Hand wieder los und starrte ihn nur an. Als die unangenehme Stille zwischen ihnen jedoch fast zu knistern begann, bat Lucy sie schnell herein. »Das Wohnzimmer wird dir gefallen! Es passen mindestens drei riesige Tannenbäume rein!«, erzählte Lucy aufheiternd und zog sie über die Türschwelle.
Doch als Miriam hinüber schritt und den Boden des Hauses betrat, passierte etwas Unglaubliches. Es erklang ein Geräusch, als würde ein riesiger Bogen Papier zerreißen. Und es war so laut, dass sie alle zusammenzuckten und die Hände nach oben rissen, um sich die Ohren zuzuhalten. In diesem Moment flog Miriam rückwärts aus der Tür und über die Veranda. Dann landete sie schließlich im hohen Bogen auf dem zur Seite geschaufelten Schnee auf der Wiese. Es war, als hätte sie etwas mit einem Seil von der Tür weggerissen. Sie versank im Schnee und stöhnte. Lucy sprang sofort die Stufen hinunter. Nikolas folgte ihr.
»Was zur Hölle war das denn??«, stöhnte Miriam. Sie rollte sich von dem kleinen Schneeberg hinunter und ließ sich von Nikolas aufhelfen. Natürlich war er schneller gewesen als Lucy.
»Alles in Ordnung? Hast du dich verletzt?«, fragte er besorgt.
Miriam klopfte sich verwirrt den Schnee von der Kleidung, ignorierte Nikolas und sah dann Lucy an. »Hast du das mitgekriegt??«
Lucy warf Nikolas einen irritierten Blick zu und hörte, wie er auf Alea schimpfte.
»Alea?«, rief Lucy entsetzt. »Sie hat das getan?«
»Nicht mit Absicht«, entgegnete er und bedeutete ihr mit einem kurzen Blick, dass sie die Sache vielleicht später klären sollten. Lucy biss sich sofort auf die Lippe, aber es war zu spät.
Miriam sah die beiden verstört an. »Wer hat was getan?«
Beide sahen sie stumm an, tauschten dann einen Blick – und ein paar Gedanken – und wandten sich dann wieder Miriam zu. »Niemand« sagte Lucy dann schnell. »Niemand hat irgendwas getan. Das war bestimmt nur...«, sie fuchtelte mit der Hand in der Luft herum und überlegte angestrengt, »Eis. Du bist bestimmt ausgerutscht.«
Miriam blickte sie entrückt an. »Ernsthaft, Lucy?«, sagte sie dann wütend und deutete auf die Haustür. »Das sind bestimmt an die fünf Meter! Ich bin also fünf Meter weit gefallen?«
Lucy sah sie ratlos an. Und sie hörte in Miriams Gedanken wilde Spekulationen darüber, wie es Nikolas geschafft haben könnte, sie von der Veranda fliegen zu lassen. Doch jede ihrer Vermutungen klang nach Science Fiction. Sie konnte es sich selbst nicht erklären.
»Miri«, sagte Lucy und hob beruhigend die Hände. »Es ist ja nichts passiert.« Sie betastete ihre Freundin und lächelte aufheiternd.
Doch Miriam entzog sich ihr wütend und sah Nikolas dabei an. »Wenn ihr mir jetzt nicht auf der Stelle erklärt, was hier los ist, werde ich fuchsteufelswild, kapiert?! Ich lasse mich nicht für blöd verkaufen! Was ist da gerade passiert, verdammt? Und wer zum Geier ist Alea?«
»Na schön.« Nikolas seufzte schwer, tauschte mit Lucy einen Blick und nickte dann. »Ich werde es dir erklären. Aber ich vermute, du kannst das Haus erst betreten, wenn du aufhörst, mich zu hassen, Miriam.«
Es war nicht leicht, Miriam davon zu überzeugen, dass Nikolas weder irre war noch einen teuflischen Plan verfolgte oder ihr etwas antun wollte, sobald sie das Haus betrat. Aber schließlich war sie irgendwann mit hinein gekommen. Natürlich, nachdem sie ihre Vorurteile – zumindest ansatzweise – über Bord geworfen hatte und Nikolas so gut es ging neutral betrachtete. Erst dann konnte sie über die Türschwelle treten, ohne wieder durch die Luft geschleudert zu werden. Das Ganze hatte knapp eine Stunde gedauert. Jetzt waren Lucy und Miriam halb erfroren und Nikolas, der in Pulli und Jeans draußen gestanden hatte, hatte nicht einmal kalte Finger bekommen. Es war Lucy ein Rätsel, wie er es schaffte, seinen Körper derart zu kontrollieren.
Lucy hatte Miriam in eine Wolldecke eingewickelt und klammerte sich selbst an ihrer Tasse heißen Tee fest. Als Nikolas Miriam den Kaffee brachte, setzte er sich zu ihnen an den großen Küchentisch. Die Sonne schien hinein und glitzerte in den kleinen Kristallen, die Lucy an die Fenster gehängt hatte. Dadurch wurden regenbogenfarbene Lichtpunkte in den Raum geworfen, die auf dem Boden und an den Wänden tanzten.
Eine Weile lang herrschte betretenes Schweigen. Man hörte nur das Klappern von Miriams Zähnen, das nach ein paar Schlucken Kaffee endlich nachließ. Als sie dann den Kopf hob und Nikolas ansah, ergriff er schließlich das Wort. »Lucy sagt, dass du dich mit übersinnlichen Fähigkeiten auskennst?«
Miriam nickte langsam und vorsichtig, blickte ihn dabei jedoch mehr als skeptisch an.
»Das Haus ist ein Geschenk von einer guten Freundin«, erklärte er. »Ihr Name ist Alea. Sie hat es vor ein paar Monaten gekauft und ein wenig … modifiziert.« Er machte einen Moment Pause, um nach den richtigen Worten zu suchen. »Du weißt, dass man die Wirklichkeit mit seinen Gedanken beeinflusst, nicht wahr?«
Wieder nickte Miriam. Dieses Mal noch langsamer.
»Nun, ich denke Alea hat es einfach ein wenig übertrieben. Sie hat es ganz sicher gut gemeint, als sie das Haus programmiert hat, aber...«
Miriam unterbrach ihn jedoch mit einer raschen Handbewegung. »Warte«, sagte sie und runzelte die Stirn. Sie fasste sich an den Kopf und zwinkerte ein paar Mal irritiert. »Hast du gerade programmiert gesagt?«
Er schwieg einen Moment und sah Lucy dabei an. Dann sprach sie weiter: »Du hast mir doch selbst einmal erzählt, dass man mit Gedanken auf Gegenstände einwirken kann. Du liest doch ständig Bücher darüber, Miri«, sagte Lucy vorsichtig. »Telekinese und so etwas«, fügte sie noch an und war selbst etwas erstaunt darüber, wie selbstverständlich all dies schon für sie geworden war.
Miriam blickte Lucy mit einem solch erstaunten Gesicht an, als sei sie gerade vom Himmel gefallen. »Willst du mir jetzt echt erzählen, dass diese Alea das Haus mit ihren Gedanken so programmiert hat, dass alle, die ins Haus wollen, von der Veranda geschossen werden?«
»Nicht alle«, sagte Lucy schnell. Dann suchte sie nach den richtigen Worten, wobei sie nervös auf ihrer Unterlippe herumkaute. »Nur die, die … einem von uns etwas tun wollen, glaube ich.« Dann sah sie Nikolas fragend an, der ihre Worte mit einem Nicken bestätigte. Also hatte sie mit ihrer Vermutung richtig gelegen. Alea hatte so etwas wie einen Schutzbann auf dieses Haus gelegt. Das war einfach unglaublich!
Miriam wich zurück und stellte ihre Kaffeetasse ab. »Du verarschst mich! Ihr beide verarscht mich! Was soll das? Was habe ich dir getan, dass du mich so behandelst? Dass du mich auf einmal belügst und mir so einen Schwachsinn auftischst? Wir waren mal Freunde, Lucy!« Ihre Stimme wurde immer lauter und bei den letzten Worten war sie aufgestanden und hatte den Stuhl mit den Beinen so heftig nach hinten geschubst, dass er jetzt umkippte und klappernd auf dem beheizten Steinboden landete.
»Ich lüge dich nicht an, Miri!«, sagte Lucy verzweifelt und stand ebenfalls auf. »Das ist die Wahrheit. Alea hat sehr starke Fähigkeiten! Nikolas hat mir erzählt, dass sie weiße Gardistin ist. Und weiße Gardisten sind sehr...«
»Gib dir keine Mühe«, unterbrach Miriam sie. Sie wirkte dabei erschreckend abweisend. »Ich hatte gehofft, dir irgendwie helfen zu können, nach deinem Unfall wieder normal zu werden. Ich dachte, du hättest ein Trauma davon getragen und seist deswegen so seltsam in letzter Zeit. Aber anscheinend hat dich der Typ hier komplett verdreht! Ich gehe.«
Als Miriam zur Tür schritt, stand Nikolas auf. »Warte, Miriam!«, rief er.
Widerwillig drehte sie sich beim Gehen noch einmal um und blieb sofort stehen, als sie sah, was Nikolas tat. Er hatte den Arm ausgestreckt und jonglierte in seiner Handfläche drei von den Schokoladenmuffins, die in einer großen Schale auf dem Tisch standen. Sie schwebten über seiner Handfläche und drehten sich im Kreis, als führen sie auf einem unsichtbaren Karussell. Miriam blieb der Mund offen stehen. Dann löste sich einer der Muffins und schwebte direkt auf Miriam zu. Sie wich erschrocken einen Schritt zurück, öffnete jedoch die Hand, als sich der Muffin direkt vor ihrer Brust befand.
»Gib Lucy keine Schuld«, sagte er. »Ich hatte sie darum gebeten, es geheim zu halten. Und ich bitte dich jetzt um dasselbe. Es darf niemand erfahren, dass ich diese Dinge kann. Wir haben schon einmal erlebt, was passiert, wenn dieses Wissen in die falschen Hände gerät.«
Miriam sah ihn jetzt mit großen Augen an. Sie war erschrocken darüber, was sie gerade gesehen hatte, aber gleichzeitig war sie fasziniert und begeistert. Dann stellte sich in ihr die Frage, was er damit meinte, dass dieses Wissen schon einmal in die falschen Hände geraten war. Sie sagte jedoch nichts.
»Er meint die Sache, die im Sommer passiert ist«, erklärte Lucy und kam ein paar Schritte auf ihre Freundin zu. »Ich bin damals gar nicht zu Hause gewesen«, gestand sie. Endlich konnte sie ihr die Wahrheit sagen. Endlich durfte sie. Es fühlte sich so unglaublich befreiend an, die folgenden Worte auszusprechen: »Ich habe gelogen und das tut mir unendlich leid, Miri. Aber ich wusste nicht, wie ich dir das erklären sollte. Und ich durfte auch nichts sagen.«
Miriam sah sie mitfühlend an. Ihre Wut war plötzlich verflogen und in ihrem Gesicht spiegelte sich Dankbarkeit wider. Dankbarkeit dafür, dass sie ihr endlich die Wahrheit sagte. »Wo warst du dann?«, fragte sie.
Lucy zögerte einen Moment und als sie gerade Luft holte, um ihr alles zu erzählen, erklang erneut ein seltsames Geräusch. Es kam aus dem Wohnzimmer. Lucy kannte dieses fast ohrenbetäubende Rauschen. Sie hatte es früher schon einmal gehört. Sie wusste spontan nur nicht mehr wann und wo.
Sie verließen alle drei rasch die Küche und als sie das Wohnzimmer betraten, erschrak Miriam so sehr, dass sie den Muffin fallen ließ und einen kurzen Schrei ausstieß. Aus dem Nichts erschien gerade in diesem Moment mitten im Wohnzimmer eine Gestalt. Man konnte zunächst nur Umrisse erkennen, die darauf hindeuteten, dass es sich um eine sehr große Person handelte. Das Bild wurde aber rasch deutlicher und innerhalb von Sekunden sah man, um wen es sich bei dem unerwarteten Besucher handelte, der sich da gerade aus einem Lichtbogen heraus manifestierte.
Lucy lachte und Nikolas rief sofort voller Freude seinen Namen aus. »Hilar! Was machst du denn hier?«
Hilar setzte das breiteste Lächeln auf, zu dem er fähig war und schlenderte lässig auf seine Freunde zu. Als er dann aber Miriam erblickte, die ihn wie versteinert anstarrte, blieb er irritiert stehen.
Lucy nahm Miriams Hand und rüttelte sanft an ihr. »Das ist schon in Ordnung. Er ist ein Freund von uns.«
Aber Miriam blieb versteinert.
Hilar blickte unsicher an sich hinunter und zupfte seine grüne Uniform zurecht. Er berührte seine Abzeichen, wischte über die Ärmel, als wollte er sie säubern und ging sich dann durch sein stoppeliges, blondes Haar. Dann sah er wieder auf, betrachtete Miriam erneut und blickte dann Nikolas und Lucy ratlos an. »Verdammt. Hätte ich 'was Anderes anziehen sollen?«
2
Heimliche Beobachter
Am Abend wurde es so kalt, dass der Schnee, der tagsüber teilweise auf den Straßen geschmolzen war, zu Eis gefror. Jemand ging über die Straße direkt vor Lucys Haus und rutschte auf einer dieser Eisflächen aus. Er konnte sein Gleichgewicht jedoch glücklicherweise halten, so dass er sich nur kurz mit einer Hand am Boden abstützen musste. Dann ging er fluchend weiter, zog sich die Kapuze tiefer ins Gesicht und steckte sich die Hände in die Jackentaschen. Es schien, als wollte er nicht bemerkt werden. Er ging so schnell, dass sein Atem in kleinen Wölkchen an ihm vorbei zog wie der Qualm einer Lokomotive. Am Ende der Straße gab es einen kleinen Park mit vielen Bäumen und einer kleinen Holzhütte, in der – wenn nicht gerade Schnee lag – tagsüber Kinder herum kletterten. Daneben stand eine Laterne, deren Birne jedoch zerbrochen war, sodass die Hütte im Dunkeln lag. Der Mann ging direkt darauf zu.
Als er nah genug war, machte er zwei kurze Pfeifftöne mit dem Mund und dann tauchte eine Gestalt hinter der Hütte auf.
»Du bist zu spät«, brummte die Gestalt im Schatten.
Der Mann schnaubte, zog die Hände aus den Taschen und rieb sie sich kräftig. »Es ist arschkalt. Man kommt kaum von A nach B.«
»Was du nicht sagst«, brummte die Schattengestalt verärgert und kam näher. »Ich stehe hier seit Stunden herum. Ich bin ein einziger Eisklotz.«
Er lachte leise. »Hör auf, zu jammern. Du hast dich für diese Aufgabe freiwillig gemeldet.« Dann drehte er sich um. Von hier aus hatte man eine freie Sicht auf Lucys Haus. Es war hell erleuchtet. An den Fenstern hingen Lichterketten und draußen stand ein geschmückter Tannenbaum, der blinkte. Von dort aus konnte man die Spielhütte im Park nicht sehen. Es war also der perfekte Platz, um das Haus zu observieren, ohne entdeckt zu werden. »Irgendwas Ungewöhnliches heute?«
Der andere steckte sich jetzt eine Zigarette in den Mund und zündete sie an. Sie bot wenigstens ein bisschen Wärme. »Ja«, brummte er. »Wir haben ein Problem.«
Er sah ihn überrascht an. »Von Problemen will der Boss nichts hören«, sagte er. »Es darf dieses Mal nichts schief gehen.«
»Ist mir scheißegal, was er hören will«, brummte der Raucher. »Wir können da nicht rein.«
»Was soll das heißen? Wir sollten doch morgen den Portalschlüssel...«
»Tja, du kannst ja dein Glück versuchen«, unterbrach der andere ihn, zog an seiner Zigarette und lachte. »Wäre ein netter Anblick. Du Hänfling würdest wahrscheinlich noch viel weiter fliegen, als die Kleine heute.«
Der Mann sah ihn verständnislos an. »Die Kleine?«
»Ihre Freundin ist da. Du weißt schon, Miriam«, sagte er, nickte zum Haus und zog noch einmal genüsslich an seiner Zigarette. »Die haben irgendwas mit dem Haus gemacht.« Dann zückte er sein Handy und suchte in der Kontaktliste nach jemandem.
»Verdammt«, sagte der andere und betrachtete die Schatten, die hinter den Gardinen auf und ab gingen. »Dann wird er wohl zu Plan B übergehen.«
Der andere nickte. »Das wird nicht gerade einfach. Halte die Stellung hier. Und wehe du haust wieder früher ab!«, sagte er drohend, wobei er mit dem Finger auf ihn zeigte. Dann machte er sich endlich auf den Weg. Seine Beine waren schon ganz taub von der Kälte und seine Finger konnte er schon seit einer Weile nicht mehr spüren. Er ging zügig auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Hauses entlang und zog sich den Kragen seines Mantels nach oben, damit ihn niemand sah. Dann hielt er sich das Handy ans Ohr. Es klingelte. Aber es ging niemand ran.
»Mist«, brummte er und sah auf die Uhr an seinem Handy. Es war spät. Er hätte schon vor einer Stunde anrufen sollen. So wie jeden Tag, wenn die Schicht wechselte. Aber sein dummer Kollege war mal wieder zu spät gekommen. Er nahm noch ein paar Züge von seiner Zigarette und murmelte fluchend etwas vor sich hin, behielt das Handy aber in der Hand, um es gleich noch einmal zu versuchen. Währenddessen blickte er immer wieder zurück, um sicherzugehen, dass ihn niemand bemerkt hatte.
Bald schon war das Haus so weit entfernt, dass er das Blinken des Tannenbaums nur noch schwach aus der Ferne erkennen konnte. Erleichtert ließ er die Schultern sinken. Er war jedes Mal froh, wenn eine Schicht überstanden war. Denn es konnte jederzeit passieren, dass sie von Nikolas erwischt wurden. Ständig wurde ihnen eingehämmert, wie clever er war. Und wie gefährlich. Doch langsam begann er, daran zu zweifeln. Er hatte immer noch nicht bemerkt, dass er beobachtet wurde. Und dass sein Mädchen sogar schon seit Monaten unter ihrer Beobachtung stand. Grinsend zog er an seiner Zigarette. Sie waren überheblich, diese Lumenier. Und das machte sie unvorsichtig und dumm.
Plötzlich hörte er ein Geräusch. Er wandte sich schnell um, sah aber niemanden. Die Straße war leer. Die Leute waren in ihren warmen Häusern bei ihren Familien. Niemand war mehr unterwegs. Schon gar nicht bei dieser Kälte. Aus der Entfernung hörte er leise Weihnachtsmusik aus einem der Häuser erklingen. Doch ansonsten war alles still. Totenstill. Er sah sich noch einmal kurz um und lauschte, hörte aber nichts mehr. Also ging er langsam weiter.
Als er die Nummer erneut wählen wollte, bemerkte er jedoch, dass das Display seines Handys flackerte. Er blieb zunächst irritiert stehen und blickte sein Handy verstört an, doch dann kam ihm ein erschreckender Gedanke. Er sah zu Lucys Haus, das bereits weit entfernt lag. Sie konnte es nicht sein. Ihr Einfluss auf technische Geräte beschränkte sich nicht nur auf Handys. Würde sie dieses Flackern verursachen, würden jetzt auch die Laternen in den Straßen flackern. Und die Lichter in den Häusern. Das hatte er schon mehrmals erlebt. Es musste also jemand Anderes hier sein.
Sofort schmiss er die Zigarette weg und rannte reflexartig los. Er lief so schnell er konnte. So schnell, dass die eisige Luft in seinem Gesicht biss und die vereinzelten Schneeflocken ihm entgegen flogen. Am Ende der Straße bog er in einen Seitenweg ein und rutschte auf dem Gehsteig fast aus. Dann griff er schnell in seine Jacke, um die Waffe zu ziehen. Er umfasste das kalte Metall mit festem Griff und wollte noch einmal die Nummer wählen, doch als er auf sein Handy sah, war es tot. Es ließ sich nicht mehr einschalten. Er fluchte wütend und rannte weiter. Doch als er wieder aufsah, stand urplötzlich jemand vor ihm. Ein riesiger Kerl in einer blauen Uniform. Er erschrak heftig, wollte sofort anhalten und umdrehen, doch er rutschte auf dem Schnee aus und fiel rückwärts hin.
Er schlug mit dem Kopf auf dem eisigen Boden auf und sah benommen nach oben. Dabei richtete er die Waffe auf den blau Uniformierten, doch diese zerfiel augenblicklich zu Staub, der ihm auf die Jacke rieselte. Dann versuchte er, rückwärts von dem Gardisten weg zu kriechen, doch das war nur ein vergeblicher Versuch, mehr Abstand zu ihm zu gewinnen – was völlig sinnlos war. Das wusste er. »Was … was willst du??«, rief er ängstlich.
Der Gardist folgte ihm mit langsamen Schritten und sah ihn dabei eiskalt an.
»Ich habe niemandem etwas getan!«, rief er verzweifelt und suchte unterdessen das Messer, das hinten in seinem Gürtel steckte.
Jetzt kniete sich der Gardist zu ihm hinunter und lachte leise. »Schamloser Lügner«, sagte er. Seine Stimme war tief und klang bedrohlich. »Du bist Söldner, oder nicht?«
Der Mann sah ihn überrascht an. Woher zum Teufel wusste er das? Woher wusste er überhaupt irgendwas? Ihm wurde versichert, dass all die Gardisten, die in den letzten Monaten Jagd auf sie gemacht hatten, weg waren. Seit Nikolas hier war, waren alle anderen fort. Er rutschte noch ein Stück von ihm weg und versuchte, unauffällig nach dem Messer zu greifen. »Ich … ich meine die beiden. Nikolas und die Frau. Ihnen habe ich nichts getan«, sagte er währenddessen, um ihn abzulenken.
»Nein«, sagte der Gardist mit ruhiger Stimme und hob dabei die linke Hand. »Dazu wärst du wohl auch kaum in der Lage.«
In diesem Moment riss etwas an seinem Gürtel und das Messer, das er gerade greifen wollte, flog dem Gardisten direkt in die Hand.
»Bemühe dich nicht«, sagte der Gardist selbstsicher und ließ auch das Messer zu Staub zerfallen. Es rieselte wie feinster Sand zwischen seinen Fingern zu Boden. »Du hast sowieso keine Chance.« Dann streckte er die Hand nach ihm aus und legte sie an seinen Kopf.
»Was soll der Scheiß?«, rief er wütend und schlug ihm die Hand weg.
»Shhh«, machte der Gardist und sah ihn dabei eindringlich an.
Und auf einmal wurden die Glieder des Mannes betonschwer. Sein Oberkörper fiel auf den Gehsteig in den Schnee und sein Kopf schlug erneut hart auf. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Er lag da wie ein Brett. Seine Arme, seine Beine, sein Rumpf, alles war wie gelähmt. Er starrte nach oben in das Gesicht des Gardisten. Sein Blick war eiskalt. Wie aus Stein war seine Mimik. Ihm lief ein Schauer über den Rücken. Und das lag nicht nur an dem geschmolzenen Schnee unter ihm, der ihm die Kleidung durchnässte. Dieser Typ hatte einen Blick, der sich geradewegs in seine Seele bohrte. Dann legte er wieder eine Hand an seinen Kopf. Dieses Mal konnte er sie nicht weg schlagen. Er musste geschehen lassen, was auch immer jetzt mit ihm passierte. Erschrocken bemerkte er, dass die Hand des Gardisten kochend heiß war. Es fühlte sich fast so an, als würde sie ihn verbrennen.
»Dachtet ihr ernsthaft, ich lasse es zu, dass ihr euch einen Portalschlüssel holt?«, fragte der Gardist währenddessen. »Marius hat seine Chance auf einen Lumenischen Kristall verspielt.«
Der Mann sah ihn irritiert an. »Wer zum Teufel ist Marius?«
Der Gardist hielt inne und zog die Stirn kraus. »Du kennst Marius nicht?«
»Nein, zum Teufel!«
»Und wer hat dich dann beauftragt?«
Der Mann zögerte einen Moment. »Ich kenne seinen Namen nicht. Niemand kennt seinen Namen.«
Während der Gardist ihn prüfend betrachtete, konnte er regelrecht spüren, wie er in seinen Geist eindrang, um nach Informationen zu suchen. Und da waren eine Menge Informationen, die er finden konnte. Er wusste einiges über die Ereignisse im Sommer. Und er wusste eine Menge über die Lumenier. Über ihre Fähigkeiten, ihr geheimes, verstecktes Land, über Nikolas, der als einziger Mensch jemals einen Weg in dieses Land gefunden hatte. Und natürlich über Lucy und was gerade mit ihr geschah.
Der Gardist schien sehr erbost über all diese Informationen zu sein. Doch er wirkte auch enttäuscht, weil er wohl eine wichtige Information nicht hatte finden können. Er sah ihn eindringlich an, bohrte ihm seinen Blick geradezu in seinen Geist und sagte: »Du wirst alles vergessen. Alles, was du über Lumenia weißt. Du wirst dich nicht mehr an die Namen Lucy Meier oder Miriam Jenkins erinnern und du wirst nicht mehr wissen, was im Sommer passiert ist. Und in Zukunft wirst du dich von dieser Gegend fernhalten.«
Plötzlich breitete sich eine schwarze Leere im Kopf des Mannes aus. Eine Dunkelheit, in der alles zu versinken schien, was vor wenigen Momenten noch da gewesen war. Verknüpfungen verschwanden und Informationen lösten sich in Luft auf. Es war, als würden die letzten Stunden, Tage, Wochen und Monate einfach weg radiert werden. Oder als würden sie in einem schwarzen Loch versinken. Er sah den Gardisten erschrocken an, denn irgendwann wusste er gar nicht mehr, warum er überhaupt hier auf dem Boden lag.
Der Gardist löste seine Hand jetzt von seinem Kopf, griff nach seinem Arm und half ihm, aufzustehen. Dann hob er das Handy auf, das auf dem Boden lag. Er hielt es einen Moment lang in der Hand, woraufhin es plötzlich wieder ansprang. Er reichte es ihm mit den Worten: »Sollte dich jemand kontaktieren und dich auf deine Aufgabe ansprechen, richte ihm Grüße von Taro aus.« Mit diesen Worten ließ der blau uniformierte Mann ihn einfach stehen, ging an ihm vorbei und bog in die Hauptstraße ein.
Er sah ihm nach, bis er verschwunden war. Und er überlegte. Lange. In dieser Straße lebte jemand, dessen Namen er vergessen hatte. Er spürte es, irgendwo in einem tief vergrabenen Winkel seines Unterbewusstseins. Jemand Besonderes lebte da. Und ihm kam auch der Name Taro irgendwie bekannt vor. Er löste ein entsetzliches, jedoch unerklärliches Schaudern in ihm aus.
Doch bevor er noch länger darüber nachdenken konnte, klingelte sein Handy. Er sah auf das Display. Eine anonyme Nummer. Noch völlig benommen und verstört ging er ran. »Hallo?«
»Gibt es etwas Neues?«, fragte eine unheimliche, strenge Stimme am anderen Ende.
Er sagte nichts. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte. Er dachte nach. Er bemühte sich so sehr, doch sein Kopf war völlig leer. Warum war er hier? Verzweifelt sah er sich um. Es war dunkel und kalt. Und er befand sich in einem Nobelviertel, so wie es aussah. Was zum Geier suchte er in einer Gegend wie dieser? Er fror fürchterlich. Seine Klamotten waren nass und sein Kopf schmerzte. Hatte er einen Unfall gehabt? Konnte er sich deswegen an nichts erinnern?
»Hey, bist du taub?«, schnauzte der Mann am Telefon.
Wieder versuchte er, sich zu konzentrieren. Doch ihm fiel nichts Anderes ein, als: »Da war ein Mann. Ein Mann in einer Uniform.«
Stille. Endlos lange Stille.
»Er sagte«, fuhr er dann irgendwann fort, »ich soll Grüße von Taro ausrichten.«
Wieder war es still. Totenstill. Er hörte ihn nicht einmal atmen.
»Hallo? Was hat das alles zu bedeuten?«
Doch er bekam keine Antwort. Stattdessen fragte die Stimme mit beherrschtem Ton: »Erinnerst du dich an etwas? An irgendetwas?«
Der Mann sah sich wieder um und versuchte, irgendeinen Anhaltspunkt zu finden. Aber da war nichts. Gar nichts. »Woran genau?«, fragte er dann.
Der Mann am anderen Ende seufzte. »Nicht mehr wichtig«, sagte er dann. Er klang wütend. »Geh nach Hause. Du wirst nicht mehr benötigt.«
3
Benommen
Hilar hatte endlich damit aufgehört, im Wohnzimmer auf und ab zu gehen und setzte sich nun auf die Couch. Miriam gegenüber. Sie starrte ihn immer noch an.
Sie sieht mich an, als sei ich ein Alien!, dachte er und richtete diese Gedanken an Lucy und Nikolas. Er fülte sich unter Miriams erstarrten Blicken zunehmend unwohler. Vielleicht hätte es ihm nicht so viel ausgemacht, wenn er ihre Gedanken hätte hören können, um zu erfahren, was in ihr vorging. Aber keiner von ihnen konnte auch nur einen ihrer Gedanken zu fassen kriegen, um sie zu lesen. Nicht mehr. Es waren zu viele. Und sie jagten sich und tobten so schnell durch ihren Kopf, dass selbst Nikolas schwindelig wurde bei dem Versuch, sie zu greifen. Das Einzige, was sie alle deutlich spüren konnten, waren ihre Gefühle. Verwirrung, Schrecken, Faszination, Traurigkeit, Wut, Hass, Ärger, Liebe, Freundschaft … und alles gleichzeitig.
Lucy legte eine Hand auf Miriams Knie und sah sie mitfühlend an. Diese ganze Geschichte zu hören, hatte Miriam völlig überfordert. Und sie konnte es verstehen. Sie war ja noch nicht einmal selbst über die Ereignisse im Sommer hinweg gekommen. Sie hatte nach wie vor Albträume. Und manchmal erschien ihr die Tatsache, dass Nikolas aus einer anderen Welt stammte, immer noch zu verrückt, um wahr zu sein. Obwohl sie schon ein halbes Jahr Zeit gehabt hatte, das alles zu verarbeiten. Wie musste es erst Miriam gehen, die all das innerhalb von ein paar Stunden erfahren hatte? »Willst du heute Nacht hier bleiben?«, fragte sie sanft. Sie wollte ihre Freundin in diesem Zustand nicht nach Hause schicken. Sie wirkte völlig apathisch.