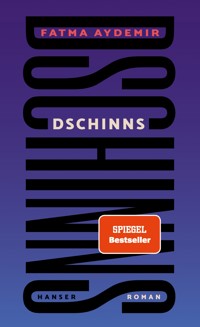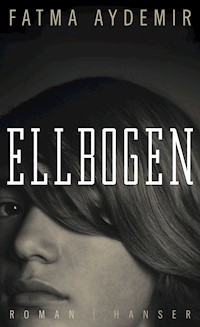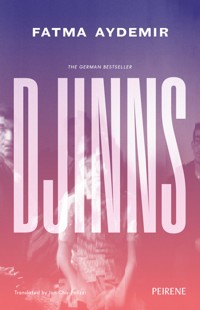10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Das sind die Stimmen, die wir hören müssen. Damit es in diesem Land nicht noch finsterer wird.« Margarete Stokowski Wie fühlt es sich an, tagtäglich als "Bedrohung" wahrgenommen zu werden? Wie viel Vertrauen besteht nach dem NSU-Skandal noch in die Sicherheitsbehörden? Was bedeutet es, sich bei jeder Krise im Namen des gesamten Heimatlandes oder der Religionszugehörigkeit der Eltern rechtfertigen zu müssen? Und wie wirkt sich Rassismus auf die Sexualität aus? Dieses Buch ist ein Manifest gegen Heimat – einem völkisch verklärten Konzept, gegen dessen Normalisierung sich 13 Autor_innen wehren. Zum einjährigen Bestehen des sogenannten "Heimatministeriums" sammeln Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah schonungslose Perspektiven von Denker_innen, die Rassismus und Antisemitismus erfahren. In persönlichen Essays geben sie Einblick in ihren Alltag und halten Deutschland den Spiegel vor: einem Land, das sich als vorbildliche Demokratie begreift und gleichzeitig einen Teil seiner Mitglieder als »anders« markiert, kaum schützt oder wertschätzt. Mit Beiträgen von Sasha Marianna Salzmann, Sharon Dodua Otoo, Max Czollek, Mithu Sanyal, Olga Grjasnowa uvm.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
»So unterschiedlich wir auch sind, liegt unser jeweiliges Wissen um das Aus-dem-Raster-Fallen sehr nah beieinander. Unser Wissen um das Niemals-normal-Sein. Wir sind immer sichtbar. Wir sind Teil einer Community.
Diese Community formiert sich nicht nach sexuellen Präferenzen, Geschlechtsidentitäten oder Religionszugehörigkeit. Wir sind die Anderen, die wissen, dass normal uns nichts zu sagen hat. Normal ist keine Autorität für uns.
Wir werden füreinander da sein, wenn die Mehrheitsgesellschaft zuschaut und nicht eingreift. Wir müssen uns nicht in allem einig sein, wir müssen uns nicht einmal mögen. Aber wir wissen um die Kraft der Allianzen. Also schaffen wir unsere eigenen Strukturen, und wenn wir in Gefahr sind, werden wir uns aufeinander verlassen können.«
Die Autoren
Fatma Aydemir, 1986 in Karlsruhe geboren, ist Kolumnistin und Redakteurin bei der taz. 2017 erschien ihr Debütroman Ellbogen, für den sie mit dem Franz-Hessel-Preis ausgezeichnet wurde. Als freie Autorin schreibt sie u.a. für das Missy Magazine. 2019 ist sie Stipendiatin der Villa Aurora in Los Angeles.
Hengameh Yaghoobifarah, geboren 1991 in Kiel, ist freie_r Redakteur_in beim Missy Magazine und bei der taz, schreibt für deutsch-sprachige Medien, u.a. die Kolumne «Habibitus« für die taz sowie für Spex, an.schläge und für das Literaturjournal politisch schreiben. Yaghoobifarahs Essay Ich war auf der Fusion, und alles, was ich bekam, war ein blutiges Herz erschien 2018.
Fatma AydemirHengameh Yaghoobifarah (Hrsg.)
EureHeimat istunserAlbtraum
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-2042-7
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019Foto: © Valerie-Siba RousparastLektorat: Carla SwiderskiUmschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für uns
Inhalt
Über das Buch und die Autoren
Titelseite
Impressum
Widmung
Vorwort
Anmerkung zum Kapitel
Sichtbar
Anmerkungen zum Kapitel
Arbeit
Anmerkungen zum Kapitel
Vertrauen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Anmerkung zum Kapitel
Liebe
Anmerkung zum Kapitel
Blicke
Anmerkung zum Kapitel
Beleidigung
Anmerkung zum Kapitel
Zuhause
Anmerkungen zum Kapitel
Gefährlich
Privilegien
Essen
Anmerkungen zum Kapitel
Sprache
Anmerkung zum Kapitel
Sex
Anmerkung zum Kapitel
Gegenwartsbewältigung
Anmerkungen zum Kapitel
Zusammen
Zu den Autor_innen
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Vorwort
Die Idee zu diesem Buch entstand im März 2018, zeitgleich mit der Taufe des sogenannten »Heimatministeriums«. So lautete neuerdings die Kurzbezeichnung des einstigen Innenministeriums, das im Zuge der neuen Regierungsbildung in »Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat« umbenannt worden war. Dass an die Spitze dieser neuen Institution ein Politiker berufen wurde, der sich zuallererst für mehr Abschiebungen, eine restriktivere Migrationspolitik und gegen »den Islam« als Teil der deutschen Gesellschaft aussprach, ließ die politischen Beweggründe hinter dieser Umbenennung erkennen.
»Heimat« hat in Deutschland nie einen realen Ort, sondern schon immer die Sehnsucht nach einem bestimmten Ideal beschrieben: einer homogenen, christlichen weißen Gesellschaft, in der Männer das Sagen haben, Frauen sich vor allem ums Kinderkriegen kümmern und andere Lebensrealitäten schlicht nicht vorkommen. In den vergangenen Jahrzehnten diente das Wort Rechtspopulist_innen und -extremist_innen als Kampfbegriff, um all jenen Menschen, die diesem Ideal nicht entsprachen, ihre Existenzberechtigung abzusprechen. So bezeichnet sich die rechtsextreme NPD als »soziale Heimatpartei«. Und alle drei Mitglieder des NSU-Kerntrios gehörten einer militanten Neonazi-Organisation an, die sich »Thüringer Heimatschutz« nannte, bevor sie durchs Land zogen, um (mindestens) neun Migranten und eine Polizistin zu ermorden. »Heimat« ist auch ein integraler Teil der faschistischen NS-Ideologie und somit kaum ohne Zusammenhang zur Shoah denkbar. Und nun wird ein Ministerium danach benannt. Das Wort wird somit normalisiert. Ohne Diskussion. Ohne jegliche Begründung. Einfach so.
Nicht umsonst ist diese »Heimat« ein Albtraum vor allem für marginalisierte Gruppen, aber nicht nur. Deshalb sind zwei Worte im Buchtitel »Eure Heimat ist unser Albtraum« im selben Lila gefärbt wie der Hintergrund: Denn nicht die Herausgeber_innen und Autor_innen dieses Buchs entscheiden, wo das »Wir« endet und das »Ihr« beginnt. Sondern jede_r Leser_in bestimmt für sich selbst: Will ich in einer Gesellschaft leben, die sich an völkischen Idealen sowie rassistischen, antisemitischen, sexistischen, heteronormativen und transfeindlichen Strukturen orientiert? Oder möchte ich Teil einer Gesellschaft sein, in der jedes Individuum, ob Schwarz und / oder jüdisch und / oder muslimisch und / oder Frau und / oder queer und / oder nicht-binär und / oder arm und / oder mit Behinderung gleichberechtigt ist?
Keine Angst, dieses Buch wird sich nicht mit einem von alten weißen Männern geleiteten Ministerium beschäftigen. Stattdessen haben wir 12 herausragende deutschsprachige Autor_innen gebeten, mit uns gemeinsam über oft übersehene, aber sehr existenzielle Aspekte marginalisierter Lebensrealitäten in Deutschland zu schreiben. Herausgekommen sind dabei mal witzige, mal bedrückende, vor allem aber kluge und sehr ehrliche Texte, die hilfreich sein können bei der Frage: Wie halte ich es mit dieser »Heimat«?
Einige Anmerkungen zur Sprache im Buch sind uns wichtig:
Wir verzichten auf das generische Maskulinum (die Leser) und gendern mit dem sogenannten Gap, einer mit Unterstrich gefüllten Lücke (die Leser_innen). Diese Schreibweise bezieht nicht-binäre Personen ein und entzieht sich damit dem hegemonialen Zweigeschlechtersystem.
Außerdem schreiben wir Schwarz als politische Selbstbezeichnung Schwarzer Menschen groß, die soziale Positionierung weiß hingegen klein. Mit Bezug auf Noah Sow, Autorin von Deutschland Schwarz Weiß1, weisen wir darauf hin, dass es sich bei diesen beiden Begriffen weder um Farben noch um »Biologisches« handelt, sondern um politische Realitäten, und dass es leider nicht möglich ist, Rassismus zu überwinden, ohne seine Konstrukte »Schwarze« und »Weiße« zu benennen.
Die aus den USA stammende Formulierung People of Color – im Singular Person of Color, oder kurz: PoC – markiert den gemeinsamen Erfahrungshorizont von Menschen, die nicht weiß sind, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Es handelt sich hierbei um eine politische Selbstbezeichnung. Beim »Color« geht es weder (ausschließlich) um Hautfarbe, noch kann der kolonialrassistische Begriff »farbig« als Synonym verwendet werden.
Schließlich wollen wir all jenen danken, ohne deren Engagement, Wissen und Inspiration dieses Buch nicht hätte entstehen können. Allen Autor_innen, deren Namen in diesem Buch an verschiedenen Stellen auftauchen, aber auch den unzähligen nicht namentlich genannten Akademiker_innen, Aktivist_innen, Care-Arbeiter_innen, Denker_innen, Künstler_innen, die seit Generationen für eine gleichberechtigte Gesellschaft kämpfen und denen wir es zu verdanken haben, dass wir 2019 diesen Essayband veröffentlichen können.
Fatma Aydemir & Hengameh Yaghoobifarah,
Berlin im Januar 2019
Anmerkung zum Kapitel
1. Noah Sow: Deutschland Schwarz Weiß, BoD 2018.
Sichtbar
von Sasha Marianna Salzmann
Ich werde nie wissen, was es heißt, unsichtbar zu sein. Ich werde nie wissen, wie es ist, unvorsichtig sein zu können beim Küssen im Park, einfach draufloszuknutschen. Was es heißt, durch die Straßen zu streifen und nicht damit rechnen zu müssen, dass jemand im Vorbeigehen meine Haare zu berühren versucht. Wie es ist, sich nicht ständig in Selbstgesprächen zu beschwichtigen, wenn man mehrmals am Tag gefragt wird, ob man Deutsch verstehe. Mich in der Menge aufzulösen, ist keine Option für mich. Ich gehöre gleich mehreren Minderheiten an; das kaschieren zu wollen, birgt für mich größere Gefahren, als meine Positionen zu benennen.
Your silence will not protect you2, heißt ein Essayband von Audre Lorde, in dem sie gleich in mehreren Texten die destruktive Kraft von (selbst) auferlegtem Schweigen herausarbeitet: Der einzige Weg, der verhindert, dass das, was man ist, gegen einen verwendet wird, sei das Sprechen über sich, bevor es andere tun. Andernfalls blieben die Angriffe und Beurteilungen der anderen in den Grauzonen der gesellschaftlichen Wahrnehmung, und man wird danach behaupten können, man habe von nichts gewusst.
Ich denke an die Jüdinnen und Juden, die Anfang des 20. Jahrhunderts so damit beschäftigt waren, sich zu assimilieren, dass Hitler sie daran erinnern musste, dass sie nie dazugehören würden und nie erwünscht wären. Diese Menschen wurden jüdisch durch Diskriminierung, durch Ausgrenzung, durch ihren Tod. Viele von ihnen meinten, wenn sie sich als Teil der christlich-deutschen Gesellschaft verstünden, dann seien sie es auch. Einige glaubten der antisemitischen Propaganda und schämten sich ihrer selbst: »Wer sich assimilieren konnte oder wollte, für den war alles, was an den Moschus des Judentums erinnerte, eine Art hässlicher Atavismus, wie ein Fischschwanz, den man noch hinter sich herzieht, nachdem man den Schritt aufs Festland geschafft hat«, schreibt Maria Stepanova in ihrem Roman Nach dem Gedächtnis3. Das Ergebnis ist bekannt. Assimilation führt ins Verderben. Warum versuchen wir also dazuzugehören? Welche Versprechen birgt es, so zu sein wie alle, das »Normalsein«? Und kann man nach den Erfahrungen des letzten Jahrhunderts wirklich glauben, dass man als Minorität in einer Gemeinschaft geschützt wird, wenn man leise ist und sich so unauffällig wie möglich verhält?
Zumindest im jüdischen Kontext bedeutet das Nicht-Auffallen und Nicht-Benennen, dass man nicht vorkommt. Wenn ich meine Kultur nicht feiere, existiert sie nicht, versuchte ich der Frau, die sich mir als Christin vorstellte, zu erklären, als sie mich nach einer Lesung darauf hinwies, dass für sie die Art, wie ich meinen Davidstern gut sichtbar über dem Shirt trage, Exhibitionismus sei.
An diese Frau musste ich denken, als ich in dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes las, dass 43,8 Prozent der deutschen Bevölkerung voll und ganz oder mindestens tendenziell dem Satz zustimmen: »Homosexuelle sollten aufhören, so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen.« Für die meisten dieser Gruppe ist ihre eigene Sexualität als Norm markiert; sie fordern mein Schweigen, meine Unauffälligkeit und damit mein Verschwinden mit dem Verweis darauf, dass man über Homosexualität nicht mehr sprechen müsse, denn Homos seien längst überall angekommen. Selbst hochrangige Politiker_innen seien offen homosexuell und stünden mit ihrem Lebensstil für die Toleranz der westlichen, christlichen Gesellschaft. Sieht man sich aber die Geschichte von Queerness genauer an, wird deutlich, wie ungesichert und immer aufs Neue umkämpft dieses Feld ist: Das in Deutschland 1872 eingeführte und von den Nazis 1935 verschärfte Homosexuellengesetz unter dem § 175, das Männer für gleichgeschlechtliche Akte mit Zuchthaus bestrafte, wurde erst 1994 abgeschafft. Die Rehabilitierung aller Verurteilten und ihrer Sexualpartner folgte erst 2017, viele der Betroffenen waren längst tot.
Die sogenannte Ehe für alle wurde in Deutschland zwar 2017 eingeführt, wird aber nach wie vor kontrovers diskutiert und bleibt umstritten.
Erst 2018 nahm die Weltgesundheitsorganisation Transidentitäten von der Liste der Geisteskrankheiten. Trotzdem müssen diese Menschen zwei voneinander unabhängige psychiatrische Gutachten vorlegen, wenn sie eine Hormonbehandlung beginnen wollen. Das aktuell verabschiedete Gesetz zur dritten Geschlechtsoption, das neben »männlich« und »weiblich« auch den Eintrag »divers« vorsieht, zielt auf Intersexuelle, aber nicht auf Transidente und Nicht-Binäre. Ich selber, als nicht-binäre Person, bin mit dem Gefühl aufgewachsen, dass Menschen die Art, wie ich mich selbst wahrnehme, für eine psychische Störung halten.
Gleichzeitig stimmt es, dass Lesben- und Schwulenrechte mittlerweile eine relevante Spielkarte in politischen Machtkämpfen darstellen. Seinem Selbstverständnis nach steht Europa für Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten. Nicht zufällig lässt jedes Land, das in die EU will, gleich nach der Bewerbung um den Beitritt eine Gay Pride Parade zu. Meistens zum ersten Mal und unter Einsatz eines massiven Polizeiaufgebots, das die Demonstrierenden und Feiernden vor dem wütenden Mob schützen soll. Nicht umsonst nennt uns Russland, das sich in radikaler Opposition zu der Union sieht, in der wir leben: Gayropa.
Und so gibt es hierzulande das Märchen vom guten Schwulen. Der a) weiß ist, b) dasselbe begehrt wie jede heterosexuelle Person angeblich auch: einen Partner, ein Haus, Autos und Karriere. Einer von ihnen, Jens Spahn, bewarb sich zum Zeitpunkt, als ich an diesem Text schrieb, um den Vorsitz der aktuell regierenden Partei des Landes. Seine Sexualität verschweigt er nicht, allerdings gibt er auch zu, dass er zu seinem privaten wie öffentlichen Coming-out durch innerparteiliche Machtkämpfe gezwungen wurde. Außerdem wird er nicht müde zu betonen, dass er keine »schwule Klientelpolitik« machen will. Auf keinen Fall will er damit auffallen, dass er schwul ist. Sein Markenzeichen ist sein Hass auf die Muslim_innen: Er will Burkas verbieten, wettert gegen in Unterhosen duschende muslimische Männer in Fitnessclubs und zieht Parallelen zwischen der religiösen Herkunft von Tätern und ihren Verbrechen. Wenn es allerdings darum geht, Argumente für seine Demagogie zu finden, kommt Spahn die eigene sexuelle Orientierung gerade recht: Er behauptet, Angst vor dem Islam zu haben, weil man ihn in einem muslimischen Land wegen seiner Homosexualität von Türmen schubsen würde. Auf die Nachfrage eines Journalisten, wie es um die Akzeptanz der Ehe für alle in dem kleinen christlichen Ort steht, aus dem Spahn kommt (Ottenstein im Westmünsterland), antwortete er: »Sicherlich gibt es Vorbehalte. Aber nur weil jemand Vorbehalte hat, ist er deshalb nicht automatisch homophob.«4
Demnach wären die Hardliner in Ungarn, Polen, Bayern und den Niederlanden auch nicht homofeindlich, vermutlich auch nicht die eine Million Demonstrant_innen gegen die Ehe für alle, die in Paris vor wenigen Jahren auf die Straße gingen. Nur Moslems sind in Jens Spahns Denkraum Feinde der Schwulen.
Nationale, patriotische, schwule Retter des Abendlandes gibt es zur Genüge. Diese Haltung ist keine Erfindung Spahns. Mit dem Begriff des Homonationalismus5 beschreibt die Gender-Theoretikerin Jasbir Puar, wie Mitglieder ausgegrenzter Minderheiten ihren (Karriere-)Weg in einer Mehrheitsgesellschaft machen: Ökonomisch starke, meist weiße Homosexuelle treten als Vertreter_innen europäischer Errungenschaften auf, die sie gegen vermeintlich homofeindliche Kulturen verteidigen müssen.
Homonationalismus ist selbstverständlich nicht nur den Schwulen vorbehalten: Alice Weidel behauptete unlängst in einer Rede vor Mitgliedern ihrer Partei »Alternative für Deutschland«, dass sie schon Millionärin wäre, wenn sie nur einen Cent für die immer wieder gestellte Frage verlangt hätte, wie sie als lesbische Frau (mit einer Partnerin aus Sri Lanka und zwei adoptierten Kindern, alle leben in der Schweiz) eine rechtsnationale Partei repräsentieren könne. Eine Partei, die in ihrem Programm wenig Konkretes bietet außer Hass auf Minderheiten. Hass auf den angeblichen Genderwahn. Hass auf »den Islam«. You name it.
Weidels Antwort ist vorhersehbar und funktioniert nach demselben Prinzip wie die Argumentation von Jens Spahn: Sie sei natürlich nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Homosexualität in der AfD.6
Ich beobachte die Zuhörer_innenschaft, vor der Alice Weidel die zwölfminütige Rede zu ihrer sexuellen Orientierung hält. Sie jubelt. Schrumpelige Opas halten den Daumen hoch. Frauen applaudieren mit glänzenden Augen und sind kurz vor Standing Ovations. Ich frage mich, was wäre, wenn dieselbe Alice Weidel jetzt sagen würde: »Ihr Lieben, der Wohlstand unserer Gesellschaft basiert auf massiver Ausbeutung dieses Planeten und seiner Völker, und darum stehe ich heute hier und fordere die konsequente Umverteilung der Güter und offene Grenzen.« Ich stelle mir vor, wie die Frau mit dem toupierten kastanienbraunen Haar, die ihre Lippen über die Ränder hinaus mit bräunlichem Rot überschminkt hat, ihren Sitznachbarn mit dem Ellbogen anstößt und so, dass alle im Raum es hören können, flüstert: »Sie ist eine Lesbe, oder?« Woraufhin der Herr im gestreiften Hemd und mit rahmenloser Brille, die ihm eng auf der Nasenwurzel sitzt, sein Kinn noch höher in die Luft reckt, seine Arme aus der Verschränkung löst und angewidert die Augen verdreht, vielleicht sagt er auch etwas mit abfällig verzogenem Gesicht.
Ich frage mich, ob Alice Weidel wirklich denkt, dass diese Leute sie als Homosexuelle akzeptieren. Oder ob sie weiß, dass ihr Publikum sie für den Hass feiert, den sie verkörpert und der lange unter dem Deckel politischer Floskeln brodelte und nun in den expliziten Ansagen der AfD offen zutage tritt. Hass auf das Migrantische, auf die »Flüchtlinge«, die »Türken«, die »Araber«, ebenso wie Antisemitismus sind hoch im Kurs bei der »Alternative für Deutschland«, die nach jetzigem Stand drittstärkste Partei in diesem Land ist.
Natürlich versteht Alice Weidel, dass die Menge, die ihr applaudiert, ihr Lesbisch-Sein als Alibi gegen mögliche Diskriminierungs- und Rassismusvorwürfe benutzt. Natürlich weiß Jens Spahn, dass ihm so manches katholische Gemeindemitglied, auch in seinem geliebten Münsterland, in seiner Kindheit eine Behandlung in der Psychiatrie verordnet hätte, den jüngsten Empfehlungen des Kirchenoberhaupts Franziskus folgend.
Alle sogenannten Weltreligionen werden zur Ausgrenzung benutzt, um Homosexuellen- und Frauenfeindlichkeit zu begründen. Da erbringt weder eine liberale Imamin noch eine queere Rabbinerin oder ein offen schwul lebender Pastor den Gegenbeweis. Doch darum geht es weder Spahn noch Weidel. Beide wissen, dass es mit rechten populistischen Parolen schneller auf der Karriereleiter nach oben geht als mit Debatten über das komplexe Thema der Mehrfachdiskriminierung.
Diese beiden Homonationalist_innen besetzen Top-Positionen in der politischen Landschaft Deutschlands zu einem Zeitpunkt, an dem die Wirtschaft floriert, die Arbeitslosigkeit auf einem Tiefstand ist, die Kriminalitätsrate niedrig und die Anzahl der Asylbewerber_innen unter der festgelegten Obergrenze bleibt. Die ansonsten üblichen Erklärungsversuche für den Rechtsruck in Deutschland sind also ausgehebelt.
»Leider scheint es viel einfacher zu sein, menschliches Verhalten zu konditionieren und Menschen dazu zu bringen, sich auf eine völlig unvorhergesehene und entsetzliche Weise zu verhalten, als irgendjemanden davon zu überzeugen, aus der Erfahrung zu lernen, das heißt mit Denken und Urteilen beginnen, anstatt Kategorien und Formeln anzuwenden«, sagt Hannah Arendt in ihrem Essay Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur?7
Gewaltdynamiken, das machen soziologische Untersuchungen deutlich, weisen nicht als Pfeil von Täter zu Opfer, sondern haben die Form einer Triangel. Diskriminierung, Ausgrenzung und Zerstörung finden demnach in einem Spannungsfeld von drei Parteien statt: die angegriffene Person, der_die Angreifer_in und als Drittes die Gruppe, die sich nicht zu der angegriffenen Person bekennt und sich nicht schützend vor sie stellt. Die wegsieht. Die behauptet, nichts sei geschehen. Die versucht, das Geschehene unkenntlich zu machen, und dem Opfer zuredet, es solle kein Aufsehen erregen, indem es den Übergriff publik macht. Für die angegriffene Person kommt das unmittelbare Übel von dem_der Angreifer_in, das nachhaltige jedoch von der Gruppe, die wegschaut. Für sie ist es keine Überraschung, von jemandem attackiert zu werden, der voller Hass auf ihren Lebensstil ist. Dass aber Menschen zuschauen und nicht eingreifen, nicht helfen, vielleicht im Nachhinein sogar das Geschehene leugnen, verursacht die Verletzung, die sie in ihrem Grundvertrauen erschüttert.
Diese Erfahrung wird in ein Wissen überschrieben, mit dem die Person sich zukünftig durch die Welt bewegt. Dieses Wissen hat für immer Auswirkungen darauf, wie ein marginalisierter Körper sich zu dieser dritten Gruppe, die sich als Mehrheit versteht, verhalten wird. Es geht nicht darum, dass diese Mehrheit nicht selber angegriffen hat – es sind immer Einzelne, die die Aggression ausführen –, aber sie hat auch nicht verteidigt. Denn die Angriffe der Einzelnen entspringen den Gewaltstrukturen dieser dritten Gruppe, der Mehrheit.
38,4 Prozent der in Deutschland Befragten empfinden homosexuelle Küsse in der Öffentlichkeit als unangenehm. 43,8 Prozent wollen mich unsichtbar. Seit den Kindertagen, in denen ich in Kleidung gesteckt wurde, die mich zu verformen versuchte, seit der Pubertät, in der sich mein Körper auf eine Weise veränderte, die sich für mich falsch anfühlte, allerspätestens seit dem ersten Coming-out, von dem ich noch nicht wusste, dass es ein permanentes werden wird, bin ich eine andere. Ich brauche keine vermeintliche Integration in diskriminierende Strukturen. Ich kenne die Vereinnahmungsmechanismen, ich kenne diese Teile-und-herrsche-Strategie schon als Jüdin.
So wie die Homosexuellenrechte gerne zum Ausweis eines liberalen Europas gemacht werden, so steht Europa auch für den Schutz der Jüdinnen und Juden. Die Erfindung trägt den Namen »christlich-jüdisches Abendland«. Trotz ansteigendem Antisemitismus (immerhin meint, laut der Leipziger Autoritarismus-Studie von 2018, jeder Zehnte in Deutschland, dass »Juden etwas Besonderes an sich haben und nicht so recht zu uns passen«) bietet das Jüdisch-Sein in Deutschland eine Menge Privilegien, wenn man sich in den vorgegebenen Koordinaten bewegt: Man hat den Deutschen entweder vergeben, oder man ist der unversöhnliche Aggro-Jude, der den Deutschen nie vergeben wird.
Beide Positionen kreisen, einander spiegelnd, um die Shoah, was bedeutet, dass der Jude in Deutschland ohne den Versuch seiner Vernichtung nicht denkbar ist. In den Neunzigerjahren importierte Deutschland den Juden aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion, um die ein halbes Jahrhundert zuvor entstandenen Lücken zu füllen, und gab ihm das Prädikat »Kontingentflüchtling«. Gemeint ist ein weißer Mittelschichtler, der säkular lebt oder seinen Davidstern an einer unauffälligen Kette unter dem Hemd trägt. Am 9. November darf er seine Kippa anlegen und wird ab und an zum Thema Antisemitismus befragt, wenn peinliche Comedians sich wieder im Ton vergreifen oder wenn nach Gründen für Einwanderungsobergrenzen gesucht wird.
Seit die Debatten um Migration aus muslimischen Ländern die Medien dominieren, wird der Jude – so wie der Schwule und die Lesbe – interessant, sofern er bereit ist, gegen den Moslem auszusagen (»Meine lesbische Nachbarin / mein schwuler Nachbar / mein jüdischer Nachbar will auch keine Syrer als Nachbarn«). Als Belohnung winkt die Aussicht auf Zugehörigkeit, also die Integration in die Mehrheitsgesellschaft. Dieser Mechanismus findet seine perverse Zuspitzung in einer Art Judeo-Nationalismus, der sich neuerdings unter dem Namen »Juden in der AfD« formiert. Zwar hat diese Gruppe keine nennenswerte Mitgliederzahl, wird jedoch medienwirksam in Szene gesetzt.
Schon vor einiger Zeit fragte mich eine Wochenzeitung an, ob ich darüber berichten wolle, wie es mir als Jüdin mit der alarmierenden gesellschaftlichen Veränderung durch die große Zahl muslimischer Einwanderer gehe. Ich bot im Gegenzug an, über das Zusammenleben mit meinen syrischen Mitbewohnern zu schreiben: zwei jungen Männern, damals erst seit einem beziehungsweise seit zwei Jahren in Deutschland. Ich stellte mir einen Text vor, in dem ich vom Besuch meiner Mutter in unserer damaligen Wohngemeinschaft berichten würde. Von meinen Ängsten vor ihren möglichen antimuslimischen Vorurteilen und vor unpassenden Bemerkungen der beiden Männer meiner Mutter gegenüber. Ich wollte von meiner eigenen Voreingenommenheit erzählen und wie sie sich in immer neuen Konfliktfantasien Ausdruck verschaffte, während in der Realität meine Mutter, Mazen und Yazan sich lebhaft über die Zustände in Asylheimen austauschten – über die immer gleichen karierten Hemden der Aufseher, über den Geruch in den Gemeinschaftsküchen, darüber, wie lange es dauert, bis die Beamten auf den Ausländerämtern den Namen richtig aussprechen. Beziehungsweise, versicherte meine Mutter den Jungs, dieser Augenblick würde nie kommen. Sie lachten viel.
Ich stand hinter der Küchenzeile und schaute die drei von der Seite an: eine Ärztin aus Moskau, bereits seit über zwanzig Jahren in Deutschland, mittlerweile mit einem deutschen Pass, einwandfreien Sprachkenntnissen, schwarzen Locken, breiten Wangenknochen, ein Aussehen, das Menschen immer wieder das Recht zu geben scheint, sie zu ihrem Migrationshintergrund zu befragen. Und zwei junge Männer aus Syrien, beide kaum volljährig. Die Bezeichnung für sie lautet »Flüchtling«, der Aufenthaltsstatus ist unbefristet. Ihre Sprachschule fängt früh an, manchmal verschlafen sie, manchmal gehen sie nicht hin, weil sie andere, die gerade angekommen sind und sich noch weniger auskennen, auf Ämter begleiten.
An diesem Nachmittag bei uns in der WG-Küche echauffierte sich meine Mutter darüber, dass sie mir einen Davidstern habe kaufen wollen, aber keines der Juweliergeschäfte in der niedersächsischen Stadt, in der sie wohnt, einen vorrätig gehabt habe. Ich glaube, es war Yazan, der sofort aufschrie: »Abla, mein Onkel hat um die Ecke einen Juwelierladen, komm vorbei, wir machen dir einen Davidstern. So viele du willst.«
Erst nachdem die Wochenzeitung meine Geschichte abgelehnt hatte, fiel mir der Schluss für meinen Text ein: Ich hätte erzählt, wie ich mit meinen beiden Mitbewohnern im Schwuz tanzen war, dem legendären Schwulenclub in Berlin-Neukölln. Sie sind zwar hetero, stehen aber trotzdem auf gute Musik.
Was machen Alice Weidel, Jens Spahn und die »Juden in der AfD« mit unserer muslimisch-jüdisch-queeren Tanzkultur? Mit unseren Freundschaften? Mit unseren geteilten Geschichten?
Wo waren die 43,8 Prozent der Bevölkerung, die voll und ganz oder mindestens tendenziell dem Satz zustimmten, »Homosexuelle sollten aufhören, so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen«, als meine Freundin und ich auf der Kottbusser Brücke in Kreuzberg angepöbelt wurden, als ich die Beleidigung »scheiß Lesben« nicht runterschlucken wollte, sondern zurückschrie und der Mann auf mich losging? Ich glaube, sie waren da. Ich glaube, sie haben weggeschaut. Geholfen haben mir zwei Passanten, die phänotypisch unter das Raster »Moslem« fallen. Ich kenne sie nicht weiter, wir haben uns, nachdem sie den Pöbler weggejagt hatten, kaum unterhalten. Aber ich wusste, dass die beiden, als sie mir und meiner Freundin eine Zigarette anboten, das Gefühl der Verletzbarkeit, das wir in dem Moment empfanden, kannten. So unterschiedlich wir auch sind, liegt unser jeweiliges Wissen um das Aus-dem-Raster-Fallen sehr nah beieinander. Unser Wissen um das Niemals-normal-Sein. Wir sind immer sichtbar.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.