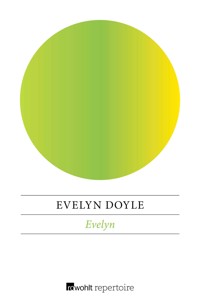
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die wahre Geschichte eines kleinen Mädchens, das seine Mutter verliert und von seinem Vater und den fünf kleinen Brüdern getrennt wird. Es ist die Geschichte eines Vaters, der seine Kinder zu sehr liebt, als dass er sie der Obhut eines katholischen Waisenhauses überlassen könnte. Es ist die Geschichte eines leidenschaftlichen Kampfes für eine menschliche Rechtsprechung und gegen die rigide katholische Moral im Irland der fünfziger Jahre – die Geschichte eines Kampfes für die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Evelyn Doyle
Evelyn
Aus dem Englischen von Katja Henkel
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Dies ist die wahre Geschichte eines kleinen Mädchens, das seine Mutter verliert und von seinem Vater und den fünf kleinen Brüdern getrennt wird. Es ist die Geschichte eines Vaters, der seine Kinder zu sehr liebt, als dass er sie der Obhut eines katholischen Waisenhauses überlassen könnte. Es ist die Geschichte eines leidenschaftlichen Kampfes für eine menschliche Rechtsprechung und gegen die rigide katholische Moral im Irland der fünfziger Jahre – die Geschichte eines Kampfes für die Liebe.
Über Evelyn Doyle
Evelyn Doyle, geboren 1946, ist das älteste der sechs Kinder von Desmond Doyle und seiner ersten Frau. Nach dem Urteil im Sorgerechtsprozess um seine Kinder zog der Vater mit seiner neuen Frau Jessie nach Manchester in England. Evelyn Doyle arbeitete dort als Verkäuferin, Busschaffnerin, Weberin, Krankenschwester und später als Polizistin. Sie hat einen Sohn und einen Enkel. Ihr Vater starb 1986.
Inhaltsübersicht
Prolog
Oben ohne am Strand: ich mit drei Jahren,als unsere Mutter noch bei uns war.
Ich erkannte sie sofort. Wie auch nicht? Sie war schließlich meine Mutter.
Es war im Jahr 1967, als ich mich von Manchester nach Glasgow aufmachte, um sie zum ersten Mal nach dreizehn Jahren wieder zu sehen. Die Reise schien ewig zu dauern, und als sich der Zug Glasgow näherte, begannen meine Nerven zu flattern. In mir kämpften Angst, Freude und Scheu miteinander. Drei Pfarrer der Anglikanischen Kirche waren in dem Waggon zweiter Klasse meine Reisegefährten. Ich rang mit den Tränen und hoffte, dass sie meine Verzweiflung nicht bemerken würden. Aber ich hätte mir keine Sorgen zu machen brauchen. Als ich losheulte, beachteten sie mich überhaupt nicht.
Der Zug wurde langsamer, und ich spielte einen Augenblick mit dem Gedanken, einfach sitzen zu bleiben. Ich ließ mir viel Zeit, meine Sachen einzusammeln. Die Geistlichen verließen bereits das Abteil. Doch ich wollte erst meine Fassung zurückgewinnen. Mir schwirrten tausend Fragen durch den Kopf. Was sollte ich ihr sagen? Hatte ich ihr wirklich vergeben? Würde ich ihre Erklärungen akzeptieren? Würde sie überhaupt welche abgeben? Ich war acht, als meine Mutter mich zum letzten Mal im Heim besuchte, danach hatte ich sie nie wieder gesehen.
Ich sprang auf den langen, schmutzigen Bahnsteig. Verwirrt vom Gedränge und vom Lärm, blieb ich reglos stehen und suchte die Menge mit den Augen ab, bis ich sie entdeckte. Eine kleine, etwas übergewichtige Frau mittleren Alters. Ich wusste einfach, dass sie es war. Als sie mich erblickte, winkte sie zaghaft. Ich winkte zurück und ging auf sie zu. Wir umarmten uns fest, bis ich mich schließlich losmachte.
«Hallo, wie geht es dir?»
Mir fiel nichts Besseres ein. Sie antwortete, dass es ihr gut gehe, sie froh sei, mich wiederzuhaben, und dass jetzt alles gut werden würde.
«Wir haben so viel zu plaudern!»
Plaudern? Das klang, als ob sie eine alte Schulfreundin wieder getroffen hätte. Worüber wollte sie wohl plaudern? Über die neueste Mode oder Popmusik, oder vielleicht wollte sie lieber darüber diskutieren, welcher Nagellack am besten zum Lippenstift passte?
«Rauchst du?», fragte sie.
Ich nickte. So hatte ich mir unser Treffen nicht vorgestellt. Sie winkte ein Taxi heran. Der gut gelaunte Taxifahrer stellte meine Tasche in den Wagen und half ihr hinein.
«Wohin, Mädchen?»
Ich unterdrückte ein Lachen. Er meinte es gar nicht witzig, wenn er meine Mutter «Mädchen» nannte. Wir waren schließlich in Glasgow. Sie nannte ihm ihre Adresse, und während der zwanzigminütigen Fahrt unterhielten wir uns über Nichtigkeiten und qualmten sein Taxi voll. Schließlich hielten wir vor einer Doppelhaushälfte mit Sozialwohnungen aus den Fünfzigern. Mir fiel auf, dass der Garten ein wenig ungepflegt war und die Gardinen nicht so weiß und glatt wirkten wie die der Nachbarhäuser. Sie führte mich zu der blauen Eingangstür. Bevor sie den Schlüssel in das Messingschloss steckte, hielt sie kurz inne. Schweißperlen hatten sich über ihrer Oberlippe gebildet.
«Was ist los?», fragte ich.
Sie schien etwas sagen zu wollen, änderte dann aber offenbar ihre Meinung, holte tief Luft und öffnete die Tür.
«Mammy!»
Ein wunderhübsches fünf- oder sechsjähriges Kind mit strahlend blauen Augen rannte auf meine Mutter zu, die es hochnahm und auf die Stirn küsste.
«Wer ist das, Mammy?»
Das Mädchen betrachtete mich über die Schulter meiner Mutter hinweg, die großen blauen Augen unverwandt auf mich gerichtet. Sie erinnerte mich an jemanden, aber mir fiel nicht ein, an wen. Meine Mutter stellte sie wieder auf den Boden und gab ihr einen sanften Klaps.
«Wo ist der Rest?», fragte meine Mutter. «Sind alle da?»
Ich folgte ihr. Drei weitere Kinder spielten im unordentlichen Wohnzimmer – ein etwa dreizehnjähriger dunkelhaariger Junge, der praktisch genauso aussah wie einer meiner eigenen Brüder, ein pummeliges hübsches Mädchen, etwa zwölf Jahre alt, und ein weiterer Junge, der zehn oder elf sein mochte. Sie alle drehten sich um und sahen mich an. Auch diese Kinder kamen mir vertraut vor; das Gefühl, sie irgendwo schon einmal gesehen zu haben, war überwältigend. Der ältere Junge starrte mich, wie ich glaubte, hasserfüllt an.
Ich lächelte sie an. Ich mochte sie sofort und wollte, dass sie mich auch mochten. Niemand hatte mir erzählt, dass meine Mutter eine neue Familie hatte, aber jetzt wusste ich es. Diese Kinder waren meine Halbbrüder und Halbschwestern, und auf einmal war ich froh, meine Mutter wiedergefunden zu haben.
Sie nannte mir ihre Namen. «Und das ist meine Kleinste, Angela.»
Sie kitzelte die Kleine, die vor Vergnügen quietschte, unterm Kinn. Ich wartete darauf, dass sie mich den Kindern vorstellte – ich dachte, sie würden genauso begeistert sein wie ich –, als ein Mann, den ich wiedererkannte, von hinten aus der Küche hereinkam und mir seine Hand hinhielt. Ich schüttelte sie.
«Hallo, Gerry», sagte ich.
Gerry war der Cousin meines Vaters. Der Mann, mit dem meine Mutter vor all den Jahren fortgelaufen war.
Er warf meiner Mutter einen unbehaglichen Blick zu. Sie mahlte mit den Kiefern, ihre Lippen hatte sie zu einer harten, dünnen Linie zusammengepresst. Fast unmerklich schüttelte sie den Kopf.
«Wie wäre es mit einer schönen Tasse Tee?», fragte sie dann.
Sie wollte wissen, ob ich Zucker nähme, und forderte dann Gerry auf, den Tee zuzubereiten. Er war bereits wieder auf dem Weg in die Küche, als ihn ihre nächsten Worte abrupt stehen bleiben ließen.
«Kinder», sagte meine Mutter. «Das ist Evelyn. Ich habe auf sie aufgepasst, als sie noch ein kleines Mädchen war und ihre Mutter im Krankenhaus lag.»
Gerry wandte sich um und starrte sie an. Wut verzerrte seine weichen Gesichtszüge. Dann ging er schnell in die Küche und warf die Tür hinter sich zu.
Die drei jüngsten Kinder lächelten und sagten hallo, doch der mürrische ältere Junge starrte seine Mutter an und verließ dann das Zimmer. Meine Mutter sah mich an. Sie hatte mich offen verleugnet, doch in ihren Augen entdeckte ich weder Scham noch die Bitte um Entschuldigung. Ich war ihr erstgeborenes Kind, und sie hatte mich zum zweiten Mal im Stich gelassen.
Kapitel 1
Das einzige Foto von uns allenmit unserer Mutter. Es entstand kurz bevorsie uns verließ.
Das Jahr 1953 begann genauso schlimm, wie es enden sollte. Daddy lag im Krankenhaus. Wir wussten nur, dass mit ihm etwas nicht stimmte, aber nicht, was es war. Wir hatten Angst, dass er sterben würde, und beteten vor dem Zubettgehen inbrünstig für ihn. Eines Tages ging ich nach der Schule allein in die Kapelle. Den Penny, den es kostete, eine Kerze anzuzünden, hatte ich nicht, aber ich versprach Gott, ihn zurückzuzahlen, sobald ich reich wäre, und stellte eine der größten Kerzen für Daddy auf. Ich blieb dort nicht lange, schließlich musste ich damit rechnen, dass sich jemand über die große Kerze wunderte und sofort ahnte, was ich getan hatte. Auf Zehenspitzen lief ich zur Tür und schlich hinaus, in dem beruhigenden Wissen, dass es Daddy bald besser gehen würde.
Ich rannte, so schnell ich konnte, die Basin Street hinunter und erreichte in Windeseile die Eisenbrücke, die über den Kanal führte. Die Stufen waren rutschig, aber ich lief einfach weiter. Ich hatte diese Brücke in den letzten vier Jahren jeden Tag überquert. Wir wohnten in den Fatima Mansions auf der anderen Seite des Kanals. Der Staat hatte diese Wohnanlage Anfang der fünfziger Jahre für die vielen Dubliner gebaut, die zuvor in Slums gelebt hatten. Die Fatima Mansions bestanden aus grauen, vierstöckigen Blöcken, die von A bis K gekennzeichnet waren und um deren Außenwände Balkone verliefen. Unsere Wohnung lag im ersten Stock des Hauses J. Einige Jungs aus unserem Wohnblock angelten vom Ufer aus, und ich hielt an, um sie zu beobachten. Da ertönte ein Schrei.
«Jeee-sus, sieh dir das an!»
Mickey Sullivan deutete auf den Kanal. Aller Augen folgten seinem Finger, und dann rannten die Jungs los. Ein großes totes Schwein trieb auf der Seite liegend auf uns zu, sein rosa Körper war aufgedunsen und seine kurzen, dicken Beine nach vorn gestreckt. Ich konnte ein weit aufgerissenes blaues Auge erkennen. Es blickte mich direkt an, als das Tier unter der Eisenbrücke durchtrieb. Ich bekreuzigte mich und sauste zurück über die Brücke zur Kapelle, rannte hinein und blies die Kerze aus. Eine betende alte Frau sah mich wütend an, dann drohte sie mir mit der Faust.
«He, du kleine Göre, du! Möge Gott dir vergeben.»
Ich hoffte, er würde. Ich beschloss, beichten zu gehen, noch bevor ich im Mai die Erstkommunion hätte, damit ich keine Leichen mehr sehen musste.
Daddy blieb lange Zeit im Krankenhaus. Wir erfuhren, dass er eine Bleivergiftung hatte. Das kam von den Farben, die er bei der Arbeit benutzte. Ich glaubte schon nicht mehr, dass Gott unsere Gebete erhörte. Mammy war selten zu Hause gewesen, seit Daddy im Krankenhaus lag. Mrs. Sullivan, die nebenan wohnte, sagte, Mammy solle sich was schämen, ihre Babys einfach sich selbst zu überlassen.
«Die Schlampe sollte sich um ihre Kinder kümmern», sagte sie zu Mrs. Moore, «und nicht mit irgendeinem anderen Mann rummachen!»
Die beiden Frauen beugten sich über das Geländer des Balkons und beobachteten, wie ihre Kinder auf der Straße spielten.
«Aber andererseits, Mrs. Sullivan, wir wissen nicht, ob sie einen anderen Mann hat, oder? Wenn es mir auch bei Gott ein Rätsel ist, wohin sie jeden Tag geht.»
Mrs. Moore bekreuzigte sich, zog dann eine Packung Sweet Afton aus ihrer schmuddeligen Schürzentasche und bot Mrs. Sullivan eine Zigarette an. Zufrieden pafften sie eine Weile vor sich hin.
«Wie auch immer», sagte Mrs. Sullivan, «wenn die guten Leute bei Vincent de Paul, wo sie immer mittwochs um Essen und Hilfe bettelt, wüssten, wofür sie das Geld ihres Mannes ausgibt, dann würde man sie verjagen, und die armen kleinen Babys müssten mit Sicherheit verhungern.»
Mrs. Moore lauschte aufmerksam.
«Und der arme Dessie liegt auf seinem Hintern im Krankenhaus», fuhr Mrs. Sullivan fort. «Man sagt, er habe die Bleivergiftung.» Beide bekreuzigten sich, als das Wort Krankenhaus fiel. «Egal, ich bin nicht so eine, die Gerüchte verbreitet. Ich sollte mich lieber an Joes Abendessen machen.»
Mrs. Sullivan drückte ihre Zigarette aus und ließ die Kippe in ihrer Schürzentasche verschwinden. Sie selbst hatte dreizehn Kinder. Und überhaupt hatten alle Kinder unserer Straße einen Heidenrespekt vor ihr und ihrem alten Hausschuh, den sie in ihrer Schürzentasche verwahrte. Obwohl sie eine dicke Frau mit großen, knotigen Krampfadern an den Beinen war, hatte sie kaum Mühe, uns einzuholen, wenn wir vor ihr wegrannten. Andererseits war Mrs. Sullivan aber auch die Erste, zu der wir gingen, wenn wir Probleme hatten. Ihre Tochter Angela war meine beste Freundin, und manchmal schlich ich mich zu ihnen, um eine Tasse Tee zu bekommen. Die Wohnung der Sullivans war warm und sauber, und immer roch es angenehm nach Essen. Falls Mrs. Sullivan sich jemals die Mühe gemacht hätte nachzuzählen, wäre ihr sicher aufgefallen, dass sie immer mindestens vier Mäuler mehr stopfte.
Sie hatte gesehen; dass ich auf dem Treppenabsatz saß. Es störte sie kein bisschen, dass ich hörte, wie sie über Mammy sprach, sie sagte es ihr oft genug direkt ins Gesicht. Mammy fing immer an zu weinen, wenn Mrs. Sullivan ihr Vorwürfe machte. Sie sagte, Mrs. Sullivan ahne ja gar nicht, wie schwierig es für sie sei. Dabei vergaß sie, dass Mrs. Sullivan noch sieben Kinder mehr aufzog und es trotzdem fertig brachte, sie ohne staatliche Hilfe zu kleiden und zu ernähren.
«Na meinetwegen», sagte Mrs. Sullivan immer, «Joe hat Arbeit, aber nur in der Jacob’s Biscuit-Fabrik. Er verdient nicht soviel wie dein Dessie, der immerhin selbständig ist. Denk mal darüber nach!»
Wenn Mrs. Sullivan gegangen war, nannte Mammy sie eine «verdammte, neugierige Schlampe» und schlug aus Zorn auf einen der Jungs ein. Mich schlug sie nicht, denn ich hätte es Daddy erzählt, und dann wäre ein heiliger Krieg ausgebrochen.
Es wurde schon dunkel in der Wohnung. Ich hatte kein Sixpencestück für den Heißwasserzähler und hoffte, dass Mammy bald nach Hause kommen würde. Der Gasofen funktionierte wenigstens, und ich kochte etwas Wasser ab. Dann kamen meine Brüder zurück. Wir waren insgesamt sechs Geschwister, ich, das einzige Mädchen, war mit sieben Jahren die Älteste. Nach mir kam Noel, der sechs Jahre alt war. Maurice und John waren fünf und vier, und die Kleinsten, Kevin und Dermot, waren drei und eins.
Die Jungs waren heute nicht in der Schule gewesen. Maurice war an der Reihe, sich um die Kleinen zu kümmern, er hatte sie in dem großen, alten Kinderwagen herumgefahren. Sie rochen schlecht und waren sehr schmutzig. Maurice erzählte mir, dass er in einem Laden auf der anderen Seite von Fatima Mansions ein paar Kekse geklaut hatte und nicht erwischt worden sei. Er war sehr stolz darauf, dass er den Kleinen Essen besorgen konnte.
«Ich werde um Verzeihung bitten, wenn ich für Daddy das Gegrüßet seist du, Maria gesprochen habe.»
Ich sagte ihm nicht, dass es «Vergebung erbitten» hieß. Dass er mit fünf überhaupt schon so schwierige Worte aussprechen konnte, machte mich sehr stolz. Ich schüttete heißes Wasser auf die Teeblätter in den Marmeladegläsern, aber das Gebräu sah dünn aus und keiner trank es. Endlich kam Mammy nach Hause. Ihre Augen waren rot, als ob sie geweint hätte. Sie schien schon wieder sehr wütend zu sein, und ihre Laune besserte sich nicht gerade, als ich ihr sagte, dass ich kein Sixpencestück für den Zähler hätte. Sie befahl mir, nebenan bei Mrs. Sullivan zu klopfen und sie zu bitten, mir einen Shilling auszuleihen. Ich hasste es, nach Geld zu fragen, aber ich ging trotzdem, denn ich wollte nicht, dass sie mich ins Pfandhaus schickte. Das Pfandhaus war bei Dolphin’s Barn, und manchmal nahm Mammy irgendwelche Dinge aus Daddys Zimmer und schickte mich damit los. Sein Zimmer hielt Daddy sehr sauber, und alles, was kostbar war, befand sich darin. Er schloss die Tür zwar immer hinter sich ab, aber Mrs. Riley im obersten Stockwerk hatte einen Schlüssel, der passte, und sie ließ Mammy hinein.
Eines Tages hatte mich Mammy mit Daddys besten Schuhen zum Pfandhaus geschickt. Ich war zu schüchtern, den Laden zu betreten, also bat ich einen großen Jungen, die Schuhe für mich zu versetzen, doch er kam einfach nicht zurück. Ich wartete auf ihn, bis es dunkel wurde, dann musste ich nach Hause gehen und Mammy sagen, dass ich die Schuhe verloren hatte. Als Daddy kam, gab es einen riesigen Streit, und danach fragte ich nie wieder jemanden, ob er für mich ins Pfandhaus gehen könnte.
Mrs. Sullivan sagte, sie hätte kein Geld übrig, aber sie würde später ein paar Rippchen und Kohl bei uns vorbeibringen. Ich beschloss, zum Hinterausgang von Mr. Hennesseys Laden zu gehen und dort zu fragen, ob er mir ein paar leere Tee- oder Rosinenkisten geben könnte. Mr. Gleason drüben in Block K zahlte, wenn er sie für gut genug befand, drei Pence pro Stück, obwohl wir keinen blassen Schimmer hatten, was er mit ihnen anstellte. Beim Laden fanden mich Noel und Maurice.
«Du solltest besser schnell zurückkommen», riefen sie. «Mammy ist ganz schön böse!»
Ich überredete sie, mit mir zu warten, vielleicht würden wir ja ein paar Kisten bekommen. Als Mr. Hennessey mit seinem Abfall rauskam, fragte ich ihn. Ich mochte Mr. Hennessey. Er lächelte immer, und manchmal, freitags, wenn Mammy ihre Rechnung bezahlte, steckte er uns Cleaves-Bonbons zu. Er sah uns an und rieb sich das Kinn. Er rieb sich immer das Kinn, wenn er nachdachte, und jetzt kniff er die Augen zusammen, wie immer, wenn er lächelte.
«Na ja, du weißt ja, dass heute Mittwoch ist und ich die Tee- und Rosinenkisten normalerweise erst freitags ausleere.»
Wir schauten ihn stumm an. Es dauerte lange, bis er einen Entschluss gefasst hatte. Schließlich sagte er, wir sollten eine Minute warten, und ging zurück in seinen Laden. Wir konnten nicht hineinsehen, aber wir hörten, wie Mr. Hennessey stolperte und grunzte und Flüche ausstieß. Wir konnten uns nicht erklären, warum er fluchte.
Endlich kam er wieder aus der Hintertür heraus und zerrte drei große Rosinenkisten und eine Teekiste hinter sich her. Echte Kostbarkeiten! Wir konnten noch Reste von Rosinen vom Boden und von den Seiten abkratzen, aus denen Mammy dann einen Pudding kochen würde. Ich bat ihn um eine Papiertüte.
Er machte ein schnalzendes Geräusch mit der Zunge und atmete scharf ein, aber ich wusste, dass er nicht wirklich böse auf mich war. Er gab mir eine große braune Papiertüte, in der drei Cleaves-Bonbons lagen. «Oh, danke, Mr. Hennessey», sagte ich höflich, gab Noel und Maurice jeweils ein Bonbon und steckte das andere in den Mund, doch dann musste ich es wieder auf meine Hand spucken, um mich nochmals bei Mr. Hennessey zu bedanken.
«Und jetzt geht mir aus den Augen», sagte er.
Er lächelte uns schief an und verschwand durch die hintere Tür des Ladens. Die Tür fiel mit einem lauten Knall zu, und wir konnten hören, wie Mr. Hennessey ein paar Gebete aufsagte.
Jeder von uns nahm eine Kiste und begann, die Rosinen herauszukratzen und in die Tüte von Mr. Hennessey zu packen. Maurice war zu klein, um an den Boden seiner Kiste zu kommen, deshalb legte er sie auf die Seite und krabbelte einfach hinein. Ich verbot ihm zu naschen. Wir wollten, dass Mammy sich freute, also mussten wir ihr so viele Rosinen bringen, wie wir nur konnten.
Wir schleiften die Kisten durch die Straßen, bis wir Block K erreichten. Meine Brüder warteten unten an der Treppe, während ich hinaufstieg, um zu sehen, ob Mr. Gleason zu Hause war. Es gab noch andere Leute, die die Kisten gekauft hätten, aber Mr. Gleason wohnte am nächsten. Auf meinem Weg nach oben sprach ich ein Gegrüßet seist du, Maria, denn Mr. Gleason ängstigte mich fast zu Tode. Er war das, was Daddy einen «schmutzigen alten Bastard» nannte. Sein Gesicht war dunkelrot, er hatte Pockennarben, und seine Nase sah aus wie eine explodierte Kartoffel. Sein speckiger Hausmantel stank fürchterlich, und mir gefiel es gar nicht, dass er immer versuchte, mich in seine Wohnung zu ziehen. Er wohnte ganz oben, und ich war völlig außer Atem, als ich an seiner Tür ankam.
«Komm doch rein bei dieser Kälte, Kleines», sagte er.
Er lächelte und entblößte zwei dunkelbraune Zahnstümpfe. Von dem Geruch, der aus der Wohnung drang, wurde mir übel. Es stank schlimmer als das Frettchen, das Daddy in der Kohlegrube für die Kaninchenjagd aufbewahrte, schlimmer sogar als der Kanal im Sommer. Ich wollte nicht hineingehen. Ich sagte ihm also, dass meine Brüder unten warteten und dass ich es eilig hätte, zum Tee nach Hause zu kommen. Ich sagte ihm nicht, dass es keinen Tee geben würde, wenn er mir die Kisten nicht abkaufte.
Er hustete eine ganze Weile. Sein Gesicht wurde noch röter, und von irgendwo aus seiner Brust kamen ganz schreckliche Geräusche. Ich wich so weit zurück, wie ich konnte, ohne auf das Balkongeländer klettern zu müssen. Dann spuckte er einen großen Klumpen grünen Schleim aus, der beinahe auf meinem Schuh gelandet wäre. Mir wurde schon wieder schlecht, aber ich versuchte mich auf das zu konzentrieren, was mich hierher geführt hatte.
«Ich habe drei Rosinenkisten und eine Teekiste, Mr. Gleason. Meine Brüder passen unten an der Treppe darauf auf. Sie sind sehr gut in Schuss, ehrlich!»
Ich wartete darauf, dass er endlich aufhören würde zu husten. Ich versuchte, nicht hinzusehen, und obwohl ich wusste, dass das unhöflich war, steckte ich mir die Finger in die Ohren, aber Mr. Gleasons Gekeuche konnte ich trotzdem noch hören.
«Gut», sagte er, «bring sie hoch, und ich schaue sie mir an.»
Seine Stimme war ein einziges Quietschen und Pfeifen. Ich beugte mich über die Brüstung und rief meinen Brüdern zu, sie sollten die Kisten heraufbringen. Noel schrie zurück, ob ich glaubte, dass sie verdammte Esel seien oder was. Ich konnte hören, wie sie die Kisten polternd die Treppe heraufzerrten, und rannte ihnen entgegen. Wenn sie kaputtgingen, würden wir weniger Geld dafür bekommen. Schließlich reihten wir die vier Kisten vor der Balkonwand auf, damit Mr. Gleason sie inspizieren konnte.
«Ich gebe euch zwei Pence für jede», sagte er. «Sie sind nicht so gut, wie sie eigentlich sein sollten.»
Ich hatte damit gerechnet, drei Pence zu bekommen, und das sagte ich ihm auch.
«Mr. Devlin vom Bauernhof wird mir drei geben», behauptete ich. «Sie sind brandneu. Mr. Hennessey hat sie gerade erst leer geräumt. Sie sind drei Pence wert.»
Ich weinte schon fast. Es wurde inzwischen dunkel, und wir hatten gar nicht mehr genug Zeit, zu Mr. Devlin zu gehen, denn sein Bauernhof lag auf der anderen Seite des Wohnviertels. Mr. Gleason hustete und spuckte wieder aus. Ich wollte endlich weg von hier. Also befahl ich meinen Brüdern, die Kisten wieder mitzunehmen.
«Na gut, du Göre», sagte Mr. Gleason. «Dann eben drei Pence.»
Er ging in seine Wohnung und kam mit einem Shilling zurück. Ich hielt den Schatz fest in meiner Hand umklammert, als wir die Stufen hinunter auf die Straße rannten.
Als wir auf unseren Häuserblock zuliefen, versprach ich den Jungs, am nächsten Tag mit ihnen zusammen Daddy im Krankenhaus zu besuchen. Wir wussten, dass das Krankenhaus in der Cork Street lag, denn dort gingen wir immer vorbei, wenn wir uns ein kostenloses Abendbrot bei Vincent de Paul abholten. Ich mochte das Essen dort nicht. Sie kochten die Kartoffeln in der Schale und legten Blutwurst und Kohl dazu. Manchmal hatte Mammy ein paar Pennys übrig, dann gingen wir auf dem Rückweg in den Kuchenladen und kauften Rosinenbrot und ein Sahnetörtchen, doch seit Daddy im Krankenhaus lag, war Mammy nirgends mehr mit uns hingegangen.
Ich beschloss, Mammy zu sagen, dass wir nur Sixpence bekommen hätten, und vom Rest etwas für Daddy zu besorgen. «Wir werden Daddy ein Osterei kaufen», erklärte ich den Jungs. «Für morgen, wenn wir ihn besuchen.»
Ich vertraute meinen Brüdern, ich wusste, dass sie nichts von dem Shilling verraten würden. Wir hielten bei Mr. Hennesseys Laden an, um ihn zu wechseln. Ich bat seine sauer dreinblickende Frau, mir ein Sixpencestück und zwei Dreipennystücke zu geben. Sie wollte schon etwas sagen, doch Mr. Hennessey warf ihr einen strengen Blick zu. Sie schien sehr wütend zu sein, wechselte den Shilling aber trotzdem. Ich steckte in jeden Strumpf ein Dreipennystück und betete, dass Mammy sie nicht finden würde. Sonst würde sie mich bestimmt umbringen.
Am nächsten Tag wartete ich darauf, dass Mammy fortging. Sie hatte es nicht eilig. Sie schien glücklich zu sein, denn sie sang leise vor sich hin. Ich beobachtete sie dabei, wie sie aus der kleinen schwarzgoldenen Pappschachtel Pond’s-Puder auf ihr Gesicht stäubte und mit dem kleinen Finger dunkelroten Lippenstift auf ihren Lippen verteilte. Zum Schluss überprüfte sie die Nähte ihrer Strümpfe, ein sicheres Zeichen dafür, dass es nun nicht mehr lange dauern würde, bis sie ging.
«Pass auf die Babys auf und versuch, von Mrs. Sullivan was zum Abendessen zu bekommen. Ich bin bald wieder zurück.»
Und dann ging sie. An diesem Tag war ich nicht wie sonst traurig darüber, denn heute wollten wir Daddy besuchen. Ich verfrachtete die drei kleinsten Jungs in den «Sportwagen». Noel und ich schoben ihn, während Maurice den Handgriff hielt und ihn lenkte. Die Räder waren verbogen, es war schwer, damit voranzukommen. Daddy hatte den Wagen gekauft, als ich geboren wurde. Der Mann in dem eleganten Laden in der Grafton Street hatte ihn darauf hingewiesen, dass es auch billigere gebe, aber Daddy hatte sich bereits entschlossen: Dieser war der einzig Richtige für seine neugeborene Tochter, und darunter würde er es nicht tun. Der Mann sagte, dass der «Sportwagen», wie er ihn nannte, fünfzehn Guineen koste, eine weitere Guinee sei für die Lieferung fällig. Das war mehr als ein Monatsgehalt. Daddy gab dem Mann ein Pfund und zehn Shilling Vorauszahlung und ging zu Granddad. Zusammen kamen sie dann, zur Überraschung des hochnäsigen Mannes, zurück in den Laden und bezahlten den Kinderwagen.
Endlich erreichten wir Dolphin’s Barn. Die Leute schimpften uns aus, aber sosehr wir uns auch bemühten, wir konnten es nicht verhindern, mit ihnen auf den engen Gehwegen zusammenzustoßen. Der Kinderwagen fuhr einfach nie dahin, wo wir wollten. Als wir den Wagen über die Straße auf die andere Seite schoben, musste ein von einem Pferd gezogener Schweinefutterwagen abrupt abbremsen. In einem kleinen Laden, der nach Tabak und Lavendel roch, kauften wir Daddy ein Marshmallow-Osterei mit Schokoladenguss. Den Mann in dem Laden störte es nicht, dass wir ewig brauchten, um das richtige Ei für Daddy herauszusuchen. Wir einigten uns schließlich auf eins, das in glitzerndes rotsilbernes Papier eingewickelt war.
Wir trugen es abwechselnd. Als etwas von dem Papier verrutschte, probierte jeder von uns ein ganz kleines Stückchen von der Schokolade. Daddy würde das gar nicht bemerken, da waren wir uns ganz sicher. Als wir die großen Eisentore des Coombe-Krankenhauses erreichten, saß da ein Mann in einer kleinen Hütte hinter dem Tor. Sein Anzug war mit einer Reihe glänzender Knöpfe geschmückt. Noel und Maurice versuchten, das Tor aufzustoßen, aber es war zu schwer, und ich konnte den Kinderwagen nicht loslassen, weil die Bremse nicht funktionierte. Der Mann kam zum Tor. Wir sagten ihm, dass wir unseren Daddy besuchen wollten. Er trat heraus und kitzelte das Baby unterm Kinn. Dermot lachte und grapschte nach einem seiner glänzenden Knöpfe.
«Kinder dürfen nicht zu Besuch kommen», sagte der Mann. «Tut mir Leid.»
Jetzt wurde ich richtig böse. Ich sagte dem Mann, dass wir Daddy schon furchtbar lange nicht mehr gesehen hätten. Außerdem, sagte ich, hätten wir ihm ein Osterei gekauft, und wenn es jetzt auch fast nur noch aus Marshmallow bestand, so mussten wir das Geschenk trotzdem auf alle Fälle Daddy bringen, denn das würde ihm helfen, gesund zu werden. Ich starrte den Mann böse an und wiederholte, dass wir unseren Daddy sehen müssten.
Der Mann kniete sich vor mich hin, ergriff meine Arme und sagte: «Wisst ihr, was? Ich werde eurem Daddy das Osterei geben. Wie ist sein Name?»
Noel und Maurice sahen mich beide verblüfft an. Wir hatten dem Mann doch gerade erst seinen Namen gesagt!
«Er heißt Daddy!», riefen wir.
Ich übergab dem Mann das Osterei. Er sagte, er würde unseren Daddy finden und ihm sagen, dass wir ihn hatten besuchen wollen. Er tätschelte meinen Kopf, drückte mir einen Shilling in die Hand, und ich nahm mir vor, ein Gegrüßet seist du, Maria für den netten Mann zu sprechen.
«Und nun verschwindet von hier», sagte er, als er wieder durch das Tor ging.
Auf unserem Weg zurück zu Dolphin’s Barn kauften wir in Zeitungspapier eingewickelte Pommes frites und eilten, so schnell es mit den verbogenen Rädern des Kinderwagens ging, zurück zu unserer Wohnung. Noel riss in der dunkelsten Ecke des Zimmers ein kleines Stück Linoleum aus dem Boden, mit dem wir ein Kaminfeuer machen konnten. Wir setzten uns alle auf den Boden und aßen unsere Kartoffeln vor dem lodernden Feuer. Wir waren glücklich und satt, uns war sogar warm. Es war ein guter Tag. Wir blieben lange dort und sangen ein paar der Lieder, die Daddy uns beigebracht hatte. Unser Lieblingslied war:
Wenn du gehst nach Kilkenny
Dann suche das Loch in der Wand
Zwei Dutzend Eier für ’nen Penny
Und Butter dazu auf die Hand.
Noel erzählte einen Witz, den er von einem älteren Jungen in der Schule gehört hatte: «Paddy der Engländer, Paddy der Schotte und Paddy der Ire sitzen zusammen in einem Flugzeug. Es wird jeden Moment abstürzen, und es gibt nur zwei Fallschirme. Paddy der Schotte und Paddy der Ire schnappen sich je einen Fallschirm und wollen springen. Paddy der Engländer schreit: ‹Und was soll ich machen?› Paddy der Ire brüllt beim Rausspringen: ‹Schmier dir Butter auf den Arsch und rutsch den Regenbogen runter.›»
Wir lachten, bis uns Tränen über die Wangen liefen. Wir fanden, «Arsch» sei das witzigste Wort, das wir je gehört hatten. Mammy kam nach Hause und sah, wie wir uns auf dem Boden kugelten und schrecklichen Lärm machten, aber wir konnten ihr natürlich nicht sagen, worüber wir lachten.
Daddy sollte endlich wieder nach Hause kommen. Mammy war schon ein paar Tage nicht mehr ausgegangen. Sie hatte die Wohnung aufgeräumt, und Mrs. Sullivan hatte ihr ein paar saubere Leintücher und Bettbezüge ausgeliehen. Granny war zu Besuch und kochte Eintopf und Vanillesoße für den Apfelkuchen, den Mammy gebacken hatte. Ich stand neben dem Küchentisch und aß die Apfelschalen, die in langen Spiralen von den Früchten fielen. Davon bekam ich zwar grässliche Bauchschmerzen, aber ich wünschte mir, dass es zu Hause immer so wäre. Ich liebte den Duft nach Essen und die sauberen Leintücher auf den Betten. Ich liebte mein gewaschenes, weiches Haar, das mit einer grünen Schleife zusammengebunden war, und ich war glücklich darüber, jeden Tag die Schule besuchen zu dürfen. Was mir aber am besten gefiel, war, dass ich nicht mehr zu Mr. Gleason gehen musste.
Als Daddy nach Hause kam, sah er fürchterlich blass aus und seine Knochen traten hervor. Ich musste weinen. Ich hatte Angst, auf seinen Knien zu sitzen, weil ich fürchtete, dass ich ihm wehtun könnte. Er erzählte nur, dass das Essen im Krankenhaus schlimmer gewesen wäre als der schlimmste Schweinefraß.
«Aber jetzt bin ja ich zu Hause», sagte er. «Und Mammy wird mich wieder schnell aufpäppeln. Klar, schließlich muss ich ja bald wieder arbeiten gehen.»
Er hob seine dünnen Arme, und meine Brüder begannen zu singen:
Der dünne Hungerhaken mit der großen Glatz
Ging ins Kino und bekam keinen Platz
Als der Film begann – ganz kurz
hörte man von ihm ’nen Furz
Der alte Hungerhaken mit der großen Glatz.
Wir lachten alle. Daddy drohte den Jungs damit, ihnen die Ohren lang zu ziehen, aber er lachte auch. Sogar Mammy lachte.
Als Daddy schon wieder ein paar Wochen zu Hause war, wurde seine Laune immer schlechter, und er verbrachte viel Zeit in seinem Zimmer. Er spielte laut Klavier, worauf Mrs. Sullivan regelmäßig gegen die Wand hämmerte und schrie: «Heilige Mutter Gottes, Dessie, gib doch endlich Ruhe!»
Daddy hämmerte zurück und spielte nur noch lauter, und als Granddad uns besuchte, brachte er sein Cello mit und sie musizierten fast den ganzen Tag. Sie liebten Marschmusik und sehr alte Lieder. Mrs. Sullivan nannte Daddy einen «verdammten Säufer» und drohte, die Polizei zu rufen.
Schließlich bekam Daddy einen Job als Maler irgendwo auf dem Land. Er sollte sechs Wochen weg sein. Ich war sehr traurig. In den letzten Wochen war Mammy tagsüber überhaupt nicht weggegangen, unsere Wohnung war sauber und aufgeräumt. Wenn ich von der Schule kam, roch es immer nach Essen. Daddy kämmte mein Haar und flocht mir jeden Morgen Zöpfe, und er fand immer ein paar hübsche Schleifen dafür.
Einmal modellierten wir im Kunstunterricht gerade kleine Figuren, als ein Mädchen namens Chrissie Kernan mir die Schleifen aus dem Haar riss und meine Zöpfe sich auflösten. Wir hatten für unsere Knetfiguren Plastikstückchen bekommen, die aussahen wie große Orangenkerne, und ich war so wütend auf Chrissie, dass ich ihr ein paar davon ins Ohr stopfte. Am nächsten Tag rauschte Chrissie zusammen mit ihrer Mutter ins Klassenzimmer. Die Mutter forderte eine Nonne auf, ihr das «Gör» zu zeigen, das Schuld an den Ohrenschmerzen ihrer Tochter hatte.
«Ich zieh ihr die verdammten Ohren lang! Entschuldigen Sie mein Irisch, Schwester.» Sie bekreuzigte sich.
Chrissie presste ein Tuch gegen ihre rot geschwollene Wange. Sie schniefte und wischte sich die laufende Nase am Ärmel ab. Die Nonne brachte die Frau mit einem überheblichen Blick zum Schweigen.
«Nun gut, Mrs. Kernan», sagte sie dann. «Ich bringe Ihnen das Mädchen, das dafür verantwortlich ist.»
Im Klassenzimmer wurde es sehr still. Alle warteten gespannt auf das, was als Nächstes geschehen würde. Das war schließlich viel aufregender als Rechnen oder der Katechismus. Mein Hals jedoch war vor Angst wie zugeschnürt. Wenn es wirklich meine Schuld war, dass Chrissies Gesicht so aussah, dann steckte ich in ganz schönen Schwierigkeiten. Ich nahm all meinen Mut zusammen und meldete mich freiwillig. Als ich aufstand, machte mein Stuhl ein ohrenbetäubend quietschendes Geräusch auf dem Holzboden, und alle schauten mich an.
«Sie hat mir die Zöpfe aufgemacht und ich habe meine Schleifen verloren», flüsterte ich.
Ich hoffte, das wäre als Erklärung plausibel genug, aber da irrte ich mich gewaltig. Die Nonne kam an meinen Tisch und zog mich vor die Klasse. Mrs. Kernan starrte mich böse an. Am liebsten hätte ich ihr die Zunge rausgestreckt, aber mir war klar, dass das alles nur noch schlimmer gemacht hätte. Schließlich zerrte mich die Nonne am Ärmel meiner Strickjacke durch den Gang ins Büro der Mutter Oberin. Chrissie und ihre Mutter liefen hinter uns her, wobei Mrs. Kernan die ganze Zeit über die Jugend von heute schimpfte. Die Mutter Oberin riet ihr, Chrissie sofort ins Krankenhaus zu bringen, und versicherte, sie würde sich in der Zwischenzeit um mich kümmern.
Man ließ meine Mammy holen, die sich furchtbar ärgerte, als die Nonne ihr erklärte, wie man mich erziehen müsse, damit ich ein «nettes, junges Mädchen» würde. Nach der Strafpredigt wurde ich mit Mammy nach Hause geschickt. Sie schleifte mich hinter sich her durch die Straßen, schrie mich an und schlug mir auf die Ohren, und ich brüllte mehr aus Schamgefühl als vor Schmerz. Als wir endlich zu Hause angelangt waren, fand Daddy, dass ich nun genug bestraft worden sei. Ich versprach, niemandem mehr Dinge ins Ohr zu stopfen, und als Daddy mich später bat, zu Mr. Hennessey zu gehen, um ihm eine Packung Golden Flake zu holen, gab er mir sogar einen Penny für Süßigkeiten dazu.
Doch jetzt, wenn Daddy fort war, würde wieder alles so werden wie zu der Zeit, als er im Krankenhaus gewesen war.
Ich schaute Daddy dabei zu, wie er sich fertig machte. Er schüttete Zucker und Tee in kleine Tüten aus braunem Papier und legte sie zusammen mit dem Kochgeschirr in seine Segeltuchtasche. In einen kleinen braunen Koffer packte er seine weißen Overalls und seine speziellen Schuhe für Arbeiten im Haus. Er erklärte, dass manche Häuser, in denen er arbeitete, cremeweiße Teppichböden hätten, so dick, dass man darin versinken könnte. Ich hatte einen schmerzenden Knoten in der Brust. Daddy sagte, er würde alle paar Wochen für einen Tag nach Hause kommen.
«Und du wirst ein braves Mädchen sein», sagte er, «und deiner Mammy mit den Kleinen helfen. Vielleicht bringe ich dir sogar ein schönes Geschenk mit.»
Er umarmte uns alle am Fuß der Treppe, stieg in seinen kleinen schwarzen Austin und fuhr los. Meine Brüder und einige Jungs aus der Straße rannten hinter ihm her und versuchten, ihn noch vor der Hauptstraße zu überholen. Aber Daddy hupte nur noch einmal und war fort.
Schon am nächsten Tag ging Mammy weg und überließ es mir, nach den Kleinen zu sehen. Sie war nun wieder fast jeden Tag fort, und es dauerte nicht lange, bis die Wohnung wieder ganz dunkel und schmutzig war. Ich musste Mr. Hennessey wieder um Tee- und Rosinenkisten bitten. Eines Tages, als ich zu ihm ging, goss es in Strömen. Ich ergatterte nur eine einzige Kiste und war schlecht gelaunt. Als ich in unsere Wohnung zurückkam, sah ich, dass einer der beiden Kleinen fehlte.
«Wo ist Kevin?», fragte ich.
Offenbar hatte ihn schon seit geraumer Zeit niemand mehr gesehen. Ich zündete den Gasherd an und stellte den geschwärzten Wasserkessel darauf. Kevin war immerhin schon fast drei, und ich hatte Angst, dass er den Weg aus dem Haus und auf die gefährliche Hauptstraße gefunden hatte.
«Passt auf die anderen auf», sagte ich zu Noel und Maurice. «Ich gehe Kevin suchen.»
Ich hatte meinen nassen Mantel anbehalten und rannte die Treppen hinunter. Dann raste ich zur Ecke, wo der Wohnblock aufhörte, und als ich schon fast bei Block C angekommen war, sah ich, wie etwas in einer großen Pfütze herumspritzte. Wasser quoll durch die Gullygitter auf die Straße, und da saß Kevin mitten in der schmutzigen Lache und spielte so selbstvergessen und begeistert, als sei er am Strand von Dollymount. Ich zerrte das tropfnasse Bündel heraus und trug es zurück in die Wohnung. Kevin schrie wie am Spieß, weil er zu seiner Pfütze zurückwollte.
Als ich in unserem Stockwerk ankam, lief Mrs. Sullivan auf mich zu. Sie riss mir meinen nassen Mantel herunter und wickelte schnell etwas darin ein.
«Sag deiner Mutter, sollte sie jemals zurückkommen, dass ich mit dem Baby im Krankenhaus bin!» Und weg war sie.
In der Wohnung saßen meine Brüder und heulten aus vollem Hals. Es roch angebrannt. Halb verbrannte Fetzen und Papier lagen in dem Zimmer herum, der Kinderwagen war voll Wasser. Niemand konnte mir sagen, was geschehen war, aber ich sah sofort, dass Dermot, unser Kleinster, nicht mehr da war.
«Oh, heilige Mutter!»
Das Bündel, das Mrs. Sullivan in meinen Mantel gewickelt hatte, war Dermot.
Als meine Mutter nach Hause kam, fand sie eine Wohnung voller schreiender Kinder, wütender Frauen aus den anderen Wohnungen und einen Polizisten vor. Ihr Gesicht wurde kalkweiß. Der Polizist bat Mrs. Moore, die Kinder für ein paar Minuten mit nach draußen zu nehmen. Mrs. Moore war hocherfreut, eine so wichtige Aufgabe übernehmen zu dürfen, und sammelte die beiden kleinsten Jungs ein. Bevor sie die Wohnung verließ, sah sie Mammy kurz an und murmelte: «Gott vergebe dir, du kleines Flittchen!» Und dabei bekreuzigte sie sich.
Mammy rief: «Um Himmels willen, warum sagt mir denn keiner, was hier los ist?» Sie forderte die Frauen auf, «aus ihrem Haus zu verschwinden». Mrs. Sullivan packte ihren Arm und zog sie ins Schlafzimmer. Ich konnte hören, wie sie auf Mammy einredete. Dann ertönte ein Schrei, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ, und sie kam zurück ins Wohnzimmer gerannt. Sie versuchte, zur Wohnungstür zu gelangen, aber der Polizist hielt sie zurück. Ich lief zu ihr, sie umarmte mich fest. Ich umklammerte ihre Taille. Es war seltsam: Ich wollte sie beschützen. Ich wusste, dass etwas Schlimmes geschehen war. Der kleine Dermot war schrecklich verbrannt in seinem Kinderwagen. Der Polizist befahl den Frauen, die Wohnung zu verlassen, weil er mit meiner Mutter unter vier Augen sprechen wollte. Mrs. Sullivan nahm Noel und Maurice an die Hand.
«Ich werde ihnen etwas Tee zu trinken geben.» Sie wandte sich an mich. «Möchtest du etwas essen, Kleine?»





























