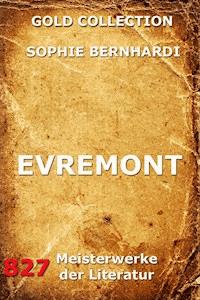
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Evremont", ein historischer Roman aus der napoleonischen Vormärz-Zeit, wurde erst nach dem Tod der Autorin veröffentlicht.
Das E-Book Evremont wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1118
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Evremont
Sophie Bernhardi
Inhalt:
Sophie Bernhardi – Biografie und Bibliografie
Evremont
Erster Theil
Vorrede
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
Zweiter Theil
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Dritter Theil
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Evremont, S. Bernhardi
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849606985
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Sophie Bernhardi – Biografie und Bibliografie
Eigentlich Sophie Tieck, deutsche Dichterin und Schriftstellerin der Romantik, geboren am 28. Februar 1775 in Berlin; gestorben am 1. Oktober 1833 in Tallinn. Schwester des berühmten Schriftstellers Ludwig Tieck und des Bildhauers Friedrich Tieck. Heiratete 1799 einen Freund Ludwigs (August Bernhardi), später folgte die Scheidung. Mit ihrem zweiten Mann, Baron Karl Georg von Knorring, zieht sie dann nach Estland.
Wichtige Werke:
Bambiocciaden,1797 - 1800Julie Saint Albain.Dresden 180Wunderbilder und Träume in elf Märchen.1802Dramatische Phantasien.1804Evremont, 1836Flore und Blancheflur, 1822 (episches Gedicht).Evremont
Erster Theil
Vorrede
Dieser Roman, welchen ich dem Publikum übergebe, ist die letzte Arbeit meiner verstorbenen Schwester Sophia1, welchen sie nur wenige Jahre vor ihrem Tode vollendete. Mein Urtheil über dieses Werk könnte ein partheiisches scheinen, und ich enthalte mich daher, weitläuftig über diese Composition zu sprechen, oder ihre Vorzüge auseinander zu setzen. Der unpartheiische Kenner wird ohne meine Erinnerung einsehn, mit welchem Fleiß und mit welcher Liebe dieses Werk, welches die Verfasserin so manches Jahr beschäftigte, ausgeführt ist. Wenn die Dichterin in ihren früheren Produkten nur Traum- und Mährchenwelt darzustellen strebte, oder ein schönes Gedicht des Mittelalters neu erzählte, so hat sie in diesem Roman ihre Ansichten der Welt und der Menschen und vielfache erfahrungen niedergelegt. Die denkwürdigsten Jahre der neuen Geschichte bilden den Hintergrund dieses großen, mit mannichfachen, wechselnden Figuren ausgestatteten Gemäldes, und die Erzählung, die gut angelegt ist, hebt sich aus dem klaren Vordergrund, und das Interesse wächst mit jedem Kapitel. Die Erinnerungen eines jeden, welcher beobachten konnte und richtig schildern kann, werden aus jener merkwürdigen Periode ein gewisses Interesse haben, und seine Worte werden um so eindringlicher sein, wenn ihm die Gabe verliehen ist, diese Bilder und Ereignisse in ein mehr oder minder künstliches Gewebe einzuflechten. Eine solch Darstellung, ergießt sie sich aus einem reichen und vollen Gemüth, wird sie nicht durch Eigensinn und Vorurtheil beschränkt, hat, außer dem poetischen, theilweise einen geschichtlichen Werth. Diese freie, deutsche Gesinnung offenbart sich in diesen Blättern, die ich hier dem Publikum übergebe, mit dem Wunsche, daß die Freunde der Wahrheit, daß der gebildete Leser sie nicht unbefriedigt aus der Hand legen mögen. Auch hoffe ich, daß diese Darstellung das Andenken der Verfasserin bei ihren wohlwollenden Freunden erneuen wird, und daß ihr Name denen wird zugesellt werden, die das Schöne, Edle und Gute erkannten und es, so viel unsere geschränkten Kräfte vermögen, erstrebten.
Ludwig Tieck.
I
Im Spätherbst, wenn die Nebel schwer und feucht an den Bergen hängen, wenn die Sonnenstrahlen nur noch matt das graue Gewölk durchdringen, und die Natur keinen erheiternden Anblick mehr gewährt; dann ist der Mensch am Leichtesten geneigt, alle traurigen Erinnerungen in seine Seele zurück zu rufen, und unwillkührlich bildet sich so seine innere Stimmung nach den Eindrücken, die er von außen empfängt. In den letzten Tagen des Novembers im Jahre 1806, an einem solchen traurigen Herbstabend, saß die Gräfin von Hohenthal mit ihrer Nichte, Fräulein Emilie von Stromfeld, am Theetisch, im Besuchzimmer des alten Schlosses Hohenthal. Die hohe Gestalt der Gräfin, ihre würdige Haltung, die dunkeln durchdringenden Augen, die edeln Formen des Gesichts ließen, obgleich durch zunehmende Magerkeit etwas zu scharf gezeichnet, dennoch deutlich erkennen, mit welch einem hohen Grade von Schönheit die Natur ihre Jugend geschmückt haben mußte, und noch jetzt, obgleich sie vierzig Jahre zählte, durfte sie Anspruch auf jene würdevolle Schönheit machen, die oft noch lange bleibt, wenn der Reiz der Jugend auch verschwunden ist.
Der Zug des Schmerzes um den Mund und die blasse Gesichtsfarbe zeugten von vergangenen Leiden, so wie die fest geschlossenen Lippen des feinen Mundes auf einen entschiedenen Charakter deuteten. Fräulein Emilie, ihre Nichte, war kaum achtzehn Jahre alt, in der Blüthe der Jugend und Schönheit, schlank, leicht, fein gebaut, so zart, daß die leiseste Bewegung des Gemüths eine Veränderung ihrer Gesichtsfarbe hervorbrachte; ihr frischer Mund lächelte mit unglaublicher Anmuth und verrieth im Lächeln die Neigung ihres Gemüths zur Heiterkeit, so wie die großen dunkelblauen, von langen seidnen Wimpern beschatteten Augen deutlich zeigten, daß ihr auch das Leid des Lebens nicht fremd geblieben war; die reiche Fülle der schönen, glänzenden blonden Haare erhöhte den Reiz dieser lieblichen Gestalt.
Beide Frauen saßen stumm da, Emilie mit einer Handarbeit beschäftigt, von der sie von Zeit zu Zeit aufsah, um einen theilnehmenden Blick auf die Gräfin zu richten, die, in sich versenkt, Alles um sich zu vergessen schien. Es ist heute ein trauriger Abend, unterbrach endlich Emilie das Schweigen mit ungewisser Stimme, der Herbst kündigt sich uns recht schwermüthig an; die Gräfin fuhr beim ersten Tone nach der langen Stille erschreckt zusammen, und zeigte dadurch deutlich, daß ihre Gedanken sie so sehr beschäftigt hatten, daß die Gegenwart des Fräuleins gänzlich von ihr war vergessen worden. Sie hörte nur halb auf Emiliens Bemerkung, stand auf, ging ein Paar Mal durch das Zimmer und sagte dann mit einem halb bittern, halb schmerzlichen Lächeln: An einem solchen Abende, glaube ich, würde auch der begeistertste Freund der schönen Natur und des einfachen Landlebens in seiner Vorliebe ein wenig wankend werden, und sich im Stillen wenigstens, wenn er sich schämte es laut zu gestehn, nach dem leichtsinnigen Geräusche der Stadt sehnen, nach Gesellschaft, die er oft langweilig genannt hat, nach Schauspiel, wenn es auch mittelmäßig wäre und die Forderungen der Kunst keineswegs befriedigte, kurz, nach allem Dem, was wir immer so hochmüthig sind verachten zu wollen, und was doch kein gebildeter Mensch entbehren kann.
Ehedem, bemerkte Emilie, war das Leben auf dem Lande heiterer, man brachte wohl schwerlich einen solchen Abend einsam zu; mehrere Familien aus der Nachbarschaft vereinigten sich, man lachte und scherzte die düstern Stunden hinweg, und ehe man es dachte, war Herbst und Winter verschwunden, und der Frühling mit allen seinen Blüthen entzückte uns von Neuem. Es ist traurig, daß Ihr erster langer Aufenthalt auf dem Lande grade in eine so ungünstige Zeit fällt. Der Krieg hat alle Menschen ängstlich gemacht, es wagt sich beinahe Niemand heraus, und wenn sich auch eine Gesellschaft vereinigt, so fehlt doch die ehemalige Heiterkeit.
Die Gräfin unterdrückte eine Antwort, die sie geben, oder eine Bemerkung, die sie machen wollte, und sagte nur seufzend: ich wollte, gutes Kind, Du könntest mich zerstreuen.
Würde Musik Sie vielleicht erheitern? fragte Emilie, indem sie aufstand und sich dem Instrumente näherte. Um Gottes Willen nicht, erwiederte die Gräfin, in meiner jetzigen Stimmung würde Musik mein Gefühl beleidigen.
Soll ich Ihnen vorlesen? fragte Emilie ein wenig schüchtern. Lesen, sagte die Gräfin mit Bitterkeit, lesen statt leben, es ist die allgemeine Meinung unserer Zeit, wir verschleudern unser eigenes Leben, um das eingebildeter Personen zu lesen; nun so laß uns denn so thöricht sein, wie alle Andern, nimm ein Buch und lies mir vor, nur bitte ich Dich keine Poesien, laß es schlichte gewöhnliche Prosa sein, woran wir uns ergötzen wollen.
Wer sollte wohl in dieser Aeußerung, sagte Emilie lächelnd, die leidenschaftliche Verehrerin der Poesie wiedererkennen?
Eben weil ich die Poesie verehre, versetzte die Gräfin, soll sie nicht in meiner jetzigen Stimmung vergeudet werden. Ich vermag heute nicht Aufmerksamkeit genug darauf zu verwenden, um die Schönheit eines Gedichtes heraus zu hören, und in solchem Zustande ist ein Roman das Beste, was man lesen kann.
Ich habe nicht geglaubt, sagte Emilie, daß Sie auch so gering von dem Romane dächten, wie die meisten gelehrten Recensenten, und nun, da es doch so scheint, werde ich in meiner eignen Ansicht irre.
Wer sagt Dir, daß ich gering von dem Roman denke? fragte die Gräfin; doch, fuhr sie fort, laß Deine Ansicht über ihn hören.
Sie wollen über mich lachen, antwortete Emilie, und wenn es Sie erheitern kann, will ich mich gern Ihnen so gegenüberstellen, als könnte auch ich ein Urtheil haben.
Gar zu bescheiden, sagte die Gräfin, Du weißt, meine Liebe, auch das Gute muß man nicht übertreiben.
Emilie erröthete ein wenig und sagte dann: jetzt wird es mir in der That schwer, eine Ansicht zu entwickeln, die ich vor Kurzem noch mit so viel Klarheit in mir hatte; aber ich dächte, die Romane wären deßwegen so allgemein beliebt, weil sie uns in der That die Gesellschaft am Meisten ersetzen; wir leben im Kreise der Menschen, die uns dargestellt werden, wir kennen die Gegend, in der sie leben, ihre Häuser und Hausgenossen, es entwickelt sich ihr Charakter vor uns, sie vertrauen uns ihr Glück und ihre Leiden an, und ist ein Buch beendigt, so habe ich wenigstens das Gefühl, als ob ich aus einer Gegend abreiste, worin ich viele Freunde und interessante Menschen zurücklasse, wo mir auch die komischen Figuren ihr Herz entfaltet haben und so mir lieb geworden sind, und selbst die bösartigen sich so gezeigt haben, daß ich sie entweder beklagen oder bewundern muß.
Du sprichst von guten Romanen, sagte die Gräfin, aber selbst die mittelmäßigen besitzen noch Vieles von diesen Reizen, und wenn uns ein wahrhaft elender in die Hände fällt, der uns in gar zu langweilige oder zu schlechte Gesellschaft versetzt, so giebt es nichts Leichteres, als sich hier zurückzuziehen, denn nichts weiter ist nöthig, als daß wir das Buch wegwerfen. Nimm denn also einen Roman und lies; laß uns versuchen, ob wir uns fremde Menschen, eine andere Gesellschaft herzaubern und darüber uns selbst vergessen können.
Emilie richtete einen traurigen Blick auf die Gräfin und wollte sich entfernen, um ein Buch zu holen; die Gräfin aber nahm sie bei der Hand und sagte mit milder Stimme: Ich quäle Dich, gutes Kind, durch meine heutige Laune, aber glaube mir, es liegt mir so Manches drückend auf dem Herzen, daß, wenn ich darüber spräche, Du mich bedauern und gern Geduld mit mir haben würdest.
Sie fürchten vielleicht, sagte Emilie mit einiger Beklemmung, daß die Feinde dennoch durch die Bergschlucht dringen und uns hier beunruhigen werden, obgleich der Onkel es für unmöglich hielt. Nicht diese Sorgen quälen mich am Meisten, erwiederte die Gräfin, obgleich ich fürchte, daß es möglich ist, und daß, wenn es geschieht, ein großer Theil unseres Vermögens verloren gehn kann, was doch auch nicht gleichgültig von uns betrachtet werden darf; Emilie schwieg und die Gräfin fuhr fort: Man braucht nicht geizig zu sein, um einen großen Werth auf ein bedeutendes Vermögen zu legen, das, indem es den Rang unterstützt, den wir in der Welt einnehmen, unsere Unabhängigkeit sichert, und gewiß hat man nur in der Jugend die Großmuth, alle irdischen Güter zu verachten, weil man weder ihren wahren Werth, noch ihren rechten Gebrauch kennt. Der edelste, uneigennützigste Mensch wird sich gedrückt fühlen, wenn Mangel an Vermögen ihn von Andern abhängig macht.
Emilie konnte einen leisen Seufzer nicht unterdrücken, und die tiefe Röthe, die sich über ihre Wangen verbreitete, verrieth der Gräfin ihre Gedanken. Emilie fühlte sich errathen, und die schöne Röthe stieg bis zur reinen Stirn empor, indem die Augen sich senkten und Thränen darin hinter den langen Wimpern sich verbargen. Es schmerzte die Gräfin, ihre junge Freundin verwundet zu haben; sie legte den Arm um ihre Schulter und ging so mit ihr durch das schwach erleuchtete Zimmer, damit Emilie in der größten Entfernung von den Lichtern die Thränen unbemerkt in den Augen zerdrücken konnte. Ich meine, fuhr die Gräfin nach einem kurzen Schweigen fort, es würde mir schmerzlich sein, wenn unser Vermögen so zerrüttet würde, daß der Graf gezwungen wäre, die Unabhängigkeit aufzugeben, die ihm so theuer ist, und dieß könnte geschehen, wenn ein feindlicher Einfall die Güter zerstörte; doch aber noch ein anderer Kummer liegt mir auf dem Herzen, der mich mehr als diese Sorgen quält.
Beide Frauen waren an einem Fenster stehen geblieben und sahen in die dunkle Nacht hinaus; ein feiner Regen schlug gegen die Fenster, die Sterne waren durch schwarze Wolken verhüllt, und kein Gegenstand ließ sich draußen unterscheiden. Ich hoffe, sagte die Gräfin, wir werden allein bleiben, obgleich die Einsamkeit mir heute sehr drückend ist, denn ich wünsche nicht, daß der Graf, bei dieser unfreundlichen Witterung, in der dunkeln Nacht den Weg über das Gebirge zurück machen möge. Er wollte aber nicht die Nacht in Heinburg bleiben, versetzte Emilie. Es ist unrecht, erwiederte die Gräfin mit kaum bemerklichem Lächeln, daß der gute alte Baron mit seinen unschuldigen Thorheiten ihm so sehr zuwider ist; ich hoffe aber, er wird heute lieber einige von dessen etwas weitläuftigen und nüchternen Geschichten anhören, als bei diesem Wetter den Rückweg unternehmen wollen.
Schimmert nicht ein Licht dort unten im Thale? fragte Emilie. Wo? rief die Gräfin.
Dort, links vom Schlosse, erwiederte jene, mich dünkt, es bewegt sich aus der Schlucht her, auf dem Wege, den der Onkel kommen muß.
Die Gräfin schaute aufmerksam nach der Gegend hin, und in der That bemerkte man nun mehrere Lichter, die sich auf dem Wege um eine dunkle Masse zu bewegen schienen. Die Dunkelheit der Nacht machte es unmöglich, einen Gegenstand zu unterscheiden, da selbst die Lichter nur matt und trübe durch den fallenden Regen schimmerten.
Die Gräfin zog heftig die Klingel und befahl dem eintretenden Bedienten, vom Schlosse aus mit mehreren Leuten den Lichtern entgegen zu gehn und eilig zu berichten, Wer da komme, und ob diese unvermutheten Gäste das Schloß zu besuchen gedächten. Aengstlich blieben beide Frauen am Fenster stehen, und man bemerkte nun bald, wie mehrere Menschen aus dem Schlosse mit Laternen dem Zuge entgegen eilten, der sich offenbar dem Schlosse näherte. Einige Diener kehrten bald zurück und berichteten, es sei der Herr Graf, begleitet von mehreren Bauern aus einem nahe gelenen Dorfe, die einen Mann auf einer Bahre nach dem Schlosse trügen.
Bestürzt blickte die Gräfin auf Emilie, wickelte sich dann in ihren Shawl und befahl zu leuchten. Emilie folgte der Gräfin; Bediente gingen mit Lichtern voran, und so stiegen beide Frauen die große Treppe des Schlosses hinunter; die Flügelthüren des Hauses wurden geöffnet, und in demselben Augenblicke auch mit großem Geräusch das Thor des Hofes; der Graf sprengte, begleitet von einem Reitknechte, herein und warf sich sogleich vom Pferde, als er die Gräfin bemerkte, die im offenen Thore des Hauses stand, auf Emilie gelehnt, und hinter beiden mehrere Bediente mit vielen Lichtern. Der untere Raum des Hauses füllte sich bald mit der Dienerschaft des Schlosses, die Neugierde, vermischt mit Furcht, herbei führte.
Der Graf warf einem Bedienten seinen von Regen durchnäßten Mantel zu, trat dann eilig zu der Gräfin und sagte, indem er ihre Hand faßte: »Es ist nichts, meine Liebe, das Sie beunruhigen dürfte, der junge Mann ist im Walde ohnmächtig und beinahe an seinen Wunden verblutend gefunden worden. Da ich glaubte, daß wir hier am Besten im Stande wären, ihm wirksame Hülfe zu leisten, so habe ich ihn hieher tragen lassen. Er scheint, nach der Uniform zu urtheilen, ein französischer Officier zu sein, also zur feindlichen Armee gehörig, doch kann dieß kein Hinderniß sein, ihm alle Hülfe zu leisten, die in unsern Kräften steht.«
Kaum hatte der Graf diese eilige Erklärung gegeben, als sich die Lichter, welche die Frauen vom Fenster des Schlosses ans bemerkt hatten, zum Thore des Hofes hinein bewegten. Voran ging der Schulze des Dorfes, ein junger, kräftiger Mann; er trug in einer Hand eine Laterne und mit der andern nahm er seine mit Pelz verbrämte sonntägliche Mütze ab, um, indem er sich tief vor der Gräfin verbeugte, zugleich mit einer heftigen Bewegung den Regen davon abzuschütteln. Mehrere Bauern trugen eine Bahre, auf der der Verwundete lag, und welche von andern, die Laternen mit brennenden Lichtern in den Händen trugen, umgeben war. Auf den Befehl des Grafen wurde die Bahre mit dem Verwundeten nun durch das offne Thor des Schlosses getragen; die Gräfin zog sich an die Mauer zurück, um den Trägern Raum zu lassen, und warf einen Blick auf den Kranken, indem er vor ihr vorbeigetragen wurde. Er lag auf Kissen in Decken gehüllt und schien völlig leblos zu sein; so wie die Gräfin die Augen auf ihn richtete, zuckte ein schmerzlicher Schrecken durch ihren Körper; sie bedeckte die Augen mit ihrer Hand, und der fest geschlossene Mund zeigte, daß sie nach Fassung rang. Emilie berührte leise den Arm der Gräfin und fragte theilnehmend: Ist Ihnen nicht wohl? Es ist nichts, sagte die Gräfin, indem sie ihre dunkeln Augen schnell wechselnd auf verschiedene Gegenstände richtete, um durch eine augenblickliche Zerstreuung einen gewaltsamen Eindruck zu bekämpfen; dann suchten ihre Augen mit einer gewissen Besorgniß den Grafen, der aber zu sehr mit dem Kranken beschäftigt war und in diesem Augenblicke nicht auf die Frauen achtete.
Es wurde nun schnell ein Zimmer im Schlosse bereitet; der Graf rief nach dem Arzte des Hauses, und die Gesellschaft wurde durch den Prediger des Dorfes vermehrt, der als ein vorsichtiger Reiter seinen Weg so langsam gemacht hatte, daß ihm sogar die Bauern, welche den Kranken trugen, vorgeeilt waren. Er ritt in diesem Augenblicke zum Thore des Hofes ein, von einem Knechte begleitet, der ihm eine Laterne vortrug und ihm nun den Steigbügel hielt. Langsam und bedächtig stieg der Pfarrer ab, und sein kleines, mageres Pferd wurde von dem Knechte ohne Weiteres nach dem Stalle geführt, indem der Geistliche ihm mit etwas heiserer Stimme noch verschiedene Vorsichtsmaßregeln nachrief, wenn das Pferd etwa heiß sein sollte, was sich bei dem langsamen Ritt in einer kalten, regnigten Nacht kaum vermuthen ließ; auch schien das Pferd überhaupt nicht so viel Sorgfalt zu verdienen, noch auch sonst zu genießen, denn sein Bau und ganzes Ansehen verrieth, daß es eben sowohl zum Pflügen und jeder anderen Arbeit, als zu den Spazierritten des Pfarrers gebraucht wurde. Nachdem der bedächtige Reiter auf diese Weise für sein getreues Roß gesorgt hatte, näherte er sich so eilig, als es ihm Mantel, Ueberrock und sonstige Verhüllungen seiner Person erlaubten, der Gräfin, die sich nun völlig wieder gefaßt hatte und den Prediger mit gewohnter Höflichkeit bewillkommnete.
Der Kranke war indeß in ein Zimmer des untern Stockwerkes gebracht worden, wohin der Graf, begleitet vom Arzte, folgte, und der Prediger eilte, von Theilnahme und Neugierde getrieben, ebenfalls zu dem Verwundeten; die Gräfin zog sich nach ihrem Zimmer zurück, und Emilie ging, um der Haushälterin alle Aufträge zu geben, die, um den Zustand des Kranken zu erleichtern, nöthig waren.
II
Nachdem der Arzt die Wunden des Kranken untersucht hatte, die von verschiedenen Säbelhieben herzurühren schienen, bemerkte er, daß er sie an sich nicht für tödtlich hielte, daß ihm aber der Zustand des Kranken dennoch gefährlich schiene, durch die starke Verblutung sowohl, als durch seine heftige Erkältung, da er wahrscheinlich lange hüflos im Walde gelegen hätte, der rauhen Jahreszeit und der unfreundlichen Witterung Preis gegeben. In der That gab der Verwundete nur schwache Zeichen des Lebens und schlug erst nach langer Zeit die großen dunkeln Augen auf, doch ohne daß er irgend etwas von den Gegenständen um sich zu bemerken schien. Der Pfarrer leistete dem Arzte alle mögliche Hülfe in der Behandlung des Kranken und verrieth eben so viel Theilnahme für den Verwundeten, als Kenntniß der Wundarzneikunst. Nachdem der Kranke versorgt war, und der Arzt die nöthigen Verhaltungsregeln gegeben, vor Allem verordnet hatte, daß man den Kranken auf keine Weise zum Sprechen reitzen müsse, eine Verordnung, die dem Pfarrer sehr unangenehm war, obgleich er ihre Nothwendigkeit einsah, kehrten Alle in das Gesellschaftszimmer zurück. Die Gräfin zeigte nichts von der trüben Stimmung, der sie sich überlassen hatte, als sie mit Emilie allein war, und fragte mit Theilnahme nach dem Verwundeten.
Der Graf unterrichtete sie von seiner gefährlichen Lage und sagte, es wäre wohl gut, wenn Dübois die Sorge für ihn übernehmen wollte; es würde dem alten Manne zwar beschwerlich sein, indeß bei seiner Gutmüthigkeit und Theilnahme für alle Unglücklichen, glaube ich, würde er es gern thun, besonders da der Verwundete sein Landsmann ist, der wahrscheinlich keine andere, als die französische Sprache zu reden versteht und sich folglich keinem von der Dienerschaft verständlich machen kann. Die Gräfin zog die Klingel, und der Pfarrer sagte vorschnell: So sollten der Herr Graf ihm befehlen, die Nacht bei dem Kranken zu wachen. Ich befehle nicht gern einem alten Manne, sagte der Graf höflich, doch ein wenig verdrüßlich, der mehr aus Anhänglichkeit an uns in meinem Hause lebt, als aus einem andern Grunde, und den ich niemals wie einen Bedienten betrachte. Man konnte überhaupt bemerken, daß sowohl der Graf, als die Gräfin ein uneingeschränktes Vertrauen zu dem alten Dübois hatten, der die Verrichtungen eines Kammerdieners und eines Haushofmeisters, wie es schien, freiwillig übernahm, denn wenigstens der Graf richtete nie einen Befehl an ihn, sondern drückte seinen Willen als Wunsch aus und ließ ihn so gewöhnlich durch die Gräfin an den alten Mann gelangen, der auch bei aller Ehrerbietung, die er gegen den Grafen zeigte, doch eigentlich nur die Gräfin als seine Herrschaft betrachtete. Dem Bedienten, der auf den Ruf der Klingel eingetreten war, sagte die Gräfin, er solle Herren Dübois bitten, einen Augenblick zu ihr zu kommen.
Der Pfarrer, ein Mann ohne feine Erziehung, der in seiner Umgebung sich zu beherrschen nicht gelernt hatte, ließ durch seine Mienen, die eine schlaue Verwunderung ausdrückten, und durch das halbe Lächeln, mit dem er den Arzt ansah, deutlich merken, wie sehr ihn diese Art, mit seiner Dienerschaft umzugehen, befremdete.
Nach wenigen Augenblicken trat der alte Haushofmeister mit einer höflichen Verbeugung ein und hielt sich ehrerbietig nah an der Thüre. Es war unmöglich, beim ersten Blicke, den man auf ihn richtete, dem alten Manne Wohlwollen und Zutrauen zu versagen. Seine hohe Stirn zeugte von einer so einfachen Redlichkeit des Gemüths, die grauen Augenbraunen beschatteten so gutmüthige Augen, die wenigen grauen, sorgfältig gepuderten Haare erweckten Theilnahme für sein Alter, und eine Trauer in seinem Gesichte, die niemals verwischt wurde, obgleich er bei jeder Rede ein wenig lächelte, verrieth mehr Tiefe des Gemüths, als man bei gewöhnlichen Dienern findet. Es war bekannt, daß er die französische Revolution mit allen ihren Folgen verabscheute, und er dehnte diesen Abscheu auf Alles, sogar auf die jetzige Kleidertracht aus, die, wie er meinte, auch eine Folge der Revolution sei. Er also war der alten guten Zeit getreu geblieben, wie in seinem Innern, so auch in seinem Aeußern, und ihn schmückte noch ein brauner Rock mit seidenem Futter und goldgesponnenen Knöpfen, wie es sich für einen Haushofmeister aus dieser guten Zeit ziemte. Seine Haare waren frisirt und gepudert und hinten in einem zierlichen Haarbeutel vereinigt, er steckte, wenn er vor seine Herrschaft trat, drei Finger seiner rechten Hand in die mit Seide und ein wenig Gold gestickte, atlaßne Weste, indeß er den Hut unter dem linken Arme hielt, auch erlaubte er sich nie anders, als in seidnen Strümpfen, vor der Gräfin zu erscheinen. So belehrte er die Bedienten des Hauses, mit solcher Ehrerbietung behandelte man ehedem seine Herrschaft und zeigte dadurch öffentlich der Welt, daß man Leuten von hoher Geburt diente, die durch ihre edeln Eigenschaften unsere tiefste Verehrung verdienten. Aber jetzt, seufzte er dann oft, jetzt ist freilich Alles anders, seit der unglücklichen Revolution kümmert sich kein Diener mehr darum, von welcher Geburt seine Herrschaft ist, auch sind ihm ihre Eigenschaften gleichgültig, Geld und Lohn wird jetzt allein berücksichtigt. Wahrhaft gekränkt konnte der alte Mann sein, wenn auf solche Rede ein leichtsinniger Bedienter antwortete: Natürlich, was geht mich die Herrschaft an, Wer am Besten bezahlt, dem diene ich am Liebsten, und mich kümmert es wenig, was er ist oder wie er ist. Wenn er solche Antworten auf seine wohlgemeinten Reden erhielt, dann zog er sich gewöhnlich auf sein Zimmer zurück und las Anekdoten aus der guten alten Zeit, von treuen Dienern und edeln Herren, und Niemand würdigte so sehr, als er, den bekannten Haushofmeister des großen Condé, der sich in Verzweiflung selbst entleibte, weil er glaubte, er würde den König nicht so bewirthen können, wie es die Ehre seines Herren erforderte.
Diesem Dübois näherte sich nun die Gräfin und fragte, indem sie ihn mit ihrem gewöhnlichen durchdringenden Blick ansah, mit etwas leiser Stimme: Haben Sie den verwundeten Officier schon gesehen? Ja, gnädige Gräfin, erwiederte der alte Mann, indem er sich verbeugte, ich habe ihn gesehen. Er richtete einen schnellen traurigen Blick auf die Gräfin, indem er diese wenigen Worte sagte, der Niemand sonst auffiel, der aber die Gräfin so bewegte, daß sie mit wankender Stimme sagte: Der Graf wünscht, lieber Dübois, Sie möchten die Sorge für den Kranken übernehmen, wenn es Ihre Kräfte und Ihre Gesundheit erlauben, das heißt, fügte sie erklärend hinzu, Sie möchten die Oberaufsicht führen, damit ihm nichts mangle, und da er wahrscheinlich nur französisch reden wird, und folglich Niemand von der Dienerschaft ihn verstehen kann, seine Wünsche von ihm erfahren und dann den Bedienten die nöthigen Befehle geben. Ich habe den gnädigen Herren Grafen schon um die Erlaubniß bitten wollen, antwortete der alte gutmüthige Mann, für die Pflege des Kranken zu sorgen; denn, sezte er mit einem Seufzer hinzu, wenn ich auch sonst keine Theilnahme für ihn hätte, so ist er doch ein Franzose, zwar ein Franzose aus der jetzigen Zeit, aber doch immer ein Sohn meines Vaterlandes, und das ist für mich hinreichend, um für ihn wie für einen eigenen Sohn zu sorgen. Ich wußte, daß Sie so denken, sagte der Graf, indem er ihm freundlich auf die Schulter klopfte, und Sie erzeigen mir eine wahre Gefälligkeit dadurch, daß Sie die Pflege des jungen Mannes übernehmen, denn nun kann ich völlig sicher sein, daß nichts versäumt wird, und in seiner gefährlichen Lage alle Vorschriften des Arztes genau befolgt werden. Dieser war nun auch hinzugetreten, und da er vernommen hatte, daß Dübois die Krankenpflege übernehmen wollte, so behandelte er ihn von diesem Augenblicke an halb als einen Amtsgenossen, halb als einen Untergebenen; er gab ihm ohne Umstände eine Menge Aufträge, was er alles für den Kranken thun sollte, und fügte bei jedem Auftrage die Ursache hinzu, warum Dieses und Jenes geschehen müsse. Dübois hörte Alles geduldig an und blieb in seiner höflichen Fassung, doch als der Arzt endlich im Eifer der Rede einen Knopf der atlaßenen Weste faßte, und indem er heftig daran zog, ihm einschärfte, alles Sprechen des Kranken zu verhindern, wurde der alte Mann ungeduldig, entzog sich mit einer geschickten Bewegung den Händen des Arztes und verließ mit einer Verbeugung das Zimmer, indem er sich kaum enthalten konnte zu bemerken, daß ehedem, vor der Revolution, auch die Aerzte besser erzogen gewesen wären, und nur die eigene gute Lebensart ihm die Kraft gab, diese unfeine Bemerkung zu unterdrücken.
Der Graf wendete sich nun an den Prediger mit der Bitte, die Nacht auf dem Schlosse zu bleiben, um ihm am andern Morgen beizustehn, den nöthigen Bericht an die Regierung über den Verwundeten aufzusetzen; mein Beamter, sagte er, ist in diesem Augenblicke abwesend, und ich, fügte er lächelnd hinzu, bin erst seit so kurzer Zeit hier, daß ich völlig fremd in den Geschäften bin. Der Prediger war sehr gern bereit, allen Beistand zu leisten, und nachdem auch seine Sache abgemacht war, und man den Befehl ertheilt hatte, den Schulzen und die Bauern auf's Beste zu bewirthen, begab sich die Gesellschaft nach dem Speisezimmer, um sich nach den Beschwerden des Tages bei einer wohl zubereiteten Abendmahlzeit zu erholen.
Da wir nun ein wenig zur Ruhe gekommen sind, sagte die Gräfin, so bitte ich Sie, uns doch mitzutheilen, wo Sie den Verwundeten in so kläglichem Zustande gefunden haben.
Sie wissen, erwiederte der Graf, daß unser guter Nachbar, der Baron Löbau, nicht mit mir über die Grenzen unserer Besitzungen einig ist, und daß ich, da mir der Zustand der Ungewißheit im Großen, wie im Kleinen zuwider ist, und ich Streitigkeiten verabscheue, mich entschloß, trotz der ungünstigen Witterung, mit ihm nach der Gegend hinzureiten, um wo möglich an Ort und Stelle Alles auszugleichen. Wir machten den Ritt mit einander, und auf einer kleinen, von waldbewachsenen Hügeln umgebenen Fläche, mitten im streitigen Grenzlande, fanden wir den unglücklichen jungen Mann; wir entdeckten, da wir untersuchten, noch Spuren des Lebens, ich hüllte ihn in meinen Mantel und ritt nach dem nächsten Dorfe, um Hülfe herbei zu rufen; der Herr Prediger war so gut mich zu begleiten, wir boten den Schulzen und die Bauern auf, und eilten, so schnell es sich thun ließ, nach dem Walde zurück. Der gute Baron war indeß bei dem Verwundeten geblieben, er hatte ihn mit Hülfe des Bedienten auf eine trockene Stelle gebracht und suchte ihn gegen den Regen so viel als möglich zu schützen. Der Kranke hatte die Augen einigemale aufgeschlagen, und ein dumpfes Stöhnen zeigte, daß er noch lebte; der Herr Pfarrer verband in der Eile seine Wunden, wir legten ihn auf Kissen und hüllten ihn in Decken, und ich nahm meinen Mantel zurück. Als der Verwundete auf der Bahre lag, trat der Baron davor, und indem er feierlich um sich blickte, fragte er, wohin nun mit ihm? Es käme dem zu, für ihn zu sorgen und der Regierung darüber zu berichten, auf dessen Grund und Boden er gefunden worden, allein wessen ist der Grund und Boden? Ich bemerkte, da meine Wohnung näher liege, als das Schloß des Barons, so wollte ich mich der Pflege des Verwundeten annehmen. Sehr wohl, erwiederte der Baron, aber ohne daß dadurch ein Recht auf diesen Grund und Boden entsteht; wenn Sie es bloß als eine Handlung der Menschlichkeit und nicht als eine Posseß-Ergreifung betrachten wollen, so bin ich zufrieden, daß Sie ihn fortbringen lassen. Ich gab feierlich mein Wort, auf die Handlung kein Recht zu begründen; der Herr Pfarrer war Zeuge unseres Vertrags, und danach sezte sich der Zug in Bewegung. Wir hielten im Dorfe an, der Herr Pfarrer suchte dem Kranken einige stärkende Mittel einzuflößen, wir versahen uns mit Lichtern, und so erreichten wir endlich nach manchen ängstlichen Augenblicken das Schloß.
Und hier, rief der Arzt mit Hastigkeit, wird nun der junge Mann unter meinen Händen entweder genesen oder sterben.
Eines von beiden, erwiederte der Graf, wird wahrscheinlich eintreten, doch hoffe ich von seiner Jugend und Ihrer Geschicklichkeit das Beste.
Es steht schlimm um ihn, bedenklich schlimm, sagte der Arzt, indem er die Augen fest zudrückte und den Kopf auf die linke Schulter senkte. Aber warum, fuhr er nach einem kurzen Schweigen den Pfarrer an, warum haben Sie ihn nicht lieber in ihrem Hause behalten? Der lange, beschwerliche Weg über das Gebirge hat die Kräfte des armen Kranken noch vollends erschöpft und gewiß seinen Zustand sehr verschlimmert.
Ich dachte, sagte der Pfarrer mit einiger Verlegenheit, da Sie hier im Hause sind, und ärztliche Hülfe das Wichtigste für den jungen Mann ist, daß es am Besten sei, wenn er unter Ihren Augen wäre.
Nichts, nichts! rief der Arzt, Sie selbst verstehen recht viel von der Kunst, Sie hätten ihn gut pflegen können, Sie hätten die Einsichten gehabt, alle nöthigen Mittel richtig anwenden zu können, es wäre dem Kranken nichts bei Ihnen abgegangen.
Aber, sagte der Pfarrer verdrüßlich, Sie hätten nicht so oft nach ihm sehen können, und das ist doch das Wichtigste.
Ich hätte mir, rief der Arzt, mein Pferdchen satteln lassen, schnell wäre ich des Morgens bei Ihnen gewesen; was mach ich mir aus Beschwerde! Und hätte ich hier keinen Kranken gehabt, und das Wetter wäre zu schlecht gewesen, so wäre ich die Nacht bei Ihnen geblieben, das hätte sich Alles machen lassen, und Sie haben immer unrecht daran gethan, den armen Menschen so weit, auf so schlechten Wegen, bei solchem Wetter und in einem so elenden Zustande fortschleppen zu lassen.
Der Arzt ahnte nicht, wie sehr er den Pfarrer quälte, denn er wußte nicht, daß dieser zwar höchst dienstfertig war und alle Hülfe leistete, so lange bloß seine Thätigkeit in Anspruch genommen wurde, daß er sich aber augenblicklich zurück zog, wo seine Hülfsleistungen ihm Kosten verursachten oder Verantwortlichkeit zuziehen konnten. Als man deßhalb vor seinem Hause mit dem Verwundeten anhielt, kämpfte er in der That mit sich, ob er ihn nicht aufnehmen sollte, denn er sah das Gefährliche seines Zustandes wohl ein, indeß die Furcht vor Kosten und Verantwortlichkeit trug den Sieg über seine Menschenliebe davon, und er folgte dem Zuge mit banger Sorge, denn ihn quälte die Furcht, der Kranke möchte unterwegs sterben, und es war ihm eben so peinlich, daran zu denken, was auf den Fall alle seine Pfarrkinder von ihm sagen möchten, als wie sehr ihn sein eigenes Gewissen beunruhigen würde. Der Graf suchte den Pfarrer von den Vorwürfen des Arztes zu erlösen, indem er erklärte, er, als der Grundherr, würde es nicht wohl haben zugeben können, daß der Verwundete, der ein feindlicher Offizier scheine, sich anderswo, als unter seinen Augen aufhielte, so lange, bis eine Bestimmung über ihn von der Regierung einträfe. Der Arzt schwieg zwar einen Augenblick, wendete sich aber gleich wieder zum Pfarrer und rief: Ich hätte mir den Kranken nicht entgehen lassen, Sie haben immer unrecht gethan!
Nach aufgehobener Tafel zogen sich die Frauen in ihre Zimmer zurück, und der Graf, begleitet vom Arzt und Prediger, besuchte noch einmal den Kranken; sie fanden ihn schlafend, und Dübois berichtete, er sei in so weit zu sich gekommen, daß man ihm einige Arzneien und auch einige Nahrungsmittel habe einflößen können, darauf sei er eingeschlafen. Gut, sehr gut, rief der Arzt, nun gewacht, darauf geachtet, wenn er aufwacht, dann gleich zu mir gekommen und mich gerufen, damit wir sehen, was alsdann zu thun ist; nur den Schlaf des Kranken nicht gestört, der Schlaf stärkt und beruhigt alle Nerven. Der Arzt hatte die Gewohnheit, alle seine Verordnungen entweder in so abgerissenen Sätzen zu geben, oder sehr weitläuftig auseinander zu setzen, weßhalb dieses oder jenes geschehen solle, und die beabsichtigte Wirkung genau zu zu beschreiben, in der Regel wendete er aber die lezte Art, seine Verordnungen mitzutheilen, nur bei Gebildeten an, von denen er voraussetzte, daß sie ihn verstehen könnten.
Der Graf sagte freundlich zu dem alten Haushofmeister: Sie werden doch, lieber Dübois, nicht die Nacht aufbleiben wollen? Es würde Sie bei Ihrem Alter zu sehr angreifen?
Der gnädige Herr Graf bemerken, sagte der alte Mann, daß ich es mir schon in dieser Absicht bequem gemacht habe. (Er hatte einen weiten braunen Oberrock angezogen.) Es wird mir nichts schaden, einige Nächte aufzubleiben, und ich habe denn doch, wenn Gott den Kranken zu sich nehmen sollte, ein ruhiges Gewissen. Er sah in diesem Augenblicke auf das bleiche Gesicht des Verwundeten und konnte seine Thränen nicht zurückhalten, ob er es gleich nicht schicklich fand, in Gegenwart des Grafen zu weinen. Dieser drückte ihm gerührt die Hand und sagte: Sie sorgen stets so treu für Andere und so wenig für Sich selbst, denken Sie daran, wie sehr es die Gräfin und mich schmerzen würde, Sie zu verlieren, und schonen Sie sich.
Der alte Mann hielt einen Augenblick die Hand des Grafen, und sah ihm mit Dankbarkeit und Entzücken in die Augen. Er kam sich in diesem Augenblicke vor wie der Diener eines hohen Fürsten aus der guten alten Zeit vor der französischen Revolution, dessen Treue und Ergebenheit öffentlich von seinem Herren vor den Edeln des Reichs anerkannt wird. Der Graf drückte noch einmal seine Hand und sagte mit großer Güte: Gute Nacht dann, lieber Dübois; schlafen Sie wohl, meine Herren, sagte er drauf mit einer Verbeugung zum Arzt und Pfarrer, und verließ das Zimmer. Dübois schwieg, aber seine Liebe für den Grafen und die Gräfin wuchs diesen Abend zu einem so hohen Grade, daß keine Opfer, welche sie auch von ihm hätten fordern können, ihm zu groß gedünkt hätten.
Der Arzt bemerkte, daß es noch nicht spät sei, und lud den Pfarrer ein, da nun die Geschäfte des Tages vollbracht wären, noch ein Stündchen ihm auf seinem Zimmer bei einer Pfeife Tabak Gesellschaft zu leisten. Diese Einladung wurde vom Pfarrer um so bereitwilliger angenommen, je mehr er sich längst darnach gesehnt hatte, seine gewohnte Abendpfeife in behaglicher Ruhe bei einer zwanglosen Unterhaltung zu rauchen.
III
Schon längst war es der sehnlichste Wunsch des Pfarrers gewesen, die nähern Familienverhältnisse des Grafen zu erfahren. Ohne bösartig zu sein, wurde er von einem inneren Verlangen getrieben, Alles zu erforschen, was irgend einen Menschen oder eine Familie betraf, die zu dem Kreise seiner Bekanntschaft, wenn auch in weitester Entfernung, gehörten; ja, Manche, die ihn näher kannten, behaupteten, seine große Dienstfertigkeit entspringe zum Theil daher, weil sie ihm Gelegenheit verschaffe, Manches zu erfahren, was ihm verborgen bleiben würde, wenn er sich nicht willig mit den Angelegenheiten vieler Menschen beschäftigte. So kam es, daß er der allgemeine Rathgeber der ganzen Gegend war, ihr Rechtsfreund, wenn die Prozesse nicht zu wichtig waren, der Arzt aller Bauern und Beamten, die weit lieber ihm ihre Gesundheit anvertrauten, als sich an einen wirklichen Arzt wendeten. Er häufte auf diese Weise Arbeit und Beschwerden aller Art auf sich, und fühlte sich vollkommen belohnt, wenn seine Klienten und Patienten alle Fragen, die er ihnen vorlegte, gewissenhaft, genau und treu beantwortteten, dagegen konnte er aber in unbescheiden üble Laune gerathen, wenn es sich Jemand beikommen ließ, nur seine Arzneimittel oder seinen Rath benutzen zu wollen, ohne ihm weitere Auskunft über sich und Andere zu geben, so wie er eine mitleidige Verachtung gegen die Wenigen empfand, die in der That nichts zu sagen wußten, weil sie sich nicht um die Angelegenheiten Anderer bekümmerten; einem Solchen konnte er mit wahrer Bitterkeit sagen: Es ist unbegreiflich, wie man in der Welt mit den Menschen kann leben wollen, ohne sich um sie zu bekümmern. Bei solchen Eigenschaften war es natürlich, daß, ob er zwar sein Amt vorschriftsmäßig verwaltete, und man nicht sagen konnte, daß er etwas von seiner Pflicht versäumte, doch allen seinen Handlungen der geistliche Charakter, möchte ich sagen, fehlte, und man auf der Kanzel, wie vor dem Altar immer den Geschäftsmann sah, der nun grade dieß Geschäft abmachte, weil Zeit und Stunde es forderten. Er fühlte dieß selbst und zwang sich oft, Ernst und Salbung in seine Haltung und Mienen zu bringen, die, weil sie im vollkommenen Widerspruche mit seinem übrigen Thun und Treiben standen, ihm einen Anstrich von Heuchelei gaben, die seiner Seele fremd war.
Diesem Manne nun mußte es höchst peinlich sein, daß der Graf seit einigen Monaten auf dem Schlosse lebte, ohne daß er erfahren konnte, weßhalb. Denn ihm schien es unnatürlich, daß ein Mann wie der Graf, der beinah funfzig Jahr alt war und seit zwanzig Jahren unumschränkter Besitzer eines großen Vermögens, der sich in der ganzen Zeit wenig um seine Güter bekümmert, sondern immer abwechselnd in den größten Städten Europas gelebt hatte, nun auf ein Mal, und zwar im Herbst, sich ohne Ursache auf eines seiner Schlösser zurückziehen sollte. Ebenso hatte er nur dunkle Nachrichten über die Art, wie die Verbindung zwischen dem Grafen und der Gräfin sich gebildet hatte, denn obgleich die Gräfin in Schlesien geboren war, so war sie doch im Auslande mit dem Grafen verheirathet worden, und er wußte nicht einmal recht, wo? Der Graf war der protestantischen Kirche zugethan, dagegen war die Gräfin katholisch, ja er hatte dunkel gehört, sie sei dazu bestimmt gewesen, sich dem Kloster zu weihen, und er hatte nie erfahren können, was ihren Entschluß konnte geändert haben.
Der einzige Bruder der Gräfin hatte große Besitzungen, die kaum zehn Meilen von dem jetzigen Wohnorte des Grafen entfernt waren, aber auch er war seit langer Zeit abwesend, und der Pfarrer wußte nicht einmal, wo er sich aufhielt. Der Graf und die Gräfin behandelten sich gegenseitig mit großer Achtung, aber mit einer gewissen Zurückhaltung, und es ließ sich nicht bestimmen, ob sie glücklich oder unglücklich mit einander lebten. Selbst der alte Dübois war ihm eine räthselhafte Person, und er konnte es nicht herausbringer, weßhalb er von dem Grafen und der Gräfin mit so viel Schonung, Achtung und Aufmerksamkeit behandelt wurde.
Diese Fragen, die er sich selbst oft vorgelegt hatte, ohne sie befriedigend beantworten zu können, glaubte er, würden ihm nun wenigstens zum Theil aufgelöst werden. Denn da der Arzt mit dem Grafen gekommen war und, wie es schien, ihn schon eine Zeitlang auf seinen Reisen begleitet hatte, so glaubte er, daß dieser ihm über Vieles Aufschluß geben könnte.
Es war dem Pfarrer zu vergeben, daß er so falsche Hoffnungen auf den Arzt gründete, er hatte noch nicht Gelegenheit gehabt, ihn näher kennen zu lernen, nur bei Kranken hatte er ihn einigemal angetroffen, die die ganze Aufmerksamkeit des Arztes in Anspruch nahmen, und es war zwischen ihm und dem Pfarrer von nichts die Rede gewesen, als von dem Zustande dieser Kranken. Er hatte also nicht bemerken können, daß der Arzt zu den unschuldigen Egoisten gehörte, die nur sich selbst beachten und nur ihre Wissenschaft verehren, für die also die übrigen Menschen nur in so weit bedeutend sind, als sie diese Wissenschaft an ihnen ausüben können. Darum war ein gefährlich Kranker für ihn von höchster Wichtigkeit, der seine ganze Theilnahme in Anspruch nahm, dem er alle seine Zeit, alle seine Gedanken widmen konnte, und für den er eine dankbare Liebe gewann, wenn er endlich, nachdem er sich pünklich allen Vorschriften unterworfen hatte, genas, und durch Leben und Gesundheit zeigte, daß die Wissenschaft über die Krankheit zu triumphiren vermag. Dagegen hatte er eine Art von Verachtung gegen Personen, die häufig leiden, ohne sich für eine bestimmte Krankheit zu entscheiden und sie nach den Regeln durchzumachen, deren reizbare Seele nachtheilig auf den Körper wirkt, und die dann, wenn der Körper dem Uebel erliegt, das ihm die Seele zufügt, zum Arzte ihre Zuflucht nehmen. Zu diesen Unglücklichen gehörte eigentlich die Gräfin, und es war dem Arzt jedesmal verdrießlich, wenn er zu ihr gerufen wurde. Gesunde konnten in der Regel nur in so fern darauf Anspruch machen, seine Theilnahme zu erregen, als er sie geeignet fand, mit ihnen über seine Wissenschaft oder über sein Leben zu reden. Denn so arm und eng sein Leben auch war, so höchst wichtig, bedeutend und lehrreich erschien es ihm; der kleinste Vorfall dünkte ihm eine wunderbare Begebenheit, die nicht verfehlen könnte, ein großes Interesse zu erregen; seine Meinungen und Ansichten kamen ihm entscheidend vor, und er hatte keine Ahnung davon, daß er von der Welt und dem Leben gar nichts wußte, denn er hielt sich sonderbarer Weise mit allen diesen Eigenheiten für einen Weltmann.
Diese beiden nun saßen im Zimmer des Arztes, Jeder in einer Ecke des Sophas behaglich Taback rauchend, der Pfarrer mit dem bestimmten Plane, so viel als möglich vom Arzte zu erfahren, und dieser im Nachdenken versunken, wie sein Kranker auf's Beste zu behandeln sei.
Sind Sie schon lange mit dem Herren Grafen auf Reisen? unterbrach endlich der Pfarrer das Stillschweigen.
Auf Reisen? erwiederte der Arzt; ich bin gar nicht mit ihm auf Reisen gewesen, ich liebe solide Studien, das kann man auf Reisen nicht haben. Ich war eine Zeitlang in Wien in des Grafen Hause und bin dann mit ihm hieher gereist, wo ich mich gänzlich nieder zu lassen denke. Ja, ja! rief er lächelnd, ich will mich hier ansiedeln, Sie hätten wohl nicht gedacht, daß ich hier meine Hütte bauen will.
Die Gegend ist äußerst angenehm, sagte der Pfarrer, das würden Sie im Frühlinge finden, jetzt kann es Ihnen freilich wenig hier gefallen.
Ei, sagen Sie das nicht, rief der Arzt, ich bin sehr angenehm beschäftigt gewesen, so lange ich hier bin, ich habe drei so merkwürdige Kranke, daß mich die Aerzte in Wien darum beneiden würden. Der eine, wissen Sie, ist der alte Schmidt, bei dem ich Sie einmal antraf, wie heißt er doch gleich? ich fand ihn in dem erbärmlichsten Zustande von der Welt, als ich hier ankam, jetzt fängt er an sich zu erholen, daß es eine Freude ist ihn anzusehn; bring' ich den Menschen den Winter durch, so sollen Sie sehen, er wird vollkommen hergestellt. Der Leinweber, das ist wahr, der ging mir drauf, aber es war auch nichts an dem Menschen, er hörte nicht, er folgte nicht, er wollte nach seinem Kopfe leben, und er hat gesehn, was dabei heraus kömmt.
Der Pfarrer wollte nichts hören von Leuten, die er in allen ihren Verhältnissen genau kannte, und suchte deßwegen das Gespräch auf andere Gegenstände zu lenken. Ich meine, sagte er, die Natur kann jetzt keinen Reiz für Sie haben, die im Frühling und Sommer hier unglaublich schön ist.
Freilich, freilich, erwiederte der Arzt, die Natur schlummert jetzt, aber die Studien, Herr Pfarrer, die Studien müssen uns schadlos halten, der Graf hat auf meinen Vorschlag alle neueren medicinischen Schriften kommen lassen, die älteren besitze ich längst selbst, dabei wird mir der Winter verfliegen, daß ich es beklagen werde, wenn er vorbei ist.
Sie leben wenig in der Welt, wie es scheint, bemerkte der Pfarrer. In der Welt, antwortete der Arzt, wie sollte ich nicht? Ich lebe immerfort in der Welt, von einem Kranken geht es zum andern, von Hohen zu Niedern, von Niedern zu Hohen, dadurch gewinnt man Menschenkenntniß, Herr Pfarrer, vor dem Arzte versteckt man sich nicht, der Arzt ist wie der Beichtvater, er durchschaut die innerste Seele.
Sie haben Recht, sagte der Pfarrer, und manche Uebel könnten wohl nur der Arzt und der Beichtvater gemeinschaftlich heilen.
Solche Uebel sind mir zuwider, sagte der Arzt, eine reine, vernünftige Krankheit, da weiß man, was man thun soll, und wenn in solchem Falle der Körper auf die Seele wirkt, der Kranke schwermüthig, trübsinnig wird, so weiß man, wie man ihn erheitern, zerstreuen soll; man liest ihm vor, man erzählt ihm, und ist es so weit, daß es angeht, so führt man ihn spazieren. Aber wo die Seele auf den Körper wirkt, mit solchen Kranken ist gar nichts anzufangen.
Sollte nicht die Frau Gräfin eine solche Kranke sein? fragte der Pfarrer mit schlauer Miene.
Ei, ei! rief der Arzt erstaunt, ja beinah erschreckt, wer hat Ihnen das verrathen? Meine Lippen sind versiegelt, ich bin stumm wie das Grab; schändlich der Arzt, der eines Mißbrauches dessen fähig ist, was er an seinen Kranken bemerkt.
Ich glaubte, sagte der Pfarrer, man kann es der Gräfin auf den ersten Blick ansehen, daß sie nicht glücklich ist.
Wie so? fragte der Arzt bestürzt; woran wollen Sie das bemerkt haben?
Sie hat etwas Schwermüthiges in den Augen, erwiederte der Pfarrer, ihre Stirn ist nicht heiter, die Blässe der Gesichtsfarbe scheint die Folge von Gram und Kummer zu sein, sie thut sich selbst Gewalt an, um an der Unterhaltung Antheil zu nehmen; das Alles weist hin auf einen entweder durch eigene, oder durch fremde Schuld gestörten Seelenfrieden.
Der Arzt schwieg einen Augenblick und sagte dann: Ich glaube, die Gräfin ist ungern hier, sie scheint das Landleben zu hassen, sie ist mehr für die große Welt. In der ersten Woche, die wir hier zubrachten, verließ sie beinah ihr Zimmer nicht, und ich sah sie gar nicht. Endlich führte mich der Graf eines Abends zu ihr, und ich fand sie so angegriffen, so verwandelt, daß ich mich recht entsezte. Es war mir leicht einzusehen, daß Gemüthsbewegungen das Alles hervorgebracht hatten; ich sagte es ihr klar und deutlich, daß sie selbst das Beste dafür thun müßte, um sich herzustellen, daß meine Mittel allein nicht wirken könnten. Sie verstand mich nicht und wollte mich nur los sein, um wieder den ganzen Abend zu weinen, wie das solche Kranke an sich haben; aber ich sagte ihr gerade heraus, daß sie Gesellschaft brauche und sich zerstreuen müsse; ich bot ihr an, eine Parthie Schach mit mir zu spielen, dazu hatte sie mich sonst zuweilen aufgefordert; ich meinte es aufs Beste, aber nichts war mit ihr anzufangen, der Graf mischte sich hinein und wollte behaupten, Einsamkeit würde heute am Wohlthätigsten auf sie wirken. Ich bewies ihm deutlich, daß er sich irrte, und gab ihm zu verstehen, daß er von der Medicin nichts wüßte, und können Sie denken, ein so gescheiter Mann, als der Graf, wurde empfindlich und sagte mir ganz trocken: meine Einsicht möge die bessere sein oder nicht, man müsse auf jeden Fall dem Wunsche der Gräfin nachkommen.
Mein Amtseifer verleitete mich zu sagen: Wenn es also der Wunsch der Frau Gräfin ist, ihre Gesundheit völlig zu Grunde zu richten, so muß ich als Arzt ihr darin beistehen? Ich sah wohl, daß der Graf böse wurde, aber ich war so aufgebracht in dem Augenblick, daß ich Alles aufs Spiel setzte und mich um die Folgen nicht bekümmerte, wenn sie auch die entsetzlichsten gewesen wären. Die Gräfin sagte einige Worte englisch zum Grafen, sie weiß, das verstehe ich nicht, und auf einmal war der Graf ganz ruhig. Sie bat mich nun, den andern Morgen zu ihr zu kommen, und versprach mir, dann eine ernstliche Kur anzufangen und Alles, was ich verordnen würde, gewissenhaft zu brauchen. Was blieb mir übrig, ich mußte gehen, aber ich fühlte damals, lieber Herr Pfarrer, die Wahrheit der Behauptung: daß es keine Rosen ohne Dornen gibt; ich fühlte mich in einer, einem Manne nicht geziemenden Abhängigkeit vom Grafen und bedurfte aller meiner Philosophie, um mich über mein Schicksal zu trösten.
Es scheint also, bemerkte der Pfarrer, daß die Gräfin sehr auf den Grafen einwirkt, daß seine Ansichten sich nach den ihrigen richten, mit einem Wort, daß sie eine gewisse Herrschaft über ihn ausübt.
Ja, ja! rief der Arzt, das mag wohl sein, da zünden Sie mir ein großes Licht an, Herr Pfarrer, wodurch ich auf einmal die richtige Ansicht bekomme. Es ist doch sonderbar, daß ich immer in meinen wichtigsten Lebensverhältnissen mit Frauen zusammentreffe, die ihre Männer beherrschen.
Ist Ihnen das schon öfter begegnet? fragte der Pfarrer lächelnd.
Auf eine höchst merkwürdige Weise ist es mir begegnet, entgegnete der Arzt, im wichtigsten Augenblick meines Lebens ist es mir begegnet. Ich wäre beinah Ihr Amtsbruder geworden, müssen Sie wissen, ich studirte Theologie, meine Angehörigen wünschten es, man verschaffte mir ein Stipendium, und der erste Professor der Theologie auf der Universität, die ich bezog, war mein Oheim. Ich verschweige den Namen der Universität, ich will Niemanden schaden: Sie sehen, ich hatte brillante Aussichten. Aber ich darf wohl sagen, von der Wiege an verfolgte mich das Unglück, vernichtete meine schönsten Träume und stählte mich eben dadurch zum Philosophen.
Was begegnete Ihnen denn so Seltsames? fragte der Pfarrer mit gespannter Neugierde.
Denken Sie, antwortete der Arzt, ich komme an und finde meinen Oheim, den Professor, verheirathet.
Nun, sagte der Pfarrer lächelnd, das ist weder seltsam, noch merkwürdig, beinah alle Professoren sind verheirathet.
Ja, aber wie war er verheirathet, versetzte der Arzt, darauf kommt es an. Entwürdigt hatte er sich, erniedrigt bis zur Verbindung mit seiner Haushälterin, einer rohen Person, die von Bauern abstammte, keine Kenntnisse hatte, als was Kochen und Waschen anbetraf, eine Gesellschafterin, die eines Gelehrten völlig unwürdig war. Ich überwand mich, diese rohe Bäuerin Frau Base zu nennen, weil ich niemals gegen die Pflichten der feinen Lebenart verstoße; ich ließ mir aber die Ueberwindung deutlich merken, die es mich kostete, um meiner eignen Würde nichts zu vergeben, und die rachsüchtige Furie verfolgte mich von dem Augenblick an. Ich bemerkte es bald, daß sie meinen Oheim ganz beherrschte und zu meinem Nachtheil auf ihn wirkte; seine Güte für mich hörte auf, und das Leben in seinem Hause wurde mir sehr verbittert. Dadurch wuchs die Abneigung gegen die Theologie, die ich immer empfunden hatte; meine Neigung zur Medicin wurde größer, als je; außerdem erlaubte mir meine schwache Brust nicht zu predigen, und so entschloß ich mich zu handeln wie ein Mann. Ich schrieb meinem Oheim einen Brief, worin ich ihm alle Gründe auseinandersetzte, die meinen Entschluß bestimmten, und nahm von der Theologie Abschied. Ich meldete ihm zugleich, ich wünschte ihn den Abend auf seinem Studirzimmer zu sprechen, um mich mit ihm über meine Laufbahn zu berathen. Ich stellte mich ein zu der Stunde, die ich ihm bestimmt hatte, aber denken Sie sich mein Erstaunen, er war abwesend, und auf seinem Studirzimmer traf ich statt seiner die Megäre, sein Weib. Er hatte die Schwachheit gehabt, ihr mein Schreiben mitzutheilen, und sie stürmte mir mit einem Strom von Scheltworten entgegen, nannte mich unsinnig, daß ich mein Studium aufgeben wollte, fragte mich, wovon ich leben wollte, ob ich ihr zur Last zu fallen gedächte, und was der Gemeinheit mehr war. Ich, empört, daß eine so unwürdige Person sich ein Urtheil über Männer anmaßen wollte, deren Handlungen sie gar nicht fähig war, zu begreifen, sagte, indem ich meine Stimme bedeutend erhob, mit einem Ausdruck von Würde, der sie stutzig machte: Frau Professorin und Frau Base, merken Sie den Spruch und wenden sie ihn auf sich an, denn es ist darin nicht bloß die Kirche gemeint, sondern alles Würdige und Edle, was für Männer und nicht für Weiber gehört, Mulier taceat in ecclesia, dieses verordnete schon der Apostel Paulus.
Nun, sagte der Pfarrer, da ihre Base vermuthlich nicht lateinisch verstand, so ging diese Bitterkeit unschädlich vorüber.
Ich übersezte ihr, was ich gesagt hatte, rief der Arzt, aber nun war es auch hohe Zeit, der Furie zu entrinnen, ich verließ das Zimmer meines Oheims sogleich, und sein Haus vor Anbruch des Tages. Ich schrieb ihm aus Jena, wohin ich nun eilte, um mit ganzer Seele Medicin zu studiren, ich erhielt aber nur eine kurze, trockne Antwort, worin er mir meldete, daß er seine Hand gänzlich von mir abziehe, da ich mich erdreistet habe, seine Gattin mit solcher Frechheit zu beleidigen. Was war zu thun, ich mußte mich fügen, und ich kann sagen, daß ich mit geringen Mitteln die Arzneiwissenschaft wie ein Held erobert habe.
Jedoch, wie kamen Sie mit dem Grafen in Verbindung? fragte der Pfarrer, der gern wieder das Gespräch auf diesen Gegenstand leiten wollte, der ihm wichtiger war, als die Lebensgeschichte des Arztes, ob er gleich auch diese nicht ohne Theilnahme anhörte, denn es war ihm ein Bedürfniß geworden, aller Menschen Verhältnisse genau zu kennen, mit denen er irgend in Berührung kam.
Ich hatte es möglich gemacht, sagte der Arzt mit selbstgefälligem Lächeln, indem ich meine eignen Studien trieb, noch so viel durch Unterricht, den ich Andern gab, zu gewinnen, daß ich nicht nur lebte, sondern auch noch ein Sümmchen ersparte, womit ich mich auf den Weg nach Wien machte, um die großen Geister der dasigen Region kennen zu lernen. Es ging auch dort mühsehlig, aber es ging doch; ich erreichte meinen Zweck und studirte mit Eifer. Der Graf hielt sich zu der Zeit in Wien auf, er suchte einen geschickten jungen Arzt, der ihn auf seine Güter begleiten sollte, man empfahl mich, und ich erndtete nun die Früchte meines Fleißes; ich kann bei einem bedeutenden Gehalte nun ein völlig sorgenfreies Leben führen und ungehindert mich meinem Lieblingsfach widmen.
Der Pfarrer versuchte es einigemal, das Gespräch wieder auf den Grafen zu lenken; indeß die Phantasie des Arztes war zu sehr durch seine eigne wunderbare Lebensgeschichte angeregt und alle Fragen, die der Pfarrer an ihn richtete, er mochte sie wenden, wie er wollte, führten den Arzt immer wieder auf einen Vorfall seiner Jugend oder Kindheit, so daß nichts mehr aus ihm herzubringen war, und der Pfarrer, verdrießlich über die geringe Ausbeute, die er gemacht hatte, sich endlich entschloß, zu Bette zu gehen. Er verabredete noch vorher mit dem Arzte, daß sie um fünf Uhr am andern Morgen aufstehen und den alten Dübois von seiner Krankenwache ablösen wollten.
Nach dieser Verabredung begaben sich beide zur Ruhe, und überließen sich den Träumen, die ihrem Lager nahen wollten.
IV
Mit dem Schlage fünf stand der Pfarrer, der in allen Geschäften höchst pünktlich war und sein ganzes Leben zum Geschäft machte, vor dem Bette des Arztes und ermahnte ihn, der Verabredung gemäß, aufzustehen, indem er ihm zugleich anzeigte, daß der Kaffee schon auf dem Tische stehe, wie sie es am vorigen Abend bestellt hätten.
Der Arzt sprang auf, kleidete sich mit großer Hast an und rieth dem Pfarrer, seine Morgenpfeife beim Kaffee zu rauchen, weil er nicht zugeben könne, daß im Zimmer des Kranken geraucht würde. Er selbst machte das Kaffeetrinken eilig ab, denn er hatte eine große Begierde, den Kranken zu sehen. Nach wenigen Minuten begaben sich beide, Arzt und Pfarrer, nach dem Krankenzimmer; sie fanden den Verwundeten ruhig schlummernd und den alten Haushofmeister neben dem Bette desselben in einem Lehnstuhl sitzend. Er hatte seine silbergrauen Haare mit einer weißen Nachtmütze bedeckt, Pantoffeln an den Füßen, seinen weiten braunen Ueberrock bis oben zugeknöpft und las mit der Brille auf der Nase andächtig in einem französischen Gebetbuche, beim Schein einer Lampe, deren Schimmer er so gerichtet hatte, daß der Kranke nicht von den Lichtstrahlen belästigt wurde.
Nun, wie gehts, bester Herr Dubois, rief der Arzt eilig, wie geht's mit unserm jungen Manne? Sie haben mich nicht gerufen, in der Nacht ist also wohl nichts vorgefallen?
Der Kranke, versetzte der Haushofmeister, erwachte aus seinem Schlummer vor einigen Stunden, er blickte um sich und wollte sich aufrichten; es war ein rührender Anblick, dem armen jungen Mann fehlten die Kräfte, ich bat ihn ruhig zu sein. Wo bin ich? fragte er französisch. Ich gab ihm in der Kürze einige Auskunft, ich weiß aber nicht, ob er mich verstanden hat; er forderte zu trinken, und als ich seinen Wunsch befriedigt hatte, sank er wieder in Schlummer, wie Sie ihn noch sehen.
Es ist gut, sagte der Arzt, es ist sehr gut, indem er den Puls des Verwundeten lange mit bedächtigen Mienen untersuchte. Jetzt, alter Freund, können Sie zu Bett gehen, und wir Beide, der Herr Pfarrer und ich, wollen die Krankenwache übernehmen.
Wäre es nicht besser, wenn ich hier bliebe? fragte der Haushofmeister; der junge Mann hat sich vielleicht schon an meinen Anblick gewöhnt, auch kann ich mich ihm verständlich machen.
Meinen Sie, es könne Niemand hier französisch sprechen als Sie? sagte der Arzt empfindlich; ich spreche so gut als Sie, und kann also mich dem Kranken eben so wohl verständlich machen. Diese letzten Worte fügte er als Beweis der Behauptung, die sie enthielten, französisch hinzu, indem er zugleich alles Nöthige zum Verbande des Verwundeten auf den Tisch in Ordnung legte; da er aber das Deutsche im härtesten Thüringer Dialekt sprach und diesen auch auf das Französische übertrug, so klangen seine Worte den Ohren des geboren Parisers so rauh, wie die Rede eines Wilden, und er sah den Arzt mit Erstaunen an, der so unbefangen behauptet hatte, dies sei so gutes Französisch, als nur immer er, der Pariser, zu sprechen vermöge.
Nun machen Sie, alter Mann, gehen Sie zu Bett, wiederholte der Arzt, Sie müssen durchaus einige Stunden schlafen, sonst werden Sie krank, und dann fallen Sie in meine Hände.
Diese letzte Aeußerung schien in der That Eindruck auf den Haushofmeister zu machen, denn er wollte sich stillschweigend mit einer Verbeugung aus dem Zimmer entfernen, der Pfarrer aber trat ihm in den Weg und ersuchte ihn, doch sogleich einen Boten zu schicken und den Kreisarzt aus dem nächsten Städtchen holen zu lassen; das hätten wir gleich gestern thun sollen, bemerkte er, es wurde aber in der Unruhe vergessen; es ist nöthig, daß er den Kranken sieht, der Herr Graf könnte sonst Ungelegenheiten haben. Dübois entfernte sich, um diesen Auftrag zu besorgen und sich dann zur Ruhe zu begeben. Der Arzt wartete auf das Erwachen des Kranken, und der Pfarrer fing an, den Bericht an die Regierung über ihn aufzusetzen. Diese Gesellschaft wurde nach einigen Stunden durch den Kreisarzt vermehrt. Der Kranke erwachte, seine Wunden wurden von allen Dreien gemeinschaftlich untersucht und verbunden, und auf einige Fragen, die er thun wollte, wurde er von Allen gemeinschaftlich bedeutet, daß er in guten Händen sei, aber sich fürs Erste alles Sprechens enthalten müsse, wenn er sein Leben erhalten wolle. Die größte Ermattung des Verwundeten machte, daß er sich geduldig in Alles fügte, was über ihn beschlossen wurde, und die fremden Menschen, die ihn umgaben, mit ruhigem Erstaunen betrachtete.





























