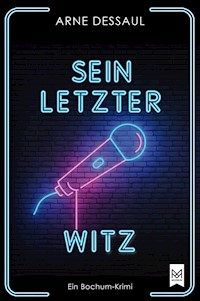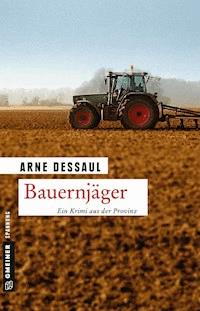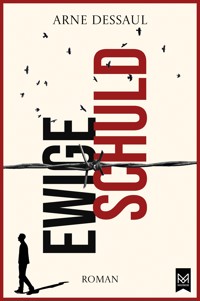
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zonenrandgebiet 1974 – ein düsteres Dorfgeheimnis, eine verhängnisvolle Liebschaft und die erste große Liebe "Hätte ich geahnt, was meine Fragen auslösen, hätte ich die Finger davongelassen." Eine tiefe Schuld, auch wenn wir sie nicht bewusst auf uns laden, verfolgt uns ein Leben lang. Wenn wir sie endlich tilgen wollen, machen wir es oft nur noch schlimmer. So ergeht es Fritz Tiedemann. Fritz bewegt sich zwischen den Welten. Als Einziger aus seinem Dorf geht er aufs Gymnasium in Wolfenbüttel und macht sich damit selbst zum Außenseiter. Als er und seine Mitschülerin Freda sich kurz vor dem Abitur näherkommen, beginnt für ihn ein neues Leben. Nicht zuletzt wegen Freda wühlt er tief in der Nazi-Vergangenheit seines Heimatdorfes und lüftet ein düsteres Geheimnis. Als ihn dann Elke, die Verlobte seines besten Freundes Helmut, verführt, gerät Fritz in einen gefährlichen Strudel, aus dem es kein Entrinnen gibt … Vor allem ahnt Fritz nicht, welche Tragödien er auslöst. Das ganze Ausmaß erschließt sich ihm erst mehr als vierzig Jahre später. Ein großer Gesellschaftsroman um Vergangenheit, Vergeltung und Schuld – voller Tragik, Spannung und großen Emotionen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arne Dessaul
Ewige Schuld
Roman
Über das Buch
Zonenrandgebiet 1974 – ein düsteres Dorfgeheimnis, eine verhängnisvolle Liebschaft und die erste große Liebe
„Hätte ich geahnt, was meine Fragen auslösen, hätte ich die Finger davongelassen.“
Eine tiefe Schuld, auch wenn wir sie nicht bewusst auf uns laden, verfolgt uns ein Leben lang. Wenn wir sie endlich tilgen wollen, machen wir es oft nur noch schlimmer. So ergeht es Fritz Tiedemann.
Fritz bewegt sich zwischen den Welten. Als Einziger aus seinem Dorf geht er aufs Gymnasium in Wolfenbüttel und macht sich damit selbst zum Außenseiter. Als er und seine Mitschülerin Freda sich kurz vor dem Abitur näherkommen, beginnt für ihn ein neues Leben.
Nicht zuletzt wegen Freda wühlt er tief in der Nazi-Vergangenheit seines Heimatdorfes und lüftet ein düsteres Geheimnis.
Als ihn dann Elke, die Verlobte seines besten Freundes Helmut, verführt, gerät Fritz in einen gefährlichen Strudel, aus dem es kein Entrinnen gibt …
Vor allem ahnt Fritz nicht, welche Tragödien er auslöst. Das ganze Ausmaß erschließt sich ihm erst mehr als vierzig Jahre später.
Ein großer Gesellschaftsroman um Vergangenheit, Vergeltung und Schuld – voller Tragik, Spannung und großen Emotionen!
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2024 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2024
Lektorat: Rainer Schöttle
Korrektorat: Herwig Frenzel
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt
Umschlagmotiv: © Good dreams - Studio/ Shutterstock, Sans Artwork / Shutterstock
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI Books GmbH
Made in Germany
ISBN: 978-3-98679-038-7
Inhalt
Über das Buch
Impressum
Vorwort
Teil 1 Januar bis Mai 1974
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
Teil 2 Sommer 1974
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
Teil 3 Sommer 2014
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
43. KAPITEL
44. KAPITEL
45. KAPITEL
Epilog
Der Autor Arne Dessaul
Arne Dessauls Krimis im Verlag
Vorwort
Wer meinen Krimi „Bauernjäger“ kennt (2017 im Gmeiner-Verlag erschienen), weiß, dass ich mich schon einmal mit dem Schicksal der russischen Soldaten Boris und Pawel beschäftigt habe, damals aus der Sicht von Helmut Jordan, dem Protagonisten meiner ersten fünf Bücher. Diesmal erzähle ich die Geschichte aus der Perspektive von Helmuts Gegenspieler Fritz Tiedemann. Er erlebt den verregneten Sommer 1974 vollkommen anders als Helmut, dennoch überschneiden sich die Geschichten an einigen Stellen.
Dieses Buch ist kein Krimi – trotz verschiedener Verbrechen und der schweren Schuld, die einige der handelnden Personen auf sich laden. Doch kein Kommissar überführt sie, keine Richterin verurteilt sie. Alle müssen allein mit ihrem Gewissen zurechtkommen, allen voran Fritz, dem ich einen Hang zu Soul und Funk andichte. Die bekanntesten Lieder des Jahres 1974 entsprangen jedoch anderen Genres. Diejenigen, an die ich mich am besten erinnere, heißen: Über den Wolken, Waterloo und Seasons in the Sun.
Teil 1 Januar bis Mai 1974
1. KAPITEL
Wer mag, darf über mich richten. Ich möchte jedoch zunächst alles erzählen. Danach akzeptiere ich jedes Urteil.
Meine Geschichte beginnt im Jahr 1974. Eine Zeit lang schwebte ich wie Reinhard Mey über den Wolken und genoss grenzenlose Freiheit. Das Lied, das mein Schicksal besser wiedergibt, ist aber ein anderes. Terry Jacks singt über einen jungen Mann, der sich nacheinander an seinen besten Freund, seinen Vater und seine Freundin wendet. Ein junger Mann, der Abschied nimmt. Endgültig.
Goodbye to you, my trusted Friend.
Das neue Jahr begann in Atze Hoiers Partykeller in Winnigstedt, einen Kilometer von der deutsch-deutschen Grenze entfernt und weltgeschichtlich so bedeutend, wie der Name der Tausendfünfhundertseelengemeinde es vermuten lässt. Die Leute in der Kreisstadt Wolfenbüttel verballhornten es gern als „Winzigstedt“, falls sie den Ort denn überhaupt kannten.
Immerhin erfreuten wir die westliche Welt mit einem Grenzübersichtspunkt. Die Besucher reisten von weit her an, um einen Blick aufs dunkle Deutschland zu werfen. Sie sahen einen rund um die Uhr mit Soldaten besetzten, viereckigen Wachturm aus Beton, Metallgitterzäune mit Selbstschussanlagen, einen Todesstreifen mit Landminen und in der Ferne ein verlorenes Nest jenseits der Sperrzone. Es hieß Veltheim und war für uns genauso unerreichbar wie Vietnam oder Vancouver.
Atzes Partykeller fügte sich in diese Tristesse ein. Alte, vollgeaschte, mit Rotwein-, Cola- und Wachsflecken gesprenkelte Teppichreste verdeckten halbherzig einen nackten Betonboden. An nachlässig verputzten Wänden sammelte sich neben Bravo-Starschnitten von Uschi Glas, Suzi Quatro, Mark Spitz und T-Rex das gleiche Sammelsurium an Flecken wie auf dem Teppich. Zwei zerschlissene Sofas waren um die sogenannte Tanzfläche gruppiert. Einzig die Theke erinnerte an einen Partykeller. Hier schenkte der Gastgeber Getränke aus und bediente nebenbei den Plattenspieler. Vor der Theke standen vier fadenscheinige Hocker, die wir weitgehend mieden.
Die Dorfjugend feierte seit knapp vier Jahren „unten bei Atze“ und, ganz ehrlich, es war uns egal, wie es aussah oder roch. Da alle qualmten, gern Alkohol verschütteten und jeder von uns mindestens einmal auf die Teppichflicken gereihert hatte, roch es sehr speziell.
Ich war achtzehn und Jungfrau. Diese Feier würde daran nichts ändern. Bei Atze tanzten fünf Pärchen und, mit mir, sechs männliche Singles ins neue Jahr hinein.
Eigentlich wäre ich lieber mit den Leuten von meiner Penne zusammen gewesen, der Großen Schule in Wolfenbüttel. Das hätte die Chance auf bessere Musik erhöht – und die auf Entjungferung. Rein theoretisch, da meine Mitschüler mit einigen ungebundenen Mädels feierten. In der Praxis hätte ich mich wie immer in die Falsche verguckt. Die Blonde mit der Zahnlücke, deren Freund gegen Mitternacht unvermittelt auftauchte. Die Rothaarige vom Gymnasium im Schloss, die hinter jemandem anders her war. Oder in die Brünette mit der frechen Brille, die gerade ihre letzte Beziehung aufarbeiten musste und sich nicht bereit fühlte für einen neuen Freund. Auch wenn er so süße dunkle Locken hatte wie ich, wie mir einige Male versichert worden war.
Dummerweise hatte ich es mir mit der wichtigsten Clique am Gymnasium verscherzt. Sie feierte ohne mich Silvester. Bei Lothar am Schiefen Berg, piekfeine Adresse in Wolfenbüttel. Ärzte, Anwälte, Firmenchefs, Professoren. Da passte ich Landei sowieso nicht hinein.
Okay, zwischenzeitlich hatte es funktioniert. Die Jungs hatten mir das Gefühl gegeben, dazuzugehören. Ich durfte in der Pause in ihrem Teil der Raucherecke abhängen. Ich fuhr mit ihnen ins Autokino und tanzte auf ihren Feten.
Jetzt war es vorbei. Das Asyl, das Lothar mir gewährt hatte, nachdem ich ihm in der elften Klasse bei einem Deutschreferat geholfen hatte, war abgelaufen. Es hatte damit angefangen, dass ich politisch geworden war und die falschen Witze erzählte. Witze über Barzel, über Strauß und andere führende Politiker von CDU und CSU. Lothar und seine Leute waren glühende Anhänger der CDU. Sie erzählten ihrerseits gemeine Witze über mein Idol Willy Brandt.
Ich lachte nicht über ihre Witze, sie nicht über meine. Ich versuchte, ihnen zu erklären, warum Brandt und Wehner genau die richtige Politik machten. Sie verdrehten die Augen, wechselten das Thema, ließen mich auflaufen. Sie verabredeten sich ohne mich. Kein Autokino, keine Feten, keine Treffen im Park. Auf ihre Raucherecke verzichtete ich von allein. Wir sprachen miteinander, aber sehr zurückhaltend, unterkühlt. Mein Ausflug in die Welt der Schönen und Reichen war beendet.
Jetzt blieben mir vom hundertfünfköpfigen Abiturjahrgang nur die anderen Außenseiter. Bis auf Detlev und Thomas interessierte mich keiner von ihnen. Beide feierten nicht Silvester. Also ließ ich mich von meinem besten Winnigstedter Kumpel mit zu Atze schleppen. Helmut Jordan, frischgebackener Malergeselle, und ich waren seit frühester Kindheit befreundet.
Dennoch beäugte ich ihn in diesem Moment, eine halbe Stunde vor Mitternacht, irritiert. Helmut und seine Freundin Elke interpretierten Bernd Clüvers Der Junge mit der Mundharmonika sehr eigenwillig. Irgendwo zwischen Stehblues und ungelenkem Tango. Die anderen Pärchen, die unter der niedrigen Decke schwoften, na ja, sie stahlen den beiden nicht gerade die Show. Der Alkohol forderte seinen Tribut, und gefeierte Tänzer hatte das Dorf noch nie hervorgebracht.
Nach ihrer Tanzeinlage gesellten sie sich zu mir an die Theke, wo ich an einer Cola mit reichlich Rum nippte. Helmut verwickelte mich in ein Gespräch, während Elkes Augen die Ferne absuchten. Mich sah sie praktisch nie an. Was schade war, denn Elke stach alle Blonden, Brünetten und Rothaarigen, die ich kannte, locker aus.
Helmut hatte entweder Laberwasser oder zu viel Cola-Rum getrunken. Nüchtern quetschte er meist nur das Nötigste zwischen den Zähnen hervor, jetzt analysierte er lang und breit die Lage seines Lieblingsvereins. Eintracht Braunschweig verbrachte ein unfreiwilliges Jahr in der Regionalliga. Und wie standen eigentlich die Chancen von Eintracht-Torhüter Bernd Franke, im Kader für die Fußball-WM zu landen?
Helmuts epischer Vortrag endete erst, als Atze Block Buster! auflegte und das Jahr 1973 für die meisten von uns auf der Tanzfläche endete. Laut und wild.
Ein paar Minuten später bevölkerten wir den Hof der Hoiers. Die Familie betrieb an der Ausfallstraße zum Nachbardorf Roklum eine Gärtnerei: drei Gewächshäuser und eine üppige Freilandfläche mitsamt Baumschule. Bei Hochzeiten, Beerdigungen, Konfirmationen oder runden Geburtstagen führte kein Weg vorbei an Hoiers Sträußen, Kränzen und Gestecken. Verständlich, dass das geflügelte Wort von „Hoiers florierenden Geschäften“ im Ort kursierte. Atzes Vater Anton war darüber hinaus unser Bürgermeister. Obwohl er der CDU angehörte, verstanden wir uns gut. Ich konnte mit ihm sogar über Politik diskutieren, ohne dass er mich gleich „nach drüben“ schicken wollte.
Die Nacht war trocken und mäßig kühl. Ich hatte meinen Parka übergezogen, drehte mir eine Zigarette und schaute den anderen zu, wie sie Böller warfen und Raketen in den Himmel feuerten. Es knallte und zischte, unten waberte der Qualm der Feuerwerkskörper, oben verzierten die Raketen den nächtlichen Himmel. Ab und zu ertönten Schreckensschreie, wenn ein Böller direkt neben einem Fuß explodierte.
In diesem Moment traten Atzes Eltern aus dem Haus. Sie feierten den Jahreswechsel zusammen mit Familie Wettenstedt, den größten Landwirten im Ort. Ein Treffen der oberen Zehntausend des Dorfes. Vater Hoier wankte direkt auf mich zu, im Schlepptau Jochen, ältester Sprössling der Wettenstedts, einundzwanzig Jahre alt und offenbar zu erwachsen für unseren Partykeller. Wenn er nicht auf dem Hof der Eltern arbeitete, fuhr er mit Anton Hoier – als dessen rechte Hand – durch die Gegend.
„Alles Gute zum neuen Jahr“, begrüßte Hoier mich. Er war um die fünfzig, knapp einen Meter fünfundsiebzig groß und stämmig. Wie sein Sohn Atze hatte er rotblondes, leicht gelocktes Haar. Er trug eine Trachtenjacke und paffte an einer Zigarre.
„Ihnen auch“, antwortete ich. Jochen ignorierte ich, da er mich ebenso wenig beachtete. Das tat er nie. Drei Jahre Altersunterschied plus ältester Sohn des größten Bauern im Dorf gegenüber dem Sohn eines einfachen Tischlers, das bedeutete eine Menge Distanz, beinahe einen Klassenunterschied, wie Detlev es genannt hätte.
„Was macht denn dein Willy so?“, fragte der Bürgermeister launig. Er hatte einige Bierchen und Schnäpse intus. Das verriet neben dem wackligen Gang die lallende Stimme.
„Er wagt mehr Demokratie“, nahm ich einen bekannten Slogan von Kanzler Brandt auf.
„Jetzt?“ Hoier grinste.
„Ich schätze, jetzt feiert er Silvester.“
„Der war gut!“ Hoier lachte lauthals und zog so Jochens Aufmerksamkeit auf uns. Der Bauernsohn musterte mich, während die nächsten Raketen in den Himmel zischten. Jochen war einen halben Kopf größer als ich und hatte hellbraune Haare mitsamt Seitenscheitel. Im Gegensatz zu Vater Hoier hatte er sich für den Abstecher nach draußen keine Jacke übergezogen. Er begnügte sich mit einem Rolli.
„Schöner Parka, Tiedemann.“ Er wackelte mit seinem rechten Zeigefinger grob in meine Richtung. Auch seine Stimme klang nach Bier und Korn. Bestimmt hatte er mit seinem Chef mithalten wollen.
„Danke.“ Alle Welt trug Parka. Keine Ahnung, warum Jochen unbedingt über meinen Anorak quatschen wollte.
„Und wo ist die Flagge?“
„Bitte?“ Jetzt ahnte ich, wohin die Reise gehen sollte.
„Na, die Deutschlandfahne am Ärmel! Die gehört schließlich dahin, nicht wahr? Auf einen Bundeswehrparka!“
Hoier verfolgte unseren Dialog mit gerunzelter Stirn.
„Die habe ich abgetrennt.“ Ich wäre jetzt gern sehr lässig gewesen, aber das gelang mir nicht. Ich zog mit zitternder Hand an meiner Kippe.
„Schämst du dich?“ Jochen rückte mir näher auf die Pelle.
„Bitte?“ Ich wusste anhand dieser Formulierung nicht, wofür ich mich schämen sollte.
Jochen half mir auf die Sprünge. „Schämst du dich, ein Deutscher zu sein?“
„Sollte ich denn stolz darauf sein?“
„Selbstverständlich.“ Seine Stimme troff vor Stolz.
„Auch auf Auschwitz?“
„Was?“
Ein kleiner Riss in Jochens Rüstung. Seine etwas zu laut geratene Antwort erreichte außerdem einige fremde Ohren. Zumindest Elke, Atze und Atzes Mutter schielten zu uns rüber. Als sie Hoier senior entdeckten, wandten sie sich wieder ab. Offenbar lag nichts in der Luft, wenn der Bürgermeister über die Szene wachte.
„Ob ich stolz auf Auschwitz sein soll?“, konkretisierte ich meine Frage.
„Du darfst Deutschland nicht auf Auschwitz reduzieren, Tiedemann. Das ist idiotisch!“ Jochen fletschte die Zähne.
„Ich reduziere gar nichts. Ich will nur nicht verdrängen wie …“
„Wie wer?“
„Wie du zum Beispiel.“
„Vorsicht, Tiedemann!“
Jochens Faust schnellte nach vorn, traf wuchtig auf meine Schulter. Garantiert hatte er auf exakt die Stelle gezielt, wohin in seiner Vorstellung die Deutschlandfahne gehörte.
Ich taumelte ein Stück zurück, nahm die Hände nach oben, in abwehrender Haltung. „Eh, was soll das? Bist du bescheuert?“
„Ich zeige dir gleich, wer hier bescheuert ist, du kleiner Bombenleger!“ Jochen hob die Hände, formte sie zu Fäusten. Er tänzelte wie Muhammad Ali vor mir herum und überrumpelte mich mit einer Links-rechts-Kombination. Seine linke Faust wehrte ich, wie ich dachte, geschickt ab. In Wahrheit wollte er mir eins mit der rechten Faust verpassen. Die schoss unter meiner Deckung hindurch und landete brutal in meiner Magenkuhle. Ich sank auf die Knie.
„Jungs, lasst es gut sein“, mischte sich Hoier endlich ein. Er schnappte sich Jochens Faust und sah seinen Assistenten böse an.
Ich keuchte und richtete mich langsam wieder auf. Ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Es entpuppte sich glücklicherweise als Fehlalarm. Die Situation war peinlich genug, mittlerweile besaß ich die ungeteilte Aufmerksamkeit beider Feiergesellschaften. Alle Blicke ruhten auf mir, der sich hustend den Dreck von der Jeans klopfte. Meine erste Prügelei seit der Grundschule. Auch damals hatte ich verloren.
„Lass uns reingehen“, sagte Hoier zu Jochen und legte den Arm um dessen Schultern.
Jochen nickte mir wortlos zu. In seinem Blick las ich, dass dies nicht das letzte Wort gewesen war oder besser: nicht der letzte Hieb.
2. KAPITEL
„Alles in Ordnung mit dir?“ Helmuts ovales Gesicht war wie aus dem Nichts neben mir aufgetaucht. Elke stand hinter ihm und starrte auf den Boden.
Ich erklärte Helmut den Grund unserer Auseinandersetzung. Er schüttelte den Kopf. Einerseits konnte er mit meinen politischen Überzeugungen wenig anfangen, da er sich nicht für Politik interessierte. Andererseits zählte Jochen nicht zu seinen Freunden.
Im Gegensatz zu mir. Wir waren wie Brüder aufgewachsen. Helmut war in meinem Elternhaus ein und aus gegangen, ich in seinem. Besonders eng war unsere Freundschaft während der Grundschulzeit. Wir liefen morgens zusammen zur Schule, saßen im Unterricht nebeneinander, spielten in den Pausen Fußball, stiefelten nach Unterrichtsende gemeinsam nach Hause und trafen uns nach dem Mittagessen und den Hausaufgaben sofort wieder.
Dann endete die Grundschulzeit. Helmut hatte sich nie für den Schulstoff interessiert, die Hausaufgaben ohne Hingabe erledigt und sich nie über eine Vier in Lesen oder Rechnen geärgert. Im Dorf war es sowieso üblich, dass die Kinder nach der Grundschule auf Real- oder Volksschule wechselten; einige schob man auf die Sonderschule für lernschwache oder verhaltensauffällige Schüler ab. Nur ein paar Exoten schafften den Sprung aufs Gymnasium. Zu denen gehörte ich, als einziger der fünfundzwanzig Schüler unserer Grundschulklasse. Ab dem fünften Schuljahr fuhr ich jeden Morgen um zehn vor sieben mit dem Linienbus nach Wolfenbüttel, die Fahrt dauerte eine Dreiviertelstunde.
Helmut blieb, wie viele ehemalige Mitschüler, im alten Schulgebäude, das außer der Grundschule eine Volksschule beherbergte. Erst in den letzten beiden Schuljahren, nach Auflösung dieser Schulform, fuhr er mit dem Schulbus in das kleine Städtchen Schöppenstedt, um die nagelneue Hauptschule zu besuchen.
Damit fiel automatisch ein großer Teil unserer gemeinsamen Zeit weg. Nachmittags trafen wir uns kaum noch. Während Helmut wie gehabt lieblos seine Hausaufgaben erledigte, büffelte ich oft stundenlang. Unserer Freundschaft tat dies zunächst keinen Abbruch. Komplizierter wurde es, als die Pubertät unser Interesse für das weibliche Geschlecht weckte. Während ich für hübsche, unerreichbare Lehrerinnen schwärmte, fand Helmut bereits mit sechzehn seine große Liebe: Elke Marchowitz, Winnigstedts ungekrönte Schönheitskönigin. Schulterlanges blondes Haar, leuchtend blaue Augen, süße Sommersprossen und bereits mit vierzehn eine imposante Oberweite.
Im Herbst 1970 passierte es, unten bei Atze. Die erste Fete mit Elke. Zuvor hatten ihre Eltern es verboten. Nun, da sie fünfzehn geworden war, durfte sie mittanzen und zog sofort alle Blicke auf sich und ihr enges T-Shirt, weiß, mit einem gelben Smiley drauf.
Da Elke in Schöppenstedt zur Realschule ging, hatte ich sie bislang weitaus seltener gesehen als die anderen. An diesem Abend konnte ich kaum die Augen von ihr lassen. Elke sah mich kein einziges Mal an. Als wäre ich Luft für sie. Mit Helmut trank sie Brüderschaft. Und wie! Die beiden knutschten minutenlang vor unser aller Augen und gingen ab diesem Zeitpunkt miteinander.
Helmut verbrachte fortan viel Zeit mit Elke, die uns nun ebenfalls verloren ging. Es blieben nur die Treffen mit der Clique oder hin und wieder zu dritt in Helmuts Jugendzimmer. Dann spielten wir Karten oder würfelten. Elke gab sich keinerlei Mühe, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich wusste auch nie so recht, worüber ich mit ihr plaudern konnte. Besonders beklemmend waren die Momente, wenn Helmut rausging, zur Toilette oder um Getränke zu holen. Dann schwiegen Elke und ich uns beharrlich an. Sie starrte ins Leere und ich unauffällig auf ihren Busen. Helmuts Rückkehr stellte jedes Mal eine Erlösung dar.
Als ich dann häufiger die Abende mit Schulfreunden in Wolfenbüttel verbrachte, reduzierten sich unsere Treffen erneut. Falls wir uns doch einmal zu zweit trafen, suchten wir bisweilen krampfhaft nach Gesprächsthemen. Helmut versuchte es mit Fußball. Wenn ich mich aber in diesen Jahren auf das Thema Sport einließ, wollte ich lieber über den Radsport und Eddy Merckx reden; er kam für mich gleich nach Willy Brandt.
Eddy Merckx interessierte Helmut genauso wenig wie Politik. Bei Musik lagen unsere Interessen weit auseinander; über meinen Lernstoff konnte ich mit ihm ebenso wenig diskutieren. Übrig blieb der Dorftratsch, der mich rasch ermüdete. Was interessierten mich Kaminskis, deren Hausfassade Helmut demnächst gemeinsam mit Atze streichen würde?
Kaminskis waren Schlesier, genau wie Elkes Familie. Im Zweiten Weltkrieg vor der Roten Armee geflüchtet und in Winnigstedt gestrandet. Helmut erwähnte sie bloß, um geschickt zu Elke überzuleiten und von ihr zu schwärmen – und von seinen Plänen. Verlobung. Hochzeit. Kinder. Hausbau. Für Helmut zeichnete sich alles deutlich ab.
Ich hielt das für voreilig. Die allererste Freundin, das konnte doch nicht alles gewesen sein. Okay, ich war auch eifersüchtig. Elke wurde von Jahr zu Jahr attraktiver. Ihr Körper konnte sich nicht großartig weiterentwickeln, aber ihre Gesichtszüge wurden erwachsener. Der Teenager verwandelte sich in eine junge Frau.
In diesem Moment flüsterte Elke Helmut etwas ins Ohr und lief zurück zum Haus. Helmut erkundigte sich ein weiteres Mal nach meinem Befinden. Ich versicherte ihm, dass alles in Ordnung wäre. Dann kehrten wir zurück zur Fete und tanzten bis vier Uhr früh. Mithilfe von Cola-Rum verdrängte ich die Gedanken an Jochen und Elke.
Die folgenden zehn Stunden verschlief ich. Anschließend ging ich entschlossen meinen Eltern und jeglicher Nahrung aus dem Weg, schnappte meinen deutschlandfahnenlosen Parka und wagte einen Spaziergang. Ich wollte die Gräber meiner Großeltern besuchen, die sich auf zwei Friedhöfe verteilten, da das Dorf früher aus zwei Ortsteilen bestanden hatte, mit je eigenen Kirchen und Friedhöfen. Ich startete mit dem Grab meiner Großeltern väterlicherseits in Groß-Winnigstedt. Der Friedhof befand sich an der Ausfallstraße nach Schöppenstedt, ungeschützt auf einer Anhöhe. Nordwind und Regen suchten ihn oft heim. An diesem Tag wehte aber nur eine leichte Brise, die ich kaum spürte.
Auf dem Rückweg begegnete ich am Friedhofstor der Gemeindesekretärin Renate Junker, einer attraktiven Dame Ende vierzig. Ich traf sie häufig auf dem Friedhof. Sie kümmerte sich um das Grab ihres Mannes und das zweier russischer Soldaten, das sich jenseits der Friedhofskapelle versteckte. Überraschenderweise blieb sie stehen. Meist grüßte sie bloß.
„Frohes Neues, Fritze! Warst du bei Oma und Opa?“
„Ja, genau. Auch Ihnen alles Gute fürs neue Jahr!“
„Habt ihr jungen Leute kräftig gefeiert?“
„Ja, bei Atze im Partykeller.“
„Richtig so. Genießt das Jungsein. Anstrengend wird das Leben früh genug.“
Seltsamerweise klangen diese profanen Ratschläge aus ihrem Mund nett. Bei den meisten Erwachsenen hätte ich die Augen verdreht.
„Machst du nicht dieses Jahr Abitur, Fritze?“
„Ja, im April gehts los.“ Ich betete, dass sie nicht fragte, was ich danach vorhatte. Solche Fragen hasste ich wie die Pest.
Meine Sorge erwies sich als unbegründet. „Dann drücke ich dir die Daumen, Fritze!“
„Danke.“
„So, ich will dann mal weiter. Grüß bitte deine Eltern von mir!“
„Das mache ich.“
Zum Friedhof von Klein-Winnigstedt musste ich einmal das Dorf durchqueren. Dennoch brauchte ich hinterher noch mehr frische Luft und Bewegung, um den Restalkohol zu bekämpfen. Die Straße, die am Friedhof von Klein-Winnigstedt vorbeiführte, mündete in einen der Zufahrtswege zum Großen Bruch, einem trockengelegten Sumpfgebiet, das sich entlang der Grenze erstreckte. Auf unserer Seite prägte Landwirtschaft das Bild, Feld reihte sich an Feld, Getreide und Zuckerrüben. Jenseits des unüberwindbaren Grenzzauns lag der Todesstreifen, vermint und bei Dunkelheit von den wuchtigen Scheinwerfern der Wachtürme ausgeleuchtet.
Wenn ich zum Grenzübersichtspunkt in der Nähe von Mattierzoll liefe und am Sportplatz vorbei zurück nach Winnigstedt, hätte ich einen Weg von fünf Kilometern vor mir. Ich wäre eine gute Stunde unterwegs. Ob ich danach endlich Appetit bekommen würde?
Gesagt, getan. Ich marschierte los. Ein paar Krähen begleiteten mich, einzig ihre Rufe störten diesen friedlichen Januarnachmittag.
Der Grenzzaun zeichnete sich mit jedem meiner Schritte deutlicher ab. Doch nach einem Kilometer bog der Weg nach rechts ab; ich lief fortan parallel zum Zaun, direkt auf den Wachturm zu und erreichte nach einer halben Stunde den Grenzübersichtspunkt. Dort stand ein Holzhäuschen mit Schaufenster. Dahinter war ein Modell der Umgebung zu sehen, gestaltet wie die Landschaft einer Modelleisenbahn. Ich bewunderte zum hundertsten Mal den kleinen Zaun und den Miniatur-Wachturm, die hier so harmlos wirkten, bevor ich nach Mattierzoll weiterzog.
Dieser abgelegene Ortsteil von Winnigstedt war von Industrie geprägt: Ziegelei, Molkerei, Raiffeisen-Genossenschaft, Bahnhof samt Verladestation für Ziegel und Zuckerrüben. Doch der Niedergang deutete sich längst an. Die Molkerei hatte vor sechs Jahren ihre Produktion eingestellt. Die Zukunft von Bahnhof und Ziegelei war ungewiss. Der Bauboom war versiegt, zumal im Zonenrandgebiet, einen Kilometer entfernt vom Eisernen Vorhang und den Truppen des Warschauer Pakts, die uns jeden Moment überfallen konnten.
Das Schicksal der Ziegelei belastete viele Winnigstedter, darunter die Jordans, da Helmuts Vater dort arbeitete. Mein Vater war besser dran. Sein Job als Tischler in der vom Land Niedersachsen und der evangelischen Kirche finanzierten Behinderteneinrichtung in Neuerkerode war krisensicher. Das sogenannte Dorf der Behinderten hatte sogar die Nazis überlebt. Fraglich war, ob das auf alle Behinderten zutraf. Es nützte nichts, Vater danach zu fragen. Es interessierte ihn nicht. Vom Dritten Reich berichteten meine Eltern ohnehin wenig. Ich wusste nur, dass Vater kein Soldat gewesen war. Zu jung.
Langsam bekam ich Hunger und begab mich auf den Heimweg. Dort wartete Kartoffelsuppe auf mich, die ich nur aufwärmen musste. Meine Eltern quetschten mich wegen der Silvesterfeier aus. Da ich das Gefühl hatte, sie heute vernachlässigt zu haben, berichtete ich ausführlich von der Rangelei mit Jochen, was Vater unflätig kommentierte. Er hielt Jochen für einen Aufschneider, der nichts mit seinem Vater und Großvater gemein hatte, die Vater für ehrenhafte Männer hielt. Dem widersprachen weder Mutter noch ich. So endete dieser erste Tag im Jahr 1974 in familiärer Harmonie.
3. KAPITEL
Bis zum Unterrichtsbeginn am Montag hatte ich noch ein paar Tage frei. Am Mittwoch quälte ich mich aus dem Bett, um pünktlich um acht Uhr zum Lebensmittelladen schräg gegenüber zu gehen. Ich wollte eines der raren Exemplare einer ordentlichen Tageszeitung ergattern. Mit der hiesigen Braunschweiger Zeitung konnte ich nichts anfangen, erst recht nicht mit der Bild-Zeitung. Ich schnappte mir die Süddeutsche Zeitung, die ich in meinem Zimmer eingehend studierte. Ich setzte mich aufs Bett, da es ansonsten nur einen harten Schreibtischstuhl gab, mit dem ich meinen Hintern bei den Hausaufgaben mehr als genug malträtierte. Für Sessel oder ein Sofa bot mein Zimmerchen keinen Platz. Außer Bett und Schreibtisch samt Folterstuhl passten bloß ein Kleiderschrank und ein Mini-Regal hinein, darin der Plattenspieler, LPs, ein Ordner mit Zeitungsartikeln über Willy und Eddy sowie ein paar Bücher, hauptsächlich Schullektüre.
Über die Feiertage war laut Süddeutscher nicht viel geschehen. Weiterhin drohte eine Ölkrise. In Schweden leuchteten nachts keine Reklameschilder mehr, um Strom zu sparen. Außerdem gönnte die dortige Regierung ab sofort Eltern nach der Geburt eines Kindes einen sechsmonatigen Urlaub, wahlweise Mutter oder Vater. Die britische Regierung führte wegen der Streiks im Bergbau und bei der Eisenbahn die Dreitagewoche ein. Der Sportteil bot einen Ausblick auf die Höhepunkte des Jahres. Neben der alles überstrahlenden Fußball-WM erwähnten die Reporter auch die Tour de France.
Würde Merckx seinen fünften Titel erringen? Ich wäre so gern im Sommer nach Frankreich gefahren, um ihn auf den Bergetappen anzufeuern. Was sprach dagegen? Geld. Aber ich konnte arbeiten. Ich hatte in den vergangenen beiden Jahren in einem Fahrradgeschäft in Schöppenstedt ausgeholfen und gutes Geld verdient. So viel, um mir ein Rennrad zu leisten, eines wie Merckx es fuhr, knallorange. Bei Fahrrad-Krause hätten sie bestimmt wieder Arbeit für mich in der Werkstatt. Spätestens nach dem schriftlichen Abi. Ich könnte mir für die Reise einen Bulli mieten, darin würde ich schlafen – und mein Rennrad mitnehmen, um selbst einige Etappen zu fahren. Das klang verlockend!
Ich legte die Zeitung beiseite und verdrängte die Reise vorübergehend, denn der Gedanke ans Abi hatte einen Alarm ausgelöst. Ich benötigte dringend einen Lernplan. Geschichte, Chemie, Deutsch und Latein waren meine Prüfungsfächer. Der Stoff türmte sich vor mir auf wie ein unüberwindbarer Berg im Himalaja. Geschichte und Deutsch bereiteten mir einigermaßen Freude, Chemie und Latein waren reine Notlösungen. Entsprechend lieblos hatte ich die Kurse absolviert – mit den dazugehörigen Noten. Um den gewünschten Abiturschnitt von 2,5 zu erzielen, müsste ich mich in den Prüfungen deutlich verbessern.
Ich legte Superfly auf, mein Lieblingsalbum von Curtis Mayfield, und machte mich direkt an die Arbeit. Bis zum Abend stand das Gerüst für Chemie. Am Donnerstag folgten Geschichte und Latein. Für Deutsch brauchte ich keinen Plan. Wir würden einen Text analysieren, das beherrschte ich. Ich musste nur die relevanten Bücher erneut lesen. Brecht, Grass, Lessing, Goethe. Ich startete am Donnerstagabend mit der Blechtrommel.
Am Freitag widmete ich mich der Chemie und verdarb mir rasch die Laune mit Molekülketten und Atommodellen. Die schlechte Stimmung ließ ich an Mutter aus, da sonst niemand greifbar war. Alle Leute aus dem Dorf, die in meinem Alter waren, arbeiteten, zum Teil bereits seit Mittwoch. Genau wie Vater.
Ich verzichtete auf weitere Zeitungskäufe. Zum einen begann ich, für Frankreich zu sparen. Zum anderen tat sich herzlich wenig in der Welt, wenn ich der Tagesschau glauben durfte. Das Radio schaltete ich seit Wochen nicht mehr ein, da jedes Mal I’d Love You to Want me gespielt wurde. Bis zum Erbrechen.
Am Nachmittag beruhigte ich mich. Das lag daran, dass ich nun Latein lernte und einen ausladenden Spaziergang durchs Dorf unternahm. Dabei begegnete mir ausgerechnet Jochen in seinem BMW, der aufgrund irgendwelcher Manipulationen am Auspuff sehr laut war. Er warf mir im Vorbeifahren finstere Blicke zu, machte aber keinerlei Anstalten, anzuhalten, um mich zu verdreschen.
Abends las ich weiter in der Blechtrommel.
Am Samstag tauchte ich tief in die deutsche Geschichte ein. Ich verschaffte mir einen groben Überblick von der Schlacht im Teutoburger Wald bis zum Wiener Kongress. Diese tausendachthundert Jahre waren nicht prüfungsrelevant. Trotzdem war es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie alles geschehen konnte. Bekanntlich war die deutsche Revolution mitsamt Paulskirche nicht einfach so vom teutonischen Himmel gefallen; ebenso wenig Bismarck. Er war prüfungsrelevant, mit ihm musste ich mich intensiv beschäftigen.
Am Samstag trafen wir uns bei Atze, um die Reste von Silvester zu vernichten. Es versammelte sich allerdings bloß die halbe Mannschaft. Auch Helmut trudelte allein ein. Er wirkte betrübt. Ich erkundigte mich nach Elke.
„Sie trifft sich in Wolfenbüttel mit einer Arbeitskollegin“, antwortete er.
Helmut klang nicht gerade erfreut. Einmal mehr fragte ich mich, wie man sich nach fast vier Jahren Beziehung fühlte. Würde man dann mal gern einen Samstagabend allein verbringen wollen? Was, wenn der Partner klammerte oder eifersüchtig war? Wahrscheinlich würde ich all das niemals herausfinden, ich konnte noch nicht einmal eine einstündige Beziehung vorweisen.
4. KAPITEL
Am Montagmorgen fuhr ich um Viertel vor sieben mit dem Bus nach Wolfenbüttel, die Schule ging wieder los. Ich hockte in der hintersten Bank, blickte auf die braunen Äcker zwischen den Dörfern, die sich in der Morgendämmerung abzeichneten, und nickte ab und an einem bekannten Gesicht zu, das in den Bus stieg. Die Plätze neben mir besetzten lärmige Fünftklässler. Keine Ahnung, ob sie wie ich die Große Schule besuchten oder das benachbarte Gymnasium im Schloss. Sie waren laut und nervig und freuten sich – genau wie ich – auf die Schule, nur halt ausgelassener.
Der schmutzig gelbe Backsteinbau empfing mich bei einsetzendem Nieselregen. Ich schlüpfte durchs Eingangsportal, durchquerte die monströse Halle, die wie üblich nach den Ferien nach Bohnerwachs roch, und steuerte den ersten Stock an.
Das Jahr 1974 begann mit Geschichte, Leistungskurs bei Linnenweber, dem neuen Stern am Lehrerhimmel unserer geschichtsträchtigen Bildungseinrichtung, deren Anfänge im sechzehnten Jahrhundert lagen. Linnenweber gelang es perfekt, den Geist der Jahrhunderte ein- und auszuatmen. Er verstand sich zudem prima mit dem Direx und blickte einer erfolgreichen Karriere entgegen.
Ich erreichte das Klassenzimmer unmittelbar vor ihm und quetschte mich zwischen Detlev und Thomas. Auch hier hing der Geruch nach Bohnerwachs schwer in der Luft. Er vermischte sich mit den Rasierwassern der vierzehn jungen Herren und den Parfümen der drei jungen Damen. Da die Große Schule erst seit 1964 Mädchen unterrichtete, war deren Anteil in unserem Jahrgang, dem zweiten seit Einführung der Koedukation, sehr gering. In manchen Kursen saßen gar keine Mädchen.
Im Geschichts-LK waren die Sitzreihen u-förmig angerichtet, mit einer zusätzlichen Querreihe. Detlev, Thomas und ich bildeten den Boden des Us, weit weg vom Lehrerpult. Vor uns lümmelten sich ein paar andere Jungs. Der Rest verteilte sich ungleichmäßig auf die Längsstriche des Us. Mal saßen die Leute zu zweit an einem Tisch, mal allein.
An den Wänden hingen Landkarten und Wahlplakate längst vergangener Epochen, über der Eingangstür wachte eine gigantische Bahnhofsuhr. Viertel vor acht, es konnte losgehen. Wie auf Kommando schrillte die Klingel, laut wie eh und je. Ich erschrak mich dennoch jedes Mal halb zu Tode.
Draußen verstärkte sich der Nieselregen zu einem heftigen Schauer. Regentropfen prasselten gegen die Bogenfenster, der Himmel verdunkelte sich, der Turm der Hauptkirche am nahe gelegenen Kornmarkt, benannt nach der seligen Jungfrau Maria, ließ sich nur schemenhaft ausmachen.
Linnenweber knallte seinen Ranzen aufs Lehrerpult, folgte ein paar Sekunden lang dem traurigen Schauspiel vor den Fenstern, schüttelte betrübt den Kopf und knöpfte sein graues Sakko auf, um einen grauen Rollkragenpullover zu präsentieren. Dazu eine graue Stoffhose. Grau in Grau. So sah Linnenwebers Uniform aus. Für einen Mann um die dreißig nicht zu spießig und nicht zu sportlich. Angemessen, adrett und akkurat wie sein Seitenscheitel, der an den von Jochen erinnerte. Die beiden ähnelten einander in mehrfacher Hinsicht. Linnenweber würde sich zwar nicht dazu hinreißen lassen, mich wegen der fehlenden Flagge auf meinem Parka zu verprügeln, aber er war genauso stockkonservativ wie Jochen.
Der Lehrer drehte sich schwungvoll zur Tafel, schnappte sich das längste Kreidestück und schrieb.
„Bismarck!“
Thomas neben mir stöhnte leise auf. Ich konnte ihn gut verstehen, denn Bismarck hatte bereits vor den Weihnachtsferien den Unterricht dominiert, im Grunde genommen seit Schuljahresbeginn im August. Dabei mussten wir bis April zum Zweiten Weltkrieg kommen. Angesichts des Tempos von Linnenweber erschien dies fraglich.
Detlev hatte eine Theorie zu diesem Dilemma entwickelt. „Linnenweber ist verliebt in Bismarck und vergöttert das Kaiserreich. Auf den Ersten Weltkrieg, die Kriegsschuldfrage und die Fischer-Kontroverse hat er keinen Bock. Geschweige denn auf die Nazis. Er möchte nur halbwegs schöne deutsche Geschichte unterrichten.“
Diese Theorie klang plausibel. Sie half uns allerdings nicht, denn spätestens im Abi würden wir uns mit dem Ersten Weltkrieg, der Weimarer Republik und dem Dritten Reich beschäftigen. Am besten punktgenau vorbereitet durch unseren Geschichtslehrer.
Der schwadronierte bereits über die Errungenschaften des jungen Kaiserreichs, Sozialversicherungen, Gründerzeit, die Blüte der Kunst. Als bekennender Wagnerianer stellte Linnenweber bei jeder sich bietenden Gelegenheit dessen Verdienste um Kultur und Gesellschaft heraus. Diese Gelegenheit bot sich jetzt.
„An alldem hatte Richard Wagner einen gehörigen Anteil. Seine genialen Werke …“
Detlev schnaubte, wie immer, wenn es um Wagner ging, diesmal lauter als gewöhnlich. So laut, dass Linnenweber es wahrnahm und seine Lobeshymne unterbrach.
„Detlev, geht es Ihnen nicht gut?“, flötete er.
„Sie wissen schon, dass Wagner Antisemit war?“, brach es aus Detlev heraus.
Ich erschrak, hielt mir fast die Hand vor den Mund. Zwei der jungen Damen taten es. Die dritte junge Dame versteckte sich, gesenkten Hauptes, hinter ihren Haaren. Alle anderen starrten zunächst auf Detlev, dann auf unseren Lehrer.
„Was wollen Sie uns damit sagen, Detlev?“ Linnenweber lächelte süffisant.
„Dass wir Wagner auch unter diesem Aspekt betrachten sollten.“
Ich bewunderte meinen Freund in diesem Augenblick, ahnte zugleich, dass er sich in tiefes Unglück stürzte. Linnenweber würde die Abiturklausur stellen und als Erster korrigieren. Und diese Unterrichtsstunde hatte gerade erst begonnen.
Der Lehrer blieb erstaunlich gelassen. „Ich denke, wir sollten das Werk Wagners von dessen Ansichten zum Judentum trennen. Oder haben Sie aufgehört, zu beten, als Sie erfuhren, dass Martin Luther Antisemit war, Detlev?“
Fünfzehn Augenpaare richteten sich auf Detlev. Der platzierte provokant die gefalteten Hände auf dem Tisch und antwortete: „Ich bin vor drei Jahren aus der Kirche ausgetreten.“
Linnenweber schluckte, diese Antwort hatte er nicht erwartet. Er sammelte sich rasch. „Eine edle Tat. Wahrlich, Detlev.“ In der festen Überzeugung, den Disput damit beendet und für sich entschieden zu haben, wandte sich Linnenweber zur Tafel.
Detlev gab aber nicht klein bei. „Es beruhigt das Gewissen.“
Linnenweber hielt inne, drehte sich nicht zur Tafel. Stattdessen öffnete er in Allerseelenruhe seinen speckigen Ranzen und fummelte das kleine rote Notizbuch heraus.
Alle wussten, was nun geschehen würde.
„Nun Detlev, das ist schön für Ihr Gewissen. Wollen wir mal schauen, wie es um Ihr Wissen bestellt ist. Sagen wir zu den Sozialistengesetzen. Kommen Sie nach vorn. Bitte!“
Linnenweber prüfte in praktisch jeder Geschichtsstunde einen von uns, bisweilen in alphabetischer Reihenfolge, häufig auch, um jemanden zu bestrafen, jedoch niemals unmittelbar nach der Sünde. Mit anderen Worten: Linnenweber war sehr sauer auf Detlev und alle durften es wissen.
Einen Moment lang befürchtete ich, Detlev könne zu einer weiteren Replik ansetzen. Die Sorge war unbegründet. Genau wie alle anderen im Kurs, Linnenweber eingeschlossen, wusste Detlev, dass er diesen Wettstreit gewonnen hatte – und dass dieser Sieg so oder so nichts wert war. Er erhob sich brav, schlurfte zur Tafel und stellte sich dort auf.
Linnenweber blätterte in seinem kleinen roten Buch, nickte und schleuderte Detlev unvermittelt die erste Frage ins Gesicht.