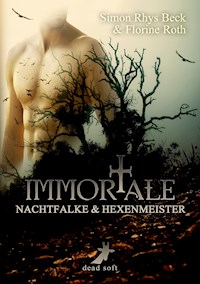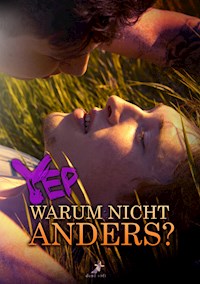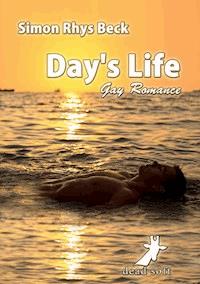Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dead soft verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Alexander de Dahomey ist eine der Lichtgestalten im Reich der Schatten. Doch die Liebe zu dem Sterblichen Brian wird ihm fast zum Verhängnis. Immer tiefer gerät er in ein Netz aus Schmerz und Leidenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simon Rhys Beck
Impressum
© dead soft verlag, Mettingen 1999
http://www.deadsoft.de
Cover: Irene Repp
http://daylinart.webnode.com/
Bildrechte:
© javarman – fotolia.com
© queen 21 – fotolia.com
ISBN 978-3-934442-00-9
ISBN 978-3-944737-89-8 (epub)
6. Auflage 2015
This one is dedicated to
Michael – my life
and
Was willst du von mir?
Dich töten, dich küssen
Dich lieben, dich hassen
Dich quälen, dich schützen
Alles für dich sein und nichts
Auf ewig und niemals
In Liebe und göttlicher Verachtung.
1
London 1611
Ich erwachte in völliger Dunkelheit. Meine Augen brannten, und ich hatte höllischen Durst. Vorsichtig bewegte ich meine schlaffen Glieder. Kalter Schweiß rann mir über die Stirn – ich fieberte. Er hatte es wieder getan, aber ich konnte mich nicht erinnern.
»Lomay«, flüsterte ich und hustete erschöpft. Wieder einmal am Rande des Todes. Wann würde das aufhören? Ich konnte es nicht mehr ertragen. War das der Preis, den ich zahlen musste? Ich war so entsetzlich müde. Mühsam versuchte ich, meine Augen offenzuhalten. Ich sah mich um, konnte aber in der Schwärze nichts ausmachen.
Wo hatte er mich diesmal wieder eingesperrt? Ich bemerkte, dass mein Herz kämpfte, es schlug entschieden zu langsam. Ich quälte mich in eine sitzende Position.
Mein Körper fühlte sich verbraucht an, als wäre ich bereits ein alter Greis, aber ich war gerade 22 geworden. Mein schulterlanges schwarzes Haar fiel mir locker in die Augen, unwirsch strich ich es zur Seite. Dann vernahm ich ein Geräusch. Ganz leise und heimlich. Wahrscheinlich hätte ich es gar nicht hören sollen, aber mein menschliches Gehör hatte sich den Heimlichkeiten der Unsterblichen schon sehr gut angepasst. Er war bei mir. Hier in diesem stinkenden, dunklen Loch, und er konnte mich sehen. Wahrscheinlich weidete er sich an meinem Leid – wie schon so oft. Aber ich wollte durchhalten. Egal, was er mir für Prüfungen auferlegte – ich war bereit, es durchzustehen. Vielleicht bewunderte er es – vielleicht hasste er mich dafür. Aber diesmal war er wirklich weit gegangen. Ich würde sterben, machte er es wieder. Manchmal wünschte ich mir den Tod. Endlich alles vergessen zu können, aber eigentlich war ich zu feige. So weit war ich gegangen für das ewige Leben. Der Zeitpunkt des Aufgebens war längst überschritten.
Ich hatte bereits zu viel Leid gebracht, zu viel Tod, im Namen des Meisters. Würde ich jetzt aufgeben, war ich gescheitert. Ich dachte oft über die Sünden nach, die das ewige Leben mit sich brachte, aber ich war bereit dafür. Dieses grausame, animalische Leben zog mich unwiderstehlich an, dafür gab ich ihm gern meine menschliche Existenz. Aber ich konnte nicht immer nur geben. Ich war so erschöpft.
Ich vernahm ein zischendes Geräusch und augenblicklich wurde es hell.
Lomay hatte eine große Kerze entzündet und beobachtete mich neugierig. Lässig lehnte er an der feuchten Wand des alten Gemäuers.
Sein wunderschönes, seidiges Haar war zu einem Zopf zurückgenommen und gab den Blick auf ein fast makelloses Gesicht frei. Fast makellos, denn eine dicke Narbe zog sich von der Stirn über das linke Auge bis zum Wangenknochen. Erstaunlicherweise war das Auge unbeschädigt. Aber diese Narbe verunstaltete ihn nicht, sie machte sein jungenhaftes Gesicht nur noch interessanter.
»Du überraschst mich, Alexander«, sagte er und bei dem beruhigenden Ton seiner rauen Stimme ließ ich mich zurücksinken. »Du lebst mit einer erstaunlichen Intensität. – Einfach nicht totzukriegen.« Er lachte melodisch. Sein Lachen war einnehmend. Niemand, der ihn lachen hörte, konnte sich vorstellen, was für ein durch und durch bösartiges Geschöpf sich hinter dieser Fassade verbarg. Aber ich wusste es – hatte es unzählige Male erlebt.
Ich wollte antworten, doch außer einem Gurgeln kam nichts aus meiner Kehle, und ich hasste ihn. Ich wischte mir mit dem Handrücken über den Mund und sah die roten Tropfen meines eigenen Blutes. Er hatte wirklich versucht, mich umzubringen, und vielleicht ließ er mich jetzt sterben. Wieder hustete ich, wieder spürte ich den metallischen Geschmack des Blutes in meinem Mund. Er brannte auf meiner Zunge. Und auf einmal bekam ich Angst. Er hatte nie vorgehabt, mich zu einem der ihren zu machen. Die ganze Zeit war ich sein Sklave gewesen, hatte jeden Wunsch von seinen Lippen abgelesen, und jetzt machte er sich über mich lustig. Meine Angst wandelte sich in flammenden Zorn und wäre ich nicht so geschwächt gewesen, ich wäre ihm an die Kehle gegangen. Ich hätte mich auf dieses übernatürliche Wesen gestürzt und hätte versucht, es umzubringen. Eine eigenartige Idee, die nur einem sterbenden Gehirn entspringen konnte. Ich konnte den Tod nicht töten. Und Lomay war der Tod.
Er schüttelte den Kopf, hatte wieder in meinen Gedanken gelesen.
»Ich bin nicht der Tod. Ich bin das ewige Leben – ein Engel Gottes«, sagte er und verzog spöttisch die Lippen.
Wieder wischte ich mir etwas Blutschleim vom Kinn und hustete. »Du Teufel. Stehst da und siehst zu, wie ich sterbe. Du bist die schlimmste Kreatur auf Gottes Erdboden.«
»Wie kannst du so etwas sagen? Das schmerzt in meiner Seele«, sagte Lomay gekränkt.
Aber ich schrie mit der letzten mir verbleibenden Kraft: »Du hast gar keine Seele!« Dann würgte ich, es ging zu Ende. Oh, was für ein schmähliches Ende. Ich hasste mich, ich weinte.
Leise trat er zu mir und zog mich zu sich heran. Er roch angenehm männlich und stark – doch was hatte das noch für eine Bedeutung? Ich spürte, wie er mich hochhob – oder war ich bereits aus meinem Körper herausgefahren? War ich tot?
Dann änderte sich plötzlich alles. Warmes Leben floss in mich hinein, strömte durch meine Adern. Ich bäumte mich auf, schlug irritiert die Augen auf.
Ich lag in Lomays Schlafzimmer, auf dem Bett mit der edlen seidenen Bettwäsche. Die durchsichtigen Vorhänge waren zugezogen, wie Liebende sie zuzogen. Lomay war dicht bei mir, sein Handgelenk lag auf meinen Lippen, und es war sein Blut, das in mich hineinströmte. Ich war erschrocken, aber ich konnte nicht aufhören zu saugen. Sein Blut war so heiß, so unglaublich belebend. Dann sah ich seine Lider flattern, und er versuchte mich wegzuschieben. Aber ich stieß ein knurrendes Geräusch aus und grub meine Zähne weiter in das offene Fleisch seines Handgelenks.
Mit einiger Kraft kam er von mir los und starrte mich einen Moment lang an. Dann flüsterte er: »Jetzt hast du, was du wolltest.«
Ich musterte ihn erstaunt, als hätte ich ihn nie zuvor gesehen. Alles kam mir so verändert vor, so viel schöner, als in meinem menschlichen Leben. Die Vorhänge knisterten leise im Wind, und die Seide an meiner Haut war so unendlich viel weicher als bisher.
Ich schlang meine Arme um Lomay, obwohl ich ihm nicht dankbar war. Ich war nur so glücklich.
Er ließ es zu, war auch zu schwach sich dagegen zu wehren. Diese neue Welt war erstaunlich. So unendlich viel schöner, als die beschränkte Welt der Sterblichen. Ja, das hatte ich gewollt. Dafür hatte ich diese Demütigungen und die Mühen ertragen. Es war vollendet – ich fühlte mich wie neugeboren.
Wahrscheinlich lächelte ich wie ein kleines Kind, das sich über ein neues Spielzeug freut, denn Lomay schaute mich irritiert an. Er begann bereits, sich zu erholen. Dann stand er langsam auf. Seine Bewegungen erschienen mir noch viel eleganter und geschmeidiger als zuvor, die Bewegungen eines tödlichen Raubtiers.
»Komm mit mir«, sagte er und hielt mir seine Hand entgegen. Verwirrt ergriff ich sie und ließ mich aus dem Bett ziehen.
»Du sollst die Welt kennenlernen. Deine Opfer warten auf dich.«
Und er zog mich hinaus in die Nacht, und ich konnte mich nicht sattsehen an den Häusern und Bäumen, an den Wolken und – ich wagte nicht meine Augen zu schließen, aus Angst etwas Schönes zu verpassen.
Und als ich mein erstes Opfer nahm, sein Blut in meinen Adern floss und mein Herz vor Lust fast aufhörte zu schlagen, da verstand ich Lomay.
2
Er wandelte verschlungene Pfade in seinem Bewusstsein –
ohne genau zu wissen, wo er sich befand.
Tief in seinem Innern brodelte etwas.
Das spürte er deutlich.
Eine eiskalte Wut erfasste ihn.
Animalisch und unberechenbar.
Als er die Augen aufschlug, wusste er es –
Zeit zum Jagen.
New York 1996
Virginia kuschelte sich tiefer in ihr Bett und schlug den Roman auf. Sie liebte Romane und verschlang sie geradezu. Einen gemütlichen Abend machen – ja, das klang gut. Nach all den Strapazen der Trennung von Thomas.
Asrael und Kleopatra, Virginias Katzen, hatten sich am Fußende des Bettes zusammengerollt.
Virginia war froh, dass sie die Katzen hatte, denn die Tatsache, von heute auf morgen allein in der Wohnung zu sein, hatte sie anfangs ziemlich nervös gemacht. Manchmal hatte sie sich Thomas sogar zurückgewünscht – trotz der Streitereien. Aber das war jetzt vorbei. Sie liebte ihn nicht mehr; sie hatte lediglich Angst vor dem Alleinsein gehabt.
Virginia fühlte sich behaglich. Sie hatte sich in ihre Bettdecke eingekuschelt, und es war mollig warm darunter. Sie liebte es, im Winter im Haus zu sein, wenn es draußen bitterkalt war und sie es in ihrer Wohnung gemütlich warm hatte.
Immer wenn sie von ihrem Buch aufblickte, sah sie durch ihr Fenster nach draußen. Da das Haus, in dem sie wohnte, auf einer kleinen Erhebung lag, hatte sie durch ihr Fenster einen wundervollen Blick über die Stadt. Sie sah die vielen kleinen Lichter der Häuser, Laternen und Autos, und dann stellte sie sich immer vor, dass die Stadt eine riesengroße Spielstadt wäre. Und sie wäre nicht mal erstaunt gewesen, hätte sie Kinderstimmen gehört, von den Kindern, die in der Spielstadt spielen durften.
Manchmal war die Welt doch ein idyllischer Ort; zumindest wenn man in einer wohlig warmen Wohnung saß und aus dem Fenster schaute. Und diese Ruhe ...
Virginia vertiefte sich wieder in ihr Buch.
Als sie das nächste Mal aufsah, war bereits eine Stunde vergangen. Asrael und Kleopatra schliefen eng aneinander gekuschelt und friedlich.
Entspannt lehnte sich Virginia zurück, um weiter die unheimlichen und unerklärlichen Vorfälle in ihrem Roman ergründen zu können. Sie liebte unheimliche Romane.
Dunkelheit umgab ihn, wie eine schwarze, zähflüssige Masse. Er röchelte gequält. Das Aufwachen dauerte endlos. Er versuchte vergeblich die Augen aufzuschlagen. Wieder ein langer quälender Atemzug. Dann Licht. Unglaublich grell. Verzweifelt und frustriert schloss er die Augen wieder. Manchmal verfluchte er sein Dasein.
Er hatte jedes Zeitgefühl verloren. Das passierte ihm jetzt öfter, denn er hatte einfach das Interesse an der Zeit verloren. Aber seit er sich das kleine Häuschen in Greenwich Village gekauft hatte, war es nicht mehr so schlimm. Die Leute hier waren einfach anders, nicht so entsetzlich neugierig. Außerdem fielen Außergewöhnlichkeiten nicht so auf – alles war außergewöhnlich hier. Hier mischte sich niemand mehr in seine Existenz, sein Leben ein.
In der Wohnung, die er zuvor eine Zeitlang bewohnt hatte, war es absolut unerträglich gewesen. Tote verwesen in der Nachbarwohnung. Kindesmisshandlung, und niemand hat es gewusst. Ehefrau brutal zusammengeschlagen, und keiner hat eingegriffen. – Es konnte ja niemand eingreifen. Alle waren viel zu sehr mit mir beschäftigt gewesen, dachte er zynisch. Hast Du unseren Nachbarn heute schon gesehen? – Ich seit Tagen nicht. – Kauft der eigentlich nie ein? – Also ich finde, er sieht irgendwie krank aus. – Vielleicht AIDS? – Vielleicht geht es ihm nicht gut? – Warum hat er keinen Damenbesuch? Er ist doch sehr attraktiv. – Vielleicht ist er ja schwul. – Na, dann hat er bestimmt AIDS.
Widerliches Volk. Mischt sich nur ein, wenn es was zu tratschen gibt, nicht wenn sie wirklich helfen können. Ach, wer braucht schon Hilfe. Mühsam setzte er sich auf. In seinem Kopf hämmerte es wie auf einer Baustelle. Er schloss die Augen wieder und begann, seine etwas konfusen Gedanken zu ordnen. Nicht überrascht stellte er fest, dass er beträchtlichen Hunger hatte. Wann hatte er das letzte mal gejagt? Wie lange hatte er geschlafen? Wieder erschien es ihm, als hätte die Gegenwart aufgehört zu existierten und als läge die Zukunft in unerreichbarer Ferne.
Als er nach draußen sah, bemerkte er, dass die Nacht bereits hereingebrochen war. Leider war der Winter keine besonders ertragreiche Zeit für ihn. Und das Letzte, woran er sich erinnern konnte, war, dass er seine Dauernahrungsquelle beseitigt hatte.
Immer noch hatte er den Eindruck, dass seine Gedanken etwas wirr waren. Er setzte sich aufrecht hin und fuhr sich mit den schlanken Händen durch sein dichtes tiefschwarzes Haar.
Sollte er sich auf die Suche nach etwas Bestimmten begeben, oder sich einfach bemühen, dieses gewisse Hungergefühl zu befriedigen; er lächelte. Eigentlich war es gleichgültig. Denn beide Möglichkeiten hatten durchaus ihren Reiz.
Alex stand auf und zog sich an. Sein Hunger verstärkte sich mit jeder Minute, und als er bereit war das Haus zu verlassen, hatten seine Hände angefangen zu zittern.
Sein Weg führte ihn in einem atemberaubenden Tempo durch die Stadt. Nicht in die Gegend, die beleuchtet war, wo Kneipen und Clubs und Discos waren – nein, sein Ziel war ein kleiner Park, der in der Nähe einiger Häuserblocks lag.
Er entdeckte eine von Büschen verdeckte Parkbank und ließ sich darauf nieder. Die Kälte, die fast augenblicklich in seine Kleidung drang, war kein Problem für Alex. Er bemerkte sie kaum. Die Bäume rauschten angenehm und beruhigend. Sie waren schon alt – vielleicht sogar so alt wie er.
Und sie konnten soviel erzählen, wenn man sie nur ließ. Alex vernahm die wuselnden Geräusche der kleinen Tiere im Gebüsch. Er lächelte über ihre hektische Betriebsamkeit, aber sie hatten nicht viel Zeit; das Leben war kurz.
Alex musste nicht sehr lange warten, trotzdem hatte sich das anfängliche Zittern seiner Hände bereits auf große Teile seines Körpers ausgedehnt. Trotz allem war sein Verstand klar und seine Wahrnehmung geschärft.
Als Alex die ersten Geräusche vernahm, war sein Opfer noch einige Hundert Meter weit entfernt. Er brauchte nicht lange, um die Richtung herauszufinden, und nach kurzer Zeit wusste er auch, dass sie die Richtige war. Seine Nase hatte es ihm verraten, und eigentlich konnte er sich immer auf seinen Geruchssinn verlassen.
Sie war nervös. Das hörte er an ihren raschen, hastigen Schritten. Um so interessanter ...
Alex vermutete, dass sie in einer der Wohnungen am Ende des Parks wohnte. Aber bis zum Ende des Parks war noch ein langer Weg. Ein verdammt langer Weg.
Schon von Weitem sah Alex ihre leuchtend blonden Haare. Ein Engel, dachte er und lächelte boshaft. Immer wieder sah sie sich ängstlich um, und ihre hohen Absätze klapperten laut auf dem teilweise gepflasterten Weg des Parks.
Gierig fuhr sich Alex mit der Zunge über die kalten Lippen. Es würde ihm eine ganz besondere Freude bereiten.
Als die blonde Frau an seiner Bank vorbeihastete, war er plötzlich neben ihr. Ein Schrei wollte sich aus ihrer Kehle lösen, doch Alex war schneller und verschloss mit eiserner Hand ihren Mund.
Angsterfüllt sah sie ihn an.
»Ich werde jetzt die Hand von deinem Mund nehmen, und du wirst keinen einzigen Laut von dir geben. Wenn doch, bist du tot. Klar?« Die Frau nickte mit schreckgeweiteten Augen.
Alex löste seinen schraubstockartigen Griff. Dann musterte er sie von oben bis unten. Sie war überdurchschnittlich groß, sicherlich keine überragende Schönheit, aber darauf kam es Alex auch nicht an.
»Du wirst mich jetzt zu deiner Wohnung bringen – du wohnst doch hier – und wenn du versuchst, mich auszutricksen, werde ich auch ein paar schöne Tricks mit dir machen. Haben wir uns da verstanden?«
Wieder nickte sie. Wahrscheinlich hatte sie irgendwann einmal gehört, dass man Psychopathen keinen Widerstand leisten sollte, wenn man mit heiler Haut davonkommen wollte. Alex lachte innerlich über diesen Gedanken; denn ein Psychopath war er sicher nicht.
Lautlos ging er neben ihr und suhlte sich in ihrer Angst. Er wusste, dass sie alles tun würde, um ihr Leben zu retten. Er würde auch alles verlangen – aber es gab keine Rettung. Diese Macht war wundervoll und doch beängstigend.
Er machte keinerlei Geräusche – während er neben ihr ging – und als sie ihn angsterfüllt ansah, schenkte Alex ihr ein wunderbar grausames Lächeln, welches seine schönen Gesichtszüge für kurze Zeit entstellte.
Virginia war über ihrem Buch eingeschlafen. Eigentlich hatte sie noch mehr über die undurchsichtigen Vorgänge in ihrem Roman erfahren wollen, aber sie wurde von einer Müdigkeitswelle erfasst und mitgerissen.
Virginia träumte. Das Gesicht eines jungen Mannes. Erst unklar, dann deutlicher. Das Gesicht war ausgesprochen attraktiv, nein, es war schön. Es war so unglaublich schön, als wäre es nicht von dieser Welt. Noch nie zuvor hatte Virginia so vollkommene Schönheit gesehen. Solche Reinheit. Doch irgendetwas ängstigte sie daran. Die Augen ... Faszinierend dunkel und beängstigend. Tiefes Meerblau. Tiefe und Ruhe in seinem Blick.
Das Gesicht verschwand wieder, und Virginia hörte einen langgezogenen Schrei. Er ging ihr durch Mark und Bein. Das Gesicht erschien wieder. Es war so unglaublich schön. Er hielt eine Frau in seinen Armen. So starke Arme. Dann war alles dunkel.
Virginia erwachte schweißgebadet. Verwirrt sah sie sich um. Sie hatte den Eindruck, als befände sich noch jemand im Zimmer. Aber soweit sie das feststellen konnte, war sie allein.
Mit wackligen Beinen stand sie auf und ging ins Bad, um ihr Gesicht mit eiskaltem Wasser zu waschen. Sie konnte sich an jede Einzelheit ihres Traumes erinnern, und das war eine verdammte Seltenheit. Und der Traum war so unglaublich real gewesen ...
War ihre Phantasie wegen des spannenden Buchs mit ihr durchgegangen? Sie schüttelte den Kopf. Aber irgendwie fühlte sie sich unsicher. Virginia sah auf ihre Uhr und stellte fest, dass es schon kurz vor zwölf war. Vermutlich war es das Beste, sich jetzt völlig dem Schlaf hinzugeben.
Sie verschwand noch einmal im Bad, um sich die Zähne zu putzen und löschte dann das Licht in ihrer kleinen Wohnung. Sie war seltsam nervös. Die plötzliche Dunkelheit machte ihr Angst, auch wenn sie sich das nicht eingestehen wollte. Daher zwang sie sich zur Ruhe, verzichtete darauf, noch einmal sämtliche Räume abzusuchen und machte sich fertig für die Nacht. Die Tür ihres Schlafzimmers ließ sie einen Spalt offen, damit Asrael und Kleopatra hereinkonnten, aber durch den Türspalt kroch auch beunruhigende Dunkelheit herein.
Virginia schlüpfte unter die Bettdecke und atmete tief durch. Sie hatte beschlossen, das kleine Lämpchen auf ihrem Nachtschrank brennen zu lassen – was für ein kindliches Verhalten – und versuchte, sich zu entspannen. Aber sobald sie die Augen schloss, sah sie wieder das Gesicht. Das Gesicht aus ihrem Traum. Lebendig. Als hätte sie dieses Gesicht schon einmal irgendwo gesehen. Es hatte nichts Böses an sich, daher war Virginia über ihre irrationale Nervosität verärgert. Wahrscheinlich war sie dem jungen Mann in irgendeinem Club begegnet oder sogar in der Stadt und konnte sich nur nicht mehr an ihn erinnern. Ja, so war es wahrscheinlich gewesen. Virginia verbannte die Gedanken an ihren Traum aus ihrem Kopf und schlief auch bald darauf ein.
Alex sah in ihre angstvollen Augen. Sie wusste, dass sie sterben würde. Es war kein besonders schmerzvoller Tod, aber der Gedanke an das Ende trieb ihr immer wieder die Tränen in die Augen. Sie war wie hypnotisiert, starrte in seine Augen und versuchte, vielleicht noch einen Hoffnungsschimmer zu erkennen.
Er war erstaunt über ihre Fassungslosigkeit. Hatte sie wirklich gedacht, er wollte nur Sex? Er schüttelte müde den Kopf. Sie hätte sich ihm hingegeben, aber das bedeutete Alex nichts. Jetzt war sie still. Starrte ihn nur an. Alex war es gleichgültig.
Sie widerte ihn an. Ihr Leben bedeutete ihm absolut nichts. Sie war gleichgültig. So war das halt. Er war der Jäger und sie nur seine Beute. Hatte ihr Lebensrecht dadurch verwirkt, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort war. Natürliche Bestandskontrolle. Alex grinste.
Er erinnerte sich an seinen Vater – er hatte ihn gehasst. Sein Vater war Jäger gewesen, und wenn er mit einer fetten Beute nach Hause gekommen war und in das entsetzte Gesicht seines Sohnes geschaut hatte, war sein Spruch »natürliche Bestandskontrolle« gewesen.
Er hatte längst dafür bezahlt. Dafür und für die schrecklichen Misshandlungen, die er seinem Sohn zugefügt hatte, damit aus Alex ein richtiger Mann werden konnte.
Alex wandte sich wieder seinem Opfer zu und sah, dass sie ihre Augen geschlossen hatte. Sie sah den Tod, wahrscheinlich winkte er ihr bereits zu.
Fast zärtlich nahm er sie in die Arme. Sie hatte jede Gegenwehr aufgegeben. Dann nahm er sie mit in sein dunkles Reich, bis die Farbkreise in ihrem Kopf aufhörten zu rotieren, bis ihr Herz aufhörte zu schlagen.
Er sah sie an. Tote hatten für ihn immer eine ganz eigene Schönheit. Faszinierend, dass das Herz, was ständig geschlagen hatte, ohne Pause, so lange Zeit, ohne sich zu beschweren, auf einmal ruhig war. Völlige Stille im Körper. Kein monotones Pochen mehr.
Befriedigt und gesättigt verließ Alex die Wohnung und streifte bis zum Sonnenaufgang durch die Stadt. Er liebte die Sonne, aber die Nacht war sein Reich. Er war gezwungen, ausschließlich nach Sonnenuntergang unterwegs zu sein. Die Dunkelheit war sein Lebensraum geworden, was er oftmals bedauerte. Andererseits bot die Dunkelheit auch viele interessante Aspekte an: Gewalt, Brutalität, vielleicht ein kleiner Mord ... Alles, was die Dunkelheit eigentlich verbergen sollte, war für ihn sichtbar. Spannender, als im Fernsehen. Brutaler, als im Fernsehen. Obwohl, wenn er ehrlich zu sich selbst war, neigte er nicht zu Brutalität. Aber gegen die Spannung hatte er nichts einzuwenden.
Als er nach Hause zurückkehrte, war Alex angenehm müde. Er ließ sich erschöpft auf sein Sofa fallen, und fast augenblicklich fielen ihm die Augen zu. Sein Schlafbedürfnis war sehr ausgeprägt, da in der Zeit, in der er unterwegs war, sein Stoffwechsel auf Hochtouren lief. Traumlos versank er in seine eigene Welt ...
Virginia erwachte mit dem Gesicht des jungen Mannes vor ihren Augen und war im ersten Augenblick desorientiert. Diese eigenartigen Augen ...
Nachdem sie gefrühstückt hatte, rief sie bei Monica Stillwine an. Monica wusste immer einen Rat und falls nicht, würde es trotzdem guttun, ihre Stimme zu hören.
Nach dem fünfzehnten Klingeln meldete sich Monica mit verschlafener Stimme.
»Monica Stillwine.«
»Hi Monica, hier ist Virginia.«
»Was ist los? Ist was passiert, dass du so früh anrufst?«
»Ach nein. Nur ein kleiner Anfall von Paranoia. Ich dachte, ich müsste mal mit jemandem darüber sprechen.«
»Wieso, was gibt es denn?« Monicas Stimme hörte sich besorgt an.
»Eigentlich würde ich dir das lieber persönlich erzählen. Ich hatte einen ganz eigenartigen Traum.«
»Erstaunlich genug, dass du dich überhaupt an einen Traum erinnern kannst.«
»Ja, naja, es war halt ganz eigenartig.« Virginia war verunsichert. Warum nur hatte der Traum ihr solche Angst eingejagt?
Wie durch Watte hörte sie Monicas Stimme. Am besten, du kommst gleich mal vorbei.
Ja, natürlich würde sie das tun. Irgendwas stimmte nicht. Wenn sie nur wüsste, was es war. Auch ihre Katzen schienen sich anders zu verhalten, als normal – aggressiver ... Sie spüren meine Unruhe, dachte Virginia und versuchte sich zu entspannen.
Sie machte sich einen Tee und setzte sich noch einen Moment auf die Couch. Da war es wieder. Dieses eigenartige Gefühl. War – außer ihr – noch jemand in ihrer Wohnung? Obwohl sie sich beherrschen wollte, ließ sie ihren Blick durch den Raum schweifen. Sie sah nichts Auffälliges.
Was um alles in der Welt machte ihr solche Angst? Was war bloß in der letzten Nacht passiert?
Um halb elf machte Virginia sich auf den Weg zu Monica. Sie war dick eingemummelt, denn die Luft war eisig. Sie schnitt sich geradewegs ihren Weg durch ihre Luftröhre, bis hinunter in die Lungen. Doch dadurch schien Virginia wenigstens wieder einen klaren Kopf zu bekommen.
Was ist nur los mit mir, dachte sie laut und erschrak über den Klang ihrer Stimme.
Monica und Virginia umarmten sich herzlich zur Begrüßung.
»Ich habe schon auf dich gewartet und einen Tee zubereitet. Du möchtest doch bestimmt einen, kalt wie du bist.«
Virginia nickte dankbar. Monica war immer so fürsorglich. Entspannt ließ sie sich auf einen der beigen Ohrensessel fallen und schaute sich im Zimmer um. Monica hatte einige Möbel umgestellt, aber sonst hatte sich nichts verändert. Warum war sie schon so lange nicht mehr hier gewesen?
Monica brachte eine Kanne herrlich duftenden Tee aus der Küche und ließ sich gegenüber von Virginia auf das Sofa gleiten.
»Weißt du, mittlerweile komme ich mir etwas albern vor«, begann Virginia und sah zu, wie Monica ihr eine Tasse Tee eingoss.
»Ich weiß auch nicht, aber dieser Traum hat mir eine Heidenangst eingejagt.«
»Am besten, du erzählst ihn mir von Anfang an, ja?«
Virginia nickte und schilderte Monica den Verlauf des gestrigen Abends. Sie versuchte den Traum so detailliert wie möglich wiederzugeben, aber aus irgendeinem Grund verschwammen die Bilder vor ihrem geistigen Auge. Es war richtig unheimlich.
Monica, die Virginias Schwierigkeiten bemerkte, runzelte ihre hübsche Stirn. »Und du hattest nach dem Traum das Gefühl, jemand sei im Zimmer?«
»Ja«, antwortete Virginia rasch, »es war fast eine Art Panik, die ich spürte.«
»Dein Traum muss also ziemlich intensiv gewesen sein, dass du im ersten Augenblick dachtest, du seist in Gefahr.«
»So wird es wohl gewesen sein.« Aber Virginias Gedanken schwirrten. War es wirklich ein Traum gewesen? Das ist nicht die Erklärung, du hast etwas gesehen. Aber was bedeutete es?
Monicas Stimme riss sie aus ihren Gedanken.
»Entschuldige, ich habe dir gerade nicht zugehört.«
»Ob du sicher bist, dass du den Mann in deinem Traum noch nie gesehen hast? Du beschreibst ihn ja als ziemlich gutaussehend. Könnte es nicht sein, dass du ihn irgendwo gesehen hast und ihn sehr attraktiv fandest?«
»Du meinst, es könnte ein erotischer Traum gewesen sein? – Nein, ich war es nicht, ich war nicht die Frau in seinen Armen.– Sie war groß und ziemlich blond.«
»Eine Wunschvorstellung von dir vielleicht?«
»Nein, sicher nicht. Ich glaube auch nicht, dass diese Umarmung etwas mit Zuneigung zu tun hatte – eher mit ... Tod.«
Virginia erschauderte. Unbeholfen setzte sie die Tasse an den Mund und trank eine Paar Schlucke des heißen Getränks. Sie spürte, wie der Tee in ihren Magen floss und sie von innen heraus aufwärmte. Das war es also, was sie so verunsicherte. Sie dachte an den Tod, wenn sie die Bilder des Traumes noch einmal vor ihrem geistigen Auge abspulte.
»Du träumst vom Tod eines anderen Menschen? Das ist ja merkwürdig. Für wen der beiden Darsteller in deinem Traum bedeutete die Umarmung denn den Tod?«
»Für die Frau«, wisperte Virginia mit erstickter Stimme. »Meinst du, man könnte den Traum symbolisch sehen?«
»Auf deine Trennung von Thomas könnte ich das nicht beziehen. Du hast den Mann in deinem Traum als sehr attraktiv beschrieben. Schon von daher ließe sich das nicht vereinbaren.«
Virginia lächelte leicht. Monica hatte Thomas nie leiden können, und mittlerweile konnte sie diese Antipathie durchaus nachvollziehen.
»Am besten wäre es eh, wenn du dir ganz schnell wieder einen Freund suchtest. Das dürfte dir doch auch nicht schwerfallen.«
Virginia nickte langsam. Wahrscheinlich hatte Monica recht. Auf jeden Fall fühlte sie sich jetzt etwas besser.
Erschrocken starrte er ihn an. Nur langsam entspannten sich seine verkrampften Glieder, und er ging vorsichtig auf Alex zu. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich noch einmal wiedersehe.«
»Und froh darüber?«, fragte Alex mit einem samtweichen Unterton in der Stimme.
»Was glaubst du denn?«
Alex wich vor seiner Berührung zurück. »Ich will es von dir hören«, gurrte er.
»Ich bin immer froh, dich zu sehen, Alex. Setz dich doch.«
Alex ließ sich in einen schweren antiken Sessel sinken, der wesentlich bequemer war, als er aussah. Offensichtlich hatte Brian seinen Geschmack noch nicht verändert. Er liebte diese alten Sachen, und für Alex war es ein Leichtes gewesen, ihm hin und wieder kleine Geschenke dieser Art zu machen.
»Du hast dich verdammt lange nicht blicken lassen, Alex«, sagte Brian unruhig, und als Alex aufblickte, sah er Brians gerötete Wangen und das unruhige Zucken um seinen Mund.
»Du hast Angst, Brian«, flüsterte Alex und lächelte. »Das ist gut so. Du solltest sie nie verlieren.«
Brians – vor Aufregung – gerötetes Gesicht war einfach wundervoll anzusehen. Es war fast so, als könnte Alex in jedem kleinen Äderchen das junge Blut rauschen hören. Gierig entblößte er für einen Moment seine Fangzähne, und Brian wich ein paar Schritte zurück.
»Warum bist du hier?«
»Um einen Freund wiederzusehen. Komm, setz dich neben mich. Ich habe keine Lust, mich mit dir über diesen Sicherheitsabstand hinweg zu unterhalten.«
Zögernd näherte sich Brian ihm, und Alex lächelte.
»Oh, du bist so misstrauisch, Brian«, sagte er spöttisch und zog ihn mit seinem Willen dicht zu sich heran. Brian erstarrte, fühlte, wie das Blut in seinen Schläfen pulsierte.
»Sollte man dem Teufel denn vertrauen?«, fragte er heiser.
Und Alex lächelte und sagte: »Mein lieber Brian, ich bin nicht der Teufel. Glaubst du etwa an die Existenz des Satans?«
»Ich weiß es nicht. Aber was wäre naheliegender, als in dir einen gefallenen Engel zu sehen? – Du bist so schön.« Brian streckte die Hand aus und griff in Alex’ prachtvolles schwarzes Haar. Es war so weich und dick, wie kein menschliches Haar sein konnte. Dann beugte er sich herab und küsste Alex auf die Wange. Ein merkwürdiges Gefühl, fand Alex, diese warmen Lippen auf seiner kalten Haut.
»Warum lässt du mich so lange allein, um mich dann so zu ängstigen?«
»Komm mir nicht so nahe, Brian«, warnte Alex mit rauer Stimme. »Ich bin noch durstig.«
Aber Brian rührte sich nicht von der Stelle. Er kannte diese Machtkämpfe nur zu gut.
»Würdest du mir etwas antun?«
»Ja, mit Vergnügen. Das liegt in meiner Natur. Ich kann einfach nicht anders. Oder – die Wahrheit ist, ich will es nicht anders.«
»Du hast mir einen fürchterlichen Schrecken eingejagt. Warum kommst du nicht einmal durch die Tür?«
Alex lächelte wieder. »Ich liebe es, dich zu erschrecken. Es ist so gewöhnlich, durch die Tür zu gehen. Aber ich bin einfach nicht gewöhnlich, mein lieber Brian. – Erzähl mir, was macht dein Buch?«
»Es geht eher schleppend voran. Ich habe im letzten Jahr kaum geschrieben.«
Alex zog erstaunt die Augenbrauen hoch und versuchte, Brian nicht zu fixieren. Er trug keine Sonnenbrille, und seine Augen hatten eine äußerst eindringliche Wirkung auf Sterbliche. Sie wurden geradezu in seinen Bann gezogen, selbst, wenn er das nicht beabsichtigte.
»Was ist los mit Dir? Ich dachte, das Buch wäre das Wichtigste in deinem Leben?«
Brian sah ihn lange an. So lange, bis er das Gefühl hatte, er würde in diese wundervollen Augen hineingesogen.
»Du bist das Wichtigste in meinem Leben, Alex«, sagte er rau, und seine Stimme schien von sehr weit herzukommen.
Alex schüttelte traurig den Kopf. »Du verkennst mich, mein lieber Brian.«
»Ich habe immer eure Signale gehört, immer gewusst, dass es euch gibt. Niemals hätte ich mit jemandem darüber sprechen können. Und auf einmal bist du da. Wunderschön, wie ein Engel – aber so grausam. Du weißt, wie sehr ich dich brauche und lässt mich trotzdem allein. Warum tust du mir das an?«
»Ich bin kein Mensch. Du solltest mich nicht lieben – du solltest mich fürchten!« Abrupt stand Alex auf und starrte aus dem Fenster. Er bemerkte, wie Brian sich ihm näherte. Dann spürte er die warme Hand auf seiner Schulter. Wie angenehm diese Wärme war, diese Nähe. Und wie ungewohnt. Selten hatte er eine derart enge Beziehung zu einem Sterblichen gehabt.
Vor sieben Jahren hatte Brian ihn gesehen und es darauf angelegt, ihn kennenzulernen. Dieser Mut ließ Alex aufmerksam werden.
Eines Nachts war Alex dann bei dem hübschen jungen Mann aufgetaucht und hatte ihn zur Rede gestellt. Er erfuhr, dass Brian sich schon länger mit der Idee der Unsterblichkeit auseinandergesetzt hatte.
Brian war neugierig gewesen, brannte darauf Einblicke in Alex’ düstere Welt zu erhaschen. Aber Alex war launisch, nicht gerade der ideale Gesprächspartner. Doch hatten sie mittlerweile eine ganz eigene Freundschaft aufgebaut, die keiner der beiden missen wollte.
Alex ließ seine Gedanken durch die Nacht schweifen, bis sein Blick sich verklärte. Sanft nahm er Brians Hand von seiner Schulter und hauchte einen Kuss darauf.
»Du willst gehen, nicht wahr?«
Alex nickte lächelnd. »Aber diesmal wirst du kein Jahr lang auf mich warten müssen.« Dann wandte er sich um und verschwand auf dem gleichen Weg, wie er gekommen war.
Alex streifte eher ziellos durch die Straßen. Seine seidigen schwarzen Haare flogen im Wind. Er atmete die frische Nachtluft ein und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Wie angenehm die Nacht war. Erstaunlich, dass so viele Menschen sie fürchteten, die Fenster und Jalousien schlossen, um die Nacht auszusperren. Er liebte die Nacht, wie den Tag; ergriff von ihr Besitz, wie sie von ihm. Die Nacht und die Dunkelheit hereinlassen – in den Körper lassen. Alex wurde eins mit den Schatten, war Schatten, Dunkel, Nacht und Alex. Ließ Raum und Zeit hinter sich und lachte.
Er wurde angezogen von einem eigenartigen Gefühl. Jemand hatte Angst vor ihm – jemand, der ihn nicht einmal kannte. Wie konnte das sein? Alex landete behände auf einer Terrasse und verbarg sich im Schatten der Nacht. Er war gespannt. Er suchte die Gedanken seines Opfers und ließ sich davon berauschen.
Wie eigenartig die Menschen waren. Manche waren – in seinen Augen – reine Instinktkrüppel, andere machten ihn sogar unabsichtlich auf sich aufmerksam; streckten ihre neugierigen Fühler weiter in die Nacht, als es gut für sie war. Wie einfältig und – gefährlich!
Alex lachte in sich hinein und warf einen Blick in die Wohnung. Da sah er sie – oh, wie wundervoll lebendig sie war! So rein und schön – er musste sie haben.
Virginia starrte angstvoll nach draußen. Da war etwas. Das spürte sie ganz deutlich. Ihr Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Vielleicht sollte sie Monica anrufen. Vielleicht würde sie sich beruhigen, wenn sie mit jemandem sprechen konnte. Zitternd ging sie zum Telefon und nahm den Hörer ab – das Telefon war tot! Virginia bemerkte, wie das Blut in ihr Gesicht schoss. War das real, oder war sie in irgendeinem Horrorfilm gelandet? Wer – in Gottes Namen – hatte es nur auf sie abgesehen?
Krampfhaft überlegte Virginia, was sie jetzt tun könnte. Doch ihr Kopf war erfüllt vom angstvollen Pochen ihres Herzens. Wenn das ein Scherz von einem ihrer Freunde war – sie würde ihn umbringen!
Alex hatte keine Lust mehr, zu warten. Mit der Zunge fuhr er sich über die kalten Lippen und schluckte hart.
Sie war unglaublich schön. Wie sie sich im Zimmer bewegte. Er musste sie haben. Ein sehr menschliches Verlangen, stellte er fest. Er wollte sie – er wurde wieder ganz Alex. Kehrte von den Schatten zurück.
Mühelos verschaffte er sich Zugang zur Wohnung durch eines der Seitenfenster und stand Virginia dann unmittelbar gegenüber. Diese wunderschöne Haut, diese großen Augen und diese reine Angst – er war entzückt.
Virginia erstarrte. Wortlos stand sie da und rang nach Luft. Nicht einmal fähig, einen Schrei auszustoßen und ohnmächtig zu werden. Starrte ihn an – das war der Mann aus ihrem Traum! Die Augen ...
Panik kroch in ihr hoch, legte sich um ihren Hals, wie eine Schlange. Das alles machte keinen Sinn. Was war nur passiert? Wo war er hergekommen? Es war ein Alptraum! Ihr Herz wollte stehenbleiben. Und doch schlug es weiter, groß und schmerzhaft in ihrer Brust. Sie öffnete den Mund, dann wurde alles schwarz, und sie fiel und fiel ...
Alex ließ von ihr ab. Als Virginia auf dem Boden zusammengesunken war, trug er sie ohne Mühe zum Sofa. Ihre Haut war wunderbar warm. Vorsichtig strich er mit der Hand an ihrer Wange entlang, bis zu ihrem Hals. Langsam drückte er seine kühlen Lippen auf ihre warme Haut und spürte fast augenblicklich die Wärme in sich hineinströmen. Wunderbare, köstliche Wärme. Zärtlich fasste er in ihr volles Haar.
Er hätte soviel gedurft, aber er konnte und wollte nicht. Sie war sein. Er hätte alles tun können. War sie nicht sogar in seinen Besitz übergegangen? Nein, war sie nicht, sollte sie nicht sein. Er wartete.
Eine große tickende Wanduhr im modernen Design. Sie störte.
Tick, tick, tick.
Aber die Zeit war nicht von Bedeutung. So nichtig, dass ihn die Erinnerung daran aus der Fassung brachte. Alex stand auf und nahm die Batterie aus der Uhr. Ruhe. Nur das leise Summen des Kühlschranks war zu hören.
Er wartete.
Virginia kam zu sich. Ihre Augen weiteten sich vor Angst, als sie erkannte, dass nicht alles nur ein Traum gewesen war. Sie lag auf ihrem Sofa, und er saß ihr gegenüber – in ihrem Lieblingssessel. Auf seinem Schoß lag Asrael und schnurrte.
Ein dicker Kloß aus Panik und Entsetzen steckte in ihrem Hals fest und hinderte sie am Sprechen.
So hilflos, so unsicher. Was hatte er vor? Wie war er in ihren Traum gekommen? Niemals zuvor hatte sie ihn gesehen – da war sie sicher.
Alex ließ Asrael vorsichtig auf den Boden gleiten. Dann setzte er sich zu Virginia auf das Sofa. Er bemühte sich, so menschlich wie möglich zu wirken – was gar nicht so einfach war. Er spürte ihre Angst; ein Kribbeln, das in seinem Körper auf und ab jagte. Macht und die Angst seiner Opfer waren die zentralen Emotionen in Alex’ Dasein. Er genoss sie ebenso – wenn nicht mehr – wie die seltenen Gefühle der Zuneigung, die Brian ihm entgegenbrachte.
Alex beugte sich zu Virginia hinab und hauchte ihr einen Kuss auf die Wange, und endlich wagte sie zu sprechen.
»Was willst du von mir?«, flüsterte sie ängstlich.
»Dich«, antwortete Alex, und seine Stimme war weich und angenehm. Seine Haut war matt, reflektierte das künstliche Licht, das darauf fiel. Es war gespenstisch. Was war das für ein Wesen, das sich in ihr Leben geschlichen hatte? Virginias Gedanken wurden unklar. Was passierte? Sie starrte ihn an. Er war noch schöner, als in ihrem Traum – aber noch unmenschlicher.
»Woher wusstest du von mir?«, fragte Alex fordernd.
Virginia starrte ihn weiterhin an. »Ich«, stammelte sie, »ich hatte einen Traum. Aber ich wusste überhaupt nichts von dir. Wirklich, ich ...«
»Du hast deine Gedanken in die Nacht gesendet. Du hast mich hierher gelockt.« Alex lächelte.
Virginia schlug die Hände vors Gesicht. »Ich will nicht sterben«, flüsterte sie.
Alex hielt inne. »Was?«
Tränen liefen über ihr Gesicht. »Ich will nicht sterben. Wie konnte das passieren? Ich will weiter leben. Tu mir nichts.«
»Wer spricht denn von sterben?«, fragte Alex überrascht.
Aber Virginia war nicht mehr imstande zu antworten. Es war unbeschreiblich entsetzlich.
Alex empfand die Reinheit ihrer Angst wie das klare Wasser einer Bergquelle. Sie war wie ein verschrecktes Tier, Panik in den Augen, den Tod erwartend. Er wusste, egal was er machte, er brauchte keine Gegenwehr zu erwarten.
»Virginia«, sagte er leise und strich ihr ein paar Haarsträhnen aus der Stirn. Er bemerkte, wie sie zusammenzuckte. »Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich will dir nicht wehtun.«
Seine Stimme war so einschmeichelnd – fast hätte sie ihm geglaubt. Doch er strahlte etwas Dunkles aus, etwas Gefährliches. Etwas, das Virginia noch nie zuvor gespürt hatte.
»Ich möchte dir wirklich nichts tun, aber ich möchte dich wieder besuchen. Erlaubst du mir das?«
Virginia war verwirrt. Sie wusste nicht, ob sie ihn wiedersehen wollte. Er war so schön – doch so völlig anders, als alles, was sie bisher gesehen hatte. Erstaunt sah sie, wie seine Augen sich verdunkelten. Langsam näherte sich sein Gesicht dem ihren. Sie spürte seine kühlen Lippen an ihrem Hals. Wer bist du? – Alexander. Und alles wurde schwarz. Der Name hallte in ihrem Kopf ...
3
Mein Name ist Alexander de Dahomey. Lord of ... Aber was zählen Titel und Namen schon in der heutigen Zeit? – Zum Ärger einiger wirklich sehr weiser Kreaturen der Nacht sitze ich nun hier und schreibe meine eigene Geschichte auf. Ich habe darüber nachgedacht, was für Konsequenzen auf mich zukommen werden, aber es ist eigentlich zum Lachen.
Alte, verstaubte Gesetze ... was sollte es bringen, sich daran zu halten? Sich Dinge aufzuerlegen, von denen man nicht den geringsten Vorteil hat. Aber vielleicht bin ich zu jung, um den wahren Sinn zu erkennen? Dann allerdings müssten sie es mir nachsehen. – Ah, sie würden mich töten, bekämen sie mich in die Finger!
Heute ist der 13.11.1996 – haben wir es wirklich schon 1996? Die Zeit vergeht rasend schnell, wenn man sich mit ihr befasst. Und ich habe mich mit der Zeit befasst!
Vor einigen Jahren – als ich Brian kennenlernte – wurde mir bewusst, was den Menschen die Zeit bedeutet. Sie haben Angst vor ihr! – Erstaunlich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wasZeitfür mich war, als ich noch sterblich war. Wirklich nicht.
Aber für Brian ist die Zeit ungemein wichtig. Er ist noch so jung – nicht einmal 30 Jahre – und trotzdem hetzt und strampelt er sich ab. Bemüht sich, mit der Zeit Schritt zu halten und stolpert doch nur hinter ihr her. Vergeudet sein Leben, auf der Jagd nach Zeit. Ich frage mich, warum? Er kann sich doch keine Zeit auf einem Konto gutschreiben lassen – abgesehen davon, dass er die Zeit eh nicht einholen kann. Irgendwann ist seine Zeit abgelaufen – der Mensch ist sterblich.
Aber ich will ihn nicht verlieren – nie. Ich liebe ihn. Er bedeutet mir weit mehr, als er vermutet.
Manchmal lese ich in seinen Gedanken – und das erschreckt mich. Ohne, dass ich es gewollt hätte, bin ich zu seinem Leben geworden. Ich dachte, das würde sich ändern, wenn ich ihn verlasse. Aber ich bin zurückgekommen – oh, was bin ich für ein egoistisches Wesen – ich konnte nicht ohne ihn sein. Und es war gut, denn ich hatte ihn verletzt. Das letzte Jahr war die Hölle für ihn gewesen; ich spürte es, sah es in jedem Blick, den er mir zuwarf.
Es tut mir leid, Brian. Das wollte ich nicht. Es war unüberlegt.
Oh, mein lieber schöner Brian, ich lass dich nicht mehr allein. Das verspreche ich dir.
Seit 1589 wandle ich jetzt schon auf Erden, aber noch nie habe ich ein sterbliches Wesen so begehrt wie Brian. Die Altehrwürdigen verfluchen mich, wegen meiner Freundschaft – ja, meiner Liebe zu den Menschen. »Unvernünftig«, schimpfen sie, und vielleicht haben sie recht; David, Thomar und die anderen ... Vielleicht bedeuten die Menschen irgendwann einmal unseren Untergang. Aber bis dahin ...
Soll ich ehrlich sein? Ich glaube nicht daran, dass die Sterblichen uns ausrotten können. Dafür sind sie zu schwach und – sie lieben, sie verehren uns. Auch wenn sie nicht erkennen, was wir wirklich sind. Sie sammeln sich um uns, wie Mücken um das Licht und neiden uns unsere Schönheit und Stärke.
Nur wenige wissen um uns ...
Brian ist einer von ihnen. Er hatte mich aufgespürt, das muss so gegen 1989 gewesen sein. Schon vorher empfing er Signale, konnte sie jedoch nie zuordnen. Es war, als hörte er Stimmen, Gelächter, entferntes Geschrei. Nichts Konkretes, und das machte ihn fast wahnsinnig.
In einer lauen Herbstnacht wandelte ich durch die Straßen von Paris. Paris ist eine wundervolle Stadt. Voll skurriler Typen, sodass niemand sich umschaut nach einem attraktiven, jedoch fast weißhäutigen jungen Mann, der seine Augen selbst in der Dunkelheit hinter einer Sonnenbrille verbirgt. Die ideale Vampir-Stadt.
Die Luft war herrlich würzig, ich atmete sie in vollen Zügen. Denn die Luft im Herbst ist die angenehmste.
Ich verweilte auf einer der kleineren Brücken, die über die Seine führen. Von hier konnte ich die munteren Fähren beobachten, auf denen die Touristen ihre nächtlichen Lichterfahrten machten – und ich sah Notre Dame. Eindrucksvoll ragte dieses Bauwerk noch über die großen alten Stadthäuser in seiner Umgebung hinaus. Sollte ich mal wieder dort hineingehen? Aber nein, das machte mich irgendwie immer traurig. Warum? Ich weiß es nicht. Das ist gelogen – ich will nur nicht darüber nachdenken.
Und so stand ich nachdenklich auf der Brücke, lehnte mich an das rostige Geländer und ließ meinen Gedanken freien Lauf. Wieder kam eine kleine Fähre angeschippert. Ein kleiner brummender Motor mit einer Vielzahl winziger Lichter darauf – gespannt an der Reling und quer über Bord. Ich fragte mich, wie diese Menschen bei dem ganzen Licht auf dem Schiff überhaupt noch etwas von Paris sehen konnten.
Da bemerkte ich, dass mich jemand beobachtete. Ich drehte mich langsam um und sah ihn auf der anderen Seite, mit dem Rücken an eine Laterne gelehnt, stehen. Ein interessanter junger Mann, mit hellbraunem Haar und grünen leuchtenden Augen. Er war ein Stück größer als ich, machte jedoch einen recht zarten Eindruck.
Komm zu mir.
Er fixierte mich einen Augenblick, aber als ich einen Schritt auf ihn zu machte, drehte er sich auf dem Absatz um und rannte und rannte, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Bis er schließlich in den Straßen von Paris verschwunden war.
Ich war verblüfft. Er hatte meinem Rufen standgehalten, und er wusste, was ich war. Woher?
Ich versuchte, ihn durch Paris zu verfolgen, aber er hatte sich abgeschottet. Ließ keinen Gedanken nach außen dringen. Interessant.
Ohne große Eile machte ich mich auf die Suche nach einem Opfer für diese Nacht. Unglaublich viele Menschen waren auf den Straßen. Schlenderten an den Schaufenstern vorbei, saßen in den kleinen Bistros. Es war eine wundervolle Nacht zum Jagen. Ich lauschte, wartete auf eine arme, verlorene Seele, die mir vielleicht ihre kläglichen Signale zusandte.
Ich muss gestehen, es macht mir nichts aus, unschuldige Menschen zu töten. Sie müssten einem leidtun, ich gebe es zu, und vielleicht suche ich manchmal nach einem wirklich gefährlichen Gegner, einem Mörder zum Beispiel. Dann habe ich einen Moment lang den Eindruck, etwas Sinnvolles getan zu haben; vielleicht beruhigt es mein Gewissen – wenn ich denn eines habe. Aber im Großen und Ganzen kümmert es mich wenig.
Es dauerte auch in dieser Nacht nicht lange, bis ich ein geeignetes Opfer gefunden hatte, das heißt, eigentlich fand es mich!
Ich schlenderte sorglos durch die dunklen, engen Gassen, in denen die weniger wohlhabenden Bürger Paris ihr Dasein fristeten, da baute sich plötzlich ein riesiger Kerl vor mir auf. Konnte höchstens 25 Jahre alt sein, aber ein Bär von einem Mann.
»Her mit deinem Geld«, raunzte er auf Französisch.
Aber ich schüttelte nur mitleidig den Kopf. Offensichtlich war der Gute nicht bester Stimmung und versuchte sofort, mich mit einem boshaften Faustschlag außer Gefecht zu setzen. Geschickt wich ich aus, und es kam zu einem kurzen Gerangel. Als ich mein Gesicht seinem Hals näherte, wurden seine Augen plötzlich riesengroß.
Er versuchte, mich wegzustoßen, aber ich schlug meine Zähne in die weiche Haut seines Halses und spürte, wie mir sein heißes Blut entgegensprudelte. Der Geruch von Blut, Schweiß und Angst jagte mir köstliche Schauder über den Rücken. Hemmungslos labte ich mich an seinem Körper, bis das Herz seinen letzten Schlag getan hatte.
Dann schlug ich ihn mir fröhlich pfeifend auf den Nacken, um ein schönes Plätzchen zu suchen, wo er seinen ewigen Frieden finden konnte. Nach diesem Genuss war der schöne Fremde, der mich auf der Brücke beobachtet hatte, aus meinem Kopf verschwunden.
Etwa ein Jahr später sah ich ihn wieder. Ich war wieder in meinem geliebten London. Es war traurig und noch immer anstrengend für mich, aber ich hatte London vermisst. Wollte ihm wenigstens einen kurzen Besuch abstatten. Wie immer war das Wetter lausig um diese Zeit. Ein eisiger Feuchtigkeitsfilm hatte mein Haar und mein Gesicht überzogen, als ich über die St. Martin’s Lane Richtung Trafalgar Square schlenderte. Ich wollte wieder ins Theater, mich unter die Sterblichen mischen, einer von ihnen werden.
Wenn ich in London bin, gehe ich immer ins Theater – schon solange ich denken kann. Dabei ist es gleichgültig, welches Stück. Ich liebe das Theater der Verstellung wegen; das erinnert mich an meine eigene Existenz. Denn weil ich unter den Sterblichen lebe, bin ich ständig verpflichtet, mich zu verstellen. Würde ich ein abgeschiedenes Friedhofsdasein fristen – wie einige von uns – wäre das sicher anders. Aber wie öd’ und trist wäre das – ich möchte es mir nicht einmal vorstellen.
Ich hatte schon getrunken an diesem Abend, daher war meine Haut gerötet – fast hätte man mich für einen Sterblichen halten können. Die Augen hatte ich – wie üblich – hinter einer violett getönten Sonnenbrille verborgen.
Ich suchte mir den schönsten Platz, auf der Empore. Ich brauchte nicht anstehen, brauchte keine Eintrittskarte – ein positiver Aspekt meines Lebens, wenn man denn von Leben sprechen möchte.
Entspannt ließ ich mich in den weichen roten Sessel sinken. Wie angenehm dieser menschliche Luxus doch war.
Sie spielten Shakespeares Macbeth. Wie oft hatte ich es schon gesehen? Das Drama des ehrgeizigen Macbeth, der – angetrieben von seiner Frau – die schrecklichsten Dinge tut. Er tötet seinen König – Duncan – dem er treu ergeben sein sollte. Gierig, den Thron zu besteigen. Er ist so schwach und so selbstsüchtig, ermordet selbst seinen Freund Banquo, um zu verhindern, dass Banquos Nachkommen einmal den Thron erben. Und stirbt am Ende – wie es sich gehört – im Zweikampf mit Macduff.
Es ist herzzerreißend – und blutig ... Welcher Aspekt tiefer an mir rührt – ich weiß es nicht.
Es war berauschend, ich liebte es. Doch plötzlich bemerkte ich, wie mich ein eigenartiges Kribbeln überkam. Dann sah ich ihn. Er saß mir gegenüber, andere Seite – ebenfalls Empore. Er hatte sicherlich Geld dafür bezahlt.
Ich war verunsichert, trotzdem lächelte ich ihm zu, ließ kurz meine Fangzähne aufblitzen. Er wusste, was ich war; es war gleichgültig. Ich weiß nicht, ob er es sehen konnte, aber sicher spürte er es.
Er trug sein braunes Haar kürzer als vor einem Jahr und er sah immer noch hinreißend aus. Ich sah seine grünen Augen in der Dunkelheit funkeln, als er mich anstarrte.
War unser zweites Zusammentreffen zufällig?
Wieder versuchte ich ihm zu folgen, aber er verschwand, noch ehe das Stück beendet war. Und er hinterließ keine Spuren. Seine Gedanken waren mir verschlossen – und das erstaunte mich nicht schlecht. Hatte er die bewusste Fähigkeit, mir seine Gedanken zu verheimlichen? Konnte er vielleicht sogar die meinen lesen?
Ich muss gestehen, dass ich mich ärgerte. Da gab es einen Sterblichen, der über meine Aufenthaltsorte Bescheid wusste, den ich jedoch nicht aufspüren konnte. Es verunsicherte mich nicht unerheblich.
Das nächste Mal, dass ich ihn traf, war in New York. Ich war erst wenige Male in dieser erschreckenden Metropole gewesen – das erste Mal so gegen 1843. Ein Erlebnis, an das ich nicht besonders gern zurückdenke. Es war ein strenger Winter; eisiger Wind strich durch die Straßen, und die Menschen hungerten. Viele erfroren einfach, daher hatten Lomay und ich leichtes Spiel. Niemand schöpfte Verdacht – wir konnten die Toten sogar auf der Straße liegenlassen. Aber die Temperaturen waren unangenehm; wir konnten kaum dagegen anheizen. Die Kälte fuhr einem in die Glieder und lähmte fast den Verstand. Natürlich war sie nicht lebensbedrohend für uns, aber trotzdem fast unerträglich.
Wir waren mit dem Schiff von Europa nach Amerika gefahren. Das war damals noch ein Abenteuer – und Lomay liebte es, im Gegensatz zu mir.
Erst viel später erfuhr ich, dass er leicht hätte dorthin fliegen können. Aber er wollte mich offensichtlich nicht zurücklassen, und meine damaligen Fähigkeiten hätten bei Weitem nicht ausgereicht.
Nachdem wir unsere Särge hatten an Bord bringen lassen – schon dafür mussten wir gewagte Geschichten erfinden – wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie gering meine Fähigkeiten im Vergleich zu Lomays waren – ich wurde seekrank. Es ging mir so schlecht, wie es wahrscheinlich keinem Menschen gehen kann. Es war entsetzlich. Lomay zeigte dafür wenig Verständnis und ärgerte sich darüber, dass ich die Ratten, die er mir brachte, verschmähte.
Erst nach ungefähr einer Woche gewöhnte ich mich an das Rollen und Schlingern des riesigen Dampfers und wagte mich abends unter die Sterblichen. Ich wollte menschliches Blut, obwohl Lomay mir gesagt hatte, dass ich auf einem Schiff höchste Vorsicht walten lassen müsste.
Aber ich war völlig ausgehungert, und die Ratten verursachten einen gewissen Widerwillen in mir.
Und es dauerte nicht lange, bis ich das geeignete Opfer gefunden hatte. Ich bemerkte, dass ein älterer Herr mich interessiert beobachtete. Das war mir nicht fremd, denn ich wusste, dass mich das ewige Blut noch attraktiver gemacht hatte. Außerdem hatte ich schon in meinem sterblichen Leben sowohl weibliche als auch männliche Verehrer. Ich ließ mich also auf einen Blickkontakt ein, und der Mann kam zu mir herüber.
Er schien ein echter englischer Gentleman zu sein und war hocherfreut, als er hörte, dass ich ebenfalls Engländer war. Und so saßen wir eine Weile plaudernd an der Bar, bis er mich höflich und diskret auf sein Zimmer einlud, um den Abend mit einem kleinen Mitternachtsumtrunk zu beschließen.
Bereitwillig folgte ich ihm, aber kaum hatte er die Kabinentür hinter uns geschlossen, stürzte ich mich wie ein ausgehungerter Tiger auf ihn.
Er mochte zuerst gedacht haben, mein Anliegen sei sexueller Natur, aber ich grub meine Zähne unmissverständlich in die faltige Haut seines Halses. Er hatte nicht einmal die Gelegenheit einen Schmerzenslaut auszustoßen, denn ich saugte ihn in großen Schlucken leer, bis der Tod ihn erlöste. Taumelnd erhob ich mich und ließ mich auf einen der bequemen dunkelgrünen Polstersessel fallen. Mir war klar, dass ich meine unerhörte Tat verbergen musste. Ich machte mich also an die Arbeit, und als ich fertig war, sah es aus, als habe der Mann einen Herzanfall erlitten. Es war absolut glaubwürdig.
Aber Lomay kochte vor Wut, als er von meiner Tat erfuhr, und schlug mich so, wie er es nie zuvor getan hatte, als ich noch ein Mensch war. Ich brauchte eine ganze Nacht, um mich von den Verletzungen zu erholen – aber noch wesentlich länger fraßen die Demütigungen an meiner Seele.
Der weitere Verlauf der Fahrt war eher ruhig. Beleidigt hielt ich mich von Lomay fern und begann, meine Opfer nicht zu töten, sondern immer nur kleine Schlückchen von ihnen zu nehmen.
Das kostete mich unglaubliche Überwindung. Es war die Hölle, von ihnen abzulassen, obwohl mein Durst noch nicht gelöscht war.
Nach meinen kleinen Übergriffen ließ ich einige Tropfen meines übernatürlichen Blutes auf die winzigen Einstiche an ihrem Hals tröpfeln, und die Wunden verschlossen sich sofort; mittlerweile hatte ich schon viele Dinge gelernt und so war es kein großes Problem mehr, ihre Erinnerungen zu verfälschen. Nach einigen Tagen fiebriger Erschöpfung waren die meisten wieder wohl auf.
Bis auf eine junge Dame – ihr Name war MadeleineDeveraux. Sie erholte sich nicht, fieberte stark, und der Schiffsarzt war ratlos.
Eines Nachts kam Lomay wutentbrannt zu mir. Seit Tagen hatten wir kein Wort mehr miteinander gewechselt, obwohl unsere Särge in der gleichen Kabine standen.
»Du Idiot, was hast du jetzt schon wieder angestellt?« fauchte er, aber ich hatte keine Vermutung, was er meinen könnte.
»Sie spricht von dir. Diese kleine Französin – sie erinnert sich an dich. Wenn du nicht fähig bist, ihre Gedanken und Erinnerungen zu trüben, dann töte sie lieber.«
Ich schluckte hart. Wie hatte das passieren können? Ich musste sofort zu ihr. Vielleicht konnte ich schlimmeres Übel abwenden. Widerstrebend sah ich Lomay in die Augen. Sein Gesicht war hassverzerrt.
»Wegen dir werde ich dieses Schiff nicht verlassen«, flüsterte er drohend.
»Wem hat sie von mir erzählt?«, fragte ich so ruhig wie möglich.
»Ich hoffe, nur ihrer Mutter – und das hoffe ich vor allen Dingen für dich!«
Wortlos verließ ich unsere Kabine und suchte Madeleine auf. Ihre Mutter starrte mich an, als ich ihr schweigend befahl, den Raum zu verlassen.
Leise setzte ich mich zu ihr und nahm ihre Hand. Sie war so zart und zerbrechlich. Die Schwäche hatte noch nichts von ihrer Schönheit geraubt, und ich betrachtete sie wohlwollend – wie ich es an dem Abend getan hatte, als sie mein Opfer werden sollte. Ihre kleinen Brüste hoben und senkten sich langsam bei jedem Atemzug. Ihr langes, dunkles Haar lag aufgefächert auf dem rosafarbenen Kopfkissen. Sie war blass, als wäre sie geschminkt, und das machte sie noch zerbrechlicher.
Wäre ich ein Mensch gewesen – ihr Anblick hätte mich sicherlich sexuell erregt, aber ich nahm vor allem anderen den süßlichen – fast unwiderstehlichen – Blutgeruch an ihr war, der den Menschen so eigen ist.
Als sie erwachte und in meine Augen, statt in die vertrauten Augen ihrer Mutter blickte, setzte ihr Herzschlag für einen Moment aus. Sie erkannte mich – zu meinem Schrecken – sofort wieder und hob abwehrend die Hände. Glücklicherweise war sie zu entkräftet, um zu schreien.
Das Entsetzen in ihrem Gesicht kränkte mich. Normalerweise lehnten die Menschen mich nicht ab – sie fanden mich unwiderstehlich. Liebten meine Blässe, mein seidiges Haar und meine ozeanblauen Augen. Aber in ihren Augen stand Entsetzen. Sie starrte mich an, als wäre ich der Schnitter höchstpersönlich, die Sense schon schwingend.
Daher war ich nicht besonders zartfühlend, als ich sagte: »Du stirbst. Du hast kaum noch ein paar Tage.«
Sie nickte tapfer. »Ich weiß«, flüsterte sie. »Ich werde sterben, weil ich den Teufel attraktiv fand. Das ist Gottes Strafe.«
Ich war erstaunt über ihre Antwort, aber sie sprach weiter. »Hätte ich nicht Gottes Existenz angezweifelt, hätte ich nicht sein Symbol von meiner Brust genommen, wäre ich gefeit gewesen. Aber die Zweifler werden bestraft. So steht es schon im heiligen Buch.«
»Amen«, sagte ich und lächelte sie an.
Sie erstarrte vor Schreck. Dann setzte sie wieder an zu sprechen: »Auch du wirst für deine Taten bestraft werden. Ich habe zurückgefunden zu Gott. Er verzeiht meine Ungläubigkeit und nimmt mich zu sich. Du aber wirst in der ewigen Hölle schmoren.«
Ich lachte. Ich lachte, bis die Tränen über meine Wangen liefen und meinen Hemdkragen rot verfärbten. Es war ein wunderbares Spiel. Herrlich teuflisch, und Madeleine sah mich auch an, als käme ich direkt aus der Hölle. Eine teuflische Missgeburt, die sie prüfen wollte – kurz vor ihrem Tod. Aber ich wollte sie nicht prüfen ...
»Willst du dem Tod entrinnen, Madeleine?«, fragte ich sie mit meiner sanftesten Stimme. Aber sie schüttelte entschieden den Kopf.
»Nein«, sagte sie fest. »Ich werde Gottes Urteil mit Freude entgegennehmen.«
»Und wenn ich dir sage, es gibt weder Gott noch Satan?«
Energisch schüttelte sie den Kopf und blickte zur Decke der Kabine. »Ich widerstehe der Versuchung, Herr, siehst du es?«
»Du verschwendest dein Leben für einen Irrglauben, Madeleine. Gott kann dich nicht hören, denn er existiert nicht«, sagte ich und wischte mir die restlichen Bluttränen aus dem Gesicht.
Tränen standen in ihren Augen, aber wieder richtete sie das Wort an den Herrn: »Welch’ schreckliche Sünden habe ich begangen, dass der Teufel selbst von mir Besitz ergreifen möchte? Aber ich werde diese Prüfung erleiden, denn ich war ungläubig. Weiche von mir, Satan!« schrie sie mich an, mit aller Kraft, die ihr noch blieb.
Mitleidig beugte ich mich zu ihr hinunter. Dann nahm ich ihr kleines Köpfchen in meine Hände und legte meine Lippen an ihren wunderbar weißen Hals. Das Blut pulsierte an meinen Lippen.
Mit einem kräftigen Ruck brach ich ihr das Genick. Sie zuckte nicht einmal zusammen bei diesem letzten tödlichen Kuss.
Aber so war die Zeit – die Menschen waren verblendet. Sie schlug das ewige Leben aus, um vor Gott zu bestehen. Und was bekam sie dafür? – Den Tod.
Dieses hübsche, intelligente Ding – hatte sie sich in ihrem Fieberwahn zu Tode gestürzt. Das Leben konnte so grausam sein. Bedächtig erhob ich mich und ließ ihre Kabine hinter mir zurück.
War ich nicht mittlerweile schon ebenso grausam wie Lomay? Und wie hatte ich ihn verabscheut dafür. Das alles erschien mir unendlich lange her zu sein.
Aber ich wollte ja erzählen, wie ich Brian in New York kennenlernte.
Erst vor Kurzem war ich nach New York gezogen, genauer nach Manhattan. Ich hatte mir eine kleine Penthouse-Wohnung in der Nähe des Central Parks gekauft. Eine schöne Ecke, denn ich konnte direkt in die großzügigen Grünanlagen schauen – und wenn es nachts ruhiger wurde, hörte ich die Bäume ihre Geschichten erzählen. Eigentlich war es nie mein Ziel gewesen in diese schreckliche Stadt zu ziehen, aber wenn man sich einmal eingelebt hat, fällt es einem schwer, sich ein Leben ohne diesen Koloss vorzustellen. Auch ist das ausgeprägte Nachtleben ein riesiger Vorteil für uns. Verhungern musste ich hier sicher nicht!
Und in dieser Zeit war ich noch voll damit beschäftigt, das große kulturelle Angebot zu entdecken. Jeden Abend verbrachte ich im Theater, in der Oper oder in einer Ballett-Aufführung. Die Vielfalt ist unendlich – übertrifft sie nicht sogar die in meinem geliebten London?
So saß ich auch an diesem Abend wieder im Metropolitan Opera House. Wie üblich hatte ich mir einen unauffälligen Sitzplatz gewählt, denn ich wollte kein Aufsehen erregen. Die etwas abgelegenen dunklen Plätze waren gerade passend, und so lehnte ich mich entspannt zurück und genoss die klassischen Werke, die dort übrigens fast ausschließlich aufgeführt werden.