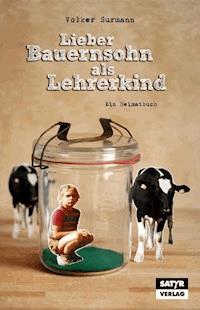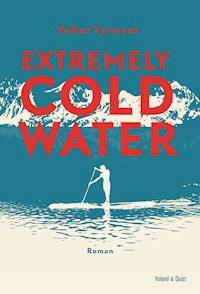
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Voland & Quist
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eugen Thomas macht irgendwas mit Medien. Doch dann steigt er plötzlich aus: aus seinem Sportwagen, aus seinem halbdigitalen Social-Network-Leben in Berlin. Und nur eine Stunde später besitzt er Wanderstiefel aus einem Schuhdiscounter und ein Flugticket in die Sierra Nevada, ausgestellt auf den kommenden Tag. Eugen steigt ein: ins Flugzeug, ins Glücksspiel in Nevada und in ein Ferienhaus am Lake Tahoe. Dort findet ihn ein neues soziales Netzwerk: Joshua, das Schlüsselkind von nebenan, und Phil, ein schwuler Callboy aus L.A. In dessen betagtem Toyota namens "Madonna" begeben sich die drei auf eine familiäre Rettungsmission nach Oregon: Es gilt, Joshuas Schwester vor ihrem Freund zu schützen. Volker Surmanns zweiter Roman ist locker erzählt, spannend und humorvoll, berührt aber zwei existenzielle Fragen: Wie will man eigentlich leben? Was ist wirklich wichtig?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verlag Voland & Quist, Dresden und Leipzig, 2014
© by Verlag Voland & Quist OHG
Umschlaggestaltung: HawaiiF3, Leipzig
Korrektorat: Jan Freunscht, Witten
Satz: Fred Uhde, Leipzig
E-Book: eScriptum, Berlin
ISBN: 978-3-86391-107-2
www.voland-quist.de
Inhaltsverzeichnis
Teil 11. Kreuzung2. Loft3. Border Protection4. Phoenix Sky Harbor5. Air6. Eldorado7. CasinoTeil 28. Truckee River9. Strand10. Haus am See11. Schrank12. Tahoma13. Schlafzimmer14. Esstisch15. Bad Bank16. NotrufzentraleTeil 317. Toyota18. Streets of California19. Oregon20. Starbucks21. Fenster22. Kampfbahn23. Pflaster24. Morpheus’ Arme25. Reno-Tahoe International26. Pacific Crest TrailDankeTeil 1
1. Kreuzung
»Jetzt fahr endlich, du blöde Fotze!«
Eugen Thomas saß am Steuer seines schwarzen Seat Leon und erschrak. Dann wurde ihm gewahr, dass es heiß war im Auto, dass ihm Schweiß auf der Stirn stand und sein Gesicht vermutlich gerötet war. Er linste in den Rückspiegel. Ja, stimmte. Stress, einfach zu viel Stress.
Dann erst wurde ihm gewahr, dass das Fenster seines schwarzen Seat Leon weit offen stand und ihm vom Gehweg zwei junge Frauen so mitleidig wie kopfschüttelnd anschauten. Er musste sehr laut geschrien haben.
Als Nächstes bemerkte er, dass ihn die Frau im Polo vor ihm über den Rückspiegel sehr böse anfunkelte. Offensichtlich hatte auch sie ihre Scheiben weit heruntergedreht. Verdammt, der Polo besaß sogar ein Schiebedach.
Zuletzt sah Eugen Thomas, dass die Frau im Polo allenfalls auf den Fußgängerüberweg auf der anderen Seite der Kreuzung hätte hinüberfahren können, denn der Verkehr staute sich noch viel weiter dreispurig durch die Stadt.
Nicht gewahr wurde Eugen Thomas, dass sein iPhone schon wieder etwas von ihm wollte. SMS, Twitter-Benachrichtigung, Anruf, Facebook-Alert. Irgendwas in der Art. Irgendeine App wollte immer irgendwas von ihm.
Dennoch griff Eugen Thomas nach dem iPhone, nach der Tasche mit Unterlagen und zog den Autoschlüssel ab. Das Radio, das gerade noch von einem Krieg in einem fernen Land und einem Streit in der Koalition (oder umgekehrt) gesprochen hatte, verstummte. Dann stieg Eugen Thomas aus.
Die Frau vor ihm schaute verwundert aus ihrem Rückspiegel. Eugen überlegte, etwas wie »Entschuldigung« zu murmeln, aber es wollte ihm nicht recht über die Lippen kommen. Er zog die Augenbrauen hilflos hoch, die Nase kurz kraus und hoffte, die Frau möge irgendwas hineininterpretieren, wenn er auch selbst nicht wusste, was genau.
»Wat wird’n ditte?«, brüllte der Taxifahrer hinter ihm und steckte seinen hitzeroten Kopf aus dem offenen Fenster.
»Es wird, was es wird«, sagte Eugen Thomas und ließ das Taxi und sein Auto hinter sich, schlängelte sich schnell zwischen Stoßstangen hindurch zum Gehweg. Der Verkehr stand nach wie vor. Irgendwo in der Ferne hupte es. Eine Fassade warf das Echo eines Martinshorns zurück.
Auf dem Gehweg angelangt, schaute Eugen Thomas noch einmal zurück, drückte auf das Abschließsymbol auf seinem Autoschlüssel, der Seat Leon machte »Bibb bibb«, die Warnblinklampen blinkten. Leon macht jetzt Bubu. Schon dröhnte die erste Hupe, der Taxifahrer. Als könnte eine Hupe einen schlafenden Leon wecken.
Was wird denn das hier gerade?, fragte sich nun auch Eugen Thomas und befand, dass es besser wäre, sich aus dem Staub zu machen. Zügig, aber ohne besondere Hektik lief er los, beschleunigte seinen Schritt zum Anschwellen des Hupgesangs und flüchtete sich hinter die nächste Schiebetür aus Glas, eine kleine Shopping-Mall – H&M, Rossmann, Edeka, Bäcker, Eiscafé Venezia, derselbe Scheiß wie überall. Wieder die erstbeste Schiebetür: Schuhdiscounter, sehr hohe Regale – gut, um sich dazwischen zu verstecken. Außerdem dämpften die Regale, gefüllt mit Leder und Kartons, das mittlerweile erstaunlich polyphone Hupkonzert von der Straße.
Das ist doch nicht normal, was ich hier tue, dachte sich Eugen Thomas und überlegte, ob er eine Facebook-Nachricht tippen sollte: »Eugen Thomas: hat böses F-Wort gesagt und dann sein Auto stehen lassen, im Stau auf der Leipziger Straße, mittlere Spur. Erklärung gesucht.«
Er schaute auf sein iPhone. Drei Anrufe in Abwesenheit. Mindestens einer davon würde zum Thema haben, ob er es noch rechtzeitig zum Meeting schaffte. Ich habe Termine, wunderte sich Eugen Thomas, ich habe einen Job, fast jede Fahrt mit dem Leon ist eine Dienstfahrt, und jetzt stehe ich in einem Schuhdiscounter und verstecke mich zwischen den Regalen. Das ist doch gerade völlig verrückt!
Nervenzusammenbruch, durchfuhr es Eugen Thomas, ich habe einen Nervenzusammenbruch. Klar, das muss es sein. Nervenzusammenbruch.
»Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen?«, fragte plötzlich eine Verkäuferin.
»Nein danke«, sagte Eugen Thomas, »ich komm schon zurecht.« Und in der Tat, wunderte er sich wieder, für einen Nervenzusammenbruch komme ich überraschend gut zurecht.
»Suchen Sie etwas für Ihre Frau?«, insistierte die Frau vom Schuhladen und musterte ihn. Eugen Thomas stand vor einem mannshohen Regal mit Damenschuhen.
»Nein, ich stöbere nur ein wenig.«
»Stöbern« ist falsch, fiel ihm auf. Stöbern tut man in Buchhandlungen. In Schuhdiscountern stöbert man nicht. Was war das eigentlich für ein komisches Wort? Stöbern.
Die Frau musterte ihn seltsam, und er musterte einen roten Damenschuh, Größe 39, mit mehr Lücken und Luft als Lackimitat, dafür sehr hohem Absatz. Jetzt hielt sie ihn sicher für einen Transvestiten.
»Keine Sorge, ich bin kein Transvestit«, sagte Eugen und fragte sich, wieso er das sagte und wieso das eigentlich ein Grund zur Sorge sein sollte.
Die Frau tat jedoch so, als nähme sie den Transvestiten-Satz als Scherz, jedenfalls lachte sie und trollte sich: »Schauen Sie sich ruhig in aller Ruhe um.«
»Umschauen«, genau! Das machte man in Bekleidungsgeschäften. Da stöbert man nicht, da schaut man sich um.
Trotzdem nahm Eugen Thomas sein iPhone aus der Tasche, rief seinen Twitter-Account auf und tippte fix: »Neuer Trend: Stöbern im Schuhgeschäft. #Trend‚ #Schuhe«.
Anschließend tat er wie geheißen und schaute sich um: ein paar Schluchten aus Regalen, die Herrenschuhe etwas weiter links. Dorthin wollte er lieber nicht, denn die befanden sich direkt am Schaufenster, und hinter dem Schaufenster war die Straße, auf der sich die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange stauten und immer noch hupten. Immerhin, es schien langsam voranzugehen, aber zäh, als bewegten sich die Autos durch klebrigen Asphalt. Wildes Blinken, Gestikulieren, wütendes Hupen, es bereitete den Kraftfahrern einiges an Mühe, im eh schon stockenden Stauverkehr das Hindernis auf der Mittelspur zu umfahren.
Rechterhand noch mehr Damenschuhe, geradeaus eine massive Wand mit festem Schuhwerk. »Festes Schuhwerk«, das hatten die Lehrer immer vorm Wandertag gefordert. »Bitte festes Schuhwerk mitbringen.« Um nicht länger als Transvestit zu gelten, steuerte Eugen Thomas das Regal mit festem Schuhwerk an.
Bald darauf lugte die Verkäuferin um eine Regalecke, traute sich aber nicht, ihn anzusprechen, obschon er seit mehreren Minuten einen Wanderschuh in seinen Händen drehte und wendete.
»Vielleicht können Sie mir doch helfen«, sprach er die Verkäuferin an. »Passt der zu mir?«
»Besser als der rote Damenschuh eben. Wollen Sie wandern?«
»Ja«, sagte Eugen Thomas und wusste nicht, wieso. Das letzte Mal, dass er wandern war, war im Harz gewesen, mit der Schule. Klasse 7 oder 8. Was wird denn das hier gerade?, fragte er sich wieder. Dazu beschlich ihn das Gefühl, es würde nicht das letzte Mal sein, dass er sich diese Frage stellte.
Fünfzehn Minuten, zwei Twitter-Nachrichten, drei entgangene Anrufe, eine SMS und immer noch kein Facebook-Posting später stand Eugen Thomas wieder auf dem Gehweg vor der kleinen Mall, in der Hand eine Einkaufstüte vom Schuhdiscounter. Darin ein Paar Wanderschuhe, von denen er nicht wusste, ob er sie jemals benötigen würde.
Das Verkehrschaos dauerte an. Die Fahrer der Autos vor und hinter dem Leon hatten gemacht, dass sie weiterkamen, als die Chance dazu bestand. Verkehr muss fließen. Autos müssen rollen. Von Termin zu Termin. Hauptsache weiter, was kümmert mich ein parkender Pkw auf der Mittelspur, wenn ich erst einmal daran vorbei bin?
Von Eugens Spontanaktion zeugten also nur der Seat, der nach wie vor für Hupen und Geschrei sorgte, sowie zwei hilflos dreinschauende Polizisten. Einer musterte den Seat, als könne er sich nicht so recht zum Kauf entscheiden, der andere stand in der offenen Tür des Streifenwagens, sprach in sein Funkgerät und blockierte auf diese Weise auch noch die rechte Spur. Dreispurig auf einspurig. Auf den gegenüberliegenden Fahrstreifen ging es auch nicht recht voran, dafür sorgte die Neugier der Fahrer: Irgendwas geht dort drüben ab, bloß was?
Das fragte sich Eugen ebenfalls. Fasziniert betrachtete er das Schauspiel an der Kreuzung und hatte ein wenig Mitleid mit seinem schlummernden Seat.
Ich muss hier weg, dachte sich Eugen Thomas und schaute sich um. Ich könnte auch ein wenig durch die Straßen stöbern, mich zwischen den Schaufenstern in aller Ruhe umsehen, dachte er. Dann sah er direkt an der Kreuzung das Schaufenster eines Reisebüros: »Depart Reiseagentur«.
Er wartete, bis die Fußgängerampel Grün zeigte. Das tat er sonst nicht, der Verkehr staute sich ja eh, er ging oft bei Rot. Aber die Anwesenheit der zwei schwitzenden Polizisten auf der Kreuzung flößte ihm etwas Respekt ein, zumal sie längst wissen dürften, wer der Halter des verlassenen Pkws auf der Mittelspur war.
Eugen betrachtete nur kurz die Angebote im Schaufenster des Reisebüros – Ibiza, Malle, Kanaren, AIDA und immer wieder Kos – und trat ein. Er war der einzige Kunde.
»Womit kann ich dienen?«, fragte eine junge Angestellte mit solariumgebräunter Haut. Vermutlich muss man so aussehen, wenn man in einem Reisebüro arbeitet, überlegte Eugen Thomas.
»Ich möchte eine Reise buchen«, sagte er.
»Wohin?«
Wohin eigentlich? Gute Frage.
»Setzen Sie sich doch.«
Eugen Thomas setzte sich und stellte die kleine Tasche mit seinen Unterlagen neben sich an den Stuhl. Er nahm die Tragetasche mit dem Schuhkarton auf den Schoß, stützte seine Ellbogen darauf ab und ignorierte das Klingeln des iPhones. Es war inzwischen sowieso viel zu spät für seinen Termin.
Wohin? Wo will ich eigentlich hin?
»Können Sie etwas empfehlen?«, hörte er sich fragen. Eine Frage, die man im Reisebüro eigentlich nicht stellte. Glaubte er zumindest. Er kannte sie eher aus Restaurants. Aber er hatte seit sicher zehn Jahren kein Reisebüro mehr betreten, immer nur online gebucht.
»Na ja, Mallorca wird gern genommen. Lanzarote hätte ich noch im Angebot. Oder Surfurlaub auf Fuerteventura, wird auch viel gebucht derzeit. Bei Ihnen könnte ich mir auch vorstellen, dass Sie so der Thailand-Typ sind.«
Eben noch Transvestit, jetzt schon Thailand-Typ. Wo sollte das noch hinführen? Hielt sie ihn etwa für einen Sextouristen?
Ich sollte Souveränität zeigen, befand Eugen Thomas. Das kann ich doch gut im Job. Souverän sein, alles in der Hand haben, Entscheidungen treffen, ans Telefon gehen, wenn es klingelt. Knackige Facebook-Botschaften posten. Dinge per Twitter auf den Punkt bringen. Social-Media-Kompetenz zeigen, Imagepflege betreiben. So ein Typ war er!
Woran machte sie fest, dass er »der Thailand-Typ« war? Am Runtergucken auf die Schuhspitzen, als hätten die Antworten für ihn? Doch da fiel sein Blick auf die Plastiktüte aus dem Schuhdiscounter auf seinen Knien. Sie gab Eugen Thomas eine unverhoffte Antwort.
»Reno«, las er ab und sprach es englisch aus: »Ich will nach Reno.«
»Wo liegt das?«, fragte die Reiseberaterin.
»USA, glaube ich«, sagte Eugen Thomas und hoffte, dass ihn seine Erinnerung nicht trog.
Die Frau schaute eh schon seltsam genug. Sie tippte die vier Buchstaben in ihren Computer ein.
»Aha, Tatsache. Da habe ich’s: Reno-Tahoe International Airport – in Nevada, richtig?«
»Ja, genau«, antwortete Eugen Thomas. Sein Blick fiel abermals auf die RENO-Tüte, verschämt stellte er sie auf den Boden.
»›Tahoe‹ sagt mir was. Das ist ein Bergsee dort … in den … Bergen. Sierra Nevada, glaub ich. Soll sehr schön sein. Großes Wintersportgebiet, im Sommer kann man da sicher gut wandern. Wandern Sie?«
»Ja«, sagte Eugen, »hab gerade noch neue Wanderschuhe gekauft.« Das trifft sich ja gut, fügte er in Gedanken hinzu.
»Wann wollen Sie denn fliegen?«
Gute Frage.
»Geht schon morgen?«
Die Solariumskauffrau gab überrascht ein pfeifendes Geräusch ab, sie wusste nicht, ob sie ihren Kunden für voll nehmen sollte. Eugen entschied sich, iPhone und Kreditkarte auf den Schreibtisch zu legen. Es war nicht erkennbar, ob sie davon Notiz nahm, doch sie tippte eifrig drauflos.
Während sie, sichtlich angestrengt, nach Flügen suchte, fegte mit einem Mal ein kleiner Luftstoß und mit ihm der Klang einer Autohupe ins Reisebüro. Ein Polizist stand vor der Glastür, die sich hinter ihm langsam wieder schloss.
»Entschuldigung«, hob er gegen das Hupen von draußen an. »Wir suchen den Halter eines regelwidrig abgestellten Kraftfahrzeugs. Ist der zufällig hier?« Er schaute auf einen Notizzettel: »Ein Herr … Thomas Eugen.«
Eugen Thomas schüttelte den Kopf und schaute auf den Schreibtisch. Viel mehr als die Tatsache, gerade namentlich gesucht zu werden, wunderte er sich über den verdrehten Namen. Vermutlich hatte die Zulassungsstelle dem Polizisten erst den Nachnamen, dann den Vornamen durchs Telefon diktiert und der hatte das Komma dazwischen nicht mitnotiert.
»Ich bin’s nicht«, sagte die Reiseverkehrskauffrau.
»Ich auch nicht«, sagte Eugen Thomas und dachte: Genau genommen stimmt das ja auch. Who the fuck is Thomas Eugen?
»Na dann. Entschuldigen Sie die Störung«, sagte der Polizist. »Ich muss dann wieder. Da kommt auch schon der Abschleppdienst.«
Eugen kam nicht umhin, dem Polizisten hinterherzuschauen. Draußen blinkten die orangefarbenen Lichter eines Abschleppwagens, der sich durch den Stau zur mittleren Spur arbeitete und nun auch noch die letzte Spur blockierte. Armer Leon, durchfuhr es Eugen, wohin wird man dich bringen?
»Über Frankfurt, Charlotte und Phoenix habe ich einen Flug mit Abflug morgen, dreiundzwanzig Stunden mit langen Aufenthalten und dreimal Umsteigen, hauptsächlich US Airways, für tausendsechshundert Euro. Rückflug in zwei Wochen auf ähnlichem Weg, allerdings ’ne halbe Stunde schneller. Alles andere ist noch teurer.«
»Klingt doch gut«, sagte Eugen. Klingt furchtbar, dachte er. »Bitte buchen Sie den für mich.«
»Dann bräuchte ich noch Kreditkarte und Personalausweis. Sie müssten dann sofort, wenn Sie zu Hause sind, das Online-Einreiseformular der USA ausfüllen …«
»Mach ich, kenn ich.« Im letzten Frühjahr war er mit Sybille einmal für ein verlängertes Wochenende in New York gewesen. Verdammt, Bille. Wie sollte er ihr das alles erklären?
»Reisepass haben Sie?«
»Ja.«
Als sie seinen Namen eingab, schaute die Solariumsfrau irritiert auf und blickte Eugen Thomas direkt ins Gesicht. Der zuckte nur einmal mit den Schultern. Sie gab sich damit zufrieden.
Am Abend saß Eugen Thomas zu Hause in seiner kleinen Loftwohnung und schaute auf das Flugticket. »Reisender: Mr. Thomas Eugen« stand da.
2. Loft
»Leiden Sie an einer ansteckenden Krankheit, an einer körperlichen oder geistigen Störung, oder betreiben Sie Drogenmissbrauch oder sind drogenabhängig?«
Schon bei der ersten Frage des ESTA-Webformulars geriet Eugen ins Stocken. Vor seiner letzten USA-Reise hatte er einfach überall »Nein« angeklickt und die Einreisegenehmigung problemlos ergattert. Dieses Mal war er sich hinsichtlich der geistigen Gestörtheit nicht ganz sicher.
Schließlich hatte er gerade so etwas wie einen Nervenzusammenbruch gehabt, oder hatte ihn noch. Es fühlte sich zwar nicht so an, aber sein geliebter Seat Leon stand vermutlich gerade auf irgendeinem Autohof, demnächst würde eine horrende Abschlepprechnung ins Haus flattern. Dazu ein ordentlicher Bußgeldbescheid. Da traf es sich doch nur zu gut, dass er gerade seinen Job aufs Spiel setzte.
Eugen hatte seine Kreuzberger Loftwohnung bei seiner Rückkehr verflucht: Statt erst einmal in eine schummrige Flurhöhle einzusteigen, hatte man sofort alles im Blick. Zum Beispiel den Anrufbeantworter, ein letztes Relikt aus den Anfängen des Digitalzeitalters, das hysterisch blinkte. So aufdringlich verhielt er sich sonst nur, wenn er Geburtstage von Familienmitgliedern vergessen hatte und seine Mutter versuchte, ihn zu erreichen. Sollte er twittern?, hatte er sich gefragt. »Hilfe, mein Anrufbeantworter hat Kammerflimmern!« Oder: »Aufreger des Tages: hyperaktive Anrufbeantworter.« Oder: »Gefühl des Abends: Sehnsucht nach Flurhöhle.« Ergänzt um die Tags »#Flurarchitektur #Nervenzusammenbruch« und vielleicht noch »#Gebärmutter«. Ja, das wär’s!, hatte Eugen gedacht und dabei grinsend im Flur gestanden. Aber womöglich würden ihm seine besorgten Follower schneller die Männer in weißen Kitteln auf den Hals schicken, als er in seinem Flieger war. Wie sollte er denen in seinem Sechzig-Quadratmeter-Loft entkommen? Also hatte er nur getippt: »In einem Loft kann man sich nicht verstecken« und abgeschickt.
Die Anrufe auf dem AB waren nicht von seiner Mutter. Die Anruferliste des Telefons hatte hingegen mehrfach die Nummer seiner Agentur gezeigt. Erstaunlich, er hatte nicht einmal gewusst, dass man dort seine Festnetznummer kannte. Die Kollegen riefen sonst nur auf seinem Mobiltelefon an. Vielleicht hatten sie die Nummer gegoogelt. Oder die Auskunft angerufen. Selbst Lucas Kerns persönliche Nummer hatte sich auf dem Display gezeigt. Anscheinend vermisste man ihn tatsächlich. Verdammt, was machte er hier gerade?
»Leiden Sie an einer geistigen Störung?«
Nervenzusammenbruch. Im Schuhgeschäft und Reisebüro hatte sich das noch total aufregend angefühlt. Hier zu Hause nicht mehr. Hier zu Hause brauchte er etwas zu trinken.
Aber was? Eugen trank daheim nur selten Alkohol. Sein Weinregal war seit dem letzten Abendessen mit Sybille leer, da hatten sie die letzte Flasche geleert. Bier hatte er so gut wie nie im Haus, in Clubs und Cocktailbars trank er am liebsten Gin Tonic. War da nicht noch …?
Tatsächlich! Im Kühlschrank war noch eine angebrochene Flasche Gin. Wie lange stand die da schon? Wann hatte er hier die letzte Party gefeiert? Egal. Gin wird nicht schlecht, dachte er. Auch ein schöner Twitter-Satz. Aber man soll’s ja nicht übertreiben.
Nur Tonic Water fand Eugen nicht, dafür ein Sixpack Bionade Litschi, das Sybille mal angeschleppt haben musste. Er mixte beides zusammen und fand im Eisfach sogar Eiswürfel.
Dann hatte er eine Idee und das iPhone schon wieder in der Hand, der Satz musste einfach raus. Dann übertreibe ich’s halt doch, außerdem passt Übertreibung ganz gut zu meinem Zustand, dachte Eugen.
Twittereintrag: »Bionade ist das neue Tonic. Trendgetränk des Tages: Gin Litschi.«
Die ersten Follower kommentierten via Facebook prompt: »Santé!«, »Uargh!« und »Probier mal Bier mit Tomatensaft«. Nur eine Kollegin aus der Agentur postete: »WO WARST DU???? HIER IST DIE HÖLLE LOS!«
Den ersten Gin Litschi trank Eugen noch vor der geöffneten Kühlschranktür. Den zweiten ebenfalls. Den dritten nahm er mit zurück zum Schreibtisch. Eugen ließ die Eiswürfel im Glas klimpernd ein paar Runden drehen.
»Betreiben Sie Drogenmissbrauch?«
Das klang nach dem Ausüben eines kleinen Gewerbes. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie so in Ihrem Drogenmissbrauchsbetrieb? Kann man davon leben? Nein, nein, würde Eugen Thomas entgegnen, das ist eine freiberufliche Tätigkeit – oder highberuflich, wenn Sie verstehen, was ich meine … Er kicherte, der Gin schien schneller zu wirken als gedacht. Er kicherte sonst nie. Das klingt tatsächlich ein wenig irre, musste er sich eingestehen, offenbar bin ich schon unzurechnungsfähig. Also konnte es auf die Frage nach der geistigen Störung nur eine Antwort geben: Nein.
Eugen Thomas klickte sich durch die weiteren sechs Fragen.
Er hatte nicht vor, »zum Zweck krimineller oder sittenwidriger Handlungen einzureisen«. Vielleicht war seine Ausreise sittenwidrig. Alles stehen und liegen lassen, das macht man doch nicht!, würde seine Mutter sagen. Und wenn jemand etwas über Sitten wusste, dann waren es Mütter. Egal, er war nicht zurechnungsfähig und trank noch einen Schluck.
Nächste Frage (lag es schon am Alkohol oder vervielfältigte sich die Zahl der »oder« in dem ESTA-Formular von selbst? Sieben »oder« zählte Eugen in der sittenwidrigen Kriminellenfrage. Fünf »oder« in der nächsten Frage): »Waren Sie jemals oder sind Sie gegenwärtig an Spionage- oder Sabotageakten, an terroristischen Aktivitäten oder an Völkermord beteiligt, oder waren Sie zwischen 1933 und 1945 in irgendeiner Weise an Verfolgungsmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Naziregime oder dessen Verbündeten beteiligt?«
Hier musste man wohl »Ja« ankreuzen, wenn man Islamist, Nazi oder Hitlers persönlicher Leibtaliban war.
Eugen klickte sich mit »Nein« durch die nächsten absurden Fragen und formulierte dabei an seiner eigenen Fragestellung herum, die er auch sogleich bei Facebook reinstellte:
»Haben Sie jemals ein Auto auf einer viel befahrenen Straße stehen lassen oder beabsichtigen Sie dies zu tun, oder haben Sie ein Flugticket für die Sierra Nevada gebucht oder wissen Sie nicht, wo das liegt und fliegen trotzdem, oder sind Sie im Besitz von festem Schuhwerk oder roten Stilettos? Ja/Nein.«
Am Ende musste er noch vierzehn Dollar Bearbeitungsgebühr per Kreditkarte bezahlen: Vierzehn Dollar für vierundzwanzig »oder«, das machte knapp sechzig Cent pro »oder«. Eine teure Konjunktion.
Ein Chatfenster bei Facebook ploppte auf.
Billes Visagenfibel: »hi, was ist los bei dir?«
Natürlich hatte Sybille nicht ihren Nachnamen angegeben, Datenschutz und so. Sie hegte eine ausgeprägte Skepsis gegenüber jedweden und insbesondere US-amerikanischen Internetangeboten, vermutlich zu Recht. Ihr »Visagenfibel« fand Eugen trotzdem albern bis peinlich.
Man soll seine Lebensgefährtin nicht albern und peinlich finden, mahnte Mama Thomas in seinem Kopf.
Eugen Thomas: »hi bille, alles bestens, alles okay.«
Billes Visagenfibel: »was sind das für komische postings von dir?«
Was konnte sie wissen? Eugen überschlug kurz. Erst war er froh, dass sie nicht twitterte, dann fiel ihm bei einem Blick auf den Bildschirm ein, dass er sämtliche sozialen Netzwerke, soweit möglich, miteinander verlinkt hatte. Sie hatte also auch bei Facebook alle Twittereinträge lesen können.
Eugen Thomas: »war heute etwas gestresst. muss mal ein paar tage raus.«
Billes Visagenfibel: »geht das so einfach?«
Eugen Thomas: »nee, aber ich mach’s einfach. fliege morgen los.«
Billes Visagenfibel: »wir wollten doch demnächst gemeinsam urlaub machen!«
Eugen Thomas: »wollten wir, aber eigentlich wollen wir nur immer.«
Billes Visagenfibel: »weiß eben noch nicht, wann ich hier mal loskomme. kriegste denn demnächst noch urlaub, wenn du jetzt welchen nimmst? bei euch ist doch auch immer die hölle los.«
Wie wahr, dachte Eugen, heute erst recht. Mein Anrufbeantworter hat es mir verraten.
Eugen Thomas: »ich nehm ja auch gar keinen urlaub.«
Billes Visagenfibel: »bist du wahnsinnig?? dein chef hat versucht, mich zu erreichen. MICH!! woher hat der meine nummer?!«
Eugen Thomas: »und?«
Billes Visagenfibel: »hab gesagt, dass ich auf einem ngo-kongress in amsterdam bin und keine ahnung hab, was du grad treibst.«
Eugen Thomas: »hihi!«
Billes Visagenfibel: »bist du betrunken?«
Eugen Thomas: »nur’n paar gin litschi.«
Es dauerte, bis eine Antwort kam. Das kleine Symbol im Chatfenster zeigte an, dass Sybille tippte. Aber sie tippte verdammt lange. Das Posting war dann überraschend kurz. Offenbar hatte sie es mehrfach neu formuliert.
Billes Visagenfibel: »eugen, was ist los? soll ich anrufen …?«
Eugen Thomas: »nee, lass mal. ich liebe dich.«
Billes Visagenfibel: »ich ruf an! mom.«
Kurz darauf klingelte sein iPhone. Es lag irgendwo in der Küche. Eugen ließ es klingeln.
Eugen Thomas: »mach dir keine sorgen, kleine. will grad nicht telefonieren. melde mich, sobald ich in reno bin. hab alles im griff. ehrlich.«
Billes Visagenfibel: »das macht aber nicht den eindruck. dein chef ist unberechenbar, dem kannste mit so einer aktion nicht kommen!!!«
Eugen Thomas: »hab noch ne schöne zeit in amsterdam. kuss, eu.«
Sein MacBook brauchte nur wenige Momente, dann war es heruntergefahren. Das Telefon klingelte noch ein paar Mal, aber Eugen ging ins Bad und nahm sein Glas mit. Beim Pinkeln, genussvoll im Stehen, schließlich würde seine Freundin in den nächsten Tagen nicht zu Besuch kommen, stellte er den Gin Litschi neben dem Zahnputzbecher ab und vergaß ihn dort.
3. Border Protection
Die Schlange vor den Schaltern der US Customs and Border Protection beim Umsteigen in Charlotte war nicht so lang wie befürchtet. Nur eine knappe Viertelstunde schlängelte sich Eugen Thomas durch ein Labyrinth aus Absperrbändern und Plastikpylonen. Der Raum war groß, flach und tageslichtlos und befand sich irgendwo in den Katakomben des Flughafens.
Der diensthabende Border-Protector sah aus wie der verfressene Zwillingsbruder von Barack Obama. Dieselben kurzen, grau melierten Haare, dieselben Segelohren, dieselben scharfen Falten um den Mund. Nur eben deutlich unsportlicher. Vermutlich weil er tagtäglich an einem einer Registrierkasse nicht unähnlichen Schalter saß, nur dass hier nicht Käse, Klopapier und Würstchen über den Scanner gezogen wurden, sondern einreisende Wurstfinger.Während Eugen seine Eindrücke noch auf ihre Twittertauglichkeit abcheckte, tastete er seine Taschen schon nach dem iPhone ab. Wo war es? Doch dann fiel ihm ein, dass es hier im Grenzschutzbereich, wo Fotografieren verboten war, aber Hunderte von Kameras an der Decke hingen, nicht ratsam war, dabei gefilmt zu werden, wie man verräterische Botschaften in die Welt postete.
»Wie war Ihr Flug?«, fragte das Obama-Grenzschutzdouble.
»Gut«, sagte Eugen Thomas und schob seinen Pass und das ESTA-Formular zu dem Beamten rüber. Hoffentlich wollte er nicht auch noch das Ticket sehen.
Mit kurzem Erschrecken dachte er an den Vormittag am Flughafen Tegel zurück. Er war mit dem Taxi und auf den letzten Drücker am Flughafen angekommen und hatte das Gebäude in dem Moment betreten, als man ihn das erste Mal ausrief: »Mr. Thomas Eugen wird gebeten, zum Flugsteig A7 zu kommen …«
Das war alles so nicht geplant gewesen. Doch Eugen hatte verschlafen – und Kopfschmerzen. Der Gin Litschi war schuld. Davon hatte er sich noch ein paar gegönnt, während er wahllos Klamotten und Reisebedarf in seinen Koffer warf. Irgendwann war er todmüde ins Bett gefallen, es war weit nach zwei, und die Bionade-Flaschen waren allesamt leer. Die Gin-Flasche ebenfalls. Am Morgen fand Eugen seine Zahnbürste in einem halb vollen Glas Gin Litschi vor und wusste nicht, wieso. Er hatte sie so stehen lassen, keine Zeit zum Aufräumen.
Die Frau beim Check-in schaute in seinen Reisepass, auf sein Ticket, dann wieder in seinen Reisepass, auf das Foto und dann wieder auf ihn.
»Das Ticket ist nicht auf Ihren Namen ausgestellt.«
»Ist es schon.«
»Ist es nicht. Es fliegt ein Thomas Eugen, aber Sie sind Eugen Thomas.«
Eugen entschied, sich dumm zu stellen.
»Wie?! Was?!«, heuchelte er Erstaunen. »Das kann doch gar nicht sein!«
Sie zeigte ihm sein Ticket und auch noch den Namen in seinem Reisepass, für den Fall, dass er ihn vergessen haben sollte.
»Wie kann denn so was passieren?«, entrüstete sich Eugen Thomas. »Da hat die Frau im Reisebüro wohl etwas durcheinandergebracht.«
»Da müssten Sie jetzt noch mal ins Reisebüro und das reklamieren.«
»Aber der Flug geht doch in ’ner halben Stunde!«
»Den kriegen Sie dann natürlich nicht mehr. Aber das Reisebüro muss Ihnen den Preis erstatten.«
»Aber … aber …«
Was »aber«?, fragte sich Eugen Thomas. Wenn er jetzt nicht in dieses Flugzeug einsteigen würde, wären eintausendsechshundert Euro weg. Natürlich würde er nicht ins Reisebüro gehen und seine irrsinnige Aktion formal korrigieren. Das machte man nicht. Stattdessen könnte er in die Agentur fahren, es würde etwas Ärger geben, aber in drei Stunden könnte er am Schreibtisch sitzen, spätestens um Mitternacht hätte er alles aufgearbeitet, was er in den letzten zwanzig Stunden verbockt hatte. Sein Leben ginge weiter wie bisher. Der ganze schöne Nervenzusammenbruch für die Katz.
»Aber … das geht nicht!«, rief Eugen und seine Stimme klang für ihn selbst überraschend panisch. »Ich muss da rüber! Es geht … es geht …« Er entschloss sich, schwere Geschütze aufzufahren: »Es geht um Leben und Tod.«
»Wie bitte?«
»Hören Sie. Ich muss heute fliegen. Mein Bruder liegt im Sterben … Gestern bekam ich den Anruf. Sie sehen ja, ich hab das Ticket erst gestern gebucht.«
»Oh, äh … das … tut mir leid«, die Airline-Angestellte verlor ihr professionelles Gesicht. »Und da fahren Sie für zwei Wochen rüber …?«
»Ja, natürlich. Da wird viel zu klären sein, die Beisetzung, vielleicht auch Überführung, Testament, das Haus, all dieser Behördenkram. Ich kann meine Schwägerin damit doch nicht allein lassen, wo sie doch selbst im Rollstuhl sitzt …«
Verdammt, jetzt übertreib ich’s, dachte Eugen.
»Oh.«
»Hören Sie …«, Eugen schaute flehentlich und dankte dem Gin-Litschi-Exzess des gestrigen Abends, dessen Nachwirkungen in seinem Gesicht man auch als Trauer und tiefe Sorge interpretieren konnte.
Ein Telefon klingelte, die Frau vom Check-in nahm ab und sagte: »Ja, ist inzwischen da, aber wir haben hier noch ein Problem mit dem Ticket. Ja … Jaaaa … Ja, Vorname und Nachname vertauscht offensichtlich.«
Eugen beugte sich vor: »Hören Sie, das Geburtsdatum ist dasselbe, Geburtsort passt. Das Ticket von Thomas Eugen ist mit der Kreditkarte von Eugen Thomas bezahlt. Wo ist das Problem? Machen Sie einfach zwei Pfeile aufs Ticket!«
Die Frau war überfordert. Hektisch schaute sie zwischen Eugen und ihrem PC-Bildschirm hin und her, der Mensch im Telefonhörer quäkte ungeduldig. Dann sagte sie: »Ich schick ihn jetzt in die Sicherheitskontrolle, er ist gleich bei euch.«
Sie reichte ihm die Bordkarten für die Flüge und band den Streifen mit den vielen Großbuchstaben TXL-FRA-CLT-PHX-RNO darum: »Ihr Gepäck müssten Sie mitnehmen und vorne am Einstieg abgeben. Es wird dann noch schnell mit eingeladen. Guten Flug und öhm … alles Gute mit Ihrem Bruder und so … Hoffentlich kriegen Sie keine weiteren Probleme wegen des Namens.«
Auf den Bordkarten stand »Eugen/Thomas«, doch das weitere Boarding war problemlos verlaufen. Auf der Ticket-Quittung selbst hatte die Hostess vom Schalter tatsächlich zwei Pfeile bei den Namen und irgendetwas Unleserliches daneben gekritzelt und abgezeichnet.
Der Mann von der Einreisekasse fragte nicht nach seinem Ticket, aber nach seinem Beruf. Eugen Thomas überlegte, ob er die Antwort »something with media« wohl gelten lassen würde.
Was machte er eigentlich? Derzeit koordinierte er eine Social-Media-Kampagne für Wurst, beziehungsweise sollte es eigentlich, doch als das gestrige Meeting stattfand, hatte er ja lieber Wanderschuhe gekauft.
Er arbeitete bei einer PR-Agentur, die meist im Auftrag von anderen PR-Agenturen besondere PR-Maßnahmen ersann, anleierte oder durchführte. »Social Media & Networking Coordination Manager« stand auf Eugens Visitenkarte. Sie hatte Querformat.
In ihrer Firma waren sie alle »Manager« für irgendwas, bis auf die Praktikanten, aber die hatten ja auch keine Visitenkarten. »Girl for everything« hätte auf seiner Karte ebenso gut stehen können, oder »Best Boy Manager«. Erster Assistent für alles Erdenkliche. Aber »Manager« gehörte halt dazu. kern | competence war ein junges Unternehmen, ein Start-up in der Medienbranche, und Eugens Chef, Lucas Kern, verfuhr gerne nach dem Geschäftsprinzip, möglichst viele Aufträge einzuwerben und sich erst in zweiter Linie darum zu kümmern, wie man ihrer Herr werden könnte. Solche lästigen Detailfragen überließ er lieber anderen, zum Beispiel Eugen.
So war dieser an die lästige Aufgabe geraten, Social-Media-Maßnahmen für die Quakenbrücker Wurstkonserven KG zu ersinnen. Nachdem es irgendeiner geschickten Werbeagentur Anfang des dritten Jahrtausends mal gelungen war, einen muffigen Kräuterlikör zu einem clubtauglichen Trendgetränk aufzuwerten, gab es andauernd ähnliche Versuche. Offenbar hatte der Juniorchef der Wurstkonserven dem besagten Likör ein paarmal zu oft zugesprochen oder bei seinem BWL-Studium in Berlin die Clublandschaft einmal zu oft durchstreift und beim Anblick all der lang- und dünnbeinigen Elektro-Hipster ein Déjà-vu gehabt. Zu Hause in Quakenbrück wurde prompt das Knackwürstchen HIPSTER ersonnen (»Zwei Stück im praktischen SlimTwin-Glas mit Kronkorken!«), es wurde eine Tochterfirma namens »QB Wurstmanufaktur« gegründet und ein kostengünstiges Berliner PR-Start-up beauftragt, das neue Produkt irgendwie zu vermarkten. kern | competence sollte zusätzlich irgendwas mit Social Media und Internet machen, denn der Würstchen-Junior und frisch gebrühte QB-Manufaktur-Chef hatte leider Gottes auch ein Facebook-Profil.
Sybille war alles andere als begeistert gewesen. Sie arbeitete als Pressereferentin bei einem Umweltverband und war überzeugte Vegetarierin. Wie auffallend viele junge Hipster heutzutage, Eugen Thomas hatte dies in einem Briefing seines Chefs vorsichtig angemerkt. Lucas Kern nahm den Einwand geschickt auf, gab ihm recht, betonte dann aber, genau das müsse Ziel der Kampagne sein, die Wurst einfach losgelöst von ihren Fleischskills zu betrachten.
»Wir könnten dem Fleisch vielleicht Amphetamine beimischen. Dann hätten wir in den Technoclubs sicher ’ne Chance«, hatte Eugen gewitzelt, aber Lucas Kern widersprach, das lasse das Lebensmittelrecht leider nicht zu. Aber es müsse doch möglich sein, in den Clubs auch traditionelle Wurstwaren feilzubieten, wenn sogar Kräuterlikör an den juvenilen Konsumenten gebracht werde. Schließlich hätten die großen Clubs schon eigene Pizzabäcker und Burgerbrater, das Berghain gar eine Eisdiele. Hunger gehöre zu einer durchtanzten Nacht dazu. Wieso nicht Quakenbrücker Wurstwaren?
Eugen dachte an seinen letzten Besuch im Berghain und versuchte sich vorzustellen, wie die verstrahlten Hipster auf Bockwürstchen mit Kronkorkenverschluss reagieren würden. Verdammt! Er konnte es sich tatsächlich vorstellen: Vegetarismus hin oder her, die meisten waren ab fünf Uhr morgens eh in einem Zustand, in dem fleischliche Skills keine Rolle mehr spielten oder gleich im Darkroom ausgelebt wurden.
Sybille hatte er auch im Berghain kennengelernt, manchmal schämte sich Eugen dafür. Ausgerechnet im angesagtesten Club der Hauptstadt. Er: gerade Praktikum in einer Werbeagentur (unbezahlt). Sie … Was hatte sie noch mal gemacht? Jobbte sie da schon bei den Umweltleuten? Egal, sie machte also auch irgendwas typisch Hauptstädtisches. Ihre Beziehung hatte so albern urban begonnen, zugedröhnt mit Berlin-Klischees. Gleichwohl war es ziemlich abgefahren: Uhrzeiten hatten in jener Nacht keine Rolle mehr gespielt, draußen war es sicherlich schon lange hell, ihm klebte das Hemd am Körper, ihr das weiße Top, ihre Jeans hing auf Hüfte, er war ihr beim Tanzen auf den Fuß getreten und sie, schon mehr als betrunken, hatte von ihm einen Drink als Entschädigung gefordert. Dann standen sie oben an der Balustrade und schauten hinab in die Tiefe, sie einen Wodka Energy in der Hand, er neben ihr, schon in einem Stadium, in welchem das Ecstasy in seinem Körper einen Höllendurst bekam …
Ersetze Wodka Energy und Wasserflasche durch HIPSTER im Glas mit Kronkorkenverschluss … – Nein.
Sie hatten runter ins Erdgeschoss gestarrt. Sybille hatte sich vorgelehnt, ihre schwarzen Haare, nass an den Spitzen, klebten in ihrem Nacken; und Eugen war so fasziniert von dem Schauspiel ihrer Schweißtropfen gewesen, die aus einer Falte ihres Tops herauskullerten und ein paar Zentimeter ihrer nackten Haut passierten, um dann vom Stoff ihrer eng anliegenden Jeans aufgefangen zu werden, dass er es gewagt hatte, einen Tropfen mit dem Finger abzufangen. Sie hatte ihn daraufhin angeschaut, gegrinst, dann hatte sie ihn geküsst. Und damit hatten sie die nächsten Stunden nur mal aufgehört, um zu ein paar Tracks zu tanzen. Später hatte sie ihn in den Darkroom gezogen, den bei der Tanzfläche, hinter den Boxen, es war höllisch laut, aber sie waren unter sich. Ihre Körper hatten gebebt, weil die Wand nicht stillstand. Der Bass fickte mit.
Danach hatten sie am Burgerstand jeweils einen Fleischklops verdrückt. Dort gestand sie ihm, dass sie eigentlich Vegetarierin sei.
Ersetze »Burger« und »Fleischklops« durch Bockwurst mit Kronkorkenverschluss … – Passt. Scheiße, es könnte wirklich funktionieren!
Anschließend hatten sie ihre Mobiltelefone aus den angeschwitzten Hosentaschen gefingert und ihre Nummern gespeichert. Romantische Begegnung im Smartphone-Zeitalter: Zwei Personen beliebigen Geschlechts stehen eng zueinandergebeugt, schreien sich Zahlen zu und vergleichen die Ziffernfolgen auf dem Display gegenüber.
Sie waren dann nicht zusammen nach Hause gegangen. Sie wollte nicht. Aber irgendwie war ja auch alles gesagt und alles getan. Und die Nacht schon lange vorbei. Die erste Message schrieb er noch in der U-Bahn nach Kreuzberg. »wiedersehen?«
Ihre Antwort kam erst am Abend: »ja gern, bin jetzt aber erst mal ne woche auf tagung. x, syb.«
»Ehm, mein Job?«, stammelte Eugen Richtung Border-Protector und rettete sich mit »PR-Agency«. Genau genommen ist mein Job gerade, trendbewusste Opinion Leader (Fußball, Techno, Poetry Slam) dazu zu überreden, an einer interaktiven Website namens »HIPSTER Blogwurst« teilzunehmen.
Dafür habe ich also mal Anglistik, Literaturwissenschaft und Soziologie studiert, dachte sich Eugen, um nun schnöde Bockwürstchen als »urbanes Food Erlebnis« zu vermarkten. »Blow-up Manager« sollte auf meiner Visitenkarte stehen.
Eugen war nach Twittern zumute. In Gedanken formulierte er schon seinen nächsten Eintrag: »Wurde gerade nach meinem Beruf gefragt. Korrekte Antwort: Ich bin Aufbläser. Ich blase Wurst auf.«
»Wie bitte?«, musste er rückfragen, denn der Grenzschützer hatte ihn schon wieder etwas gefragt.
Ob er aus Berlin sei.
Ja, sei er, antwortete Eugen.
»Great«, sagte der Grenzbeamte, er sei auch mal in Berlin gewesen, beziehungsweise ganz in der Nähe davon. »Mannheim, you know.«
»Yes, wonderful city«, erwiderte Eugen. »Absolutely like Berlin.«
Der Customs-and-Border-Mann schaute glücklich, machte das obligatorische Einreisefoto und bat Eugen dann, seine Finger auf den Fingerabdruck-Scanner zu legen.
Zwischendurch wurde er nach dem Zweck seiner Reise gefragt. Kurz überlegte Eugen, ob er zwecks Kohärenz bei der Version vom sterbenden Bruder bleiben sollte, befand aber, dass Uncle Sams Augen und Ohren nicht weit genug reichten, seine Notlüge am Check-in-Schalter in Berlin-Tegel aufgeschnappt zu haben.
Urlaub, Holiday. Verdammt, wie sagte man noch?
»Vacation. In der Sierra Nevada«, sagte Eugen.
»Wandern?«
»Ja, ist das so bekannt dafür?«
»Weiß nicht, war da noch nie«, sagte der Grenzer, »aber Sie tragen Wanderschuhe. Wie lautet Ihre erste Adresse in den Vereinigten Staaten?«
Eugen nannte ihm die Anschrift des Hotels, das er noch in der Nacht gebucht hatte, als auch im ESTA-Fragebogen nach einer Adresse gefragt wurde. Ein Casino-Hotel in Reno verramschte günstig ein paar Zimmer. Eugen durfte die Finger vom Scanner nehmen.
»Eldorado Hotel, 345 North Virginia Street«, sagte er.
»Eldorado«, sagte Obamas pummeliger Zwillingsbruder langsam und grinste genüsslich. »Wanderurlaub also. Soso.«
Wenn ich ihm jetzt die Zunge rausstrecke, dachte Eugen, könnte ich mich vielleicht damit rausreden, ihm nur eine Speichelprobe angeboten zu haben.
4. Phoenix Sky Harbor
Der Teppich am Phoenix Sky Harbor International Airport zeigte Flugzeuge. Hellgraue Flugzeuge, die aus einem dunkelbraunen Himmel in hellgraue konzentrische Kreise hineinflogen.
Eugen Thomas schaute seit einer Viertelstunde auf das Muster. Er hatte hier gute drei Stunden Aufenthalt, und je länger er auf das Muster schaute, umso mehr kam es ihm vor, als flögen die Boeings der Auslegeware direkt ins Auge eines stilisierten Hurrikans. Der alte Kampf: Technik gegen Natur. Hunderttausendfach, in Niederflurware geknüpft auf den Böden aller Flugsteige von Phoenix International.
Eugen war übernächtigt, er hatte kaum geschlafen im Flugzeug. Schon gar nicht auf dem letzten Flug von der Ostküste nach Phoenix. Gleißend hell war das Sonnenlicht gewesen, das durch die Fenster des Flugzeugs in die Kabine strahlte. Völlige Überbelichtung seiner müden Synapsen.
Er brauchte einen Kaffee. Starbucks gab es hier überall, an jedem einzelnen der vielen Flugsteige. Überall lange Schlangen. Eugen stellte sich an. Vor ihm stand ein Asiate mit Aktenkoffer. Die Bedienung, die die Bestellungen aufnahm, trug ein schwarzes Kopftuch, wie man es aus Kreuzberg kannte. Und das hier im Süden der USA, in Phoenix, am Flughafen. Eugen war überrascht. Offenbar waren die USA toleranter, als er angenommen hatte. Oder irgendwo um Phoenix herum gab es eine fundamentalchristliche Splittergruppe, in der Frauen Kopftücher zu tragen hatten. Holy Church of the Miraculous Covered Woman Maria Magdalena …
»Next!«, brüllte das Kopftuchmädchen.
Eugen bestellte einen »Coffee Latte«.
»Which size?«
»Tall.«
»Your name?«
»Eugen.«
»What?«
»Eu-gen.«
»Oi…«
Die Bedienung kritzelte irgendwas mit einem Edding auf einen Plastikbecher.
»I can spell it!«, erbot er sich, doch sie schrie schon wieder: »Next!«
Eugen wurde von der Schlange der Kaffeedurstigen zur Kollegin an der Kasse gedrückt und dann ausgespuckt auf den braunen Teppich mit den Hurrikan-Flugzeugen. Er setzte sich in einen der Wartesessel gegenüber dem Ausgabetresen und behielt den Asiaten mit dem Aktenkoffer im Blick: Wenn der sich seinen Kaffee abholte, würde er selbst hoffentlich der Nächste sein.
»Kevin«, brüllte die Frau an der Kaffeeausgabe. Der Asiate stand auf.
Eugen wunderte sich. Der Asiate konnte doch unmöglich Kevin heißen? Er hatte seinen Kaffee doch auch nur in gebrochenem Englisch bestellt. Das war doch kein US-Asiate!?
»Oi…«, schallte es von der Ausgabe her. »Oi… Oidsch… Oidschie.«
Eugen stand schnell auf und lief zur Kaffeeausgabe.
»Eugen«, sagte er, »that’s me. Eugen. Ih – ju – dschie …«
Die Bedienung schaute verständnislos erst ihn an und dann auf den Becher in ihrer Hand:
»Tall Coffee Latte?«
»Yes. That’s me. Thank you.«
»You’re welcome.« Sie schob ihm den Becher hin. »Tim! Carl! … and Betty!”
Eugen nahm den Kaffeebecher in die Hand, die Schrift mit dem Edding war kaum leserlich, aber sie begann eindeutig mit einem O, dann folgte ein i. »Oi.« Das danach sah sogar wie ein g aus. Der Rest bestand aus undefinierbaren Schlangenlinien.
Eugen setzte sich wieder und fotografierte den Becher mit seinem iPhone. Das musste er unbedingt gleich bei Facebook posten: »Call me Oidge. Oink Oink. Welches Schweinderl hätten S’ denn gern?«
Ihm gegenüber saß der Asiate. Er nippte an seinem Kaffee und schaute Eugen bei seiner Becherfotografie zu. Dabei grinste er schüchtern. Als er Eugens Blick bemerkte, räusperte er sich leise und erklärte mit starkem asiatischen Akzent: »He he. That’s why I say Kevin everytime.«
Eugen begriff. Dann lachte er und prostete dem Asiaten zu. Auch der hob seinen Becher.
So einfach ändert man also seine Identität, dachte er. Kein Amt, keine Formulare, keine gefälschten Personaldokumente aus mafiösen Hinterzimmern: Ein schnöder Kaffee in einer amerikanischen Kaffeehauskette reicht.
Eugen nickte dem Asiaten zum Abschied lächelnd zu, dann stand er auf und schlenderte erneut über die Auslegeflugzeuge des Airports. Er wanderte durch die langen Brückengebäude mit den Laufbändern, bei denen vollautomatisierte Männerstimmen bei jedem Betreten und Verlassen »Watch your step!« mahnten. Da zwei Laufbänder, je eins in jede Richtung, immer an denselben Stellen endeten und drei Meter weiter neue begannen, überlagerten sich an diesen Punkten vier »Watch your steps« gleichzeitig. »Watch your stWatch your Watch your steWatch Watch your step step Wa-wa-watch Watch«.
In diese Kakophonie hinein mischten sich die akustischen Piep-Signale all der kleinen Elektrokarren, in denen farbige Fahrer in gestärkten weißen Uniformen Übergewichtige oder Alte oder übergewichtige Alte von Gate zu Gate kutschierten. Ständig näherte sich von irgendwo ein permanentes Piepen, gefolgt vom so typischen Schnarren der Elektrokarren, von denen menschliches Sperrgut stoisch in die Gegend stierte.
Eugen bog ab in den Tunnel zum Flugsteig C, bald schon tauchten wieder die ersten Gates auf sowie der nächste Starbucks.
Seltsam, auch hier stand eine Muslimin mit Kopftuch hinter dem Tresen, allerdings diesmal an der Milchschäummaschine. Eugen stellte sich an und bestellte noch einen »Coffee Latte«.
Er hatte zwar keinen Durst, aber er wollte es wissen.
»Name?«, fragte die Frau, die seine Bestellung aufgenommen hatte.
»Thomas«, sagte Eugen mit englischer Betonung.
»Okay«, sagte die Frau und kritzelte »Tom« auf den Becher.