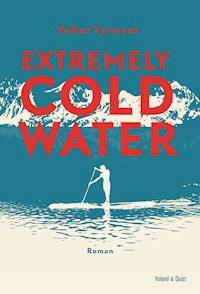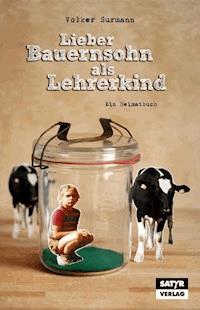
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Satyr Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Als Kind war er immer der Alien vom Planeten Acker. Auf dieses heimatliche Gestirn im System Teutoburger Wald kehrt der Berliner Satiriker, Lesebühnenautor und Gelegenheits-Slammer Volker Surmann nun zurück und geht dorthin, wo es wehtut: in seine eigene Landjugend. Nicht nur in der Schule fällt Volker zwischen Lehrerkindern, Anwaltssöhnen und Bausparkassenbezirksleitertöchtern unfreiwillig auf, auch zuhause auf dem Bauernhof gerät er in Schwierigkeiten: Seine Lieblingskuh wird heimtückisch ermordet, er versagt beim Treckerfahren kläglich und beschließt mit neun, lieber Schöngeist als Landwirt zu werden. Doch ist Volker bloß ein metrosexueller Großstädter, gefangen im Körper eines ostwestfälischen Bauernkinds? Mitnichten. Westfale bleibt man ein Leben lang. Den Planeten Acker verlässt man niemals ganz ... Ein trotziges Bekenntnis zur Heimat: autobiografisch, selbstironisch und mit sehr viel Humor. Ein Bauernsohn mit Heuschnupfen packt aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Surmann
Lieber Bauernsohn als Lehrerkind
Volker Surmann
LieberBauernsohnalsLehrerkind
Ein Heimatbuch
Volker Surmann
ist Autor, Kabarettist und Buchmacher und lebt als Exil-Ostwestfale in Ostberlin. Er ist Mitglied der Lesebühne »Brauseboys« und schrieb schon für diverse Fernsehcomedy-Produktionen. Aktuell ist er regelmäßig für die »Titanic«, das Kabarett »Die Stachelschweine« und das queere Hauptstadtmagazin »Siegessäule« tätig. Er gab zahlreiche Anthologien heraus, z.B. den Independent-Bestseller »Sex - Von Spaß war nie die Rede«. 2010 erschien sein erster Roman »Die Schwerelosigkeit der Flusspferde« (Querverlag). www.volkersurmann.de
E-Book basierend auf der 2. (um eine Fußnote erweiterte) Auflage Juni 2012
© Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin 2012www.satyr-verlag.de
Coverfoto: Paul BokowskiDruck und Bindung: AALEXX Buchproduktion GmbH, GroßburgwedelPrinted in Germany
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: http://dnb.d-nb.de
Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.
ISBN: 978-3-9814891-9-4
für meine Familie
Prolog
Siebzehn HektarKindheit
Ich wurde in den Siebzigerjahren geboren und bin auf einem Bauernhof im Teutoburger Wald groß geworden. Damit war vorherbestimmt, dass sich meine Kindheit zwischen Ackerbau, Frottee und Cordlatzhosen abspielen würde. Doch dafür hatte ich den »Teuto«, wie man ihn bei uns liebevoll nannte, direkt vor der Haustür. Kein virtuelles Fantasiespiel kann so weit sein wie er.1 Zu unserem Hof gehörte vergleichsweise wenig Land, aber es reichte: Mein Kinderzimmer maß siebzehn Hektar.
Sabine war meine Sandkastenfreundin. Sie wohnte auf dem Bauernhof nebenan. Wir spielten Hochzeit und bauten aus Pappkartons einen Altar im Kartoffelkeller. In der Verkleidungskiste fanden wir Kostüme für Braut und Bräutigam, nicht selten vertauschten wir die Rollen. Sabine war ein Jahr älter und machte sich als Mann ganz gut. Es gibt Fotografien, die, neben Sabine mit altem Zylinder in einem viel zu großen Frack, mich in einem weißen Brautkleid aus Wohnzimmergardinen zeigen. Manchmal frage ich mich, wie oft sich meine Eltern dieses Bild wohl nach meinem Coming-out angeschaut haben mögen.
Ich war der festen Überzeugung, dass Sabine und ich irgendwann auch in echt heiraten würden. Den ersten und bisher einzigen Heiratsantrag meines Lebens machte ich mit vier auf dem Hof von Sabines Eltern. Wir hatten wieder Hochzeit gespielt und standen verkleidet zwischen Klärgrube und Bullenstall.
»Nein«, hat sie gesagt und gelacht. Ich war am Boden zerstört, bin traurig nach Hause gelaufen. Als wenige Wochen später beim Spielen eines ihrer Kaninchenjungen durch mich zu Tode kam, war mir endgültig klar: Ich würde bei ihr nie eine Chance haben.
Marcus war Playmobil. Ich war Lego. Er war auch Geha und ich Pelikan, aber das war beim Spielen unwichtig. In der Pubertät bin ich eh auf Lamy umgestiegen.2
Marcus hatte sehr viel Playmobil in seinem Zimmer. Wenn wir bei ihm waren, spielten wir Überbevölkerung. Nicht, dass sein Zimmer so klein war. Er hatte einfach so viel Playmobil.
In unserer Science-Fiction-Fantasie wurde jeder, der sechsundzwanzig Jahre alt war, von der Regierung erschossen, weil kein Platz mehr im Land war. Sechsundzwanzig kam uns damals unglaublich alt vor.
Ich habe Marcus aus den Augen verloren. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch lebt, schließlich hat er die sechsundzwanzig auch schon deutlich überschritten.
Wenn wir draußen waren, spielten Marcus und ich gerne Flutkatastrophe. Unten in der Wiese stauten wir den Bach auf. Er kam dort aus einer Röhre unter der Straße her; danach weitete sich sein Bett auf wenigen Metern. Wo es wieder schmaler wurde, stand unser Damm. Errichtet aus Grasbüscheln, die wir aus der Wiese rissen, Holz, Steinen und Lehm und in Eile unter der ständigen Angst, jeden Moment das halbfertige Bauwerk wegfließen zu sehen. Das Wasser staute sich hoch, bis auch eine kleine Kiesinsel bedeckt war. Im Bachbett hinter dem Damm floss dann kaum noch Wasser, und wir hatten Angst davor, in der kleinen Stadt zwei Kilometer bachabwärts würde man das bemerken und die Polizei zu uns raufschicken. Doch schon drängte zu viel Wasser nach, alles Laufen, Verstärken, Halten und Schreien nützte nichts mehr, der Damm brach, und eine Flutwelle rollte auf das Städtchen zu, wo sie vermutlich nicht einmal bemerkt wurde. Dafür war das Wasser in unsere Gummistiefel geschwappt, die dann beim Laufen ulkig glucksten.
Wir unternahmen Bachwanderungen – auch durch die große Röhre unter der Umgehungsstraße hindurch, wo die Stimme beim Schreien so hohl hallte – zu dem Punkt, wo der Bach die Betontreppe nahm und im begradigten Bett auf die Stadt zuschoss. Nur einmal sind wir weiter gewandert. Es war langweilig.
Auf dem Rückweg dann stolperten wir die steile Böschung entlang, die uns, ohne dass wir es konkret vorgehabt hätten, zu dem halb vom Laub verdeckten Stolleneingang brachte, um den sich unsere Fantasien rankten wie um das All und den Mond, den wir manchmal nachts durch Marcus’ kleines Teleskop betrachteten.
Wir wussten: Früher hatte man hier Kohle gesucht und wohl auch ein bisschen gefunden. Dann aber hat man die Stollen sich selbst, dem Kalkstein und dem eindringenden Moderwasser überlassen, ohne sie vor uns zu sichern.
So standen wir vor einem Geheimnis, das Räume für dunkle Gedanken und Ängste öffnete und dessen Eingang hier, rundgemauert aus Backstein, vor uns im Laub lag. Der ganze Berg sei von Stollen durchgraben; in den Labyrinthen würden wir uns schneller verirren, als wir dächten. Mit schwachen Taschenlampen in das dunkle Loch hinabsteigen, hieße, Gefahr zu suchen, mit Sicherheit abzustürzen in Abgründe, die man in der Dunkelheit nicht mal erahnen konnte. Und bestimmt wartete irgendwo das Skelett eines abgestürzten Grubenarbeiters auf unsere zerschlagenen Knochen.
Unsere offene Frage war: Bestand eine Verbindung zwischen dem Stollen und der Höhle im nahe gelegenen Steinbruch? Auch in sie trauten wir uns nie tiefer als drei Meter hinein; dann senkte sich der Boden nach unten ab und das Tageslicht versteckte sich hinter dem Felsüberhang und ließ uns im Dämmerlicht Hineingegangenen in der Nacht des Steins allein.
Ein Höhlenforscher sei einmal mit seinem Jungen dort abgestiegen und nie wieder aufgetaucht.3 Vielleicht liegen ihre sich langsam auflösenden Gebeine in der fantastischen, riesigen Tropfsteinhöhle, die wir uns nie zu entdecken trauten.
Heute weiß ich, dass der vermeintliche Stollen wohl nur zu den unterirdischen Gebäudeteilen eines längst abgerissenen Kalkwerks gehörte. Jules Vernes »Reise zum Mittelpunkt der Erde« habe ich erst zwei Jahre später gelesen – mit großem Interesse; danach aber nie wieder. Noch immer steht es irgendwo in meinem Regal – ein billiges Taschenbuch, das mit den Jahren verstaubt.
Jan und ich haben dagegen Radio gespielt. Das konnten wir immer nur bei ihm spielen, denn Jan hatte einen Kassettenrecorder und ich nicht. Stundenlang haben wir uns in seinem Zimmer eingeschlossen und Radiosendungen aufgenommen. Grundsätzlich waren dabei die Rollläden unten. Aber wir dachten, da man beim Radio ja nichts sieht, muss es im Studio auch dunkel sein.
Noch heute wundere ich mich jedes Mal, wenn ich ein Radiostudio betrete, über dessen Fenster.
In der Schule, auf die ich ging, waren nur ganz wenige Bauernkinder. Es war eine Grundschule in der nahe gelegenen Kleinstadt, sie lag inmitten eines riesigen Neubaugebietes mit schmucken Einfamilienhäusern. Auch wir Bauernkinder wurden dorthin gekarrt, aber wir blieben eine klägliche Minderheit.
Meine Schulfreunde waren ausschließlich Lehrer-, Anwalts- und Bausparkassen bezirksleiter kinder. Ich habe mich deshalb oft etwas geschämt, doch es waren die Anwaltskinder, die sich im Zweitmercedes ihrer Mutter gerne zu mir auf den Hof bringen ließen, um dann mit mir in Gummistiefeln über die Weiden zu ziehen und mit Anlauf in jeden Kuhfladen zu springen.4
Abends, wenn die Anwaltsfrau ihren Anwaltssohn wieder abholen wollte, lagen wir heimlich kichernd, schmutzig und stinkend, versteckt auf unserer Deele unter Bergen aus frischem Rübenlaub. Dann schämte ich mich nicht mehr, Bauernsohn zu sein, sondern freute mich, dass die Anwaltskinder auch mal was erlebten.
Heute bin ich froh über meine Herkunft, denn die Anwalts-, Lehrer- und Bausparkassenbezirksleiterkinder sind inzwischen alle selbst Anwälte, Lehrer, Bausparkassenbezirksleiter oder mindestens in der FDP. Ich glaube, ich hatte eine glückliche Kindheit.
1 Kleine Erläuterung für die Generation Navi: Der Teutoburger Wald liegt im Nordosten Nordrhein-Westfalens, dem sogenannten Ostwestfalen, reicht bis nach Südniedersachsen hinein und ist das schmalste Mittelgebirge Deutschlands: etwa zweihundert Kilometer lang, bis zu vierhundert Meter hoch, aber nur wenige Zentimeter breit. Deswegen nennt man Ostwestfalen auch gerne einen Landstrich. Und Landstrich heißt jetzt nicht etwa, dass dort Kühe mit prallem Euter unter Straßenlaternen warten. So etwas gibt es im Teutoburger Wald natürlich nicht, also Straßenlaternen.
2 Dem Kabarettisten Jess Jochimsen zufolge kam das schon einem Outing gleich (vgl. Jochimsen 2000). Ich hätte also ebenso gut gleich mit dem weißen Brautkleid zur Schule gehen können.
3 Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wer uns all diese Bären aufgebunden haben soll. Nachbarn? Eltern? Die älteren Jugendlichen aus der Nachbarschaft? – Alles möglich, aber ich tippe stark auf unsere FünfFreunde-Kassetten.
4 Das war meine Art des Skatens. Später gelang es mir sogar, die Kühe dazu zu bringen, auf Treppenabsätze und Mauervorsprünge zu kacken.
Weil es Landliebe ist
Jedes Bauernkind entwickelt auf kurz oder lang eine tiefe innere Beziehung zu den Objekten auf dem elterlichen Hof und verliebt sich in eine Zuchtsau, ein Huhn, einen Traktor – oder zumindest eine Zuckerrübe.
Bei mir war es Erna. Sie war die erste große Liebe meines Lebens. Ich war drei und sie eine Schwarzbunte. So nennt man schwarze Kühe mit weißen Flecken.
Die Farbenlehre der Milchviehwirtschaft ist verwirrend. Braune Kühe mit weißen Flecken nennt der Züchter rotbunt. Eine lila Kuh mit weißen Flecken hieße demzufolge buntbunt. Interessanterweise werden in Gegenden mit vorwiegend katholischer Bevölkerung vermehrt rotbunte Kühe gehalten, in evangelischen Landstrichen dagegen schwarzbunte. Von den Kühen auf der Weide kann man also auf die Gewänder des örtlichen Pfarrers schließen.5
Erna war also evangelisch. Das traf sich gut. Das war ich auch. Ich wusste zwar nicht, was das hieß, aber es war gut so. Es war sicherlich schon problematisch genug, dass sie Kuh und ich Kind war, da war es gut, etwas Gemeinsames zu haben.
Erna war kein wirklich schöner Name, aber alle unsere Kühe fingen mit E an. Erna stand in einer Reihe mit Esther, Elena, Edith, Elke, Elise, Evelyn, Ellen, Elsbeth und Endivie.6
Sie war überwiegend schwarz, mit ein paar süßen weißen Flecken. Einen einzelnen davon mittig auf der Stirn. Erna war eine bildschöne Kuh. Sie hatte große Kuhaugen, aber das störte mich nicht, denn sie guckte mich immer freundlich an und hörte mir zu, wenn ich ihr erzählte, was ich im Sandkasten erlebt hatte, und ließ sich dabei sogar ihre Schnauze streicheln.
Kühe sind geduldige Zuhörer und können ungemein interessiert gucken. Ab und an nicken sie mit dem Kopf, kauen nachdenklich vor sich hin und sagen in regelmäßigen Abständen: »Hmmmmm«. – Eine Kuh ist die geborene Psychotherapeutin.
Kühe gucken nicht nur interessiert, sie sind sogar ungemein neugierig: Kühe auf der Weide kriegen alles mit. Jeder Spaziergänger, der schon mal eine Kuhweide passiert hat, wird die Erfahrung gemacht haben, dass ihm mindestens eine Kuh den gesamten Weg lang verfolgte. Kühe sind die Stalker unter den Nutztieren.
Ich interpretierte die Neugier der Kühe stets als Ausdruck von Intelligenz. Kühe stehen unendlich lange Tage im Stall und kauen vor sich hin, da hat man ziemlich viel Zeit zum Nachdenken. Zum Beispiel über die Frage, warum man eigentlich vier Mägen hat. Überhaupt muss, wer vier Mägen hat, schon über ein mathematisches Grundverständnis verfügen. Kühe sind also sehr klug. Sie sind die intellektuellen Damen unter den Stalltieren! Man sollte sie nicht Erna oder Elena nennen, sondern lieber Elfriede Jelinek oder Hildegard Hamm-Brücher. Das würde auch etwas frischen Wind in den Hofalltag bringen:
»Hermann, Hamm-Brücher erfüllt die Milchquote nicht.«
»Walter, ich hab andere Sorgen, Jelinek ist wieder bullsch.«
»Bullsch« ist eine Kuh, wenn sie rattig ist. Sie schreit nach einem Bullen. Dazu muss man wissen: Kühe können sehr laut schreien. Regelmäßig drang das heiße Rufen der bullschen Kühe bis hoch in den ersten Stock unseres Hauses, wo ich mir in meinem Kinderbett die Höllenqualen ausmalte, die Erna und ihre Freundinnen dort unten wohl gerade litten. Dass unerfülltes sexuelles Verlangen tatsächlich zum Schreien sein kann, lernte ich erst viele Jahre später.
Kühe sind emanzipierte Tiere. Die Frau schreit, und der Mann kommt. In diesem Fall aber kein stattlicher Bulle, sondern Holger, der schlaksige Besamungstechniker.
Besamungstechniker ist ein seltsamer Beruf. Die Bezeichnung klingt ein wenig nach Callboy, was in gewisser Hinsicht auch stimmt: Man ruft ihn an, und dann besorgt er’s der Kuh. Besamungstechniker sind staatlich legitimierte Sodomiten, die es für Geld machen. Er gibt der Kuh das Sperma desjenigen Bullen, den der Bauer vorher im Katalog ausgesucht hat. Die hießen meistens Vincent, Leon, Dragon oder Hartmut.7
Manchmal frage ich mich, was es mit einem macht, wenn man schon als Dreijähriger mit ansehen muss, wie Holger, der Besamungstechniker, seinen Arm bis fast zum Schultergelenk im Popo einer Kuh versenkt. Solche Bilder wird man zeitlebens nicht mehr los.
Natürlich verstand ich irgendwann, dass diese Tätigkeit in einem gewissen Zusammenhang mit späteren Kälbergeburten stand. In Bezug auf Kühe war ich sehr früh aufgeklärt. Der Transfer auf den Menschen brauchte allerdings noch etwas länger.
Erna hatte schon viele Kälbchen geboren. Sie war eine erfahrene Kuh und schon lange bei uns im Stall. Inzwischen gab sie immer weniger Milch als ihre jüngeren Kuhsinen, deren Euter so prall unter dem Körper hingen, als wären sie mit Silikon aufgepolstert. Erna erfüllte die Milchquote nicht mehr. Mein Vater wollte sie weggeben.
Das konnte ich natürlich nicht akzeptieren. Ich wollte, dass Erna mit einem allerletzten Kälbchen gemeinsam auf der Weide herumtollen und irgendwann einen friedlichen Kuhtod sterben durfte. Ich hab meinen Vater angefleht, Erna zu verschonen, weil sie meine Lieblingskuh war. Aber Lieblingskühe gibt es in der Landwirtschaft nicht.
Irgendwann musste ich mit traurigen Augen mit ansehen, wie Erna ein letztes Mal den Stall verließ, zur Weide guckte und dann etwas unschlüssig vor dem Viehanhänger stand, in den sie nun offenbar hinein sollte. Dann drehte sie ihren Kopf noch einmal in meine Richtung und guckte mich mit ihren großen Augen traurig an. Ich brach in Tränen aus, und mein Vater gab sich Mühe, Erna nicht allzu unsanft in den Viehanhänger zu bugsieren.
Ein paar Tage später gab es bei uns Nudeln mit Gulasch – eins meiner Leibgerichte. Ich haute rein, und beiläufig sagte mein Vater: »Das ist übrigens Erna.«
Es sind wohl dies die Verletzungen, die ein Kind zum Manne reifen lassen. Ich jedenfalls habe in diesem Moment eine wichtige Lektion fürs Leben gelernt: Liebe geht durch den Magen.
5 Eine These übrigens, die man sehr gut in Berlin überprüfen kann. In der weitgehend säkularisierten Hauptstadt gibt es nur 19 Prozent Protestanten und 10 Prozent Katholiken. Entsprechend wenige Kühe sieht man im Stadtbild.
6 Wir fanden das immer doof, meine Geschwister Valerie, Verena, Viktor und ich.
Die Buchstaben im Stall änderten sich übrigens mit der Zeit. Ein paar Jahre später standen dort Lara, Laura, Lena, Leonie, Lisa, Lucy, Lotta, Liane, Lilo und Luise. Heute wäre das eine Grundschulklasse im Prenzlauer Berg.
7 Heute gibt es keine Kataloge mehr, heute läuft das alles online über Stier-Book, MyOchs und ZuchtbullenVZ.
Ich war einschlechter Bauer
»Du kannst ja wirklich nicht fahren!«, maulte mein Fahrlehrer, als wir den Fahrschulgolf gemeinsam aus dem Straßengraben schoben.
»Hab ich doch gesagt«, äußerte ich beschämt und hätte am liebsten losgeheult.
»Du kannst ja gar nicht fahren« ist ein äußerst dämlicher Satz für einen Fahrlehrer zu Beginn der ersten Fahrstunde.
Ich war bis dato schon vielen dummen Lehrern begegnet, aber zu erwarten, dass man das, was sie einem erst noch beibringen sollten, schon beherrschte, gelang nicht einmal den dämlichsten Studienräten auf meinem Gymnasium.8
Doch der Satz »Du kannst ja gar nicht fahren« stand argumentativ in der Reihe mit: »Du bist ja Bauernsohn, da lernt man doch früh Treckerfahren.« Das hatte mein Fahrlehrer ausgesprochen, als ich in seinen schwarzen Golf eingestiegen war.
»Nö, ich hab keinen Treckerführerschein«, erklärte ich so kleinlaut wie wahrheitsgemäß und rührte mit dem Schaltknüppel, als wollte ich Kuchenteig glattrühren. Das konnte ich.
»… aber fahren kannste doch sicher«, stellte mein Fahrlehrer mit einem jovialen Tonfall in der Stimme fest, der keinen Widerspruch duldete.
»Stärker schieben!«, rief er nun. Der Straßengraben war gut feucht und der Vorderreifen bis zur Felge in die Grasnarbe eingesunken. Ich überlegte, ob ich meinen kleinen Bruder holen sollte, damit er uns mit dem Trecker aus dem Graben zog. Er würde das problemlos schaffen, aber mit seinen elf Jahren durfte er noch nicht auf öffentlichen Straßen fahren.
Erst das Treckerfahren, dann die Schambehaarung. So sieht’s die Pubertät auf dem Land vor. Mit vier Kettcar, mit sechs Trecker, mit sechzehn und großem Deutz-Schlepper und zwei Anhängern durch jeden Kreisverkehr – oder im Winter auch mal zur Schule –, mit siebzehn die Führerscheinprüfung ablegen, zum achtzehnten Geburtstag Opas alten Opel erben und dann nichts wie los zum TuS-Bockbierfest in der Mehrzweckhalle Bröckelberg-Hasenloh, um seinen Namen ein paar Tage später auf einem hübsch geschmückten Holzkreuz neben einem Straßenbaum wiederzufinden – oder, wenn man Pech hatte, in der Nachschulung beim alten Fahrlehrer.
Mein jüngster Bruder liebte das Treckerfahren. Damit war er natürlich Papas ganzer Stolz. Das war insofern beruhigend und gerechtfertigt, als unser Hof zu einer kleinen Enklave im Ostwestfälischen gehörte, in der aus unerfindlichen Gründen ein Letztgeborenenerbrecht überliefert ist.
Das war im Grunde tragisch, denn natürlich wollte ich anfangs auch mal Bauer werden. Ich konnte schon Kühe melken, ich sparte auf meinen ersten Mähdrescher, ich konnte Schweine schlachten mit bloßen Händen. Dann wurde mein Bruder geboren. Damit war mein erster Lebensentwurf schon gescheitert, und ich war erst zwei.
Ich gab die Landwirtschaft auf und fügte mich meiner Bestimmung. Es war ja nicht schlimm, wenn der älteste Sohn landwirtschaftlich versagte, denn der wurde eh aufs Gymnasium abgeschoben, um sich als Anwalt oder Chefarzt durchs Leben zu schlagen.9
»Könnten Sie mir es sicherheitshalber noch mal erklären?«, hatte ich meinen Fahrlehrer vorsichtig gebeten. »Nur zur Auffrischung. Sieht hier ja doch alles etwas anders aus als auf einem Trecker.« Als hätte ich das Steuer eines Traktors in den letzten vier Jahren auch nur einmal angefasst …
Natürlich hatte ich das mit dem Treckerfahren mal ausprobiert, war aber an mir und Gerät gescheitert.
Ich bin wirklich kein Grobmotoriker, aber wenn man meine Gliedmaßen durch technische Gerätschaften in allerlei Richtungen um mehrere stählerne Meter verlängert, tue ich mich mit der Koordination schwer, vor allem wenn man zur Handhabung dieser fernen Glieder auch noch diverse Schalthebel korrekt bedienen muss.
Mein Angstgegner war der Pflug: Pflüge sind dazu da, den Acker umzubrechen. Dummerweise enden Äcker meist recht abrupt an Wegen und Straßen, sodass man eine Kehre fahren muss, um dann wieder in die Richtung, aus der man gekommen ist, weiterzupflügen. Der geübte Treckerfahrer weiß, dass man gut daran tut, vor dem Wendemanöver auf Nachbars Hofzufahrt den Pflug zuvor aus dem Boden herauszuheben – ansonsten bleibt Bauer Lünkenschroth mit seinem Mercedes 190 in der Furche stecken.
Der geübte Treckerfahrer weiß auch, dass sein Gefährt, während man selbst konzentriert auf den frisch geackerten Boden hinter sich schielt, um nicht schon wieder die Grenze zwischen Acker und Lünkenschroths Hofzufahrt zu verpassen, vorne einen Frontlader hat, der in den seltensten Fällen unter den Apfelbäumen des Nachbarn hindurchpasst.
Mir fiel der Frontlader erst wieder ein, als mehrere Tonnen unreifer Ingrid Marie auf die Kühlerhaube des Treckers prasselten. Ein Geräusch wie im Krieg. Ich erschrak dermaßen, dass ich weder daran dachte, mein Gefährt anzuhalten, noch den Pflug rechtzeitig aus dem Boden zu heben; stattdessen verwechselte ich souverän Bremse und Gaspedal.
Als ich endlich zum Stehen gekommen war, blickte mein hochroter Kopf mitten in die Gesichter einer Traube von Schaulustigen: Alle Kühe auf Lünkenschroths Weide knubbelten sich am Zaun und starrten mich an. In diesem Moment habe ich gelernt, dass Kühe durchaus in der Lage sind, amüsiert zu grinsen.
Am Abend pflückte mein Vater einen stattlichen Ingrid-Marie-Ast aus dem Frontlader des Treckers, besserte zwei Tage lang Lünkenschroths Hofzufahrt aus, bezahlte die neue Achse des Mercedes 190, stellte mich bis auf Weiteres vom Treckerfahren frei und Helmer Lünkenschroth mit einer Kiste Steinhäger10 ruhig, die er mir vom Taschengeld abzog.
»Is ganz einfach«, hatte mein Fahrlehrer gesagt, woraufhin er die Bedeutung der Pedale zu meinen Füßen im Affentempo herunterrasselte, damit wir anschließend im Schneckentempo vom Hof hoppeln konnten.
»Jetzt mach dir nicht ins Hemd! Du kannst das doch, bist doch Bauernjunge!«, nölte mein Fahrlehrer. »Drück mal ’n bisschen auf die Tube!«
Ich schaute kurz nach, welches Pedal wohl die Tube sein sollte, fand es und betrachtete interessiert meinen Fuß, wie er es hinunterdrückte, während das Auto prompt einen Satz nach vorne machte. »Hochgucken!!! … und lenken!«, hörte ich noch neben mir. »LENKEN !!!« – Zu spät. Mit Anlauf hüpften wir in den Straßengraben, Tagesbestleistung im Golf-Weitsprung.
Konsterniert schüttelte mein Fahrlehrer den Kopf: »Ich fass es nicht, ein Bauernsohn, der nicht fahren kann …«
Man kann es nicht anders sagen: Ich war ein schlechtes Bauernkind. Das begann schon, als ich ganz klein war und keine Kuhmilch trinken wollte, weder gekühlt noch euterwarm. Ich brauchte Geschmackszusätze. Milchtechnisch ging bei mir ohne Kakaopulver gar nichts.11 Mein Papa ließ mir diese Extravaganz durchgehen. Wer selbst permanent Ketchup auf Käse und Marmelade auf Leberwurst schmierte, musste in diesem Punkt einfach tolerant sein.
Mit dem Grundschulalter verlor ich mein Interesse an Landwirtschaft völlig. Niemand in meiner Schulklasse kam sonst vom Bauernhof. Ich war der Alien vom Planeten Acker – und sah auch so aus. Ich bin zwischen meinem dritten und vierzehnten Lebensjahr immer nur in einer rostroten Cordlatzhose rumgelaufen. Rost, Rot, Cord, Latz – viermal scheiße aussehen in einem!
Ich wollte mich von meiner bäuerlichen Existenz emanzipieren. Als Kind verschlang ich Bücher, sparte mein gesamtes Taschengeld, bis ich in der Bücherstube Lampe 5,50 DM in Groschen für das neueste »Pitje Puck«-Buch auf den Teller zählte. Darin ging es um einen Briefträger in einem Dorf. Was für ein schönes Leben!
Mein Vater hingegen blätterte einmal wöchentlich das Landwirtschaftliche Wochenblatt durch und konnte, wie ich als Kind immer wieder mit Erschrecken beobachtete, nicht mal seinen Namen richtig schreiben! Seine Unterschrift bestand aus einem »S« und einem langen Strich dahinter!
Ich dagegen war schon im Grundschulalter permanent bemüht, mir eine Signatur mit möglichst viel Charakter auszudenken. Wenn man in verstaubten Kartons auf dem Dachboden unseres Bauernhauses alte Schulhefte von mir finden sollte, kann man sicher sein, dass das eingelegte Löschblatt vollgekritzelt ist mit schwungvollen Unterschriftsprototypen.
Landwirtschaft und ich, das hatten mich Lünkenschroths Apfelbaum der Erkenntnis und die Ingrid-Marien-Erscheinung auf der Kühlerhaube gelehrt, wir passten einfach nicht zusammen.
Ich war juveniler Literat und Poet, kein Bauer! Ich interessierte mich für Literatur, Politik und Sinnfragen, die über den Horizont des eigenen Ackers hinausreichten! Ich verschrieb mich der Schülerzeitung und kirchlicher Jugendarbeit, und mein Vater tolerierte all diese Eskapaden mit westfälischem Gleichmut.