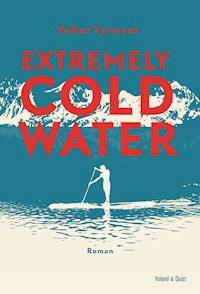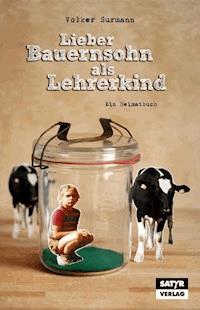Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Satyr Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder kennt sie: diese Situationen, wo aus Offenheit Entblößung wird; wo die Wirklichkeit auf dem schmalen Grat zwischen Scham und Fremdscham balanciert; sich unvermittelt Wurmlöcher zum Wahnsinn auftun und das Universum für einen kurzen Moment den Atem anhält. Menschen wie du und ich gestehen plötzlich in vollen Zügen verblüffende Intimitäten. In der Sauna lassen die Gespräche tiefer blicken als die nackten Leiber. Allerorten, und in einer Stadt wie Berlin erst recht, hängt solcherlei Bloßmenschen kompromittierendes Material öffentlich zum Hirn raus. Und eins kann der Satiriker, Lesebühnenautor und Poetry-Slammer Volker Surmann in solchen Momenten gar nicht: wegschauen. Präzise, süffisant und mit einer gehörigen Portion Selbstironie präsentiert er seine Geschichten zum Schämen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VOLKER SURMANN
Bloßmenschen
SCHÖNER SCHÄMEN FÜR ALLE
VOLKER SURMANN
ist Autor, Satiriker, Verleger und Exil-Ostwestfale in Ostberlin. Er veröffentlicht Romane, Kurzgeschichten und Anthologien, schreibt für Titanic, Siegessäule, die taz-Wahrheit und andere Printmedien, liest bei der Berliner Lesebühne Brauseboys und tritt bei Poetry Slams im gesamten deutschsprachigen Raum auf. www.volkersurmann.de
Von ihm im Buchhandel erhältlich:
–»Die Schwerelosigkeit der Flusspferde«
(Roman. Querverlag: 2010)
–»Lieber Bauernsohn als Lehrerkind«
(Geschichten. Satyr: 2012)
–»Extremely Cold Water«
(Roman. Voland & Quist: 2014)
–»Mami, warum sind hier nur Männer?«
(Roman. Goldmann: 2015)
E-Book-Ausgabe Februar 2017
© Volker Surmann, Berlin 2017
www.satyr-verlag.de
Cover: Karsten Lampe
Audioaufnahmen: Vredeber Albrecht (www.audiofenster.de)
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: http://dnb.d-nb.de
Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.
E-Book-ISBN: 978-3-944035-84-0
INHALT
Vorbemerkung
1. Teilnehmende Beobachtung
Unerwartetes Bekenntnis eines langweiligen Mannes
Saunamänner
Die Mütter vom Prenzlauer Berg
Neununddreißig Sekunden. Oder: Der blaue Junge
Recht auf Party
Bagger. Drama in einem Aufzug
Das Klappern
Sex zu ungewöhnlichen Temperaturen
2. Familiäre Prägung
Das Ding aus dem Teich
Schlüsselbeinbruch mit Udo Jürgens
Die Sportunfälle meines Lebens
Morgen kommt das Mülolo. Eine Wegwerfgeschichte
3. Berufliche Beanspruchung
Ich bin der, vor dem ich mich immer gefürchtet habe
Wer hat Angst vorm Herren Schmidt?
Procrastination Diaries
Ich sehe, wie das ist
Wie ich mal vor Markus Lanz versagte
Ich stand mit Peter Fox auf der Bühne
Meine Buchmesse (ein Life-Ticker)
4. Schamgrenzen und wie man sie überwindet
Bei Ärzten
Bei Ärzten II
Notizen vom Nacktbadestrand
Der Sackmann
Der Eisbär kotzt
5. Scham und Selbsterfahrung
Sztaub
The Ton
Das Horrorklo von Pfullendorf
6. Sehnsüchte und Fantasien
Kniebe
Die Reklamation
Monolog an einen Alleinstehenden
Hund, Wok, Tram
Nachwort
Veröffentlichungsnachweise
Audiolinks
VORBEMERKUNG
Ich habe gar keine Fantasie.
Ich schreibe nur mit.
1
TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG
Unerwartetes Bekenntnis eines langweiligen Mannes
Er ist um die dreißig, groß, blond und schlank. Aber nicht attraktiv. Er ist ziemlich groß, recht blond und mehr oder weniger schlank. Unauffällig. Er ist ein Mann, wie ich ihn malen würde, wenn man mir die Aufgabe gäbe, einen langweiligen Mann zu malen. Und wenn ich überhaupt malen könnte. Doch ich kann nicht malen, und der Mann ist nicht gemalt, sondern setzt sich in Fulda zu uns an den ICE-Tisch, den ich mir seit Frankfurt mit einer Frau aus Freiburg teile. Er fragt höflich, ob der Platz frei sei, dann setzt er sich und sagt: »Ich fahre heute das erste Mal mit der Bahn.«
»Ach Gott, wie drollig«, denke ich.
Aber nervös genug ist der langweilige Mann jedenfalls. Er fragt nach einer Steckdose für seinen Laptop, findet sie, kriecht dafür aber komplett unter den Tisch.
Dann sagt er etwas Langweiliges: »Ich baue hier mal mein kleines Büro auf.«
Ich glaube, er meint das witzig. Wer das erste Mal Bahn fährt, hält so etwas vielleicht für total originell, obwohl auch ein Bahn-Novize auf den ersten Blick sehen müsste, dass ein ICE-Großraumabteil längst Großraumbüro ist. Originell wäre, einen Drucker aufzubauen oder eine mechanische Reiseschreibmaschine, die am Ende jeder Zeile »pling!« macht.
Da fand ich die Frau aus Freiburg schon origineller, die, bis der langweilige Mann kam, Marmeladengläser in Geschenkpapier eingewickelt hat.
Dann fragt der langweilige Mann die Frau aus Freiburg: »Sind Sie Lehrerin?«
Die Frage kommt etwas unvermittelt. Aber vielleicht hat der langweilige Mann in »Bahnfahren für Einsteiger« gelesen, dass Smalltalk am Platz dazugehört, und zieht nun die Trumpfkarte »Fragen nach dem Beruf«.
Die Frau aus Freiburg sagt, sie sei Musikerzieherin. Er sagt, er sei Journalist. Er schreibe für eine Mainzer Zeitung und habe morgen ein Vorstellungsgespräch bei einer Nachrichtenagentur in Berlin. Bei seiner Mainzer Zeitung kriege er ja neunzig Euro pro Artikel, das wäre ja ’n ganz gutes Einkommen, wenn er das täglich bekäme, bekomme er aber nun mal nicht, deshalb jetzt Berlin. Wie viel sie so verdiene?
Daraufhin ist das Gespräch zu Ende. Mich bezieht er gar nicht erst ein, und das ist mir recht, denn der langweilige Mann macht mich nervös. Er zappelt in seiner Sitzschale rum, er tippt auf seinem Laptop, er zerschnipselt eine Fahrkarte; nichts wirklich Auffälliges, und trotzdem quillt bei dem langweiligen Mann die innere Unruhe aus allen Ritzen seiner Existenz. Wenn man eine Aurafotografie von ihm machte, sähe man auf dem Bild hinterher einen Fünfjährigen mit abgeklebter Brille, der furchtbar dringend aufs Klo muss.
»Junge«, möchte ich ihm gerne sagen, »vergiss das mit der Nachrichtenagentur. Wenn du in deinem Bewerbungsgespräch so bist wie hier im Zug, kannst du eigentlich schon in Kassel aussteigen. Fahr zurück nach Mainz. Berlin ist nix für dich.«
In Göttingen setzt sich eine junge Mutter mit Kleinkind zu uns, der langweilige Mann wird zum Glück etwas langweiliger und tippt auf seinem Laptop rum. Ich lese, die junge Mutter liest, ihre Tochter schläft seelenruhig auf ihrer Brust.
Irgendwann fragt der langweilige Mann: »Entschuldigung, wissen Sie, ob es hier am Tisch auch einen Mülleimer gibt?« Die junge Mutter zeigt auf die entsprechende Klappe. »Wären Sie so gut, gerade … ja, danke.«
Gemeinsam schieben sie einen Rucksack von der Mülleimerklappe, einige Papierschnipsel werden verklappt, und im Zurücklehnen sagt der langweilige Mann: »Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst.«
Für einen kurzen Moment hält das Universum den Atem an.
Der Moment ist exakt so lang, wie die Schallwellen vom Außen- übers Mittelohr zum Innenohr brauchen, vorbei an Trommelfell und Gehörknöchelchen zur Hörschnecke, in der eifrige Stereozilien Neurotransmitter ausschütten, die vom Hörnerv zum auditiven Cortex der Großhirnrinde geleitet werden, wo sofort Vergleiche mit bereits bekannten Schallmustern gezogen werden, diverse wortsemantische sowie syntaktische Verarbeitungszentren in Frontal- und Temporallappen sowie Wernicke-Areal hinzugezogen werden; irgendwo im Zentrum für Sinngegenprüfung leuchtet eine rote Warnlampe auf, ein runder Tisch der Semantik kommt zu keinem Ergebnis, beschließt aber als Sofortmaßnahme, die Stirn krauszuziehen und einen fragenden Blick aufzusetzen.
All das dauert eine halbe Ewigkeit, etwa 0,7 Sekunden. Dann atmet das Universum wieder. Die junge Mutter war 0,1 Sekunde schneller, auch ihre Stirn ist kraus, auch ihr Blick ist fragend, aber ihr Sprachzentrum ist ein Wort weiter; sie sagt: »Was?«
»Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst«, wiederholt der langweilige Mann und fügt hinzu: »etwa alle zwei Monate.«
Das Universum hat Schluckauf. Mein Wernicke-Areal guckt blöd aus der Wäsche. Schwerer Ausnahmefehler in der Sprachverarbeitung. Diese Anwendung reagiert nicht. Keine Rückmeldung. Wollen Sie die Anwendung schließen?
Ich gucke meine Sitznachbarin an, meine Sitznachbarin blickt mich an, ich schaue ins Gesicht der Freiburgerin. Die guckt gerade ratlos zu mir. Uns allen steht ins Gesicht geschrieben: Wernicke-Areal out of order.
Hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er nicht gesagt: »Ui, der Mülleimer am Tisch ist aber ganz schön voll, jaja, die Bahn mal wieder!«? – Nein, hat er nicht. Aber wollen wir nicht einfach so tun als ob?
Inzwischen hat der in meinem Gehirn gut ausgeprägte Nonsens-Lappen ein Grinsen in mein Gesicht geschickt, ich versuche, es hinter meinem Buch zu verstecken, das gelingt nur bedingt und sieht bescheuert aus. Mir fällt aber auf, dass ich den langweiligen Mann gar nicht mehr so langweilig finde.
Mein spontaner Gedanke ist: Tourette-Syndrom. Aber ist das nicht eine unkontrollierte Zwangshandlung?
»Ein interessantes Buch lesen Sie da gerade. Ficken ficken Möse lecken. Ich lese auch gern Paul Auster.«
»Äh, was?«
»Oh Verzeihung, ich spreche manchmal etwas undeutlich. Ich sagte: ›Ficken ficken Möse lecken‹. Kennen Sie ›Nacht des Orakels‹?«
Nein, Tourette scheidet aus.
»Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst, etwa alle zwei Monate.« – Was sagt man auf so einen Satz?
Variante 0, der Normalfall: »Äh-he häää … hä?!«
Variante 1, Umlenkung: »Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst, etwa alle zwei Monate.« – »Ach, das ist ja interessant. Ich gehe gelegentlich in den Zoo, auch etwa alle zwei Monate … «
Variante 2, Konfrontation: »Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst, etwa alle zwei Monate.« – »Vielleicht sollten Sie es öfter tun, dann stünde Ihnen der Saft nicht schon bis hoch ins Hirn, wo er anscheinend so einiges verklebt.« Das wäre arschcool. Wie so oft, fällt mir der Satz etwa zehn Minuten zu spät ein.
Variante 3, Konversation: »Ich befriedige mich auch gelegentlich selbst, etwa alle zwei Monate.« – »Och, das is’ ja ’n Ding! Wie machen Sie es sich denn am liebsten? Haben Sie da bestimmte Techniken? Benutzen Sie Hilfsmittel? Woran denken Sie?« – Mit etwas Glück entwickelte sich ein angenehmes und sachbezogenes Gespräch über Masturbation, aus dem beide Seiten vielleicht noch etwas lernen können.
Der Zug fährt in Braunschweig ein. Der langweilige Mann packt wortlos seine Sachen, steht auf und verlässt den Wagen. Aber wieso? Wollte er nicht nach Berlin?
Die Wahrnehmungsverarbeitung in meinem Hirn bootet sich seit einer Stunde immer wieder neu: Wieso hat sich der langweilige Mann aus Mainz eigentlich erst in Fulda zu uns an den Tisch gesetzt? Er muss doch schon seit Frankfurt im Zug sein? Sollte es gar so sein, dass er den ganzen Tag schon durch den Zug mäandert? Immer so lange an einem Platz bleibt, bis er sich auf die Knochen blamiert und weiterzieht? Sitzen irgendwo anders im Zug auch noch Reisende mit verdatterten Wernicke-Arealen? Sollte ich morgen Nachmittag mal die Nachrichtenagenturen in Berlin abtelefonieren und nach besonderen Vorkommnissen bei Bewerbungsgesprächen fragen?
Auf viele dieser Fragen wird es keine Antwort geben. In einem Punkt muss ich mich allerdings korrigieren: Der langweilige Mann passt eigentlich doch ganz gut nach Berlin.
Saunamänner
»Ich muss dringend noch ’ne Wohnung kaufen«, sagt der Mann in der Sauna.
»Wohnung oder Haus?«, fragt der Mann neben dem Mann in der Sauna.
»Eigentlich egal«, sagt der Mann in der Sauna. »Hauptsache, irgendwas als Abschreibungsobjekt, ich zahl einfach viel zu viel Steuern. Geht zwar nicht direkt, aber mit etwas Tricksen …«
Ich weiß nicht, warum, aber irgendwas macht, dass Menschen in der Sauna mit einer Offenheit plaudern, als gäbe es kein Morgen mehr – oder keine Mitsaunierenden. Vielleicht liegt es an der Nacktheit: Man hat schon alle Hüllen fallen lassen, zeigt sich völlig entblößt, und man kann alles sehen: alle Falten, jedes Haar an passender oder unpassender Stelle, dieses schwarzbraune Muttermal in der Form Zyperns neben dem Bauchnabel, jede Narbe, ob rasiert oder nicht rasiert, klein oder groß, bevorhäutet oder nacktmullig, alle Piercings, alle Tattoos, auch die peinlichen ersten. Ein anderer Typ in der Sauna hat zum Beispiel ein Tattoo auf dem Beckenknochen, auf dem steht: »Nicht vom Beckenrand springen«. Das gefällt mir. Außerdem gefällt mir, dass er gerade genauso genervt ist von den beiden finanziellen Großkotzen wie ich. Aber die denken anscheinend: Wenn die körperliche Intimität schon aufgehoben ist, kann man auch geistig alles raustropfen lassen.
»Wohnung kaufen, würd’ ich auch gern«, sagt der andere Saunamann jetzt wieder, »aber ich soll ja jetzt Rudis neuen Film finanzieren. Dem fehlen noch dreihunderttausend.«
Oder es liegt an der Hitze. Dass bei 90 Grad manche Schmelzsicherungen im Hirn einfach durchbrennen und neben ranzigem Schweiß aus den Poren jede Menge müffelnde Wahrheit aus den Mündern quillt. Jedenfalls hab ich in der Sauna schon sexuelle Intimitäten, kolportierte Seitensprünge, pikante Geständnisse und Geschäftsgeheimnisse aufgeschnappt, da sind Handytelefonate in der Deutschen Bahn nichts gegen, und selbst da erfährt man ja schon so einiges: »Ja, hallo, Frau Böge, hallo? Ja, ich war wohl gerade in einem Funkloch … also noch mal: Die Klageschrift wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz geht an Simon Peters … Simon wie Simon und dann Peter Emil Theodor Emil Richard und S wie Siegfried. … Nein, das sind nicht die Vornamen, Frau Böge … Bommerlunder Straße 18, 58089 Hagen … Hallo? Sind Sie noch da, Frau Böge? … Hallo, ja gut … haben Sie? … Sehr gut. Und schreiben Sie bitte ›vertraulich‹ auf die Akte, muss ja nicht jeder wissen, was er mit der Kleinen gemacht hat.«
Inzwischen glaube ich, Schilder der Art »In der Sauna bitte Ruhe!« sind gar keine Ausgeburt deutschen Spießertums, es sind Warnhinweise. »Sagen Sie nichts, was Sie später bereuen könnten.« Neben jedem »Kein Schweiß auf’s Holz!«-Schild sollte eins hängen mit: »Kein Wort über die Lippen!«
Ich glaube, wenn man in Deutschland mal eine wirklich aufrichtige, interessante Talkshow zeigen wollte, sollte man sie in einer finnischen Sauna drehen. In einer finnischen Sauna im Zug. Und die Fragen werden per Handy gestellt.
»In der Sauna mit …« – Vielleicht sollte man das mal Anne Will vorschlagen, als neues Talkkonzept, dann käm’ in ihrer Sendung auch mal wieder was bei rum. Und wenn es nur das erste Arschgeweih von Frauke Petry ist. Und ich wette: Sie hat eins.
Die beiden Großkotze in der Sauna großkotzen weiter. Die anderen in der Sauna, vor allem der Nicht-vom-Beckenrand-Springer und ich, gucken hingegen immer genervter aus der nicht vorhandenen Wäsche.
»Wieso musst du Rudi eigentlich aushelfen?«, fragt der Häuslekäufermann.
»Du, der Rudi hat da einfach völlig missgewirtschaftet«, erklärt der Dreihunderttausend-Euro-Mann. »Jedes Jahr mehr ausgegeben, als er eingenommen hat. Das ging so lange gut, wie neue Fördergelder und Drittmittel reinkamen, die er dann immer für den Vorgängerfilm ausgegeben hat, tja, und jetzt fehlen ihm für seinen aktuellen Film dreihunderttausend.«
Nach diesem Saunagang eile ich sofort an meinen Spind, hole mein Smartphone raus und google: In Berlin gibt es genau zwei Filmfirmen mit einem Geschäftsführer namens Rudi. Zwei Spinde weiter steht der Beckenrandspringer, ebenfalls mit seinem Smartphone in der Hand. »Zwei Firmen«, raune ich ihm zu. Er grinst: »Ich tippe auf T&B Movie GmbH.« Dann nicken wir uns wissend zu.
Ein Saunagang später: Die beiden Geschäftsmänner und ich sitzen wieder in der finnischen Sauna, dann kommt der Tattoomann mit einem Kumpel rein. Sie sind munter am Plaudern. »Weißt du«, sagt der Beckenrandtätowierte, »das nervt mich echt. Die Leute sehen nur meine Tattoos und denken sich wer-weiß-was, was ich beruflich mache. Keiner kommt auf die Idee, dass ich Insolvenzrichter bin.«
»Geht mir ähnlich«, sagt sein nicht minder tätowierter Kumpel, »aber ich glaub mir manchmal ja selbst nicht, dass ich beim Finanzamt gelandet bin.«
Der Häuslekäufer läuft trotz 90 Grad Lufttemperatur gerade blassblau an im Gesicht. Dann fährt der Kumpel vom Tattoomann fort: »Ist es eigentlich wahr, dass du jedem Hinweis auf Insolvenzverschleppung nachgehen musst?«
»Klar, sobald ich irgendwas höre, was auf Insolvenzverschleppung hindeutet, muss ich den Wirtschaftsstaatsanwalt von Amts wegen bitten, da mal zu ermitteln. Ganz schön nervig so was …«
»Äh, mir ist zu heiß«, sagt der Häuslekäufermann und flieht. »Mir irgendwie auch«, sagt der Dreihunderttausend-Euro-Mann und hechtet hinterher. Durch die Glastür sehen wir sie draußen aufgeregt dampfen und gestikulieren.
Ein paar Minuten später folgt mein Auftritt: Im Saunagarten steht der Dreihunderttausend-Euro-Mann barfuß im Schnee, dampft gar nicht mehr, sondern sieht gerade sehr nachdenklich aus. Fast ein bisschen bleich.
Ich ziehe mein Handy aus dem Bademantel und spreche hinein: »Hallo? … Bist du’s? … Gut, dass ich dich erreiche, … Hallo? Hallo? … Ja, der Empfang hier ist ganz schlecht. Ich bin nämlich gerade in der Sauna. Weißt du, Rudi, Zufälle gibt’s, du glaubst es nicht … Jedenfalls dachte ich, ich ruf dich besser gleich mal an …«
Mit diesen Worten gehe ich durch die Glastür zurück nach drinnen. Von dort sehe ich, wie der Dreihunderttausend-Euro-Mann, obwohl barfuß im Schnee, gerade puterrot anläuft und ganz heftig zu schwitzen beginnt. Aber genau dazu geht man ja schließlich in die Sauna.
Die Mütter vom Prenzlauer Berg
Manchmal gehe ich zum Einkaufen in den Edeka an der Danziger Straße. Dort sehe ich sie: Sie sind männlich, sie sind jung, sie sind beide im Vorschulalter, und sie sind furchtbar schlecht erzogen. In der Gemüseabteilung schwingen sie Rhabarberstangen wie Laserschwerter und machen dazu »Bssssüüümmm-Bsssüüümmm«. Na gut, das finde ich noch drollig, zumindest bis sie die matschigen Rhabarbä zurücklegen ins Gemüsefach. Und zwar unter den Augen ihrer Mutter.
In diesem Moment habe ich sie gefressen: die Mutter (nicht die Rhabarberstangen).
Als sich die Jungs mit Weintrauben bewerfen, während Mutti die Inhaltsstoffe eines Müslis auswendig lernt, schaue ich noch weg, aber beim Joghurt wird es mir zu bunt: Während sich Frau Mama nicht zwischen Luftkurortgetrockneten Toskana-Biotomaten und eingelegten Fair-Traide-Yucatán-Jalapeños mit Demeter-Frischkäse-Füllung entscheiden mag, spielen ihre Jungs ein Spiel, das im Wesentlichen darin besteht, so lange mit den Fingern auf Joghurtdeckel einzutrommeln, bis das Alu reißt und die Fingerspitze im süßen Nass hängt.
»He!«, sage ich. »Könnt ihr das mal lassen, das wollen andere noch essen!«
Die Jungs schauen verwundert auf. So etwas hat ihnen offensichtlich noch niemand gesagt.
»Ja, geht’s noch?«, zischt dann auch endlich die Mutter der beiden, die Jungs zucken sichtlich zusammen. Na also!
»Wie sprechen Sie denn mit meinen Kindern?!«
»Äh-was …?« Verwirrt schaue ich mich um. Meint sie mich?
»Kann ich helfen?«, mischt sich eine zweite Frau ein, die gerade mit ihrem Einkaufswagen zu uns rübergeschaukelt kommt.
»Ach, nur’n Missverständnis«, sage ich, »ihre Kinder haben hier Joghurtdeckel angepiekst. Ich hab sie gebeten, das zu lassen, und die Dame hier meint offenbar, ich hätt’ ihre Kinder angegriffen …«
»Das macht man ja auch nicht!«, sagt die andere Frau.
»Eben, das muss man den Kindern ja auch mal deutlich ma…«
»Man mischt sich nicht in die Erziehung anderer Eltern ein!«
»Genau! Wer hat Ihnen erlaubt, meine Kinder zu erziehen?«, greift Mutti Nr. 1 den Faden dankbar auf.
»Na, wenn Sie es nicht machen, irgendwer muss es ja tun.« – Okay, das ist mir mehr so rausgerutscht und kein sonderlich geschicktes Argument, wenn man mit einer wütenden Mutter diskutiert. Und sich gerade fünf bis zehn andere Mütter um einen herum in Position bringen.
»Und wer gibt Ihnen das Recht dazu?«
»Der Supermarkt … quasi«, erkläre ich. »Als Kunde habe ich doch das Recht auf unversehrte Ware! Hier sehen Sie mal: alle angepiekt!« Ich greife eine Palette Joghurt aus dem Kühlregal und halte sie anklagend hoch.
»Petze!«, zischt eine Frau von hinten. »Das ist ja das Allerletzte! Denunziert Kinder!«
Ich deute auf die zermatschten Joghurtbecher. »Aber das macht man nicht!«
»Reaktionäres Spießerargument!«, erklingt es aus dem Kreis, der sich mittlerweile um mich und die Alphamutter fest geschlossen hat.
»›Das macht man nicht.‹ Scheiß Law-and-Order-Nazis«, raunt es von hinten. »Wählt wahrscheinlich auch noch die AfD.«
Nun schnappe ich nach Luft. Ich bin in den Achtzigerjahren groß geworden. Mit Hungersnot in Äthiopien. »Aber was sollen die Kinder in Afrika denken?«, war das Standardargument meiner Eltern, wenn ich nicht aufessen wollte. Und ich sah es sogar ein! Ich sah ja selbst die Bilder der Blähbauchkinder im Fernsehen, die Spendenaufrufe. Ich bin mit Live Aid aufgewachsen. Kein Zweifel. So eine Szene wie hier: Unter Bob Geldof hätt’s das nicht gegeben!
Die Mütter begutachten die kaputten Becher: »Das ist doch nur der Gut-und-günstig-Billigjoghurt, den kauft hier doch eh niemand!«
Ich probiere es mit einem neuen Argument: »Aber was sollen die Kinder in Afrika denken?«
»Ach, die vertragen doch eh keine Laktose da in Afrika.«
»Sie verwechseln Asien und Afrika«, werfe ich ein.
»Der ist doch nicht mal bio!«, wirft eine Ökomutti ein. »Aus Industriemilch von Kühen aus Tierfabriken!«
»Eben!«, ergänzt die zweite Reihe: »Den würd’ ich nicht mal beim Containern mitnehmen!«
»Aber darum geht’s doch gar nicht!«, wende ich ein. »Ich kauf den Joghurt ja auch nicht.«
»Ach was?!«, fährt die Alphamutter dazwischen. »Und was interessieren Sie dann die kaputten Deckel? Das wird ja immer absurder!«
»Dabei sehen Sie durchaus wie jemand aus, der Joghurt aus Tier-KZs kauft!« Wieder die zweite Reihe.
»Es sind trotzdem Lebensmittel, und die Deckel sind nun mal eingeditscht!«
»Lorenz, Oskar. Wart ihr das?«, fragt die Alphamutter die beiden Jungs. Die schütteln energisch den Kopf. »Auch noch Falschbeschuldigungen!«
Oskar schleckt sich noch schnell die letzten Joghurtreste von den Fingern. Lorenz grinst mich verschmitzt an. Aber kann ich’s ihnen übel nehmen? Leider taugt das bei der Prenzlmüttermeute nicht als Argument: »Na ja, in dem Alter hätt’ ich auf so eine Frage meiner Mutter auch den Kopf geschüttelt.«
»Unterstellen Sie meinen Kindern etwa zu lügen?«
Lorenz nickt heftig. Ich möchte ihm gern vors Schienbein treten.
»Meine Jungs lügen ihre Mutter nicht an. Sie sind gut erzogen. Im Gegensatz zu Ihnen.« Treffer und Applaus von den anderen Müttern.
»Na ja … nicht direkt Lüge, aber es sind halt Kinder, die was ausgefressen haben, da hab ich als Kind auch nie die Wahrheit gesagt …«
»Haben Sie das gehört? Er gibt zu, schon als Kind notorischer Lügner gewesen zu sein. Wer sagt uns denn, dass er heute die Wahrheit sagt?«
»Aber ich weiß doch, was ich gesehen habe!«
»Haben Sie Kinder?« Die Einkaufswagenfrau stellt die Gretchenfrage.
»Nein, aber was tut das zur Sache …?«
»Also, liebe Damen«, wendet sich die Alphamutter an die Mütterschar: »Hat sonst noch jemand gesehen, wie meine Kinder die Joghurtdeckel, wie dieser kinderlose Herr sagt, ›anpiekten‹?« Alle schütteln den Kopf, kein Wunder, sie waren ja auch alle nicht am Kühlregal zur fraglichen Zeit. »Sie stehen also ziemlich allein da mit Ihrer Beobachtung!«
»Lassen Sie mich durch, ich bin Anwalt in Elternzeit«, drängelt sich ein junger Vater mit einem kleinen Mädchen in der Bauchtasche nach vorn und hält eine Visitenkarte hoch. »Wenn Sie Hilfe benötigen!«
»Kann sein, dass ich bald einen Anwalt brauche«, sage ich frustriert.
Er sagt: »Kindesmisshandler vertrete ich nicht.«
»Vielleicht hat er die Joghurts ja selbst angepiekt«, wirft die zweite Reihe ein.
»Ja klar!«, rufe ich. »Das wird’s sein! Ich hab nichts Besseres zu tun, als den lieben langen Tag in Edeka-Märkten rumzulungern, palettenweise Joghurtdeckel durchzupieksen und dann die erstbesten Kinder dafür zu beschuldigen!«
»Also für mich klingt das ganz plausibel.« Eine Supermarktangestellte im Edeka-Kittel: »Sie glauben nicht, was man als Filialleitung so alles erlebt. Mich überrascht gar nichts mehr.«
Allgemeines Kopfschütteln in der Müttergruppe. Das Edeka-Schwurgericht Danziger Straße befindet mich für schuldig. Die Filialleiterin verurteilt mich zu Hausverbot und zwanzig Gut-und-günstig-Joghurts mit beschädigten Deckeln.
»In was für einer Welt leben wir eigentlich?«, zischt die Alphamutter und greift nach ihren Kindern: »Lorenz, Oskar, kommt ihr bitte weg von diesem Mann!«
Ich betrat den Edeka als Hungriger, ich verließ ihn als Dürstender nach Gerechtigkeit.
Gesenkten Hauptes und eine Palette Joghurt auf dem Arm schleiche ich über den Parkplatz. Ein Becher fällt mir herunter. Zitrone. Mag ich eh nicht. »Umweltsau ist er auch noch!«, ruft mir der Anwalt in Elternzeit nach.
Plötzlich höre ich eine Kinderstimme hinter mir: »Hier, den haben Sie verloren.« Lorenz hält mir den Zitronenjoghurt hoch. Perplex greife ich danach und sage: »Danke.« Lorenz’ Mutter ist nirgends zu sehen.
»Wieso macht ihr das mit den Joghurts?«, frage ich ihn.
»Macht halt Spaß«, sagt er. »Und schmeckt.« Dann rennt er davon.
Zum Einkaufen fahre ich jetzt immer mit dem Auto nach Wilmersdorf. Da kaufen nur Rentner ein.
Nur manchmal, wenn ich allein am Kühlregal bin, pieke ich meine Finger durch ein paar Joghurtdeckel und lecke sie ab. Macht wirklich Spaß. Und schmeckt.
Neununddreißig Sekunden Oder: Der blaue Junge
Habe ich jemals behauptet, die Pubertät sei die schlimmste Zeit des Lebens? Pubertierende seien pickelig, hässlich, dreist und doof? Nun, es gibt Ausnahmen.
Die Ausnahme trug eine blaue Hose. Mehr sah ich erst nicht von ihr, denn die blaue Hose stieg gerade in Nienburg/Weser eine Treppe zum Bahnsteig hinauf. Es war so ’ne Skater-Stoffhose in einem durchdringend leuchtenden Knallhimmelblau. Mann, Mann, Mann, dachte ich, das ist ja mal ’n Ausnahmeblau.
Da ich zum selben Bahnsteig hochmusste, sah ich schnell, dass sich über der blauen Hose ein kariertes Hemd anschloss, und über dem Hemd waren halblange, Ron-Weasley-rote Haare im aktuellen Teen-Jungs-Look. Mannomann, der Junge hatte aber mal Style. Und Mut zur Farbe. Und ein hübsches, brünettes Mädchen an der Hand. Vielleicht hatte auch sie den Style und er nur den Mut des Verliebten. Denn sie sah aus, als sei sie soeben einem der H&M-Plakate am Bahnsteig entstiegen. So standen sie Hand in Hand herum. Er mit Milchbubi-Gesichtszügen, sie mit Make-up. Beide maximal vierzehn Jahre alt, wenngleich jedes Kleidungsstück an ihr in die Umgebung krakeelte: »Haltet mich bloß für siebzehn!«
Als ich den Bahnsteig entlangschlenderte, wandte der blaue Junge seinen Blick von seiner Freundin ab und schaute Richtung Anzeigetafel, unter der ich stand. Er hatte Augen so blau wie seine Hose. Augen von einem Blau, das mich einmal längs über den Bahnsteig fegte und an den nächsten Wagenstandsanzeiger tackerte. Krass, verfiel mein Sprachzentrum in Teen-Modus: Krass, krass, krass. Kein Wunder, dass das Mädchen an seiner Seite so krampfhaft seine Hand umklammerte, sie musste sich einfach festhalten!
»Krass, krass, aua!, krass, krass«, wimmerte eine Frau, die gerade neben mir einschlug. Weitere Wartende flogen an uns vorbei. Nur eine alte Dame hielt dem Blick des blauen Jungen stand, aber sie trug einen weißen Stock in der Hand.