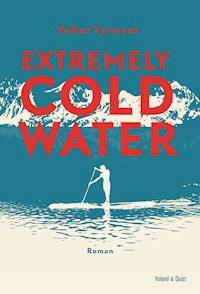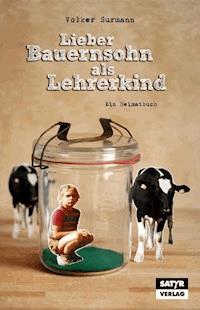7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verkehrte Welt im Gay-Resort auf Sardinien: Hotelier Helmer Klotz, selbst schwul, verachtet seine homosexuelle Klientel aus tiefstem Herzen. Dann gewährt er in einer Notsituation Ilka, einer frisch verlassenen Mutter mit ihren zwei Kindern, Unterkunft. Damit treffen zwei Welten aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein können. Denn auf eine Konfrontation mit so viel Heterosexualität sind Helmers Hotelgäste nicht vorbereitet, die aufgeweckte Kleinfamilie stiftet ordentlich Unruhe und Chaos. Und doch sind es am Ende ausgerechnet die von der Liebe enttäuschte Heterofrau und ihre Kinder, die dem bärbeißigen Hotelchef vor Augen führen, dass es unter Homosexuellen durchaus auch liebenswerte Exemplare gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Helmer Klotz, Anfang 50, betreibt die schwule Ferienanlage Rainbow Inn auf Sardinien. Ein nahezu wertloses Stück Felsküste unweit einer Autobahnabfahrt hat er in ein gut laufendes Homo-Resort verwandelt. Als bärbeißiger Eigenbrötler und Grantler, aber mit der Raison des professionellen Hoteliers führt er Resort wie Personal, verachtet aber insgeheim das bunte Treiben in seinem Haus. Ilka, Mitte 30, Schulsekretärin aus Hannover, hat eine überstürzte Trennung hinter sich, zwei Kinder auf der Rückbank und eine Motorpanne inmitten einer heftigen Gewitternacht. Das Rainbow Inn ist die nächstgelegene Unterkunft. Gegen den Widerstand des schockierten Rezeptionisten finden sie und ihre Kinder dort Aufnahme. Damit treffen zwei Welten aufeinander, denn auf eine Konfrontation mit so viel Heterosexualität sind Helmers Hotelgäste nicht vorbereitet. Und die aufgeweckte Kleinfamilie stiftet ordentlich Unruhe und Chaos. Am Ende sind es aber ausgerechnet die von der Liebe enttäuschte Heterofrau und ihre Kinder, die den mürrischen Hotelchef aus der Reserve locken – und ihm vor Augen führen, dass es unter Homosexuellen durchaus auch liebenswerte Exemplare gibt.
Autor
Volker Surmann ist Autor, Satiriker und Exil-Ostwestfale in Ostberlin. Er stand zwanzig Jahre als Kabarettist und Comedian auf der Bühne und ist einer der Hausautoren des Berliner Kabaretts »Die Stachelschweine«. Er schrieb für diverse TV-Comedyformate (z. B. »Mensch Markus«, »Was guckst Du?«) und rechnete in seinem ersten Roman »Die Schwerelosigkeit der Flusspferde« (2010) mit dem Comedybusiness ab. 2012 erschien seine Geschichtensammlung »Lieber Bauernsohn als Lehrerkind«, 2014 sein zweiter Roman »Extremely Cold Water«. Er schreibt Beiträge für das Satiremagazin »Titanic«, Kolumnen für das queere Hauptstadtmagazin »Siegessäule« und betreibt seit 2011 den Berliner Satyr Verlag für Humor und Satire. Seit 2003 liest er jeden Donnerstag bei der Berliner Vorlesebühne »Brauseboys« und tritt regelmäßig bei Poetry Slams in ganz Deutschland auf.
VOLKER SURMANN
Mami, warum sind hier nur Männer?
Roman
1. Auflage
Originalausgabe Oktober 2015
Copyright © 2015 by Volker Surmann
Copyright © 2015 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Gestaltung des Umschlags: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: FinePic®, München
Redaktion: Friederike Arnold
BH · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-16165-1
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:
TAG 1
HELMER
Ich hasse Schwule. Ich dachte, bevor Sie das hier als irgendein emotionales Toleranzgeschwafel missdeuten, stell ich das lieber klar. Schwule gehören zu den nervtötendsten Zeitgenossen unter der Sonne. Ich weiß das, ich betreibe ein Gay-Resort auf Sardinien.
Als Gott überlegte, welche Kreaturen er nach Schlange, Schwan und Schweinchen noch so schöpfen konnte, hat er die Schwulen geschöpft. Er wird sich was dabei gedacht haben. Die Wege des Herrn sind unergründlich, die Wege der Herren indessen äußerst vorhersehbar. Sosehr sie auch nach öffentlicher Teilhabe und Gleichberechtigung krähen, im Grunde bleiben die Schwulen doch lieber unter sich – vor allem im Urlaub. Davon lebe ich, und das gar nicht schlecht.
Mein Hotel liegt mehr oder minder im Nichts. Vor der Tür liegt die stark befahrene Küstenstraße, einen halben Kilometer weiter eine Art Autobahnkreuz, von dem die Hälfte eine immerwährende Baustelle ist. Das ist wohl die sardische Lebensart, von der die Reiseführer gerne sprechen. Hier gibt’s nicht viel. Auch keinen Strand. Hauptsächlich Felsküste, von der beliebten Costa del Sud sind wir eine Autostunde entfernt, von der berühmten Costa Smeralda mehr als zweihundert Kilometer. Aber Schwule brauchen keinen Strand. Schwule brauchen andere Schwule. Und eine Dusche, bei der man den Brausekopf garantiert abschrauben kann (sprechen Sie mich an, wenn Sie Fragen dazu haben). Beides finden Sie in meinem Hotel. Hier gibt’s so viele Schwule wie andernorts auf dieser Insel Sand. Es ist schrecklich.
Schwule bewegen sich am liebsten unter ihresgleichen. Zumindest die, die bei mir Urlaub machen, von niemand anderem spreche ich, wenn ich von »den Schwulen« rede. Es gibt andere Schwule, gewiss. Die interessieren mich aber nicht. Ich interessiere mich für die, die Gay-Travel-Magazine aufschlagen, ob Print oder im Netz, die meine Anzeigen dort lesen: »Rainbow Inn. Gay-Resort an der malerischen Südküste Sardiniens, verkehrsgünstig gelegen in der Nähe zur pulsierenden Inselmetropole Cagliari. Eigener Pool, Sauna, Cruising Area. Alle Zimmer mit Meerblick. Duschköpfe garantiert abschraubbar. 100 % gay – keine Frauen, keine Kinder.«
Dass alle Zimmer Meerblick haben, stimmt. Das Rainbow Inn liegt auf einer kleinen Landzunge. Ich habe sie für ’n Appel und ’n Ei gekauft, samt einigen Gebäuderuinen. Felsküste in dieser Lage ist nahezu wertloses Land. Der sardische Bauer, dem dieser Klumpen gehörte, konnte sein Glück kaum fassen. Letztes Jahr hat er sich besoffen totgefahren.
Das Hotel ist gut. Da lass ich nichts auf mich kommen. Das habe ich von der Pike auf gelernt. Drei Sterne superior, natürlich nach deutschem Standard. Die hiesige Standardisierung ist so belastbar wie eine italienische Nachkriegsregierung.
Vater hat mich ausgelacht, als ich mir mein Erbe ausbezahlen ließ, meinen Anteil am Zweihundert-Betten-Haus am Titisee, das längst meine ältere Schwester führt. Widerwillig hat er mir das Startkapital überwiesen, das ich brauchte für die weiteren Kredite, um ein eigenes Haus auf wertlosem Geröll in Sardinien zu errichten.
»Vadder«, hab ich gesagt. »Das hab ich von dir gelernt« – und zwar bis zum Abwinken. Als Azubi im eigenen Haus durfte ich immer nur Touristenbusladungen niedersächsischer Landfrauen einchecken. »Man muss seine Klientel kennen. Und meine Klientel ist nun mal dumm genug, in einem wertlosen Haufen Steine, eingekeilt zwischen Mittelmeer, Autobahn und dem Industriegebiet Cagliaris, ein Paradies auf Erden zu sehen.«
Ich sollte recht behalten. Seit zwölf Jahren betreibe ich das Rainbow Inn und hab ’ne Auslastung, bei der mein alter Herr Pipi in die schwachen Augen kriegt.
In der schwulen Welt läuft das eben so: Häng irgendwo ’ne Regenbogenfahne dran, und die Tunten rennen dir die Bude ein. Vorausgesetzt, du machst deinen Job gut, und das mache ich. Ich weiß, wie man mit Gästen umzugehen hat. Mögen gehört nicht dazu.
Das hab ich im Schwarzwald gelernt. Nicht von Vater, sondern vom Bauern nebenan. Kluge Bauern behandeln ihre Milchkühe gut, und seien es auch noch so dumme Rindviecher.
Auf die einschlägigen Symbole ist der gemeine Schwule durch jahrzehntelanges Community-Training perfekt konditioniert. Wenn Sie es so wollen, bin ich Rattenfänger. Ich halte die Regenbogenfahne hoch, und die darauf abgerichteten Biester folgen mir in meinen Bau, in meine Fallen. Und meine Fallen kosten ab einhundertsechzig Euro aufwärts – je nach Saison und Ausstattung. Vor- und Nachsaison sind meine Hauptsaison. Schwule verreisen nicht in den Schulferien (ausgenommen die armen Schweine, die Lehrer sind). Sie glauben, davor und danach sind die Preise günstiger. Als ob ich nicht wüsste, dass sie das glauben. Außerdem sind dann keine Kinder da. Und es gibt nicht viel, was Schwule mehr hassen als Kinder. Außer Türken und Frauen vielleicht.
Ich kann das alles freimütig zugeben. Meinem Hotel wird das nicht schaden. Meine Gäste lesen nicht, jedenfalls nicht solche Bücher wie dieses hier. Vielleicht mal ’nen Krimi, das Magazin Männer, eingefleischte Tunten die Vogue. Die Intellektuellen lesen Thomas Mann, die Großstadttypen, die im Urlaub nur vögeln und feiern wollen, lesen vielleicht mal einen schwulen Roman aus einem schwulen Verlag über schwule Großstädter, die genug gevögelt und gefeiert haben und nun die große Liebe suchen. Aber selbst die sind in der Minderheit. Schwule lesen nicht. Die beliebteste Ferienlektüre meiner Gäste ist ihr iPhone.
Wenn Sie mich nun für einen Schwulenhasser halten, haben Sie sicher recht. Aber ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selber schwul. Doch bevor Sie heiter drauflos psychologisieren: Mit Selbsthass hat das nichts zu tun. Ich bin mit mir im Reinen und mag mich. Ich mag nur die Schwulen nicht, die sich hier in meinem Haus einnisten.
Warum ich dann ein Hotel für Schwule betreibe? Nun, es ist einfach ungemein lukrativ. Denn es gibt nur eine Sache, die Schwule noch mehr lieben als sich selbst und überall rumzupimpern: sich ausnehmen zu lassen.
ILKA
Er hat mich gefragt, ob ich eine Biofrau bin!
Da stehe ich tropfnass vor ihm an der Rezeption und erkläre diesem Superschwüppi in seinem hübschen Anzug, in seinem hübschen trockenen Anzug, lang und breit und möglichst dramatisch, dass ich gerade mit meiner Karre liegengeblieben bin, Motor kaputt – Klong und heftiges Schleifen, dann abgesoffen und Ende im Gelände. Gelände gleich Straße mit heftigem Gewitterregen um kurz vor elf. Vielleicht ist die Karre auch nur einfach im wörtlichen Sinne abgesoffen. Motor aus dem Kühler weggespült, spontane Turboverrostung, was weiß ich. Es machte weiß Gott keinen Spaß, nachts auf dieser verfickten Küstenstraße abzusaufen, in Dennis’ verficktem Drecksauto, in diesem verfickten Gewitterregen! Seit Stunden kübelte es wie aus Eimern, kaum war das Gewitter abgezogen, machte es dem nächsten Platz, dessen Regenfäuste einem wieder so richtig schön in die Fresse schlugen!
Mir läuft also die Suppe nur so aus den Haaren, und was macht die blöde Tresentunte in ihrem hübschen, trockenen Anzug? Fragt, ob ich eine Biofrau bin!
»Biofrau?«, hab ich gefragt. Herrgott, ich war scheiße nass! Aber ich sah doch nicht aus wie ’ne Ökotussi vom Bioland-Hof! Wie diese Uschi bei uns auf dem Wochenmarkt am Stand von Biohof Schlagstiertot-Abersanft. Senffarbene Kleidung aus naturgefuchteltem Flachs oder gedrechseltem Hanf, Frisur aus Makramee und ihr Deo aus Kartoffelblüten selbst extrahiert. Das ist ’ne Biofrau. Aber ich doch nicht!
Ich muss geguckt haben wie Dennis’ kaputtes Auto, jedenfalls fragte mich dieses Ding am Tresen doch allen Ernstes, ob ich eine biologische Frau sei, und ich hab geantwortet: »Nein! Ich bin ein Android von der Enterprise und nur aus dem Regen geflohen, damit ich nicht roste.«
Ich solle nicht so sarkastisch sein, sie seien eben ein Gay-Resort und auf die schwule Community als Kundschaft spezialisiert, Transvestiten und Transgender wär’n natürlich willkommen, aber bei biologischen Frauen könne er leider nichts machen.
Dass er bei mir nichts machen könne, sei mir schon klar, erwiderte ich, aber danach stehe mir gerade eh nicht der Sinn. Von Männern hätte ich einstweilen die Schnauze gestrichen voll.
Das tue ihm sehr leid, sagte er da, auch für Lesben sei sein Gay-Resort leider nicht offen.
Wie er denn jetzt drauf komme, dass ich Lesbe sei, habe ich gefragt.
Weil, dazu schaute er verwirrt aus der Wäsche, und es bestätigte sich wieder einmal, dass Schwule mit dem anderen Geschlecht eigentlich immer überfordert sind, das hätte ich doch eben gesagt.
»Nichts habe ich gesagt!«, habe ich gerufen, »Ich habe mich gerade von meinem Mann getrennt!« Die Lust auf Männer gehe mir gerade maximal bis zu den Fußsohlen, und außerdem sei ich gerade sehr gut darin, Männer anzuschreien. Ob er das wolle? Oder ob er sich nicht erbarmen und wenigstens nachschauen könne, ob noch ein Zimmer frei sei, nur für eine Nacht, denn wenn nicht, könne ich mir’s sparen, ihn weiter anzupampen.
Kein Problem, meinte er, ein paar Zimmer seien bestimmt frei, sei ja Hauptsaison auf Sardinien und weniger los, aber sie seien nun mal ein Gay-Resort.
Dann solle er bitte so tun, als ob ich Transe wäre, habe ich gesagt, ich könne sogar den Text von It’s Raining Men auswendig, zumindest den Refrain. Da musste er auf einmal lächeln und erwiderte: »Na ja, für eine Nacht …«, aber er wolle sicherheitshalber kurz mit seinem Chef sprechen.
»Gut so«, sagte ich. »Tun Sie das, ich hol nur schnell die Kinder.«
Da bin ich wieder rausgerannt in den Regen, die Tresenschnitte guckte mir nach wie ’ne blöde Kuh, wenn’s donnert. Und es donnerte tatsächlich gerade, und ich hab gemacht, dass ich zurück zum Auto kam, wo Felix sich wahrscheinlich schon eingekackt hatte vor Angst.
HELMER
»Guten Tag, ich bin transsexuell, und das sind meine beiden Kinder Thea und Felix, ihre Biomutter arbeitet auf einem Biobauernhof bei Hildesheim, ich habe mich gerade von meinem Kerl getrennt, einem Biomann, hatte ’ne Autopanne und möchte ein Hotelzimmer!« Die klatschnasse Biofrau mit dem klatschnassen Kind auf dem Arm und der klatschnassen Tochter daneben schaute mich herausfordernd an. Gemeinsam tropften sie mir das Foyer voll. Ich durfte nachher nicht vergessen, Gregor aufzutragen, hinter dieser familiären Flutkatastrophe einmal herzufeudeln. Schadet ihm weiß Gott nicht, tut in dieser Schicht ja eh nichts anderes, als dekorativ am Tresen rumzustehen und auf dem Hotelrechner mit seinem Fickfreund in Olbia zu chatten.
»Dass Sie nass sind, sehe ich«, habe ich gesagt. »Ansonsten glaube ich Ihnen kein Wort.«
»Das mit der Panne stimmt«, sagte das Mädchen. Alter schwer zu schätzen, wahrscheinlich schon zweistellig, Post-Lillifee jedenfalls.
Die klatschnasse Frau nickte. »Ich weiß, wir passen nicht hierher, aber wo sollen wir denn hin? Ihr Rezeptionist meinte, Sie hätten noch Zimmer. Es ist ja nur für eine Nacht.«
Ich schaute Gregor an. Der hob entschuldigend die Schultern: »Sorry, aber ich hab ihr erklärt, dass wir ein Gay-Resort sind!« Angewidert deutete er auf die beiden Kinder. »Und die wollte sie uns dann einfach unterschieben.«
Ich betrachtete die tropfende Familie. Die Frau hatte den Jungen auf dem Arm. Im Grunde war er zu alt dafür, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, schmächtig, aber zu schwer. Er sah erschöpft aus. Sie auch. Draußen krachte wieder ein Donner, und der Junge zuckte sichtlich zusammen.
»Hast du Angst vor Gewittern?«, fragte ich ihn. Er nickte scheu.
»Die klingen hier immer viel schlimmer, als sie sind«, sagte ich. »Wegen der Berge.«
Dieselbe Chose wie im Schwarzwald. Der Donner kommt mit seinen großen Brüdern, den Echos von gegenüber, die jedoch nur brüllen können. Der Bauer von nebenan hatte es mir erklärt, nachdem er mich mal als heulendes Bündel in seiner Tenne gefunden hatte.
Immer noch geschockt betrachtete Gregor die triefende Kleinfamilie, als hätten sich wilde Tiere in das Foyer verirrt und auf den Marmor geäpfelt.
»Hundertachtzig für eine Nacht mit Frühstück, Frühstück bis elf. Kinderbetten haben wir nicht, Sie müssen mit einem Kingsize klarkommen«, sagte ich, und Gregors Augen weiteten sich erschrocken.
Natürlich würden sie mit einem Kingsize klarkommen. Wo in gewisser Regelmäßigkeit drei Männer reinpassen, sollte Mutti auch sich und die beiden Blagen einparken können. »Alle Betten ausgestattet mit komfortablen Granlit-Matratzen (ohne Besucherritze)«, steht in meinem Prospekt, »Zimmer 23–28 sogar mit Wasserbett (50€ Zuschlag pro Nacht)«.
»Zusätzliche Bettwäsche und Handtücher legt Gregor Ihnen gleich raus.«
Gregor nickte gequält, vielleicht auch, weil gerade die Chatbimmel am Rezeptionsrechner ging.
»Was war das?«, fragte ich scheinheilig, und Gregor wurde rot. »Nichts, da ist nur ’ne E-Mail gekommen.«
Gregor ist ein schlechter Lügner, den sollte man eigentlich nicht an der Rezeption beschäftigen. Da sollten nur gewiefte Lügner Dienst tun. Aber Schwule wollen Deutsche an der Rezeption. Und knackige Sarden auf den schlecht bezahlten Stellen, Zimmerservice und Barpersonal, Poolboy. Sprich, überall dort, wo sie wuseln und man auf Ärsche schauen kann, aber an der Rezeption bitte einen strohblonden Volksfreund mit blauen Augen und attraktiver Fönwelle. Gregor hatte seinen Kopf ein paarmal zu oft geföhnt, deshalb fährt er bei mir meist die Nachtschicht und Andreas die Tagschicht. Andreas hat mehr drauf, auch auf den Hüften. Das muss er durch Freundlichkeit kompensieren. Zeigen Sie mir einen dicken Schwulen, der nicht total nett ist. Andreas ist meine Charmeschleuder, und wenn’s drauf ankommt, ein gewiefter Lügner. Ich überlasse ihm gerne die Tagschicht.
»Gregor gibt Ihnen gleich den Schlüssel. Haben Sie Gepäck?«
Die Frau nickte. »Das kann aber auch im Auto bleiben, bei dem Regen.«
»Kommt nicht in Frage. Gregor hilft Ihnen ohne Zweifel gerne, es aus dem Auto zu holen.«
Ich gestattete mir ein Lächeln. Gregor schaute, als müsse er gleich in den Gewitterregen raus. Was auch stimmte. Nachts checkt so gut wie nie jemand ein, da bezahl ich doch keinen Pagen. Das lohnt bei so einem kleinen Haus nicht.
Ich lächelte. »Geh ruhig mit der Dame mit, Gregor. Ich bleib so lange an der Rezeption und schau mal, was für eine E-Mail da gerade gekommen ist.«
Gregor warf mir einen herrlich hilflosen Blick zu. Seinen Chef vom PC wegschubsen konnte er ja schlecht. Also fügte er sich in sein Schicksal. Die Frau stellte den halbschlafenden Felix neben seine Schwester und sagte: »Bin gleich wieder da!« Dann watete sie mit Gregor hinaus ins tosende Gewitter.
In das aufgeploppte Chatfenster auf dem Rezeptionsrechner tippte ich hinein: »Gregor is temporarily not available. Please call again later. PS: Er ist dann sicher gut feucht.«
Dann schloss ich alle Fenster bis auf das Hotel-Programm.
Der Junge hielt sich an seiner Schwester fest und zuckte noch immer bei jedem Donner zusammen.
»Ich bin Thea, und wer sind Sie?«, fragte das Mädchen.
»Ich bin Helmer Klotz und Chef«, antwortete ich.
»Danke, dass wir hier schlafen dürfen, Herr Klotz.«
Ich nickte.
TAG 2
THEA
»Mom? Wieso schauen uns die alle so komisch an?«, fragte ich Mom, weil die uns alle so komisch anschauten.
»Hab ich dir doch erklärt«, antwortete Mom, »die sind alle schwul.«
Aber Mom hatte auch gesagt, dass Homosexuelle ganz normale Menschen sind. Aber wie normale Menschen guckten die alle gerade nicht. Normale Menschen gucken anders, wenn sie uns sehen, nämlich nicht besonders, sondern eher gar nicht.
Dann schrie Felix: »Es gibt Schokocroissants!«
Er riss sich von Mom los und stürmte zum Buffet. Ein Mann ließ daraufhin seine Tasse fallen und kreischte. Vielleicht kreischte er auch erst und ließ dann die Tasse fallen, weiß ich nicht mehr.
Jetzt schauten uns wirklich alle an.
»Guten Morgen«, nuschelte Mom und zischte mir zu: »Wir verhalten uns einfach ganz normal.« Dabei erinnerte sie mich an diese Leute in den Kinderkrimis, die ich aber nicht mehr lese, weil ich jetzt echte Krimis lese. Die Leute in den Kinderkrimis machen sich damit in ungewöhnlichen Situationen Mut. Aber hinterher fallen sie doch auf. Wie wir gerade. Kinderkrimis sind voll unrealistisch.
Aus dem Alter bin ich raus. Deshalb sage ich zu Mom auch »Mom« und nicht mehr »Mutti«. Mom gefällt das nicht, aber da müssen Mütter durch, wenn Kinder erwachsen werden. So ist das eben. Ich finde, »Mom« klingt erwachsener. Mom sagt, das klingt albern und amerikanisch. Das ist mir egal. Ich bin kein Kind mehr, und Mom weiß das auch. Ich kann jederzeit meine Tage bekommen. Als ich das mal zu Mom gesagt habe, ist sie rot angelaufen, wütend geworden und hat gemeint, mit der Scheiße kann ich mir ruhig noch ein paar Jahre Zeit lassen. Meine seltsamen Launen wär’n auch so schon schwer zu ertragen.
Der Mann mit der Tasse war wohl auch gerade in einer seltsamen Laune. Mein Bruder kann wirklich ganz schön nervig sein, aber diesmal hatte Felix echt nichts getan. Er hat sich nur ein bisschen vorgedrängelt, aber das dürfen Kinder ja. Meistens rufen Erwachsene dann, dass Felix total niedlich ist, und gucken ihn an, als wollten sie ihm durch die blonden Haare strubbeln. Aber das tun nur alte Frauen, andere tun das nicht mehr, wegen Missbrauch. Ich mach das natürlich schon manchmal, denn Felix hat total schöne, blonde Haare, meine hängen nur blöd runter. Ich würde sie mir gerne blondieren, damit ich auch so schöne Haare habe wie Felix, aber Mom erlaubt mir das nicht. Und Felix mag es auch nicht, wenn man ihm durch die Haare strubbelt. »Bring meine Frisur nicht durcheinander«, kreischt er dann immer. Deshalb mach ich das nur, wenn ich ihn ärgern will.
Manchmal glaube ich, dass Felix und ich gar keine Geschwister sind, weil wir so unterschiedlich aussehen. Aber Mom sagt, wir sind auf jeden Fall Geschwister, doch wir sollten uns ruhig mal die anderen Kinder in der Stadt genau angucken. Da wären vielleicht noch ein paar Halbgeschwister bei.
Das hat Mom natürlich nur zu mir gesagt und nicht zu Felix. Und sie war auch gerade sehr wütend auf Dad. Ich glaube, sie meinte, dass Dad vielleicht noch mit anderen Frauen Kinder gemacht hat, was ich ziemlich unmöglich finden würde. Mom, glaube ich, auch.
Meine Eltern streiten sich oft, aber so wie gestern haben sie sich noch nie gestritten. Mom hat Felix und mich abends ins Auto gesetzt, und wir sind ratzfatz losgefahren. Sonst braucht sie immer zwei Tage, um zu packen, diesmal ging es ganz schnell. Wahrscheinlich haben wir ein paar Sachen vergessen. Die muss Dad später mitbringen.
Vielleicht bin ich auch bald ein Scheidungskind. Wie die anderen in meiner Klasse. Meine Freundin Lena hat gesagt, bei ihren Eltern fing das auch so an. Dabei glaube ich, dass Dad meine Mom noch mag, obwohl sie sich so gestritten haben. Auf jeden Fall hat Dad mir in der letzten Nacht eine SMS geschrieben, dass ich Mom sagen soll, dass es ihm leidtut, sie mal ans Handy gehen soll und wir bitte schön zurückkommen sollen. Ich hab ihr noch nichts von der SMS erzählt, und zurückfahren können wir gar nicht, weil unser Auto kaputt an der Straße steht und wahrscheinlich in dieser Nacht vollgelaufen ist. Und wenn Mom meint, dass Dad große Scheiße gebaut hat, glaub ich ihr das. Da können wir Dad ruhig ein wenig schmoren lassen.
Ich bin erst mal zum Buffet gegangen und hab mir ein Croissant und etwas Aprikosenmarmelade geholt. Bei mir ließ niemand eine Tasse fallen. Aber komisch geschaut haben sie trotzdem alle. Ich hab dann einfach voll komisch zurückgeguckt. Das kann ich gut. Felix musste jedenfalls lachen.
HELMER
»Ihhh, ein Kind!«
Eine von den Gastschwuppen kreischte panisch, als wäre ihr gerade eine Kakerlake über die Dolce&Gabbana-Flipflops gekrabbelt. Hektisch hielt sich das blondierte Ding an seinem Begleiter fest. »Boris! Da ist ein Kind!«
Es klang wie eine Aufforderung draufzutreten. Was für besagten Boris kein Problem darstellen würde, da er in etwa über die Figur und die Durchschlagskraft eines SUV verfügte. Und denselben Intellekt.
Die blondierte Schwuppe, ich glaube Raffael mit Namen, seit fünf Tagen eingecheckt, stand mit ihrem Muskeltransporter am Eingang des Frühstücksraums und spielte gekonnt auf der Zither der Zickigkeit. Ihr demonstratives Entsetzen war stimmlich genau so dosiert, dass es als privat gelten musste, es jedoch alle gerade so verstehen konnten. Drama-Queen-Regel Nummer eins: Verspritze dein Gift nie so, dass Menschen etwas abbekommen. Lass sie es einfach nur riechen, dann können sie es sich nicht abwaschen, stattdessen packt sie Furcht.
Oder Wut. Gregor stand bei der Frau und gestikulierte auf sie ein, während sich über ihrem Kopf schon eine Gewitterwolke des Zorns zusammenbraute. Dann erblickte er mich. »Helmer, es hat Beschwerden gegeben – von Gästen. Wegen … Sie wissen schon … dem Kind und …« Er suchte nach Worten. Man sah, wie sein übernächtigtes blondes Hirn in der Kammer mit den bösen Wörtern kramte … »der Familie«.
Ich blickte zum Tisch, an dem die beiden Kinder Grimassen schnitten und die Biofrau in gespannter Angriffsstellung saß, bereit, jeden Moment hochzuschnellen wie eine Springteufelin. Sie machte ein Gesicht wie meine Mutter, bevor sie wegen meiner Mathematiknote zu meinem Grundschullehrer aufgebrochen war, um ihn auf seine Affäre mit ihrer Chorkollegin anzusprechen. Viele Gesichtsausdrücke meiner Mutter sind mir nicht in Erinnerung, dieser schon. Vermutlich weil ich überraschend doch versetzt wurde.
»Was besagen die Beschwerden?«
»Na ja«, erläuterte Gregor, »im Kern, dass sie hier sind.«
»Und wie viele Beschwerden sind es?«
Gregor druckste herum: »Eine«.
Drama-Queen-Regel Nummer zwei: Auch wenn du in Mathe immer ’ne Niete warst: Multipliziere! Hilft nicht immer, denn eins kann man, so oft man will, mit eins multiplizieren, es ändert nichts am Ergebnis.
»Eine. Und wie lautet die?«
»Nun, ein Gast erkundigte sich, woher das Kind kommt.«
»Das ist eine Frage, Gregor. Keine Beschwerde.«
»Aber dem Tonfall nach …«
»Wie halten wir das sonst am Tresen?«
Gregor wurde kleinlaut. »Beschwerden sind es erst, wenn sie auch als Beschwerden vorgetragen werden.«
Gewiss, eine solche Regelung ist eines anständigen Hoteliers im Grunde unwürdig, aber was soll man tun. Ich betreibe ein Haus für homosexuelle Männer, Meckern gehört da zur Etikette. Und dann sind diese Homosexuellen auch noch überwiegend Deutsche. Das ist Meckern hoch zwei. Da lernt man irgendwann zu differenzieren. Das ist nicht unhöflich, das ist Notwehr.
»Und was soll ich sagen, wenn die Frage noch einmal gestellt wird?«
»Was weiß ich. Sag ihnen, sie sind persönliche Gäste des Chefs.«
»So so. Sind sie das?«
»Gregor, ich kümmere mich drum.«
ILKA
Unglaublich! Da kommt mein Liebling von der Rezeption anscharwenzelt und bittet darum, uns doch nicht so auffällig zu verhalten, es hätte schon jede Menge Beschwerden gegeben.
»Nicht so auffällig? Was meinen Sie damit?«, habe ich ihn gefragt, da hat er rumgedruckst und erklärt: »Nun, unsere Gäste sind so was nicht gewöhnt«, und ich hab gefragt, ob er mit »so was« etwa meine Kinder meine. Oder mich, oder gar uns alle. Daraufhin kam er wieder mit seiner Leier, sie seien halt ein Gay-Resort, da erwarteten die Gäste keine Kinder zum Frühstück. Und ich daraufhin, das sei ja noch schöner, meine Kinder gäb’s hier nicht zum Frühstück. Aber den Spruch hat leider nur Thea kapiert, ich war schon ein bisschen stolz, als sie losprustete. Am Nebentisch lachte ein rothaariger, junger Mann auf, immerhin. Nur Schwüppi hat natürlich nichts gecheckt, schon gar nicht seinen sprachlichen Fauxpas, meinte jedoch, genau das, er deutete auf die lachende Thea, das sei eben unangemessen.
»Das ist bloß ein lachendes Kind«, klärte ich ihn auf.
»Ich bin kein Kind mehr!«, warf Thea ein.
»Das denkt sie«, sagte ich zu dem Rezeptionsbürschchen, woraufhin Thea protestierte und prompt Felix losgiggelte, weil Thea ihm gegenüber immer voll auf erwachsen macht. Der Disput mit dem Tresenboy drohte, mir gerade zu entgleiten.
»Ich bin Teenager«, beharrte Thea.
»Ach, nee?«, blaffte ich sie an. »Weil du neulich stolze eleventeen geworden bist?«
Superschwüppi schnappte derweil ein paar Mal nach Luft, fing sich wieder und zischte uns zu: »Check-out ist um elf«, und machte die Biege. Beim Wörtchen »Check-out« atmeten ein paar Männer im Raum hörbar auf.
Draußen vorm Speisesaal sah ich Schwüppi aufgeregt mit seinem Chef gestikulieren. Hatte was von Ausdruckstanz. Gerade mimte er einen sterbenden Schwan, der von einem Wolf zerfleischt wurde.
Kaum war er damit fertig, hatte ich den Chef auch schon bei mir am Tisch sitzen. Na super, das war ja ein wirklich entspanntes Frühstück!
Allerdings hatte er höflich gefragt, ob er sich zu mir setzen dürfe, und dabei sogar die Kinder angeschaut, die plötzlich verschüchtert nickten.
»Ich weiß nicht, inwieweit wir uns heute Nacht schon vorgestellt haben. Helmer Klotz. Mir gehört dieses kleine Etablissement. Haben Sie gut geschlafen?«
»Ja«, sagte ich.
»Mama, was heißt ›Etablissement‹?«, fragte Felix.
»Das ist …«, was weiß ich! Ich bin Schulsekretärin, keine Deutschlehrerin. Wie erklärte man so was am besten? Lehrer können erklären. Ich kann nur Lehrern was erklären.
»Etwas, wo man hingeht und Zeit verbringt«, sprang mir Herr Klotz bei. »Ein Hotel, ein Café oder dieses Gästehaus.«
»Oder deine Schule«, funkte Thea dazwischen. Himmel hilf, hoffentlich merkte Felix sich das Wort nicht! Ich malte mir schon die Debatten mit seiner Grundschullehrerin aus: »Frau Tänzer, der Felix hat heute Morgen gesagt, ich zitiere wörtlich, ›im Etablissement der 1c fehle etwas Pink‹. Können Sie sich vorstellen, woher er das Wort hat?«
Als wäre Felix’ Rosafimmel nicht für sich schon schwierig genug zu erklären! Aber es ergäbe durchaus ein stimmiges Bild. »Ach, wissen Sie, Frau Bender, ich betreibe im Heizungskeller unserer Schule ein kleines Privatbordell für Lehrkörper und Oberstufe, und immer wenn Felix ungezogen war, muss er dort die Kissen aufschütteln.«
Herr Klotz trug übrigens auch Rosa. Aber sehr dezent, ein Hemd, dazu eine dunkle Jeans, darüber ein lockeres schwarzes Sakko. Ich schätzte ihn auf knapp fünfzig, Haare schon etwas schütter und eine kleine Platte am Hinterkopf, aber trotz leichtem Bäuchlein alles in allem durchaus ansehnlich. Natürlich sehr gut gebräunt. Im Grunde eine gute Partie, mir würden mindestens zwei Lehrerkolleginnen bei uns einfallen, die sich um eine gemeinsame Pausenaufsicht mit ihm reißen würden, ach was, prügeln. Und ein Kollege.
Die Falten in seinem Gesicht wirkten allerdings ein wenig streng. Vielleicht ging von ihnen die Autorität aus, die er offenbar in den ganzen Frühstücksraum ausstrahlte. Es klingt bescheuert, aber ich bin mir sicher: Sobald er an unserem Tisch saß, wurden die argwöhnischen Blicke im Raum stiller! Vorher hatten sie gezischt.
In die Stille der verstummten Blicke hinein rappelte auf einmal mein Handy.
»Ihr Handy klingelt«, sagte Herr Klotz mit jenem Unterton, der Geduld simulierte, aber eigentlich nur ausdrückte, dass er sich seine Gutmütigkeit schon vor Jahrzehnten abtrainiert hatte. Sechzigjährige Physiklehrer sprechen so.
Obwohl ich nicht aufs Handy zu schauen brauchte, um zu wissen, wer es war, tat ich es dennoch. Vielleicht rief ja der Pannendienst zurück, mit dessen Callcenter-idioten ich mich vorhin irgendwo zwischen Auslandseinsatz, »Plus-Mitgliedschaft« (hatten wir die? Ich glaube schon), Fahrzeughalter, fehlender ADAC-Clubkarte (bei Dennis im Portemonnaie) und Kfz-Kennzeichen verheddert hatte. Scheißdreck, ich konnte mir die Ziffern von unserem Kennzeichen noch nie merken. Ich fuhr die Karre ja so gut wie nie. »Dann schauen Sie doch in den Fahrzeugschein«, hatte der Typ gesagt. »Geht nicht, der steckt ebenfalls bei meinem zukünftigen Exmann im Portemonnaie«, gab ich zurück. Dann schwiegen wir eine Weile, bevor der Typ sagte, ich solle vielleicht erst meine Ehe reparieren, bevor ich mich des Wagens annähme. Daraufhin bin ich ausgerastet, hab ihn angeschrien, er solle sich seine Scheißwortwitze sparen, ansonsten könne er gleich weitermachen, denn mein Mann sei ja wie er ein Profi im Abschleppen, harhar! Da hat sich der Callcenteridiot tausendmal entschuldigt und versprochen, er sehe mal, was er tun könne. Ich solle aber bitte in der Zwischenzeit rausfinden, wo genau ich liegengeblieben sei. »Irgend so eine Scheißstraße auf Sardinien« sei doch etwas zu unkonkret für den lokalen Abschleppservice. Erst nach dem Auflegen fiel mir ein, dass das Auto ja nur ’nen halben Kilometer entfernt an der Straße stand; dort hätt ich das Kennzeichen ja problemlos nachschauen können.
ENDE DER LESEPROBE