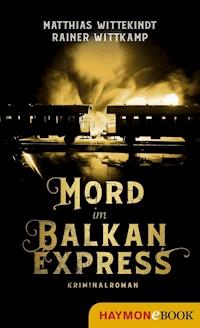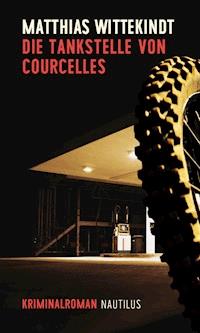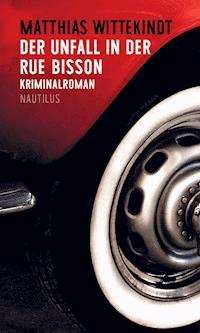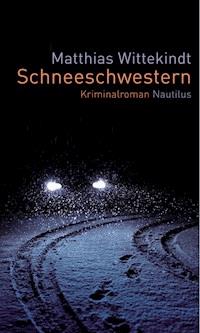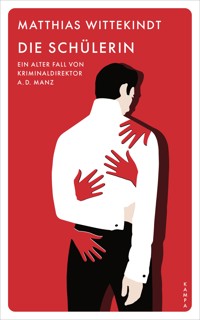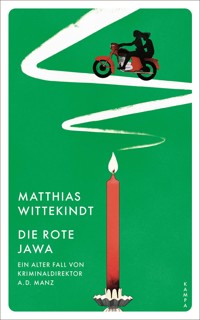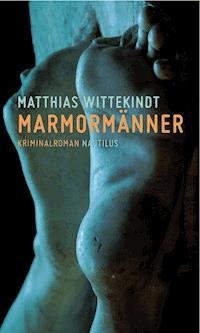9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Craemer-und-Vogel-Reihe
- Sprache: Deutsch
Deutsches Kaiserreich, 1910. Die Welt wird täglich komplexer. Um dem Rechnung zu tragen, hat der Große Generalstab einen eigenen Geheimdienst ins Leben gerufen. Als bei einem dramatischen Zugunglück in der Nähe von Wiesbaden mehrere Menschen ums Leben kommen, deutet einiges auf eine Verstrickung ausländischer Agenten hin. Major Albert Craemer, Leiter der Abteilung Spionage Frankreich, und seine Mitarbeiterin Lena Vogel beschließen, den Vorfall persönlich vor Ort zu untersuchen – und stechen in ein Wespennest aus Spionage, Kriegstreiberei und wirtschaftlichen Interessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DASBUCH
An einem Bahnübergang nahe dem kleinen Ort Bingen am Rhein kollidiert ein Renault mit einem Güterzug. Bei der Untersuchung des Vorfalls macht die örtliche Polizei eine schreckliche Entdeckung: Der Fahrer des Unfallwagens wurde unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit je zwei Schüssen in Kopf und Brust regelrecht hingerichtet.
Kurz darauf wird in Bonn der Chemiestudent Frank Grimm ermordet – erschossen nach demselben Muster. Die militärische Präzision der Taten ruft den erst kürzlich aufgewerteten Preußischen Geheimdienst auf den Plan. Findet hier möglicherweise eine feindliche Geheimoperation mitten im Deutschen Reich statt?
Als schließlich auch die geplante Überführung von drei französischen Flugapparaten ins Reichsland Elsaß-Lothringen im Desaster endet, droht eine handfeste außenpolitische Krise. Die Agenten Albert Craemer und Lena Vogel sind entschlossen, die Fäden zu entwirren – notfalls mit unkonventionellen Methoden.
DIEAUTOREN
Matthias Wittekindt, geboren 1958 in Bonn, aufgewachsen in Hamburg, ist Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Kriminalromanen. Seine Werke wurden mit dem Kurd-Lasswitz-Preis, dem Berliner Architektenpreis sowie zweimal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Matthias Wittekindt lebt in Berlin.
Rainer Wittkamp, geboren 1956 in Münster, arbeitete bereits zu Studienzeiten für diverse Film- und Fernsehproduktionen und schrieb im Lauf der Jahre Kriminalromane, Kurzgeschichten und mehrere Hundert Drehbücher. Rainer Wittkamp starb im Dezember 2020, kurz vor Fertigstellung des Manuskripts von Fabrik der Schatten.
MATTHIAS WITTEKINDT
RAINER WITTKAMP
FABRIK
DER
SCHATTEN
KRIMINALROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 07/2022
Copyright © 2022 by Matthias Wittekindt und Rainer Wittkamp
Copyright © 2022 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Lars Zwickies
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,
unter Verwendung eines Motivs
von Vintage Germany/Sig. Uwe Ludwig
Innenklappe (U2/U3): Karte »Europa 1910«:
Das Illustrat unter Verwendung eines Motivs
von Cartarium/Shutterstock;
Innenteilkarte [>>]: Karte »Reichsland Elsaß-Lothringen«:
Das Illustrat unter Verwendung eines Motivs
von Piotr Przyluski/Shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-26716-2V002
www.heyne.de
Ich möchte hier an meinen Freund und
Co-Autor Rainer Wittkamp erinnern,
der am 29. Dezember 2020 gestorben ist.
Noch immer sehe ich uns beide hinter den Geranien
auf meinem Balkon oder in Rainers Wohnung
nebeneinandersitzen, überlegen und schreiben.
Amüsiert.
Völlig d’accord.
Völlig im Widerspruch.
Und immer haben wir einen Weg gefunden,
der für uns beide der richtige war.
Ich denke nicht ständig, aber doch sehr lebendig
an diese Situationen und an einen Freund.
Die hier vorliegende Geschichte, Fabrik der Schatten,
haben Rainer und ich noch gemeinsam geschrieben.
Matthias Wittekindt, Berlin im März 2022
Als sein Agent, kann ich nur sagen und wiederholen:
Es war mir eine Ehre, lieber Rainer!
Dein Elan, Deine guten Texte,
die wunderbaren Streitereien und Eklats mit Dir und um Dich,
dass ich dank Dir Matthias kennenlernen durfte,
Unsere gemeinsame Begeisterung für Musik,
Deine Ideen,
Du fehlst.
Lars Schultze-Kossack
PERSONENVERZEICHNIS
Die wichtigsten Figuren in der Reihenfolge ihres Auftretens
Albert Craemer, Major, Leiter der Abteilung Spionage Frankreich
Gottfried Lassberg, Oberst, Leiter der Abteilung Inlandspionage
Ferdinand Kurzhals, Hauptmann, stellvertretender Leiter der Inlandspionage
Josephine Sonneberg, Telegrafenschreiberin
Frank Grimm, Chemie-Doktorand und Weltverbesserer
Heinrich Kessler, Chemiestudent
Ludwig Schädelbauer, Chemiestudent
Lena Vogel, Agentin des militärischen Geheimdienstes
PaulBrinkert, stellvertretender Polizeipräsident der Rheinprovinzen
Pankraz Schütte, Gendarm bei der Binger Polizei
Gustav Nante, Leutnant, Flieger und Agent des militärischen Geheimdienstes
Berthold Stielke (eigentlich Maurice Demoulin), Flieger
Enno Huth, Luftfahrtpionier, Besitzer der Albatros-Werke
Simon Brunnhuber, Flugpionier
Carl Wilhelm von Eisleben, Bankier aus Wiesbaden
Professor Dr. Leo Davidsohn, Chemieprofessor an der Universität Bonn
Helmine Craemer, Albert Craemers Gattin, Chefin einer Spirituosenfabrik
1910, BINGEN/DEUTSCHES KAISERREICH
Der Bahnübergang lag so still da, so bläulich und kalt, dass er wie ein Gemälde wirkte. Da die Gleise das Licht des Mondes reflektierten, konnte man ihrem Verlauf zwischen den Weiden ein gutes Stück weit mit den Augen folgen. Die Strecke beschrieb hier einen eleganten Bogen und war, wie in späteren Vernehmungen mehrfach betont wurde, gut einsehbar.
Man hörte die beiden Cabriolet-Limousinen lange bevor man sie sah. Sie waren noch etwas entfernt, als die Lichter der Lokomotive hinter einem Wäldchen aufblitzten. Während der Güterzug dem vorgegebenen Bogen zwischen den Weiden folgte, näherten sich die beiden Automobile mit hoher Geschwindigkeit dem Bahnübergang.
Lokführer Fritz Eucken kannte die Strecke wie seine Westentasche. Trotzdem kam er seiner Pflicht nach und lugte hin und wieder nach vorne, wobei er sich seitlich aus dem Fahrerstand lehnte. Anders ging es nicht, da das kleine Bullauge in Fahrtrichtung ständig verrußte. Die Strecke war frei, in einer guten halben Stunde würden sie in Wiesbaden sein.
Während die Lok stampfte und der Heizer hinter ihm schippte, hing Eucken dienstlichen Gedanken nach. Der Bremser im Bremserhäuschen am letzten Wagon schlief vermutlich. Das war zwar gegen die Vorschrift, beunruhigte Eucken aber nicht weiter. Hier im flachen Gelände wurde ein Bremser nicht gebraucht. Euckens Augen tränten etwas im Fahrtwind. Ein Gefühl, das er mochte, da es für ihn der spürbare Teil seiner Pflicht war. »Augen wie Leder«, hatte mal ein anderer Lokführer zu ihm gesagt, als es um Tränen ging. Eucken hatte sofort gewusst, was er meinte.
Alles lief, wie es laufen sollte, das Leben war nach Euckens Dafürhalten letztlich auch nichts anderes als ein durchstrukturierter Fahrplan.
Doch in dieser Nacht folgte das Leben keinem verlässlichen Plan. Zwischen den vereinzelten Gebäuden neben der Strecke blitzten plötzlich Lichter auf, die sich schnell Richtung Bahnübergang bewegten.
Der Fahrer der ersten Limousine sah die Lok sofort, als sie am letzten Haus vorbeifuhren.
»Merde!«
Von dem schnell ausgestoßenen Fluch abgesehen, sagte er nichts. Es war überflüssig. Er wollte nicht sterben. Aber er würde sterben, wenn er auf die Bremse trat und das Verfolgerfahrzeug sie einholte. Der Mann neben ihm hatte denselben Gedanken, sprach ihn nur anders aus.
»Allez! Allez!«
Eine überflüssige Anweisung. Der Fahrer hatte das Gaspedal bereits bis zum Bodenblech durchgetreten.
Die rechte Hand seines Beifahrers kam hoch, suchte nach etwas, woran sie sich festhalten konnte, doch das verdammte Renault-Cabriolet hatte ja nicht mal ein Dach. Er berechnete die Entfernungen, glich sie mit seinem Gefühl für die Geschwindigkeit ab. Die Lok war noch wenigstens hundertfünfzig Meter vom Übergang entfernt, und sie waren gleich rüber.
Als der Lokführer Fritz Eucken die Autos sah, fluchte er. Nur ganz leise. Er reagierte in Sekundenschnelle. Richtig und vorschriftsmäßig, wie spätere Untersuchungen ergaben.
Die Lok gab einen wütenden, lang anhaltenden Ton von sich, ein grässliches Geräusch von Metall auf Metall ertönte. Es war dieses Kreischen, das alles entschied.
Der Fahrer erschrak, ein fehlgeleiteter Überlebensinstinkt zwang ihn nun doch dazu, den Fuß vom Gas zu nehmen. Er hatte vermutlich noch vorgehabt, auf die Bremse zu treten, doch dafür blieb nicht das kleinste Fitzelchen Zeit zwischen dem Moment des Erschreckens und dem Tod.
Die Lok erwischte die Limousine mit einem brutalen Schlag gegen die Kühlerhaube, und das Cabriolet wurde mit einer solchen Wucht herumgeschleudert, dass das Genick des Fahrers augenblicklich brach.
Sein Beifahrer hatte nicht das Glück, schnell zu sterben. Er wurde aus dem Wagen geschleudert, flog durch die Luft, landete in flachem Winkel auf dem Bahndamm, federte hoch, ging erneut zu Boden, rollte wie ein tolldreister Junge ein Stück über das frisch gesenste Gras neben den Schienen. Zuletzt lag er so, dass ihm die Wagons, einer nach dem anderen, über die vordere Hälfte seiner Füße rollten. Der Schock. Das Adrenalin. Er spürte es nicht einmal. Seine hart auf die Wunde aufgepressten Stiefel verhinderten, dass er verblutete.
Die Lokomotive war zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig mit ihrer Arbeit. Die kinetische Energie, das Trägheitsmoment, kam zur Wirkung. Das schwarze Ungetüm schleppte die funkenspeiende Limousine weiter neben sich her, denn sie war nach einer Volldrehung seitlich unter die malmende Lok geraten, hatte sich dort verkeilt. Fritz Eucken betrachtete von oben, was unten geschah. Es kam ihm falsch vor, und war ganz gewiss nicht fahrplangemäß.
Benzin entzündete sich, mächtige blaurote Flammen schossen auf, zerstörten Euckens Gesicht. Den Heizer hinter ihm rissen der tödliche Flammenstrahl und der explodierende Kohlenstaub augenblicklich in den Tod.
Das Heck der Limousine sichelte unterdessen einen Hühnerstall weg, riss eine Kuh in zwei Hälften.
Dann endlich Ruhe. Sechshundert Meter hinter der Unfallstelle kam der Güterzug zum Stehen.
Das Feuer war auf die offenen, mit feinster Bruchkohle beladenen Wagons, auf ein Fachwerkhaus mit Schreinerei sowie zwei Heuschober übergesprungen. Weitere Staubexplosionen waren zu hören.
Und doch ging kein Licht an in Bingen. Noch nicht.
Die zweite Limousine hatte es geschafft, rechtzeitig zu bremsen. Zwei Männer stiegen aus, bewegten sich schnell und gebückt. Der eine flüsterte einen militärisch klingenden Befehl, wie der Bremser später aussagte. Sie schienen etwas zu suchen. Als sie den Fahrer der Renault-Limousine dicht am Bahndamm entdeckten, schossen sie ihm zweimal in den Kopf und zweimal in die Brust.
In den Häusern waren nun Lichter angegangen, die ersten Bürger kamen zum Bahndamm gelaufen. Die beiden Verfolger mussten daher ihre Suche nach dem zweiten Mann abbrechen. In geduckter Haltung rannten sie zu ihrem Fahrzeug zurück, wendeten und rasten davon.
Ein Geselle des ortsansässigen Schlachters geriet dabei vor das seitlich auskragende Schutzblech. Sein Bein wurde zur Hälfte abgetrennt, und er verblutete, obwohl ein Schmied noch geistesgegenwärtig versuchte, die Wunde in seiner Werkstatt auszubrennen.
Die Feuerwehr kam schnell und vollbrachte Heldentaten, die noch Wochen später in der Wirtsstube mit Freibier und Krustenbraten belohnt wurden. Es gelang den Feuerwehrmännern, zwei brennende Häuser zu löschen, die nah an einem Petroleumlager standen. Nur eine Bettlägerige konnten die Männer nicht mehr retten.
LOTZIN/DEUTSCHES KAISERREICH
Die Heeresversuchsanstalt Lotzin lag in der Schorfheide nördlich von Berlin und war erst ein Jahr zuvor vom Großen Generalstab als Testgebiet für Artilleriewaffen und schwere Kampfgeräte auserkoren worden. Es handelte sich um ein weiträumig eingezäuntes Waldgelände mit mehreren gerodeten Heideflächen und aufgelassenen Forstgebäuden. Für den heutigen Tag stand ein wichtiger Waffentest an.
Auch Major Albert Craemer war abkommandiert, daran teilzunehmen. Dabei arbeitete er eigentlich beim militärischen Nachrichtendienst, einer Untersektion des Großen Generalstabs. Mit Artilleriewaffen hatte er für gewöhnlich nur auf dem Papier zu tun, denn wer in der Abteilung III b Dienst tat, war eher zum Planen bestellt als zum Feuern. Craemer wusste um das übergeordnete Ziel der Behörde, denn in seiner Abteilung am Königsplatz 6, nur wenige Schritte vom Deutschen Parlament entfernt, wurden jene Pläne erstellt, die dem Reich bei zukünftigen Kriegen den Sieg garantieren sollten. Von der Mobilmachung, dem Einsatz der Streitkräfte, der Beschaffung von Kriegsmaterial bis hin zur Spionageabwehr wurde hier alles strategisch erdacht und organisiert.
Nach ihrer Gründung im Jahr 1889 hatte die Abteilung III b zunächst ein Schattendasein geführt. Gerade einmal eine Handvoll Offiziere waren mit geheimdienstlichen Aufgaben betraut gewesen. Da die Welt, und mit ihr die Konflikte, täglich komplexer wurden, fand zwanzig Jahre später ein Umdenken statt. Für die militärische Elite schien ein Krieg unvermeidlich. Man brauchte Männer, die diesen neuen Aufgaben gewachsen waren.
Daher war das Personal massiv aufgestockt worden, und man hatte geeignete Personen mit militärischer Ausbildung eingestellt. Einer dieser Männer war Albert Craemer.
Von Berlin aus war Lotzin bequem mit der Heidekrautbahn erreichbar, ein Umstand, der Craemer die ungeliebte Pflichtaufgabe etwas erträglicher machte. Die Heide stand in voller Blüte, und der Anblick der farbenfrohen Kräuter nahm sein Auge gefangen.
Der Major und Leiter der Abteilung Spionage Frankreich hatte sich in ein Abteil mit ihm unbekannten Offizieren gesetzt, um einer Konversation möglichst aus dem Weg zu gehen. Er hatte noch immer nicht die geringste Ahnung, warum er vom Großen Generalstab zu dieser Vorführung einbestellt worden war.
Auf dem Versuchsgelände von Lotzin angekommen, war eins für Craemer sofort klar: Ein großer Tag für das Heer, keine Frage.
Eine militärtechnische Novität sollte vorgeführt und erprobt werden. Ein Minenwerfer, von dem man sich im Grabenkampf des Stellungskriegs bei der Erstürmung feindlicher Verteidigungsposten große Wirkung versprach. Hunderte Offiziere der Artillerie, Infanterie und Kavallerie hatten sich am Leitstand der Heeresversuchsanstalt eingefunden. Sie bestaunten den Minenwerfer, der einige Meter entfernt stand und an dem mehrere Kanoniere letzte Vorbereitungen trafen. Die Männer trugen die feldgraue Litewka, den bequemen Uniformrock der Kanoniere sowie die preußische Schirmmütze der Mannschaften.
»Die Kröte«, wie Craemer den Minenwerfer in Gedanken sofort nannte, war erheblich kürzer als ein herkömmliches Geschütz. Er sah aus, als würde er am Boden hocken, wirkte gedrungen und trutzig.
Bereits nach wenigen Minuten entdeckte Craemer unter den Offizieren seinen Kollegen Oberst Gottfried Lassberg, der die Inlandspionage Deutsches Reich leitete, sowie dessen Stellvertreter Hauptmann Ferdinand Kurzhals. Lassberg war ein mittelgroßer, feingliedriger Mann von Anfang fünfzig, mit unruhig hin und her eilendem Blick. Hauptmann Kurzhals, ein Enddreißiger mit kahl geschorenem Schädel und einer Hasenscharte, die nur notdürftig von einem Oberlippenbärtchen kaschiert wurde, wirkte so sehr in sich ruhend, dass es schon fast etwas Stumpfes hatte.
Die drei Männer begrüßten sich militärisch knapp und begannen ein Gespräch über die anstehende Präsentation. Kurzhals schien nun zu erwachen und äußerte sich begeistert über die neue Waffe.
»Sie hat eine maximale Reichweite von 1050 Metern, das müssen Sie sich mal vorstellen. Mit ihrem Steilfeuer können wir sämtliche Arten von Unterständen in null Komma nichts auseinandersprengen.«
»Sie arbeitet mit Wurfminen, nicht wahr?«, fragte Oberst Lassberg.
»Die Dinger haben eine ungeheure Zerstörungskraft, obwohl sie nicht danach aussehen«, antwortete Kurzhals. »Es wurde ja auch dringend Zeit, dass das deutsche Heer sich um Modernität bemüht und nicht länger ausschließlich traditionellen Methoden verhaftet bleibt. Die französische Militärdoktrin ist uns leider auf manchen Gebieten inzwischen stark überlegen.«
»Worauf führen Sie das zurück?«, fragte Craemer.
»Vorsichtig ausgedrückt würde ich von einer ›taktischen Stagnation‹ sprechen. Das unveränderte Festhalten an den militärischen Strategien Graf von Moltkes und Graf von Roons ist eindeutig kontraproduktiv.«
»Diesen genialen Generalfeldmarschällen haben wir den Sieg über unseren französischen Erbfeind zu verdanken«, sagte Lassberg mit deutlicher Schärfe. »Das ist Ihnen schon klar, Kurzhals, oder?«
In diesem Moment ertönte eine Signalpfeife, die Gespräche brachen ab, und alle Militärs drehten sich zu dem Minenwerfer. Mit einer Signalflagge gab der Geschützführer seinen Kanonieren das Zeichen zum Einsatz. Routiniert wurde die Kanone gerichtet, die Munition eingelegt und kurz darauf abgefeuert. Die Wurfmine schoss aus dem Rohr, flog etwa achthundert Meter weit und schlug dann in einen großen Holzstapel ein, der sofort in Flammen aufging.
Während all das geschah, kurbelte ein Operateur wie verrückt an seiner hölzernen Kamerabox, um keinen Moment zu verpassen. Begeisterung machte sich unter den vierhundert Offizieren breit, viele klatschten, man hörte Bravo-Rufe.
Dann wiederholte die Geschützmannschaft den Vorgang neun weitere Male mit anderen Zielen in verschiedenen Entfernungen. Ein präziser Vorgang ohne Abweichung. Das Auswischen des Rohres, die Neuausrichtung des Geschützes und das Einlegen der Wurfmine nahmen bei jedem weiteren Vorgang ein paar Sekunden weniger in Anspruch.
Der leitende Offizier der Heeresversuchsanstalt wandte sich an die Anwesenden. »Meine Herren, Sie sehen, dass die deutsche Armee über ungeheure Fähigkeiten verfügt. Und dies ist nur eine von vielen neuen Waffen, die wir Ihnen schon bald zu präsentieren hoffen.«
Lautes Klatschen, heftiger Applaus und Hochrufe auf den Kaiser erschallten.
»Ich darf Sie jetzt alle zu einer zünftigen Mahlzeit einladen«, sagte der Offizier. »Es gibt leckeres Hirschragout aus der Gulaschkanone und ein ganz vorzügliches Schwarzbier. Lassen Sie es sich schmecken.«
»Das hört sich doch gut an«, sagte Kurzhals zu Craemer.
»Muss leider passen. Ich habe in zwei Stunden einen Termin im Großen Generalstab.«
»Schade. Dann ein anderes Mal«, sagte Lassberg.
Craemer nickte seinen Kollegen zu und verschwand in der Menge der Offiziere.
◆ ◆ ◆
Der Major sinnierte noch immer über das Gespräch mit Oberst Lassberg und Hauptmann Kurzhals, als er das Gebäude des Großen Generalstabs betrat. Merkwürdig – der eine scheint die Franzosen zu mögen, der andere hasst sie geradezu. Was für ein Gespann …
Im Büro erwartete ihn bereits seine Mitarbeiterin Lena Vogel. Sie trug ein sportlich geschnittenes zweiteiliges Kostüm, dessen Rocksaum mit den Fußknöcheln abschloss. Ihre üppigen kastanienbraunen Haare hatte sie hochgesteckt, was sie wenigstens fünfzehn Zentimeter größer machte. Wie immer trug Lena auch heute keinen Hut. Auf Außenstehende wirkte sie mit ihrer kecken Stupsnase und den zahlreichen Sommersprossen oft so, als wäre sie gerade von einer ausgedehnten Landpartie zurückgekehrt.
»Gibt’s was Neues?«, fragte Craemer.
»Nachricht aus Bingen. Auf Ihrem Tisch.«
Lena Vogel arbeitete zwar erst seit einem Jahr für ihn in der Abteilung III b, doch in dieser Zeit war sie zu seiner wichtigsten Vertrauten geworden.
Craemer überflog die Fernschreiben.
»Nun gut, eine schlimme Sache«, erklärte Craemer, während er die Papiere zurück auf seinen Schreibtisch legte. »Da haben sich offenbar einige Schwerverbrecher ein Duell geliefert. Oder sehen Sie mehr darin, Fräulein Vogel?«
»Ein Insasse schwer verletzt, ein zweiter tot – Kopf fast abgerissen.«
»Hab ich gelesen.«
»Und trotzdem noch zwei Schüsse in die Stirn und zwei in die Brust? Für mich sieht das nicht nach Gaunern aus, eher nach einer militärischen Operation. Das war, wenn Sie mich fragen, eine regelrechte Exekution.«
»Meinen Sie? Und warum, wenn das Profis waren, lagen dann Patronenhülsen neben dem Toten?«
Lena zeigte auf die Fernschreiben.
»Die Sache hat sich nachts ereignet, und das Zugunglück hat die halbe Stadt geweckt. Vermutlich blieb schlicht keine Zeit, die Hülsen zu suchen.«
»Sie hören mal wieder die Eulen pfeifen, Fräulein Vogel.«
»Sie meinen, dass Eulen pfeifen können?«
»Ich bewundere Ihren Scharfsinn und Ihre Kenntnisse, das wissen Sie, aber … Warten wir erst mal ab, ob noch was kommt.«
Es war sicher verfrüht, aus einem Duell zwischen Ganoven – denn das war es nach Craemers Ansicht – auf etwas Großes zu schließen, das möglicherweise einen für den Geheimdienst relevanten Hintergrund hatte.
Craemer überlegte, ob er vielleicht seinen Kollegen Lassberg informieren sollte. Aber das konnte warten. Wenn in den nächsten zwei, drei Stunden keine weiteren Fernschreiben mit ähnlichen Hiobsbotschaften aus Bingen eintrudelten, konnte er den Oberst morgen früh immer noch informieren.
Craemer kannte zwar sein Fräulein Vogel; sie hatte ein gutes Gespür. Trotzdem handelte es sich bei dem Vorfall am Bahnübergang von Bingen aller Wahrscheinlichkeit nach um eine isolierte Aktion ohne weitere Bedeutung für seine Abteilung. Ein Geheimdienst, so Craemers Überlegung, hätte sicher keine so auffällige Hinrichtung veranstaltet.
BONN/DEUTSCHES KAISERREICH
Als der Doktorand Frank Grimm zusammen mit seinen Kommilitonen Ludwig und Heinrich die Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn verließ, regnete es noch nicht, aber die Wolken hingen bereits so tief und der Himmel war so verdüstert, dass man fast hätte meinen können, es würde bald Nacht. Dabei war es erst sechs Uhr abends.
»Also noch mal zur Frage aller Fragen.« Ludwig Schädelbauer führte wie so oft das Wort und schien den unbedingten Wunsch zu haben, das Gespräch möglichst weit wegzulenken von anorganischer Chemie oder den gängigen Verfahren zur Verflüssigung von Sauerstoff, Stickstoff und anderen Substanzen flüchtiger Art. »Wenn Bier und Wein wirklich so schädlich für Geist, Physis und Sinn wären, wie unser verehrter Professor uns glauben machen will, dann frage ich mich natürlich …«
»… warum du in den Seminaren noch mitkommst.« Heinrich liebte diese kleinen Wortgefechte mit Ludwig, vor allem nach vier Seminarstunden Chemie.
»Ich dachte da eher an unsere Geistesgrößen.«
»Zu denen du dich zählst?«
»Versteht sich. Aber mal im Ernst: Goethe zum Beispiel soll deutlich mehr als eine Flasche Wein pro Tag verkostet haben. Und auch Baudelaire forderte: ›Man muss immer trunken sein!‹«
»Was dem einen nützt, schadet dem anderen«, murmelte Grimm, der nicht viel mit dieser Märchenstunde in Sachen Bier, Wein und Goethe anzufangen wusste. Grimm war ohnehin etwas tiefer vertäut als die beiden Freunde. Sein Interesse galt dem Frieden unter den Völkern. An der Universität galt er als Kämpfer für eine Welt ohne Waffen. Angeblich korrespondierte er sogar mit so bedeutenden Persönlichkeiten wie Bertha von Suttner, Andrew Carnegie und Anatole France. Beliebt gemacht hatte er sich damit nicht. So waren ihm am Ende nur Heinrich und Ludwig als Freunde geblieben. Und das vermutlich vor allem deshalb, weil er ihnen kostenlos Nachhilfe erteilte. Frank Grimm war, was die Chemie anging, der Beste seines Jahrgangs. Im Gegensatz zu den beiden anderen war er bereits Doktorand.
»Goethes Vater war Weinhändler, wusstet ihr das?«
»So ein Quatsch!«
Grimm war dieser lächerliche Disput egal, denn er hatte es eilig. »Seid mir nicht böse, aber ihr lauft mir zu langsam.«
»Oh, Pardon.«
»Ich will noch in die Bibliothek.«
»Wir ebenfalls.«
»Das mag sein, aber bei eurem Tempo werdet ihr zu spät kommen. Wir sehen uns morgen.«
»Schönen Abend noch, und denk dran: Auch zu leben ist eine Kunst!«
Grimm ging nicht darauf ein, sondern beschleunigte seinen Schritt, als wäre er auf dem Weg zu einem lebenswichtigen Treffen.
»Er ist uns eben immer voraus«, erklärte Heinrich, als Grimm sich bereits gut dreißig Meter von ihnen entfernt hatte.
»Ist es dir auch aufgefallen?«, fragte Heinrich, als sie den kleinen Park erreichten.
»Was sollte mir aufgefallen sein?«
»Er ist so still in letzter Zeit.«
»War er das nicht immer? Er ist eben ein Denker.«
»Ich finde, das mit dem Denken wird zu einer richtigen Marotte bei ihm.«
»Nun, wir studieren«, gab Ludwig zu bedenken.
»Grimm sondert sich mehr und mehr ab. Das ist nicht gesund. Auch nicht im staatlichen Sinne.«
»Vielleicht hat er ja doch eine Freundin.«
»Grimm? Bestimmt nicht. Ich glaube, in seinem Kopf drehen sich pausenlos irgendwelche Schrauben und Räder«, erklärte Heinrich und machte dabei eine entsprechende Bewegung mit der Hand. »Er perzipiert kaum noch, was um ihn herum vorgeht. Und Weiber kommen zwischen seinen ratternden Rädern ganz sicher nicht vor.«
»O doch! Denk an Bertha von Suttner.«
»Glaubst du, dass der wirklich mit all diesen berühmten Leuten in Kontakt steht?«
»Ich glaube, zum Lügen fehlt ihm was.«
»Das Menschliche?«, hakte Heinrich nach, wobei er sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte.
»Was mich wieder auf Goethe bringt.«
»Allein dieser komische Gang …«
»Bei Goethe?«
»Grimm. Ist dir das noch nie aufgefallen? Ich sag dir, der denkt pausenlos über Dinge nach, die für uns wenigstens zwei Nummern zu groß wären.«
Grimm hatte den kleinen Park bereits halb durchquert, und zweimal war er gestolpert. Das passierte ihm öfter in letzter Zeit. Den Fehler hatte er längst identifiziert: Er hob die Füße beim Gehen nicht richtig an, war auch immer zu schnell unterwegs. In seinem Kopf ratterte es tatsächlich. Doch dabei ging es nicht um Chemie, sondern um Moral.
Denn er hatte sich mit dem französischen Erzfeind in Verbindung gesetzt.
Hochverrat. Das Wort spukte ihm nun schon seit fast zwei Wochen im Kopf herum. Und die Franzosen haben mir nicht mal geglaubt! Schlimmer noch, Grimm fühlte sich seit dem letzten Treffen von ihnen verfolgt. Schatten. Gestalten, die ihm nachgingen. Er wusste jetzt, dass er zu viel riskiert hatte. Idiot, immer glaubst du, alle wären wie du. Sind sie aber nicht. Dabei war er sich so sicher gewesen, dass die Franzosen ihm für seine hochbrisanten Informationen dankbar sein würden. Irgendwann setzen sie dich fest. Entweder du fällst den Franzosen in die Hände oder unseren Leuten. Dann landest du im Kerker. Dann werden die Eltern vernommen.
Da Grimm unentwegt verschiedene Bedrohungsszenarien durchspielte, fiel ihm der Mann, der ihm entgegenkam, nicht weiter auf. So erschrak er regelrecht, als der Fremde ihn plötzlich ansprach.
»Monsieur Grimm?«
»Pardon?«
»Frank Grimm?«
»Ja. Was kann ich für Sie tun?«
»Riens.« Der Mann zog eine Pistole und schoss ihm mitten in die Stirn. Es ging so schnell, dass der begabte Doktorand seine eigene Hinrichtung nicht einmal bemerkte.
Nachdem Grimm zu Boden gegangen war, drehte der Fremde ihn auf den Rücken. Grimm bekam einen weiteren Kopfschuss und dann noch zwei Kugeln ins Herz.
Der Mörder handelte routiniert, schien keine Eile zu haben. Er steckte seine Waffe wieder ein, warf einen kurzen Blick in Richtung Parkausgang und setzte seinen Weg dann ruhigen Schritts fort. Als er kaum dreihundert Meter gegangen war, kamen ihm zwei junge Männer entgegen.
»Haben Sie das auch gehört?«, fragte ihn der kleinere, als er schon fast an ihnen vorbei war.
»Pardon? Je ne comprends pas.«
»Les coups de feu.«
»Non. Excusez-moi, je suis pressé.«
»Dann wollen wir Sie nicht aufhalten.«
Zwei Minuten später fanden die Freunde Grimms Leiche.
Heinrich sprach wie ein Wissenschaftler. »Viermal«, sagte er in einem Tonfall, als gälte es, ein Experiment zu beschreiben.
»Und der Franzose eben hat behauptet, er hätte keine Schüsse gehört.«
»Du meinst, der war das?«
»Hast du sein Gesicht gesehen?«
»Nicht drauf geachtet. Er war ja schon halb an uns vorbei.«
Nachdem sie den Fund ihres toten Freundes in der Gendarmerie gemeldet hatten, wurden Heinrich und Ludwig vernommen.
»Also der Reihe nach und ganz in Ruhe«, bat der Gendarm, der ihre Aussage zu Protokoll nahm.
»Es gibt keine Reihe. Erst fielen Schüsse, und kurz darauf kam uns ein Mann entgegen.«
Ludwig ergänzte: »Wir haben nicht groß auf ihn geachtet. Wir wussten ja nicht …«
»Na, irgendetwas werden Sie doch sagen können. Wie sah er aus? Überlegen Sie in Ruhe«, bat der Gendarm mit einer Gelassenheit, als ginge es um den Diebstahl von Äpfeln.
»Na, so wie viele aussehen.«
»Sein Alter? Ungefähr.«
»Dreißig, vierzig.«
»Er trug einen Regenmantel.«
»Richtig. Eine dunkle Regenpellerine. Aber es sah ja auch nach Regen aus, nicht wahr?«
»Der Regen tut hier nichts zur Sache«, erklärte der Gendarm. »Rannte der Mann, als er auf Sie zukam?«
»Nein«, sagte Heinrich, ohne zu zögern.
»Er kam einfach auf uns zu. Wie ein abendlicher Spaziergänger. Wir fragten ihn, ob er die Schüsse gehört habe, und er sagte Nein.«
»Und dass er weitermüsse.«
»Ich glaube, er sagte, er sei in Eile«, korrigierte Ludwig seinen Freund.
»Sie sind sich nicht einig?«, hakte der Gendarm nach und sah sie misstrauisch an.
»Mein Französisch ist nicht so gut.«
»Ach so, der Mann war Franzose?«
»Richtig!«, sagte Heinrich. »Er sprach jedenfalls Französisch.«
»Und Sie meinen, dieser Franzose könnte den jungen Mann erschossen haben?«
»Das haben wir nicht gesagt. Wir wissen nicht, was passiert ist. Grimm ging ein gutes Stück vor uns, er wollte in die Bibliothek.«
»Ach. Sie kannten den Toten?«
»Er war ein Kommilitone von uns.«
»Weshalb ging er nicht mit Ihnen zusammen?«
»Grimm war meistens in Eile.«
»Genau. Als wir dann im Park waren, hörten wir Geräusche, die wie Schüsse klangen. Ganz sicher waren wir uns allerdings nicht.«
»Kurz darauf kam Ihnen der Mann entgegen.«
»Genau.«
»Er war der Einzige, dem wir im Park begegnet sind, und er kam aus der Richtung, in der wir dann Grimms Leiche fanden.«
Heinrich nickte zur Bestätigung.
Der Gendarm schien nachzudenken, was einige Zeit in Anspruch nahm. »Ihr Freund wurde in der Nähe des Parkausgangs erschossen. Wäre es da nicht wahrscheinlicher, dass sein Mörder anschließend umkehrt und den kürzeren Weg nimmt?«
»Dann hätte er auf der Straße gestanden …«, konterte Heinrich.
»… und zwar kurz nachdem Schüsse gefallen sind«, beendete Ludwig den Gedanken.
»Dort wäre er viel mehr Menschen begegnet als im Park.«
»Und Ihnen ist gar nichts Besonderes aufgefallen, was sein Äußeres angeht?«
»Nein!«, sagte Ludwig nun schon ein wenig ungeduldig.
»Wir waren in Gedanken noch ganz bei den Schüssen. Ich glaube sogar, dass ich kurz überlegt hatte, ob wir nicht weglaufen sollten, oder …«
»Warte«, unterbrach Ludwig den Freund. »Der Mann hatte etwas am Hals. Eine Schramme oder eine Narbe. Jedenfalls stimmte dort irgendwas nicht mit seiner Haut. Ganz sicher bin ich aber nicht.«
»Ist Ihnen das auch aufgefallen?«, fragte der Gendarm Heinrich.
Der schüttelte den Kopf.
Die Vernehmung zog sich noch gut dreißig weitere Minuten hin, dann endlich wurden Heinrich und Ludwig entlassen.
Erst als sie wieder auf der Straße standen, begriffen sie tatsächlich, was passiert war. Sie sprachen es nicht aus. Dafür war es zu schlimm. Zu endgültig. Und gleichzeitig zu unerklärlich.
Ludwig zitterte, als er seine Zigarillos herausholte.
»Ich glaube, für die Bibliothek ist es jetzt zu spät«, erklärte Heinrich nach einer Weile. Ludwig gab ihm mit einem stummen Nicken recht.
Und genau in diesem Moment war es so weit. Der Regen kam mit einer Macht, als hätte jemand sämtliche Schleusen geöffnet.
BERLIN/DEUTSCHES KAISERREICH
»Bis jetzt acht Tote.«
»Du meine Güte!«
Major Albert Craemer und Oberst Gottfried Lassberg standen im Telegrafenraum. Draußen war es inzwischen stockdunkel, hier drin sah es nach Überstunden aus. Seit einer halben Stunde gingen die Meldungen aus Bingen im Zehn-Minuten-Takt auf dem Typendrucktelegrafen ein. Josephine Sonneberg, die für gewöhnlich die aus der Maschine ratternden Papierstreifen sammelte und halbstündlich zu den Abteilungen brachte, kannte das schon. Wenn etwas wirklich Schwerwiegendes geschah, dann immer, wenn sie eigentlich längst Feierabend hatte. Dann wartete keiner mehr, bis sie kam und die Meldungen brachte. Im Grunde hatte sie also nichts mehr zu tun, musste aber bleiben, für den Fall, dass der Apparat streikte. Manchmal ging das über viele Stunden so. Ihr kleines Büro wurde in diesen Momenten zum Herz des deutschen Geheimdienstes.
Und sie saß untätig herum.
So wie jetzt.
Anfangs hatte Josephine überlegt, ob sie wohl etwas essen dürfe. Sie hatte mittags keinen Appetit gehabt, was sicher an ihrer Schwangerschaft lag. Also wartete immer noch ein großes Stück Apfelkuchen, den ihre Schwiegermutter am Vortag gebacken hatte, in ihrem Körbchen. Und ihre Schwiegermutter verstand sich auf Apfelkuchen. Ein Schraubglas mit Kakao hatte sie ebenfalls dabei.
Josephine merkte, wie sie plötzlich großen Appetit bekam. Ihr lief schon das Wasser im Mund zusammen. Trotzdem entschied sie sich, auf den Kuchen zu verzichten und den beiden Männern bei ihrer Arbeit zuzusehen. Schließlich ging es um Belange des Vaterlands, da musste das Gebäck eben warten. Außerdem wollte sie in Ruhe hören, was noch alles aus Bingen kam. Es war interessant, ja sogar spannend. Sie konnte nur hoffen, dass in ihrem Bauch nicht wieder das Getrampel losging.
Wieder ratterte es. Craemer zog das Blatt aus der Maschine.
»Zu den acht Toten kommt jetzt auch noch ein schwer verletzter Zugführer. Danken wir der Feuerwehr, dass nicht die halbe Stadt abgebrannt ist.«
Und wieder ratterte es.
Craemer las, Lassberg wartete.
»Die Täter haben laut Aussage eines Bremsers Französisch gesprochen.«
Lassberg ließ sich Zeit mit seiner Antwort. »Sie werten das hoffentlich nicht als kriegerischen Akt.«
»Dafür wissen wir zu wenig. Aber das muss schleunigst aufgeklärt werden. Gerade auch, damit niemand irgendwas Übereiltes unternimmt.«
Für »schleunigst« ist hier bis jetzt nicht viel passiert, dachte Josephine. Sie verglich die Arbeit des deutschen Abwehrgeheimdienstes manchmal mit häuslichen Angelegenheiten. Bei ihr daheim jedenfalls lief es schneller, da ging alles zack, zack. Eine andere Haltung hätte ihre Schwiegermutter auch niemals geduldet.
»Ja, das muss unverzüglich untersucht werden«, bestätigte Lassberg. »Ganz Ihrer Meinung, Craemer, ganz Ihrer Meinung. Schon eine Idee, was dahinterstecken könnte?«
»Vielleicht tatsächlich nur eine Schießerei zwischen Kriminellen. Der Schienenverkehr ist jedenfalls für wenigstens vier Tage unterbrochen.«
»Sie meinen, französische Gauner schießen an einem deutschen Bahnübergang aufeinander und blockieren dabei zufällig einen für das Reich wichtigen Verkehrsweg?«
Craemer nickte langsam und bedächtig. Seine Erfahrung sagte ihm, dass es keine gewöhnliche Schießerei gewesen war. »Ich werde selbst runterfahren.«
»Das stand doch von vornherein fest«, sagte Lassberg.
Und obwohl sich die beiden Männer oft wie Konkurrenten verhielten, mussten sie nun doch lächeln. Sie hatten sich in dem knappen Jahr seit Craemers Eintritt in die Abteilung III b schon gut kennengelernt.
Major Craemers beruflicher Werdegang war nicht eben gradlinig verlaufen. Er entstammte einer hugenottischen Familie, die Ende des 17. Jahrhunderts aus dem Languedoc nach Berlin geflohen war. Dort hatten die Craemers bald Fuß gefasst und sich Schritt für Schritt in die Berliner Oberschicht emporgearbeitet. Seine Vorfahren hatten es vom Handwerker und Landwirt über kleine und mittlere Beamtenpositionen bis hin zum Führungspersonal gebracht.
Nach dem Abitur und seinem Militärdienst, den er mit dem Dienstgrad Rittmeister verließ, hatte Craemer zunächst Jura studiert. Doch dann bot sich ihm eine verlockende Alternative, der er nicht widerstehen konnte.
Mit Beginn des neuen Jahrhunderts hatte die Reichshauptstadt beschlossen, die Kriminalitätsbekämpfung grundlegend zu reformieren. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sollten verstärkt in der Polizeiarbeit eingesetzt werden, um die Ermittlungstaktik bei Kapitalverbrechen zu verbessern.
Craemer war fasziniert. Anthropometrie, Daktyloskopie, Signalementslehre und die systematische Beschäftigung mit Gaunersprachen sowie dem Zigeunerwesen, das alles empfand er als geradezu revolutionär. Hier wurde Neuland betreten, hier wollte er mitmachen.
Was nicht ganz einfach war. Rittmeister Albert Craemer war zwar ein tadelloser Militäroffizier und befähigt, die Verantwortung für Ausbildung, Führung und den Einsatz von militärischen Verbänden zu übernehmen. Aber warum sollten diese Qualitäten ihn in die Lage versetzen, komplizierte, auf kleinste Belastungsmomente ausgerichtete Polizeiarbeit zu leiten?
Die Ablehnung seitens der polizeilichen Führung lag nah, doch so leicht ließ Albert Craemer sich nicht abwimmeln. Mithilfe einiger Empfehlungsschreiben seiner Professoren wurde seinem Antrag, in den preußischen Polizeidienst einzutreten, im Frühjahr 1901 schließlich stattgegeben. Ende Mai 1902 legte er die Prüfung zum Kriminalkommissar ab, wurde zwei Wochen später zum Hilfskriminalkommissar und am 1. August desselben Jahres zum Kriminalkommissar ernannt.
Man hatte Craemer eine feste Einheit der Berliner Kriminalpolizei zugeteilt, mit der er bald äußerst erfolgreich arbeitete. Was vor allem daran lag, dass er sich in kürzester Zeit ein Netz von Spitzeln aufbauen konnte. Sein Talent bestand darin, Kriminelle erbarmungslos unter Druck zu setzen, um sie für seine Interessen einzuspannen. Diesbezüglich war er ausgesprochen skrupellos.
Das fiel schließlich auch dem Preußischen Geheimdienst auf. Dank seiner hugenottischen Abstammung sprach Craemer zudem perfekt Französisch. Die Abteilung III b machte ihm daher im Spätsommer 1909 das Angebot, zum militärischen Nachrichtendienst zu wechseln und dort die Frankreich-Abteilung aufzubauen. Mit dieser Versetzung war auch die Beförderung vom Rittmeister zum Major verbunden.
»Dass ich reise, bleibt vorerst unter uns«, sagte Craemer. »Ich möchte mir nicht den Ruf eines Aktionisten einhandeln«
»Bleibt unter uns, versteht sich«, antwortete Oberst Lassberg.
»Das gilt auch für Sie, Frau Sonneberg.«
»Aber natürlich, Herr Major.«
»Sie werden alleine fahren?«, fragte Lassberg.
»Nein, ich … Nein, nicht alleine.«
»In Ordnung. Ich sehe mal zu, wer Ihnen da unten helfen kann. Ich kann mich leider nicht selbst darum kümmern, wir haben zurzeit Probleme mit dem neuen Flugfeld in Johannisthal.«
»Davon wusste ich gar nichts.«
»Es ist auch nicht sehr pressierlich, aber ich muss mich darum kümmern.«
»Darf ich fragen, worum es geht?«
»Die Albatros-Werke werden in absehbarer Zeit Flugapparate für uns bauen«, sagte Lassberg. »Manche Militärs halten das für eine Spielerei, aber ich …«
»Dass Flugapparate geliefert werden, ist doch kein Problem.«
»Nein, aber dass die Albatros-Werke in dieser Sache mit den Franzosen zusammenarbeiten, könnte zu einem Problem werden.«
Craemer nickte. »Verstehe. Nun, Sie kümmern sich um Ihre Flugzeuge, ich mich um mein Zugunglück.«
»Jeder hat seins an der Backe.«
Nachdem das geklärt war, verließen die Männer den Telegrafenraum.
Sie waren kaum draußen, da stand Josephine Sonneberg auf und öffnete das Fenster. Es war immer dasselbe. Ging es um etwas Wichtiges, wurde heftig geraucht. Das war doch verrückt. Sie hätte Lassberg gleich sagen können, dass Craemer die Sache in die Hand nehmen würde. Tut er schließlich immer in solchen Fällen. Ist eben seine Vergangenheit bei der Polizei. Die laufen auch viel rum, wenn sie ermitteln.
Noch bevor der Raum vollständig durchgelüftet war, griff Josephine in ihren Korb und holte den Apfelkuchen heraus.
Der Typendrucktelegraf blieb ruhig, als gälte es, ihre Pause zu achten. Zu schade, zu schade, dachte Josephine, als sie den ersten Bissen zum Mund führte. Sie hätte zu gerne gewusst, was man nun wegen der Sache in Bingen unternehmen würde.
Als Craemer in seinem Büro ankam, hatte er eine Entscheidung getroffen. Er wollte die Sache nicht zu groß machen und vorerst außer Lassberg niemanden vom militärischen Personal einweihen. Somit war klar, wer ihn begleiten würde.
»Fräulein Vogel!«
Eine Tür, getäfelt, hell gebeizte Eiche, öffnete sich, und Lena Vogel betrat das Büro. Wie meistens hielt sie Block und Stift in der Hand.
»Kein Diktat, Fräulein Vogel. Wir fahren nach Bingen.«
»Also ist doch was dran.«
»Das wollen wir herausfinden.
»Wann geht’s los?«
»Halten Sie sich bereit.«
»Darf ich fragen …«
»Der Unfall betrifft die Preußische Staatsbahn«, sagte Craemer. »Viele Tote, ein rücksichtsloses Vorgehen. Die Art, wie gehandelt wurde, lässt darauf schließen, dass hier keine gewöhnlichen Gauner am Werk waren.«
»Ein Unfall der Preußischen Staatsbahn? Mit so was befassen wir uns?«
»Es gibt Hinweise darauf, dass mehr dahintersteckt.«
»Welche Art Hinweise?«
»Die Art des Vorgehens erinnert eher an eine militärische Operation als an eine gewöhnliche Schießerei. Außerdem sollen die Täter Französisch gesprochen haben. Wie immer bitte ich Sie ausdrücklich um Ihre Verschwiegenheit, Fräulein Vogel.«
»Gewiss doch, Herr Major. Bleibt mir noch Zeit zum Packen?«
»Natürlich. Es gibt keinen Grund, überstürzt abzureisen. Morgen früh, Anhalter Bahnhof. Sie organisieren das und informieren mich bitte wegen der genauen Abfahrtszeit.«
»Selbstverständlich. Darf ich einen Regenschirm mitnehmen?«
»Warum das?«
»Ich war erst kürzlich beim Friseur, dort unten war in den letzten Tagen sehr schlechtes Wetter.«
»Ja, Gott, warum nicht. Haben Sie noch wichtigere Fragen als die nach einem Schirm?«
»Im Moment nicht.«
1895, JARSZÓW/GALIZIEN
Jarszów lag am Rande des Gebiets der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, auf halber Strecke zwischen Lemberg und der Grenze des russischen Zarenreiches. Es war ein Städtchen, wie es in Galizien viele gab. Ärmlich und noch nicht mit den Neuerungen der modernen Zivilisation gesegnet. Die Dorfstraßen waren ungepflastert und verwandelten sich bei Regen in einen schlammigen Morast, in dem so manches Pferdefuhrwerk stecken blieb.
Die Häuser, die eher Hütten glichen, waren aus Holz gebaut und mit Schindeln gedeckt. Nur die Synagoge sowie einige wenige Gebäude der Reichen waren aus Stein errichtet worden. Denn auch in Jarszów gab es ein paar vermögende Leute. Doch die meisten Bewohner waren bitterarm, Händler und Handwerker, die sich nur das Allernötigste leisten und sich kaum jemals richtig satt essen konnten.
In Jarszów lebten rund neunhundert Menschen, drei Viertel davon waren Juden, der Rest Christen. Die unterschiedlichsten Ethnien waren vertreten: Armenier, Deutsche, Juden, Lipowaner, Moldauer, Polen, Ruthenen, Russen, Roma und Ungarn. Alle handelten miteinander, und im Allgemeinen war es hier friedlich. Zwar gab es hin und wieder kleine Reibereien, aber keine Anschläge, keine Gewalt.
Die meisten jüdischen Männer, die im Schtetl von Jarszów lebten, unterschieden sich in nichts von ihren Vorfahren. Sie trugen Kaftan und Hut, hatten Schläfenlocken und Bärte. So auch Moicher Tajtelbaum, der vermutlich ärmste Jude von ganz Jarszów, der mit seiner Frau Golda, den Knaben Aaron, Isidor, Levin, Meijer und Zacharias sowie dem sechsjährigen Nesthäkchen Rahel in einer baufälligen Hütte am Rande des Schtetls wohnte.
Golda hatte Moicher Tajtelbaum als Fünfzehnjährige geheiratet. Damals war er ein zwölf Jahre älterer Fuhrmann und im Schtetl nicht sonderlich angesehen gewesen. Als sein Zugpferd Joka vor zwei Jahren verendet war, stellte es sich nicht als das »Geschenk Gottes« heraus, wie Moicher bei der Namensgebung gehofft hatte, denn er besaß nicht genug Geld, um sich ein neues zu kaufen. So gelang es dem Fuhrmann nicht mehr länger, seine Familie mit eigenen Händen zu ernähren, er war auf Almosen und Zuwendungen der Gemeinde angewiesen. Was sichtbar an Moichers Gemüt nagte und sein Dasein zunehmend verdüsterte. Ja, wenn er ins gelobte Land auswandern könnte … nach Amerika … Amerika! Ein Gedanke, der immer mehr Raum in seinem Kopf einnahm.
Es war ein kalter Novembertag, als Moicher Tajtelbaum ohne Vorankündigung verschwand. Er verließ das Haus am frühen Morgen, um wie jeden Tag zum Beten in die Synagoge zu gehen. Doch dort kam er nie an.
Stunden später, als es schon dunkelte und Golda immer unruhiger wurde, nahm sie ihren Umhang und lief zur Synagoge. Sie sah, dass der Rabbiner gerade das Gebäude verlassen wollte, rückte ihre Perücke zurecht und sprach ihn an.
»Rabbi Birstein, ich würde Euch gern eine Frage stellen.«
»Möchtest du, dass ich ein rituelles Problem kläre?«
Golda schüttelte den Kopf.
»Nun denn, so frag.«
»Ich suche meinen Moicher.«
»Hier ist er nicht.«
»Wann hat er denn die Synagoge verlassen?«
»Deinen Moicher habe ich heute nicht gesehen.«
»Das kann nicht sein, Rabbi. Moicher ist ein frommer Mann. Er betet jeden Tag in der Synagoge.«
»Heute nicht.«
Und Moicher Tajtelbaum blieb verschwunden. Spurlos. Ohne ein erklärendes Wort für seine Angehörigen hinterlassen zu haben.
Die Gemeindeältesten ließen den Fuhrmann suchen, schrieben Briefe an andere Schtetl. Monatelang, doch vergeblich. Moicher Tajtelbaum tauchte nie wieder auf. Man vermutete schließlich, dass er es irgendwie nach Amerika geschafft hatte. Ins Land der Verheißung.
Golda hatte Glück im Unglück, sie fand eine Stelle als Näherin bei Eugen Pantschuk und seiner Frau Martha. Das waren vermögende, wohltätige Protestanten, die eine Fabrik betrieben, in der aus Rüben Rohzucker hergestellt wurde. Eugen Pantschuk war der größte Arbeitgeber in einem Umkreis von fünfzig Kilometern. Golda arbeitete zwar nicht jeden Tag bei den Pantschuks, aber es kam immerhin genug zusammen, dass ihre sechs Kinder daheim nicht verhungern mussten.
1910, BINGEN/DEUTSCHES KAISERREICH
Der Zug war auf die Minute pünktlich in Berlin abgefahren. Nachdem sie in Erfurt in eine andere Bahn umgestiegen waren, hatte Craemer seinen Mantel ausgezogen und ihn sich als Decke über die Beine gelegt. Er hatte Lena empfohlen, ebenfalls ein wenig zu schlafen. Doch dafür war sie viel zu aufgeregt.
Lena Vogel hatte den Major, der mit geschlossenen Augen im Halbschlaf vor sich hindöste, lange betrachtet und sich gefragt, wie viel von dem, was ihm im Kopf herumging, er ihr wohl verraten hatte. Draußen zog die Landschaft vorbei. Und vorbei und vorbei und … Irgendwann war sie wohl doch eingeschlafen.
Dann ein Zufall. Oder tickte in ihrem Inneren eine Art seelischer Wecker? Als Lena die Augen wieder aufschlug, fiel ihr Blick nach draußen, wo gerade das Ortschild von Bingen vorbeiwischte. Craemer schlief noch immer, säuselte leise vor sich hin.
»Herr Major«, sagte sie mehrmals.
Als Craemer nicht reagierte, nahm sie ihren Schirm und stieß ihn vorsichtig mit der Spitze an. Immer fester, bis er endlich erwachte.
»Ja … was?«, fragte er schlaftrunken.
»Bingen. Wir sind da, Herr Major.«
»Gut, gut … Schön.«
Lena und Craemer waren kaum aus dem Zug gestiegen, da wurden sie bereits von PaulBrinkert begrüßt, dem stellvertretenden Königlich-Preußischen Polizeipräsidenten der Rheinprovinz.
»Albert, welche Freude!«, dröhnte es vom anderen Ende des Bahnsteigs. Mit strammen Schritten und ausgebreiteten Armen kam der gutaussehende Mittvierziger auf sie zu.
»Ein Empfangskomitee, wie vorbildlich«, lobte Craemer nach einem längeren Händedruck, der damit endete, dass Brinkert die Hand des alten Freundes mit seinen so herzlich umschloss, als wolle er sie wärmen.
»Versteht sich doch, Albert, dass ich euch empfange. Lassberg hat mich schon in groben Zügen informiert. Wie war die Fahrt?«
»Keine Zwischenfälle, es ging flott voran.«
»Flott voran. Und auch noch in Damenbegleitung!«
Craemer wandte sich an Lena. »Fräulein Vogel. Darf ich Sie mit Paul Brinkert bekannt machen?«
»Und ich dachte schon, die Herren seien sich selbst genug.«
»Nun, nun!«
»Deine Sekretärin?«
Craemer warf Lena einen erneuten Blick zu, und sie fabrizierte einen kleinen, sehr akkuraten Knicks mit Verbeugung. Anschließend strahlte sie Brinkert mit erschütternder, beinahe schon ans Naive grenzender Offenheit an und erklärte: »Immer den Stift zur Hand, so kommt man voran.«
»Adrett, adrett«, lobte Brinkert lautstark und wies anschließend mit der Hand in Richtung Ausgang.
Während sie dem Bahnsteig folgten, wechselten die Männer ein paar Worte über ihre gemeinsame Vergangenheit. Lena ging neben ihnen, hörte aufmerksam zu und lächelte, wenn etwas Amüsantes gesagt wurde. Dabei ließ sie ihren Schirm verspielt vor und zurück schwingen. Ihre mädchenhafte Art inspirierte Brinkert zu einer kleinen Anekdote aus der Zeit von Craemers und seiner Grundausbildung.
Die Pointe bestand darin, dass einer ihrer Kameraden von damals, »ein Zecher vor dem Herrn, Mademoiselle Vogel, ein Zecher vor dem Herrn!«, am Ende eines Besäufnisses falsch herum auf seinem Pferd saß und sich beklagte, »das Tier hat keinen Kopf, und ich kann die Zügel nicht finden«.
Lena belohnte Brinkerts pointiert vorgetragene Geschichte mit einem hellen Lachen, wobei sie sich die Hand artig vor den Mund hielt.
»Adrett, adrett«, sagte Brinkert zur Belohnung, wobei er mit dem linken Auge zwinkerte. Auf Lena wirkte das nicht ganz so galant wie beabsichtigt, denn durch den deutlich sichtbaren Schmiss, der am unteren Rand von Brinkerts Auge begann und bis fast zum Mundwinkel reichte, fehlte dem Zwinkern die nötige Leichtigkeit.
Am Portal des Bahnhofs nahm das Gespräch schließlich eine Wendung ins Berufliche. Es begann mit einer einfachen Frage von Brinkert.
»Ich freue mich wirklich sehr, dich zu sehen, mein lieber Albert. Und Sie kennengelernt zu haben, Mademoiselle Vogel, ist ohne Zweifel ein Vergnügen, nur … Warum diese Reise? Steckt etwa mehr dahinter, als Lassberg mir erzählt hat? Du weißt vielleicht nicht, wie ich zu Lassberg stehe …«
»Ich wusste nicht mal, dass du ihn kennst.«