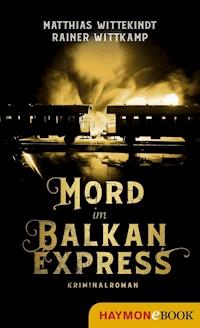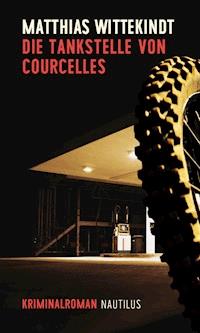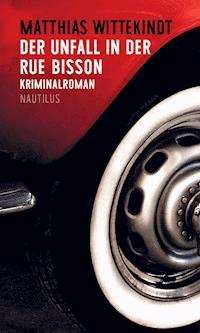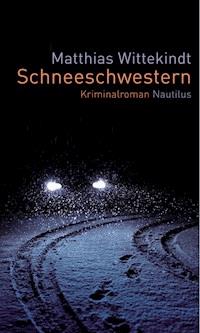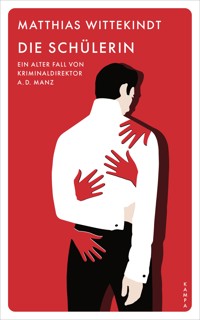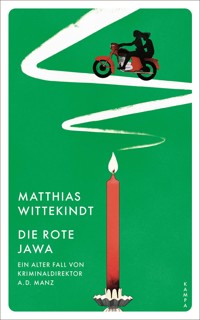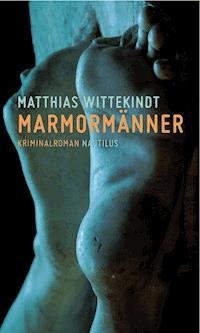Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
Kriminaldirektor a. D. Manz hat sich behaglich eingerichtet in seinem Ruhestand im Dresdner Umland. Er rudert auf der Elbe, kümmert sich um seine Enkelkinder. Doch dann reißt ihn ein Brief der Staatsanwaltschaft Berlin aus seinem Alltag: Manz soll vor Gericht aussagen. Es geht um einen Mord im Jahr 1990, seinen letzten Fall in Berlin, den er nicht mehr abschließen konnte, weil er versetzt wurde. Jetzt, über zwanzig Jahre später, scheint der Mörder gefunden. Und es geschieht, was Manz nie wollte: Er versinkt in der Vergangenheit, in alten Denkmustern, und auch Vera erscheint vor seinem inneren Auge, die Kollegin, mit der er damals zusammengearbeitet hat und die sich kurz darauf das Leben genommen hat. Haben sie bei ihren Ermittlungen einen Fehler gemacht? Beim Prozess in Berlin muss Manz feststellen, dass etwas gründlich schiefläuft. Steht ein Unschuldiger vor Gericht? Die Aufklärung des Falls verschränkt sich untrennbar mit Manz' Blick in seine eigene Vergangenheit, der Auseinandersetzung mit sich selbst, seinem älterwerden - und all das vor dem Hintergrund der wiedervereinigten Bundesrepublik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Wittekindt
Vor Gericht
Roman
Kampa
IDie Recherche
Exkursion auf die andere Seite
Als Manz an diesem Abend das Haus verlässt, steht die Sonne noch zwei Fingerbreit über dem Horizont. Er will zum Ruderclub, die anderen treffen. Vermutlich werden sie grillen, was trinken und sich mal wieder über Wolfgang lustig machen, der seit Wochen damit beschäftigt ist, ihren neuen Vierer mit sieben Schichten Bootslack neu aufzubauen.
»Soll ja halten«, hatte er erklärt, als Theo ihn fragte, warum es so lange dauert.
Ihr neuer Vierer ohne Steuermann wurde 1931 in Dresden gebaut. Sie haben ihn im Mai gegen den alten eingetauscht, denn ihr Steuermann, Robert, ist im April ganz plötzlich gestorben, und keiner der verbliebenen Freunde hat Lust, beim Rudern auf den leeren Sitz im Heck zu starren.
Zwei Mal die Woche rudern sie auf der Elbe. Das Bild, das die vier dabei abgeben, unterscheidet sich nicht von dem anderer aus ihrem Club. Wenn sie in Fahrt sind, ist der Blick gen Heck gerichtet, wenn sie pausieren, geht der Blick meist zur Seite.
So wie gestern Morgen zum Beispiel.
Es ist noch früh. Hinter ihnen, über dem Wasser, Dunst. Tropfen tropfen von den Ruderblättern, man kann ihre Gesichter gut erkennen.
Ganz vorne im Boot sitzt Wolfgang, der auch die Kommandos gibt. Genau wie Manz stammt er aus Berlin, war dort im Bausenat tätig.
»Von der Ausbildung Stadtplaner und Jurist«, so hatte er sich Manz damals vorgestellt. »Aber reden wir von was anderem.«
Direkt vor Wolfgang, also genau genommen hinter ihm, wenn man vom Bug aus zählt, hat Henning, der Notar, seinen Platz.
»Familiendramen noch und nöcher. Vor allem bei Erbschaften. Na, ihr kennt das.«
Wie so oft, wenn sie pausieren, steht Hennings Mund offen. Sein linkes Augenlid hängt ein wenig.
»Ist schon so, seit ich zwölf bin.«
Dann kommt Theo, der sich bereits Mitte der Achtziger für Elektroautos eingesetzt hat und auch eins fährt. Er zieht die Ruderblätter stets etwas höher aus dem Wasser als die anderen.
Ganz hinten am Heck Manz. Der ehemalige Kommissar war während seiner letzten Berufsjahre Kriminaldirektor in Dresden.
Vier Männer mit vier Berufen. Und alle nicht auf den Mund gefallen. Sie hätten eine Menge zu berichten. Von ihren Aufgaben, die ja für sie alle ihr Leben waren.
Nur tun sie es nicht. Manz darf mal eine kleine Polizeigeschichte, »bitte mit Pointe!«, zum Besten geben, aber sonst … Nicht zurück. Das ist die Devise.
»Nicht zurück?« Manz hat sich bei seinem Eintritt in den Club über die Anweisung amüsiert. »Rudern wir denn nicht mit dem Rücken in Fahrtrichtung?«
Über solche Bonmots können Wolfgang und Theo lachen. Henning nicht. Er neigt zur Ernsthaftigkeit und … in letzter Zeit auch zum Zorn.
Gleich wird Manz die drei treffen. Sie werden sich anhören, was Wolfgang über seine Lackschichten zu sagen hat und dabei eine Flasche Bier trinken. Henning vermutlich zwei, denkt Manz.
Henning ist vierundsiebzig und somit der älteste. Theo und Wolfgang sind, genau wie Manz, kurz vor Kriegsende zur Welt gekommen. Sie haben im April gemeinsam ihren Dreiundsiebzigsten gefeiert. Noch zusammen mit Robert und natürlich auf dem Gelände des Ruderclubs, der einst dem Betriebssport gedient hat, und …
»… nein! Das ist keiner von diesen neuen, aufgemotzten Clubs. Bei uns sind nur Leute, die gerne rudern und reden!«
»Trinken?«
»Na gut. Rudern, reden und trinken.«
»Was ist mit dem Grill?«
»Unseren Frauen?«
»Gott, seid ihr kleinlich.«
Manz war es während seiner Ausbildung zur Gewohnheit geworden, sich Dinge, die ihm durch den Kopf gehen, vorzusagen, ja, regelrecht zu formulieren, und diese Gedanken, so sie mit seinem Beruf zu tun hatten, möglichst bald aufzuschreiben. Daraus war in seiner aktiven Zeit eine Methodik der wörtlichen Aussage entstanden, die ihn von seinen Kollegen unterschied.
Sicher waren die Marotte mit den ausformulierten Gedanken und sein gut entwickeltes Vorstellungsvermögen bei gleichzeitiger Verpflichtung auf das Faktische mit ein Grund, warum er es beruflich so weit gebracht hatte.
Riecht gut heute, die Elbe.
Der Wind trägt den Geruch zu ihm hinauf, alles scheint wie immer zu sein.
Dann jedoch, er hätte keinen Grund nennen können, verwirft Manz seinen Plan, geht nicht zum Ruderclub, sondern biegt scharf nach rechts ab. Auf die Zizzenbrücke, die hier die Elbe überspannt und Zizzwitz mit einer längst aufgegebenen Enklave aus den sechziger Jahren verbindet.
»Hey! Manz!«
»Christoph.«
»Alles gut?«
»Und bei dir?«
»Wo geht’s hin? Wird bald dunkel.«
»Weiß ich noch nicht.«
»Wie weit ist Theo mit seinen Solarpanels?«
»Kommt gut voran, gestern fehlte ihm, glaub ich, ein Kabel.«
»Ich schau mal vorbei, Kabel hab ich genug. Was machst du morgen?«
»Na, was schon? Da bin ich im Ruderclub.«
»Dann sehen wir uns da. Grüß Christine.«
»Mach ich. Grüß Helga.«
Manz geht weiter, und er geht wie immer. Aufrecht. Sicher. Trotz seiner dreiundsiebzig.
Wer sich die Zeit nimmt, wer Manz eine Weile dort oben auf der Brücke beim Gehen betrachtet, sieht sofort, dass seine Muskeln, seine Gelenke, seine Koordination noch gut funktionieren. Man würde ihm sofort abnehmen, dass er, schon aus beruflichen Gründen, auf seine körperliche Verfassung achten musste und sich auch heute noch regelmäßig belastet. Es waren ja immer mal Situationen vorgekommen, wo es Mann gegen Mann ging. Da Manz zudem schlank ist, da sein Blick nicht auf den Boden geht wie bei denen, die bereits Angst haben zu fallen, wirkt er deutlich jünger, als er nach Jahren ist.
Noch jünger, noch eleganter vor allem, würde er wirken, wäre er anders gekleidet. Aber Manz hat ein Faible für dunkelgraue, manchmal auch olivfarbene Cordhosen, die er trägt, bis seine Frau sie unauffällig entsorgt.
»Lass uns doch mal in die Stadt fahren, dir was Schickes besorgen.«
Wie oft hat Christine ihm solche Vorschläge gemacht. Ohne Erfolg. Ein gewisses Maß an Sturheit, ein vielleicht schon zu sehr gefestigtes Selbstbild muss wohl vorausgesetzt werden.
Die Cordhosen kombiniert Manz in der Regel mit karierten Flanellhemden. Darüber trägt er stets eine Lederjacke, deren Taschen ausgebeult sind, da er dort viel verstaut. Schrauben zum Beispiel. Unterlegscheiben. Einen Notizblock. Sein Handy mit dem verkratzten Display, Kronenkorken, für die er keinen Mülleimer gefunden hat und Ähnliches mehr.
»Du bist so schön groß, hast ein markantes Gesicht und ein Kinn wie ein Bagger. Dir würde ein gut geschnittener Anzug viel besser stehen als diese … Vielleicht ein französischer? Etwas Elegantes wäre ein wunderbarer Kontrast.«
»Zu was?«
»Deinem Gesicht. Deinem Kinn.«
»Bitte?«
»Du hast die Figur dafür. Und den Ausdruck. Du guckst doch immer so grimmig.«
»Christine! Ich bin in einem Berliner Keller bei flackerndem Licht zur Welt gekommen, während alles wackelte und Mörtelstaub von den preußischen Kappen auf meine Mutter herabrieselte. Da wird man nicht plötzlich Franzose.«
So ungefähr hat er sich verteidigt. Und da steckt mehr dahinter als einfach nur Sturheit. Manz ist während seines Berufslebens genug alten Verbrechern begegnet, die sich jugendlich oder modisch gaben. Ihm fällt sofort auf, wenn Zähne zu weiß sind, Anzüge zu eng geschnitten oder Haare und Augenbrauen zu dunkel.
»Als Kriminaldirektor musste ich so rumlaufen. In Anzügen und bügelfreien Hemden. Jetzt kann ich sein, wie ich bin.«
»Du kultivierst deine Bodenständigkeit ein bisschen zu sehr, für meinen Geschmack.«
»Will sagen?«
»Irgendwann züchtest du Hasen.«
»Und auf Hasen kommst du …«
»Weil ich gerade an das Buch denken musste, aus dem du Julia immer vorgelesen hast, als sie klein war. Erinnerst du dich? Unserer Enkelin liest du es auch vor.«
»Die Häschenschule.«
»Genau.«
»Weil meine Mutter es mir schon vorgelesen hat.«
»Deine Mutter, ich weiß.«
Manz ist keinesfalls egal, was seine Frau denkt und will. Er ist jederzeit bereit zuzugeben, wie sehr es ihm gefällt, dass Christine sich modisch kleidet. Jedenfalls findet er, dass sie mindestens zwei Klassen besser und eleganter aussieht als die Frauen der anderen Männer im Club. Ja, sie sieht fast so gut aus wie Maria, und die ist acht Jahre jünger. Eins allerdings hat Maria seiner Frau voraus. Sie kann besser rudern, synchronisiert schneller, kommt auch bei hoher Taktung gut mit.
Manz hat die Brücke bereits zur Hälfte überquert, als er, ohne rechten Zusammenhang, an die Fähre denkt. Kaum drei Momente später hält eine Frau neben ihm, steigt von ihrem Rennrad ab.
Manz erschrickt nicht, wundert sich aber ein wenig.
»Maria. Gerade hab ich …«
»Störe ich? Denkst du nach?«
»Nie. Wie geht’s Johann?«
»Besser. Der Arzt hat ihn neu eingestellt, und er bekommt jetzt endlich seine Hüfte.«
»Klingt, als wäre dein Mann eine Maschine.«
»Heute nicht im Club?«
»Die werden auch mal ohne mich auskommen.«
»Klar. Und wo willst du hin?«
»Weiß ich noch nicht. Ich habe mich gerade gefragt, wie oft sie fährt.«
Manz zeigt runter aufs Wasser, wo gerade eine Fähre vom linken Flussufer ablegt.
»Die zur Zizzeninsel? Alle zwei Stunden. Jetzt im Sommer lohnt sich das. Wart ihr mal da?«
»Einmal und nie wieder. Christine gefiel es da überhaupt nicht. Sie möchte lieber in die Stadt, wenn sie mal Zeit hat.«
»Ist viel unterwegs, deine Frau. Stört dich das?«
»Warum fragst du?«
»Na ja, wenn man so viel allein machen muss.«
»Ich bin ganz gerne für mich.«
»Ist nett auf der Insel. Hin und wieder spielt eine Band, dann wird getanzt.«
»Christine mag keine Bierbänke, und den Wein fand sie schrecklich.«
»Sagt Johann auch. Außerdem ist es ihm zu weit, mit der Hüfte.«
»Wir könnten ja mal hinfahren.«
»Du und ich?«
»Nicht?«
»Doch. Kannst du denn tanzen?«
»Foxtrott kriege ich noch zusammen.«
»Hm.«
»Dachtest du Tango?«
»Nein, aber … Es kommt ein bisschen plötzlich. Willst du ganz rüber?«
»Wie?«
»Auf die andere Seite.«
»Weiß ich noch nicht.«
»Pass ein bisschen auf. Die Gegend … Du weißt ja, was für Leute da leben. Ich muss los, Johann braucht seine Medikamente.«
»Grüß ihn.«
»Klar …« Sie steigt auf ihr Fahrrad, radelt los. »Getanzt wird immer Freitag und Samstag …«
Manz sieht ihr nach, als sei es ein Abschied auf lange Zeit. Dabei wird er sie und Johann spätestens bei der Einweihung von Theos Solaranlage sehen. Falls Johann dann wieder krauchen kann. Frag mich sowieso, wie der zu so einer Frau kommt.
Am Ende der Brücke gibt es eine steile Treppe, die zum Uferweg hinabführt. Die nimmt Manz, registriert, dass es bereits dunkel wird, und geht dennoch weiter. Alles verwildert, hier macht keiner was.
Manz dringt immer tiefer in eine Gegend ein, die ihm äußerst fremd vorkommt, ist gezwungen, Abzweigungen zu nehmen, die ihn vom Fluss wegführen. Die Häuser gefallen ihm nicht. Auch der Geruch ist unangenehm, denn es riecht eindeutig nach Teer und schwefeliger Kohle. Er kennt das von früher. An manchen Tagen hat es in Berlin so gerochen. Hing vom Luftdruck ab und vom Wind.
Fünf Minuten später entdeckt er hinter den Büschen ein Feuer. Er geht näher ran, achtet darauf, dass er unentdeckt bleibt. Die Brandstelle hat die Größe eines Osterfeuers. Gespeist werden die Flammen von hölzernen Industriepaletten, uralten Briketts und großen Fladen Teerpappe. Jedes Mal, wenn neues Brennmaterial in die Flammen geworfen wird, wehen Funken in Richtung einer vor zwei Jahren geschlossenen Tankstelle.
Um das Feuer herum liegen Männer mit geschorenen Köpfen. Sie wirken matt und zufrieden. Diejenigen, die Brennmaterial holen, bewegen sich, als wären sie an Deck eines Schiffs.
Einen kurzen Moment lang verspürt Manz eine geradezu feurige Lust, sich zu zeigen. Er würde gerne hingehen und die ein bisschen … Einfach nur so. Warum nicht, er hat Feierabend. Lass! Der Adrenalinschub, der seinen Körper flutet, muss erst mal niedergekämpft werden. Lass die in Ruhe, obwohl … Drei oder vier würde er sicher schaffen. Besser nicht, denk an deinen Rücken, du bist nicht mehr vierzig.
Genau in diesem Moment fällt einer am Feuer um, als hätte ihn ein Schuss getroffen. Bleibt wie tot liegen. Manz hat so was schon gesehen. Männer, die nach einem Schuss in den Kopf stürzen. Er zieht sich zurück, geht weiter, meint zuletzt, er hätte die Orientierung verloren.
Endlich führt ihn ein Weg zurück an die Elbe. Er geht stromaufwärts, lässt das letzte Haus hinter sich und, ach!, ein Steg. Nicht abgesperrt und so lang. Hat er nach so etwas gesucht? Als Abschluss und Höhepunkt seiner kleinen Reise?
Manz tritt vorsichtig auf die Planken. Wippt. Das Holz federt, ist sicher alt, pass bloß auf.
Zuletzt steht er zehn Meter weit draußen über dem Wasser, das träge unter ihm hindurchströmt. Sein Blick geht rüber zum heimischen Ufer. Dort, weiter links, ich bin ja ein Stück stromaufwärts gegangen, sucht er, seinen Ruderclub ausfindig zu machen. Bei ihnen hängen doch so viele bunte Lichter, die Theo und Henning mit ihrer großen Leiter jedes Frühjahr installieren. Gibt immer Streit, wenn sie arbeiten, und machen doch alles zusammen.
Manz spürt, wie das Blut durch seine Füße strömt, und ein angenehmes, sehr allgemeines Gefühl von Zufriedenheit macht sich in ihm breit. Nur seinen Rücken, den spürt er. Dieses Körpergefühl, das sich manchmal zum Schmerz steigert, ist immer da. Wenigstens seit drei Jahren, und irgendwann brauche ich auch eine Hüfte oder einen neuen Rücken. Sein Arzt hat ihm letztes Jahr etwas aus Titan vorgeschlagen.
Es ist Anfang Juni, viele Millionen, wenn nicht noch mehr Blütenstände an Büschen und Bäumen verströmen einen so starken Duft, dass Manz sich ganz betäubt vorkommt. Besser als auf unserer Seite, mit den ganzen Segel- und Ruderclubs. Riecht da immer nach Teer und Lack.
Während Manz das ferne Ufer, das letztlich aus nichts als Lichtpunkten besteht, länger betrachtet, fühlt er sich immer einsamer. Wie verlassen. Eine Stimmung, die er in vollen Zügen genießt. Vielleicht bin ich deshalb hierher. Ins Dunkle. Und mit Maria mal auf die Insel zum Tanzen ist doch eine gute Idee, wenn Johanns Hüfte das nicht mehr schafft.
Manz hat drei längst erwachsene Töchter, zwei leben nicht weit weg in Dresden. Fünf Enkelkinder! Das eine oder andere wird regelmäßig bei ihnen abgegeben. Dazu kommen noch die Freunde aus dem Ruderclub und die vielen Verwandten von Christine.
Nein, er ist weit davon entfernt, einsam zu sein oder sich in irgendeiner Form zu verabschieden. Und doch ist ihm auf einmal, als hätte sich die Welt verändert, als hätte eine Verstellung ins Spezielle stattgefunden, als wäre nicht mehr alles so, wie es war.
Da es außer undeutlichen Schatten und bunten Lichtpunkten letztlich nichts zu sehen gibt, da Manz sich vollkommen auf die, wie ihm scheint, nur geringe Differenz zwischen sich und dem da draußen einlässt, hat er zuletzt das Gefühl, sein Inneres würde sich ausweiten. Ja, es kommt ihm vor, als würde er sich in diese äußere Welt verströmen. Die schweifende, sehr wache Ruhe gefällt ihm. Er hat so was lange nicht mehr verspürt, kennt es aber von früher. Und so hat er auf einmal Lust, etwas zu unternehmen, aufzubrechen, eine Reise zu machen.
Ein Gedanke, ein innerer Alarm.
Was …?
Schnelle Drehung. Kopf, Hals, Oberkörper. Er hat hinter sich ein Geräusch gehört, und an der Stelle, wo der Steg ans Ufer stößt, da steht doch jemand. Manz verwendet in seinen Gedanken das Wort Gestalt. Weil der am anderen Ende des Stegs keine Bewegung macht, nicht zu identifizieren ist.
Manz wartet. Lange. Und ist sich seiner Sache zuletzt nicht mehr sicher. Nachdem er sich davon überzeugt hat, dass keine Gefahr droht, dreht er sich wieder um.
Es war wohl nur eine Verrücktheit seiner überreizten Wahrnehmung. Sicher spielt der starke Duft eine Rolle, die sonderbare Gegend, in die ich geraten bin.
Manz befindet sich in einem leicht ungeregelten Zustand, den er normalerweise durch Tätigkeit aufgelöst hätte. Doch an diesem Abend setzt er sich den so lange vermissten Empfindungen weitere zehn Minuten lang aus. Er verlässt den Steg erst, als er merkt, dass das Gefühl sich abgestumpft hat, dass er dabei ist, es künstlich und willentlich zu verlängern.
Jabłońskis Mappen
Der Brief kommt drei Tage nach seiner abendlichen Wanderung.
Er liegt zwischen zwei anderen in dem Stapel, den Christine ihm nach oben in sein Arbeitszimmer getragen hat. Manz liest die wenigen Zeilen drei Mal.
Zeisig?
Da klingelt nichts. Warum bittet man ihn, in Berlin als Zeuge zu einem Vorgang von 1990 auszusagen?
Manz greift nach seinem Handy und ruft einen Kollegen in Berlin an, der noch aktiv ist.
»Ich möchte mit Jabłoński sprechen … Manz … Ja, der bin ich … Ausgezeichnet, danke der Nachfrage. Jetzt bitte Jabłoński.«
Manz zieht sich Block und Bleistift heran.
»Hallo Jabłoński, hier Manz … Ja, danke, gut und dir? … Freut mich … Ja, das steht, wir fahren nach Norwegen … Ach, ihr kommt mit, klappt es jetzt doch? … Na, da wird Christine sich freuen … Aber sicher … Aber sicher doch. Jetzt pass auf. Ich habe hier ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Berlin. Ich soll in einem Prozess aussagen. Tötungsdelikt zum Nachteil von Regina Zeisig. Sagt mir nichts, keine Ahnung, was das war. … Ja, weiß ich, dass du das nicht darfst. Du sollst mir ja auch keine Geheimnisse der Staatsanwaltschaft verraten, aber vielleicht guckst du dir meine Protokolle von damals mal an und schreibst mir ein Memo. Nur, dass ich ungefähr … Genau … Ich weiß, dass du mir keine Fotos schicken darfst. Mir reicht ein kurzes Memo … Ja, auch ein ganz kurzes. Also wenn es dir möglich ist, einem alten Freund, der dich selten um etwas bittet … Wie? … Ja, aber den Käse hat Christine weggelassen und stattdessen Schmand genommen … Ich weiß, dass ihr in Polen alles besser könnt, jeder weiß das … Danke … Was denn noch? … Für Norwegen? Na, das Gleiche, was du auch auf der Spree anziehen würdest. Wasserfest, nicht zu dick, nichts was scheuert und einen Pullover extra … Ich mich auch, wir sehen uns spätestens an der Fähre, grüß Katja.«
Drei Tage später kommen einige Mappen.
Gott, hat der alles fotokopiert?
Die Masse an Material erklärt sich, als Manz zu blättern beginnt. So viele Fotos!
Die Schwarz-Weiß-Kopien, die Jabłoński ihm geschickt hat, sind von erstaunlicher Qualität, und als Manz die Aufnahme eines Tellers betrachtet, auf dem die Knochen eines halben Hähnchens liegen, kommt die Geschichte zurück. Nicht langsam. Seine Erinnerungen setzen sich sehr schnell wieder zusammen. Der hellblaue Teppich. Sehr lange Fasern, sah aus wie in einem Puff.
Als er Christine am Abend von Jabłońskis Mappen erzählt, kommt es zu einem Missverständnis. Sie meint, er würde eine unschöne Marotte entwickeln, wäre von der Krankheit mancher Rentner befallen, wolle sich aus sentimentalen Gründen mit seinen alten Fällen beschäftigen. Ihr Verdacht ist ärgerlich, hat er doch Kollegen, die so etwas tun, stets bemitleidet.
»Was du immer gleich denkst.« Er sagt das mit einem offenen Lächeln, das seine Falten am Hals schön zur Geltung bringt. »Als ob ich so was täte. Nein, ich muss vor Gericht aussagen. Sie haben Anklage in einer alten Sache erhoben und wollen wissen, was wir damals ermittelt haben. Machen sie immer so. Steht eben nicht alles in den Akten.«
»Eine deiner Ermittlungen in Dresden?«
»Da habe ich ja kaum noch draußen gearbeitet. Nein, aus Berlin.«
»Dann ist das aber lange her. Wann sind wir nach Dresden gezogen?«
»7. Januar 91.«
»Das weißt du noch so genau?«
»Ich habe den Fall damals abgegeben, und das Gericht will nun wissen, was die ersten Ermittlungen ergeben haben. Eins ist komisch. Ich meinte damals ganz sicher, wir hätten den Töter ermittelt. Oder wären wenigstens auf dem richtigen Weg.«
»Was für einen Töter?«
»Täter. Du hörst mir gar nicht richtig zu.«
»Du hast Töter gesagt.«
»Jetzt lass das doch mal mit dem Kleinkram. Jedenfalls steht jetzt jemand ganz anderer vor Gericht. Ich hoffe nur, es wurde seinerzeit niemand verurteilt.«
»Weil der dann unschuldig im Gefängnis gesessen hätte, weil du dich geirrt hast.«
»Kriminalbeamte irren sich nicht. Juristen irren sich.«
»Also bitte!«
»Doch! Ist so. Glaub mir. Es war nie meine Aufgabe, auf jemanden zu zeigen, ich hatte Abläufe zu rekonstruieren, Zeugen zu vernehmen und Beweise zu sammeln, die dann analysiert wurden.«
»So wie in den Filmen.«
»Es geht um einen Vorgang von 1990. Da war es noch nicht so wie in den Filmen, die du dir anguckst.«
»Du guckst die doch auch.«
»Muss das sein?«
»Was?«
»Immer so kleinlich, so …«
»Du schaltest auf RTL, nicht ich.«
»Weil ich müde bin und abends nicht nachdenken will. Ich hab vierzig Jahre gearbeitet.«
Es kommen nicht nur Bilder zurück, sondern auch Ausdrücke. Manz hat in seiner aktiven Zeit nie von »Fällen« gesprochen, immer von »Vorgängen«. Jetzt, als Rentner, spricht er anders. Wenn er seinen Freunden aus dem Ruderclub eine kleine Ermittleranekdote erzählt, redet er von seinen »Fällen«. Er meint, man würde ihn dann besser verstehen.
Lackschichten
Es riecht nach Bootslack. Wolfgang, Theo, Henning und Manz stehen unter der Weide neben dem aufgebockten Vierer. Eigentlich wollte er nur Wolfgang davon erzählen, aber die anderen haben natürlich doch mitgekriegt, dass er nach Berlin fahren wird, um auszusagen.
»Einer deiner alten Fälle?«, fragt Theo.
»Sonst hätten sie mich wohl kaum vorgeladen.«
»Und nun kommt alles wieder hoch«, brummt Wolfgang, der in gebückter Haltung an ihrem Vierer arbeitet. »Die Emotionen, die Zweifel …«
»Ihr stellt euch das viel aufregender vor, als es war. Ich habe während meiner Jahre in Berlin über vierhundert Tötungsdelikte bearbeitet.«
»Das kann ja gar nicht sein.«
Als ehemaliger Notar neigt Henning ein wenig zum Zweifeln und Korrigieren.
»Doch, das stimmt schon, nur … in neunzig Prozent der Fälle steht der Täter neben der Leiche, ist ganz verzweifelt und sagt: ›Das habe ich nicht gewollt.‹«
»Wie viele hast du aufgeklärt?«, hakt Henning nach.
»Fast alle. Bei drei Vorgängen sind wir gescheitert.«
»Wir?«
»Man bearbeitet so was nicht allein. Weißt du, Henning …«
Während Manz weiterspricht, sieht er plötzlich ein Gesicht vor sich.
Vera.
Die Kollegin, mit der er damals zusammengearbeitet hat. Vera ist auf einem der alten Tatortfotos mit drauf, die Jabłoński ihm geschickt hat. Daher wohl. Er wischt das weg, spricht über die Zeit seines Wechsels von Berlin nach Dresden.
Dank seiner ruhigen Art sowie der Tatsache, dass er nie mit seiner Methodik oder Ausbildung prahlte, hatten die neuen Kollegen ihn bald akzeptiert. Schon nach einem halben Jahr war er einfach nur Manz gewesen, so, wie er auch in Berlin Manz gewesen war. Er fügte sich so gut ein, als hätte es ihn dort schon immer gegeben, als sei er der Repräsentant eines universalen Typus.
Ein Manz.
Niemand in Dresden hatte noch groß erwähnt, dass er aus dem Westen kam. Andere schon! Ein leitender Kriminaldirektor in München hatte ihn mal gefragt: »Sag, hattet ihr drüben bei euch eigentlich freie Hand beim Ermitteln, oder musstet ihr irgendwem Rechenschaft ablegen? Das ist jetzt nicht persönlich oder kritisch gemeint.«
Man hielt ihn in München für jemanden aus dem Osten.
Manz kam weder aus dem Westen noch aus dem Osten, er kam aus Berlin.
»Sag mal, Wolfgang, warum machst du das eigentlich so ungemein gründlich? Sieben Lackschichten! Ich meine, wir sind alle weit über siebzig.«
»Sei nicht albern, Manz, hol dir ein Bier.«
»Im Ernst. Warum so gründlich?«
»Es ist ein uraltes Boot, es verdient etwas Liebe.«
»Bier?«, fragt Henning, der bereits auf dem Weg zum Schuppen ist.
Manz nickt. »Bring gleich zwei.«
»Für mich noch nicht«, befiehlt Wolfgang.
»Doch. Bring zwei Flaschen.«
»Du weißt, ich trinke nicht während der Arbeit.«
»Du machst jetzt mal Pause, Wolfgang. Denk an deinen Rücken.«
»Du hast es mit den Bandscheiben, nicht ich.«
»Du merkst es vielleicht nicht, aber du stehst ganz krumm.«
»Ihr hättet das Boot ja auch höher aufbocken können.«
»Wolltest du nicht, wegen der Zweige der Weide.«
»Wann fährst du nach Berlin?«
»In acht Tagen.«
»Musst dich gut vorbereiten!«, sagt Theo, indem er seine Stimme in der Art verstellt, wie er sich einen Lehrer vorstellt.
»Nur ein bisschen. Der Richter wird mir zwei, drei Fragen stellen. Kommt nicht so drauf an.«
»Erzähl doch mal. Worum geht es?«
»Keine alten Geschichten.«
Henning kehrt mit drei Flaschen Bier zurück.
Kling-Klang.
Erst trinken sie, dann geht es wieder um Wolfgangs Schichten, die tief hängenden Äste der Weide und die Installation von Theos elektrovoltaischen Panels.
Nach einer Weile, die anderen bemerken es kaum, setzt Manz sich ab, geht zum Steg.
Die Vorgänge. Natürlich interessiert sie das. Ist ja auch spannender, als Wolfgang beim Schmirgeln zuzusehen.
»Noch ein Bier?«, hört er Henning rufen.
»Danke, nein. Muss gleich los!«
»Deinen Mordfall studieren!«, ruft Wolfgang, ohne seine Arbeit zu unterbrechen.
»Pass du lieber auf, mit deinem Rücken!«
Als Manz das Tor zum Ruderclub hinter sich schließt, hat er Wolfgang und die anderen bereits vergessen.
Mord in der Küche
»»Was ist denn damals passiert?«, fragt Christine, als er gerade dabei ist, die Teller aufzudecken. Natürlich hat sie gleich gemerkt, dass er in Gedanken ist an diesem Abend.
»Sag doch mal. Das muss ja was Größeres gewesen sein, wenn die Staatsanwaltschaft nach so vielen Jahren noch Anklage erhebt.«
»Das war nichts Großes. Eine Frau. Schon älter. Und das war alles längst raus aus meinem Kopf. Komplette Leere. Du verstehst?«
Ein Blick von ihr. Ein spezieller.
»Als wäre es nie geschehen«, fügt er hinzu.
»Und was ist nie geschehen?«
»Sie wurde im Dezember 90 in ihrer Wohnung erwürgt. Eigentlich eher erstickt. Eine extrem brutale Tötung. Regina Zeisig hieß sie. Zweiundsechzig. Salmbacher Straße, unten in Buckow.«
»Das weißt du noch?«
»Steht in den Akten, die Jabłoński mir geschickt hat.«
»Ach! Hat er was wegen Norwegen gesagt?«
»Ja. Es klappt jetzt doch, er kommt mit. Katja auch.«
»Damit rückst du erst jetzt raus? Und hör bitte auf, ihn Jabłoński zu nennen. Du bist nicht mehr sein Vorgesetzter.«
»Vermutlich ging es um Geld. Man hat den Fall damals offenbar doch nicht aufgeklärt. Falsche Präferenzen. Zu wenig Zeit. Ich dachte … Komisch, oder?«
»Wie du redest.«
»Ich hätte mich nie mehr im Leben an diesen Vorgang erinnert. Und doch ist alles noch da. Weißt du, was das Komische daran ist?«
Er wirkt so wach, so engagiert, dass Christine lächeln muss. Sie kann nicht wissen, dass dieses Komische für Manz gar nicht komisch ist. Er weiß es ja selbst nicht, ist nur ein wenig irritiert, weil er merkt, wie tief er schon drin ist, im Alten.
»Und jetzt haben sie den Täter?«
»Ein Erfolg der Forensik. Ich schätze, sie haben unsere alten Spuren ausgewertet.«
»Unsere? Hast du den Fall damals mit Vera bearbeitet?«
»Du erinnerst dich an ihren Namen?«
»DNA?«
Manz nickt.
»Und hattet ihr den, der jetzt vor Gericht steht, in Verdacht?«
»Eigentlich nicht. Vera und ich haben den Vorgang damals nur gut zwei Wochen bearbeitet und den, der jetzt angeklagt ist, auch ermittelt und vernommen. Aber dass er es gewesen wäre? Dann wurde ich versetzt. Keine Ahnung, wie das damals in Berlin weitergegangen ist. Ich jedenfalls hatte ihn eigentlich nicht in Verdacht. Vera auch nicht. Er hatte ein Alibi, und wir waren zu offensichtlich und zu oft auf ihn hingewiesen worden. Von Zeugen, die viel gelogen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten Vera und ich damals das Gefühl, wir hätten gleich fünf Leute verhaften können.«
»Sie wurde von fünf Leuten erwürgt?«
»Das ist nicht komisch, Christine. Die Tötung war extrem qualvoll für das Opfer. Andererseits … Wenn sie nicht tot gewesen wäre, hätte man Frau Zeisig gleich mit anklagen können. Misshandlung Anbefohlener und einiges mehr.«
»Aber bei einer DNA-Analyse ist ja jetzt alles eindeutig.«
»Hm … Waren wohl auf der falschen Spur. Aber wir standen ja auch noch ganz am Anfang.«
Für den damals fünfundvierzigjährigen Ermittler Manz war die Ermordung von Regina Zeisig kaum mehr als Routine. Jetzt ist das, so jedenfalls kommt es ihm vor, etwas anderes. Weil ich meine alten Sachen lese, das wird es sein. Dabei war er sich doch ganz sicher, mit seinem Beruf abgeschlossen zu haben, als er in Rente ging. Mit sechsundsechzig statt mit siebenundsechzig, ein Angebot. Und Berlin lag da bereits gut zwanzig Jahre hinter ihm.
Man hatte bei der Gelegenheit gleich seine ganze Abteilung aufgelöst. Kriminalisten wie ihn, »weil man Ihre Fähigkeit schätzt, sich in Vorgänge einzufühlen«, brauchte man nicht mehr, setzte eher auf die Forensiker oder ließ, falls die nichts Verwertbares fanden, Profiler kommen. Manz war ganz bestimmt kein Profiler gewesen, er hatte seinen Beruf Mitte der Sechziger gelernt.
»Oldschool«, so hatte es der leitende Kriminaldirektor aus München formuliert und ihn vermutlich noch am Tag seines Abschieds für einen aus dem Osten gehalten.
Weil er freiwillig ein Jahr früher ging, hatte Manz 2011 eine gute Abfindung erhalten. So waren Christine und er noch im Jahr seiner Pensionierung aus Dresden weggezogen. Aber nicht zu weit, denn zwei ihrer Töchter leben dort. Nur eben raus aus der Stadt. Hierher, an die Elbe, zehn Kilometer flussaufwärts, nach Zizzwitz.
Christine und er fahren auch heute noch regelmäßig nach Tschechien, mieten sich übers Wochenende in einer Pension ein und erkunden mit langen Spaziergängen und guten Wanderschuhen das Elbsandsteingebirge. Wir sind ja beide noch fit. Und was für ein Glück er hatte, als er durch Zufall drüben an der alten Tankstelle Wolfgang kennenlernte. Kurz nach dem Umzug war das. Fing gleich an, mit seinem Ruderclub.
»Du hast kräftige Arme«, hatte Wolfgang bereits bei ihrem zweiten Treffen gesagt. »Schon mal gerudert?«
Bald war Manz regelmäßig auf dem Wasser gewesen. Kein einziges Mal hatte er von seinen alten Vorgängen geträumt, es gab auch keine beunruhigenden Bilder in seinem Kopf.
Zwei Wochen später hatten sie ihn in ihren Ruderclub aufgenommen. Unkompliziert und so rasch, als hätten sie auf ihn gewartet. Manz hatte sich auch dort gut eingefügt und bald festgestellt, dass die Tatsache, dass sie im gleichen Alter waren, mehr wog als die Frage, ob einer von ihnen aus dem Osten oder Westen kam. Außer vielleicht Henning, der denkt noch so und behauptet immer das Gegenteil.
All das geht Manz durch den Kopf, während Christine den Aufschnitt aus dem Kühlschrank holt und alles auf einem Brett arrangiert. Sie hat ihn in Ruhe gelassen. Weiß sie, was mit ihm los ist? Natürlich.
»Kommst du?«
»Bin bereit.«
»Ach, die Teekanne …«
»Bleib sitzen.«
Manz nimmt das Sieb raus, trägt die Teekanne zum Tisch und stellt sie auf dem Meißner Stövchen mit den drei Elbfischern ab, das ihre Älteste ihnen zu Weihnachten geschenkt hat.
»Denkst du noch dran?«
»Ich wünschte, ich wäre das los.«
»Und was geht dir gerade durch den Kopf?«
»Hähnchenknochen.«
»Ach ja? Spielten die in eurem … Vorgang eine Rolle?«
»Gott, haben wir über diese blöden Knochen oft geredet.«
»Vera und du.«
»Ja. Und natürlich Grossmann von der Spurensicherung. Für den waren diese Knochen ein gefundenes Fressen.«
»Lebt Grossmann noch?«
»Keine Ahnung, warum fragst du?«
»Weil er immer gehustet hat.«
»Gehustet? Ich glaube, da verwechselst du was.«
Manz zieht die Butter zu sich heran und beginnt, sich ein Brot zu schmieren. Christine hört auf, Fragen zu stellen, schlägt ihr GEOSPECIAL auf und liest, wie so oft in letzter Zeit, einen Reisebericht. Manz bestreicht sich unterdessen sein Brot dick mit Mettwurst.
Jemand hatte in der Wohnung der Toten ein halbes Hähnchen gegessen. Mit Pommes Frites und Mayonnaise. Getrunken hatte er offenbar nichts. Warum eigentlich nicht, Hähnchen ist doch salzig? Nur das Opfer hatte getrunken. Fruchtsaft, aber das war nicht der Anfang. Begonnen hat es draußen. Auf dem Grundstück. Der Plattenweg, das Laub auf den Platten, darum ging es. Anfangs ist das keinem aufgefallen. Außer natürlich Jabłoński.
»Hör dir das an. Da sind zwei mit einem Zelt ins Death Valley gefahren. Jetzt schreiben sie, es sei teilweise unerträglich heiß gewesen im Zelt und teilweise sehr kalt. Und so ein GEO Special kostet zehn Euro. Ist das nicht frech?«
»Absolut!«
»Sag, wollen wir nicht im Herbst auch noch mal weg? Richtig weit weg. Nicht ins Death Valley, sondern irgendwohin, wo es kühl ist, luftig, wo wir uns nicht im Traum vorstellen können, wie es da aussieht und wie die Leute da leben.«
»Machen wir …«
»Hörst du mir zu?«
»Klar.«
Es hatte noch nicht zu regnen begonnen, als er in Buckow ankam, aber er hatte den Regen bereits gerochen. Die Bilder von damals lösen sich auf, sein Blick ist auf die Mettwurst gerichtet. Wie lange schon?
»Kommst du mit ins Bett oder willst du noch an deinem Vorgang arbeiten?«
»Heute nicht mehr. Hast du im Programm nachgesehen, was läuft?«
»Viele Krimis.«
»Und sonst?«
»Eine Dokumentation über Tibet?«
»Tibet klingt gut.«
Jabłoński und die alte Zeit
»»Es war so still.«
Das sagte Günther Zeisig am Dienstag, den 18. Dezember 1990, noch vor dem Haus seiner Mutter. Manz hatte den Zeugen an diesem Tag nur kurz gesehen. Und nur dieser eine Satz war gefallen. Dann waren sie unterbrochen worden, und der Zeuge war verschwunden. Das erste einer ganzen Reihe von Missverständnissen. Günther Zeisig, damals neununddreißig, hatte seine Mutter tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden und die Polizei angerufen. Mehr wusste Manz zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
»Ahorn!« Die Erinnerung wird sofort genau. Zwei Bäume. Rechts vom Plattenweg, der auf das Haus zuführt. Zeisig hatte über die Blätter gesprochen, das meinte er mit »Stille«.
Manz hat nicht laut gesprochen. Nicht den ganzen Satz. Nur die Worte »Ahorn« und »Stille«.
Er sitzt oben im Arbeitszimmer. Am Schreibtisch. Wo er normalerweise die Abrechnungen für den Ruderclub erledigt und kontrolliert, ob alle ihre Mitgliedsbeiträge bezahlt haben.
Christine hat das Haus direkt nach dem Frühstück verlassen. Eine familiäre Tragödie. Die mit einem Anruf begonnen hatte, als er gerade den Kaffee auf den Tisch stellte. Seine Frau war sofort nach Dresden gefahren. Eine Stunde später rief sie ihn kurz an und sagte, dass sie sicher noch zwei oder drei Tage bei der jüngsten ihrer drei Töchter bleiben würde.
»Julia braucht jetzt jemanden.«
»Soll ich kommen?«
»Besser nicht.«
Offenbar hatte seine Tochter ihren Mann rausgeschmissen.
»Nur bis sie sich beide beruhigt haben, es geht um eine Frau aus seinem Büro«, hatte Christine ihm am Telefon erklärt. Was Manz wahnsinnig ärgerte. Julias Tochter Emma ist sein Lieblingsenkelkind, und er ist der Meinung, wer ein Kind hat, der habe nicht das Recht und so weiter.
Manz steht auf, denn auf seinem Schreibtisch wird es eng. Also räumt er die Sachen des Ruderclubs ins Regal und breitet die Papiere aus, die Jabłoński ihm geschickt hat. Dann setzt er sich. Wobei er seine Hosenbeine ein Stück hochzieht, so, wie er es auch früher immer gemacht hat. Er schaltet seine alte Schreibtischlampe an. Die durfte er mitnehmen. Damals. Als er aufgehört hat.
Doch die alte Lampe nützt nichts. Manz hat Schwierigkeiten, wieder reinzukommen in den Vorgang Regina Zeisig.
Rausgeschmissen, warum? Hat er sich verknallt? In wen? Eine aus seinem Büro? Weil er mit der mehr Zeit verbringt als mit Julia? Weil sie die gleichen Probleme haben, die gleichen kleinen Siege feiern? Jämmerlich.
Entschlossen setzt er seine Brille auf, drückt den Bügel mit dem Zeigefinger fest auf den Nasenrücken und beugt sich über seine Papiere.
Drei dicke Ordner. Einer davon mit erstklassigen, nummeriert zugeordneten Fotokopien der Aufnahmen von damals. Der verrückte Jabłoński. Bin gespannt, wie viele Koffer er in Norwegen dabeihat. Den Ordner mit den kopierten Fotografien legt er rechts ab. Vernehmungsprotokolle und anderes Schriftliches links. So hat er es immer gemacht: Fotos rechts, Schriftliches links. Nur hat er damals für gewöhnlich nicht mit solchen Mengen an Fotos gearbeitet. Die Erinnerung an ein noch junges Gesicht wird genauer, die Formulierung bleibt die gleiche. Der verrückte Jabłoński. So haben Vera und er ihn genannt. Und Jabłoński war wirklich jung. Einundzwanzig oder zweiundzwanzig. Gewissenhaft. Er war Ende 1990 aus Ostberlin zu ihnen gestoßen.
»Dokumentation.«
Mehr hatte Jabłoński nicht erklärt, als er sich vorstellte. Einige Kollegen in der Karl-Marx-Straße meinten damals, Jabłoński wäre von der Stasi gekommen. Wie so oft schickten sie Manz vor. Weil er sich, wie sie glaubten, mit Kriminaldirektor Behrens so gut verstand. Was aber vor allem daran lag, dass die Frau von Behrens mit Christine befreundet war. Sie hatten ein paar gemeinsame Städtereisen gemacht.
»Sag mal, stellen wir eigentlich Leute von der Stasi ein?«
Behrens hatte gelacht.
»Wegen Jabłoński?«
»Er sagt nicht viel.«
»Das ist doch Unsinn, Manz! Jabłoński ist Berufsanfänger, der kann nicht bei der Stasi gewesen sein. Also regt euch ab. Früher oder später werden noch mehr Kollegen von drüben zu uns stoßen. Vielleicht schicken wir auch selbst welche rüber. Die Behörden müssen zusammenwachsen.«
»Es sei denn, die werden zu einem Staat in Föderation.«
»Das sind doch Luftschlösser. Christine und du, ihr wart ja oft drüben, du weißt, wie vergammelt da alles ist. Ohne uns kommen die niemals auf die Beine. Die werden sich schon einfügen müssen, die Kungelei mit den Russen ist vorbei.«
»Aber Jabłoński ist kein Ermittler, oder?«
»Dokumentation.«
»Du meinst Tatortfotograf?«
»Dokumentation, steht in seiner Dienstakte.«
»Die hatten andere Bezeichnungen, verstehe.«
Vermutlich wusste Behrens auch nicht mehr, hatte schlicht Anweisung erhalten, Jabłoński irgendwie in ein Team einzugliedern. Er hatte ihn Vera und ihm zugeordnet und Manz ein paar Tage später noch mal gefragt, ob ihm Dresden gefalle.
»Du hast mir doch mal erzählt, deine Frau hätte dort Verwandte.«
»Christine hat das deiner Frau erzählt, das meinst du.«
»Ist doch egal. Gefällt dir Dresden?«
Das war das erste Vorzeichen der neuen Zeit gewesen. Des Wechsels von Berlin nach Dresden. Der zweiten Hälfte seines Berufslebens.
Graustufen, aber nicht zu viele. Dank der guten Kontraste wirkt die Aufnahme beinahe plastisch. Perfekt abgelichtet. Wie alles, was Jabłoński damals ins Visier nahm.
Das Haus von Regina Zeisig war eins von denen, die man Anfang der fünfziger Jahre gebaut hatte. Zwei Geschosse mit grauem Rauputz beschlagen. Der Garten hatte über zweitausend Quadratmeter und war damit deutlich größer als die anderen in der Siedlung. Der Mann von Regina Zeisig hatte, wie Manz später erfuhr, vorgehabt, ein zweites Haus davorzusetzen, um es zu verkaufen. Doch das war nie passiert. So lag das Gebäude fünfzig Meter weiter zurück als die auf den Nachbargrundstücken. Manz muss lächeln, als er die Fotos durchgeht. Der verrückte Jabłoński hat damals wirklich alles fotografiert.