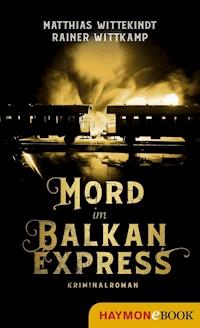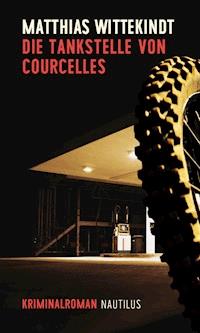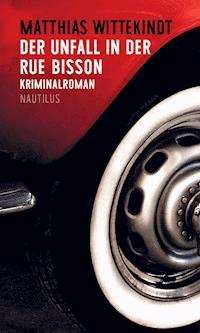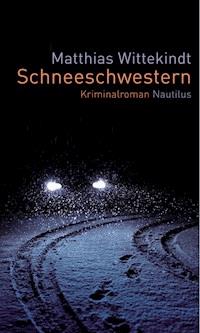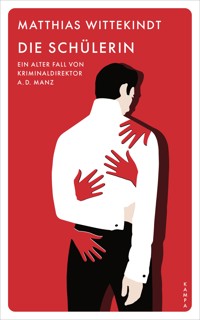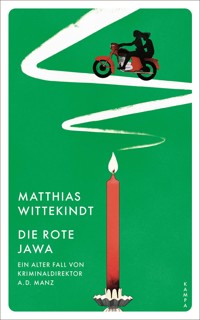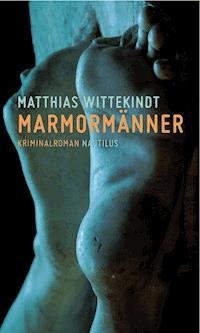8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Craemer-und-Vogel-Reihe
- Sprache: Deutsch
Kopenhagen, 1910: Der 8. Internationale Sozialistenkongress ist ein Sammelbecken für Schwärmer, Umstürzler und Utopisten jeglicher Couleur. Mitten unter ihnen: Der preußische Geheimagent Albert Craemer. Getarnt als Genosse, hofft er, etwas über die Hintergründe eines Attentats zu erfahren, das sich kurz zuvor im Berliner Tiergarten ereignete. Seine Mission ist heikel: Nicht nur, weil Craemer fürchten muss, enttarnt zu werden - sondern auch, weil er den Mördern bereits viel näher ist, als er selbst es ahnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DASBUCH
Ein Sommertag in Berlin. Zahlreiche Besucher flanieren durch den Tiergarten, eine Blaskapelle spielt, ein Elefant führt Kunststücke vor. Plötzlich Schüsse, jemand ruft etwas auf Russisch, mehrere Menschen gehen getroffen zu Boden. Die Täter können im darauffolgenden Tumult unerkannt entkommen. Wer waren sie und was trieb sie dazu, am helllichten Tag in der kaiserlichen Reichshauptstadt einen kaltschnäuzigen Mord zu begehen? Rasch werden die Ermittlungen der Sektion III b übergeben, dem preußischen Geheimdienst. Während Agentin Lena Vogel die Befragungen vor Ort durchführt, reist ihr Vorgesetzter, Major Albert Craemer, zum 8. Internationalen Sozialistenkongress nach Kopenhagen in der Hoffnung, dort Einblick in die russische Dissidentenbewegung zu erlangen. Schneller als gedacht, führen ihre Nachforschungen die beiden wieder zusammen – und offenbaren eine Verschwörung von internationalem Ausmaß.
DERAUTOR
Matthias Wittekindt, geboren 1958 in Bonn, aufgewachsen in Hamburg, ist Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Kriminalromanen. Seine Werke wurden mit dem Kurd-Lasswitz-Preis, dem Berliner Architektenpreis sowie zweimal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Matthias Wittekindt lebt in Berlin.
MATTHIAS WITTEKINDT
SPUR DES VERRATS
HISTORISCHERKRIMINALROMAN
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 06/2023
Copyright © 2023 by Matthias Wittekindt
Copyright © 2023 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Lars Zwickies/Joscha Faralisch
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
unter Verwendung von Motiven
von © Shutterstock.com (f11photo)
und © Bridgeman Images (Everett Collection)
Karte [>>]: Das Illustrat unter Verwendung eines Motivs
von © Shutterstock/Cartarium
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28566-1V001
www.heyne.de
1
(Erster Tag – Schießerei im Zoo)
Fjodor Judin hatte Angst.
Als er und seine Genossen die Lichtensteinbrücke überquerten, waren seine Augen immerzu in Bewegung. Das Gleiche galt für Fjodors Gedanken.
Sie könnten eine Frau schicken.
Die Eingebung war neu. Sie kam ihm erst jetzt, auf der Brücke. Ein schrecklicher Einfall, der aber zu seiner Gemütsverfassung passte. In Fjodors Geist war eine Art Drehbewegung entstanden, ähnlich einem Strudel. Und der zog auch noch die unbedeutendste Beobachtung zu einem Zentrum hin, wo sie ihm nichts als Angst und Sorge gebar. So kam ihm beim Anblick einer Passantin in einem gelben Kleid die geradezu absurde Vorstellung … Sie könnte einen Auftrag haben.
Einige Genossen, so ging das Gerücht, hatte die Zaristische Geheimpolizei von Frauen ermorden lassen.
Die Ochrana kennt keine Scham.
Auch auf dem belebten Droschkenplatz neben dem Eingang zum Berliner Zoologischen Garten versuchte er jede Bewegung, jede Person im Auge zu behalten.
Nicht nachlassen, dachte er wieder und wieder.
Es wurde immer schlimmer. Als er, Sergej und Witalij den Zoo betraten, zuckten seine Blicke so wild hin und her, als sei er von einem Wahn befallen. Und etwas in dieser Art war es ja auch. Ein Wahn eingebildeter Gefahr. Mit dem Blick eines gesunden Menschen hätte er lediglich den alltäglichen Sonntagnachmittag unter einem bedeckten Berliner Himmel gesehen. Frauen und Männer flanierten durch den Zoo. Einige standen in Gruppen herum. Eine Dame stieß ihren Mann an und wies mit der Spitze ihres Sonnenschirms in Richtung des Pavillons, in dem sich gleich ein Blasorchester versammeln würde, um die Zoobesucher zu unterhalten. Zwei kleine Jungen liefen ihren Eltern voraus, in Richtung des Käfigs mit den Braunbären.
»Gerade noch zeitig«, sagte die Frau mit dem Sonnenschirm und zeigte dezent auf einen Mann mit einer Tuba, der gerade den Platz vor dem Pavillon überquerte.
»Gut, dass wir die Droschke genommen haben und nicht die Tram«, antwortete ihr Mann. Dann blickte er kurz nach links, wo eine ausnehmend schöne junge Frau stand, die etwas verloren oder doch wenigstens suchend wirkte. Ihr Kleid war hellblau, mit ganz schmalen muschelgrauen Borten. Und in der Taille so eng geschnürt, dass sich der Gedanke aufdrängte, sie könne darin doch unmöglich atmen. Da er sich darüber freute, dass sie seinen Blick für beinahe drei volle Sekunden erwiderte, korrigierte er den Sitz seines Zylinders ein wenig, indem er ihn, von schräg hinten her drückend, ganz leicht in Schieflage schob.
»Nun komm, Theo«, mahnte seine Frau. »Nicht dass wir am Ende wieder ganz hinten stehen und sich deine Augen ständig verirren.«
Sie mahnte zu Recht zur Eile, denn die Mitglieder der Kapelle, die bereits ausgepackten Instrumente teils geschultert, fanden sich soeben in dem muschelförmigen Musikpavillon ein, wie sie das an jedem Sonntag um exakt diese Uhrzeit taten.
Das alles und noch einiges mehr sah Fjodor und hätte es wohl für alltäglich gehalten, wäre da nicht seine Angst gewesen.
Besser noch mal überprüfen.
Seine Hände bewegten sich, tasteten. Zwei Revolver, beide geladen.
Neben ihm liefen die Genossen Sergej und Witalij. Die Augen der beiden waren ruhig. Ihre Blicke gingen mit natürlicher Neugier in Richtung des Restaurants, des Musikpavillons, der Käfige und natürlich der Damen.
Bären, dachte Fjodor, als er den Käfig sah.
Aber da war noch mehr; der Wind trug ihm gerade einen Geruch zu, den er aus seiner Heimat kannte.
Flieder.
Im Garten seiner Großmutter am Stadtrand von Sankt Petersburg hatte es eine ganze Hecke aus Fliederbüschen gegeben. Im Sommer war dort immer ein vielstimmiges Summen zu hören gewesen, denn sein Großvater hielt Bienen.
»Ach, guckt mal!«, sagte in diesem Moment Sergej und zeigte auf einen Elefanten, der in gut hundert Metern Entfernung auf dem großen Sandplatz stand.
Was für ein Bild! Links Rosen, rechts Rosen, dazwischen der Elefant. Aber war der graue Koloss Fjodor überhaupt aufgefallen? Nein. Er war so ängstlich damit beschäftigt, seine Umgebung im Auge zu behalten, dass ihm das nicht eben kleine Tier vollkommen entgangen war.
Man hatte den Dickhäuter wie jeden Sonntag aus seinem Gehege geholt und vorbei am Vierwaldstätter See und dem Kaskadenteich hierhergeführt. Und das nicht ohne Grund, wie jeder sehen konnte, denn vor dem Elefanten lag ein mannsgroßer Ball, zusammengenäht aus bunten Stoffstreifen.
»Oha!«, sagte Witalij. »Das wird was werden.«
Der junge Russe ahnte, was gleich geschehen würde, denn er war einige Male zusammen mit seinen Kindern im Zirkus gewesen. Nicht in Berlin natürlich, sondern in Sankt Petersburg.
Fjodor hatte kein Auge für all das. Er war ganz gewiss nicht die gefahrvollen zweitausend Kilometer von Sankt Petersburg bis hierher gefahren, um einen Elefanten zu sehen.
Der Wind nahm zu. Er zupfte ein paar Hundert rosafarbene Blütenblätter von den Kamelien, die der zuständige Gärtner angesichts der Wettervorhersage besser im Wintergarten gelassen hätte.
Wieder bewegten sich Fjodors graue Augen.
Wo steckt sie?
Er hielt sich rechts und ging weiter.
Wo steckt sie?
Mehr dachte und empfand Fjodor Judin nicht. Weil die Tiere ihm nicht helfen würden, falls man ihn und seine Kameraden angriff. Er bemerkte also die Löwen, Bären und Beuteltiere gar nicht. Auch nicht die Halbaffen, obwohl die sich ziemlich aufführten, oben in ihrem Geäst. Ja, nicht mal die auffälligen Flamingos stachen ihm ins Auge, weil … Diese Augen suchten unablässig nach zwei Dingen. Erstens: möglichen Angreifern. Zweitens: Anna. Eine Frau, die sich während der Operation als seine Braut ausgeben würde. Sie hatte diesen Ort als Treffpunkt vorgeschlagen. Noch in Sankt Petersburg, vor dem Tor zur Werft.
»Warum im Zoo?«, hatte er sie gefragt.
»Weil du Berlin nicht kennst. Wo der Zoo ist, kann dir jeder sagen. Und das Bassin mit den Seelöwen wirst du schon finden.«
»Und dort werde ich Keegan und Bates treffen?«
»Ja.«
»Und sie werden mich sicher nach England bringen?«
»Man weiß nie, wie es kommt, aber so ist es geplant.«
Gerade mal zehn Tage lag dieses Gespräch zurück. Anna war vor ihnen gefahren. Seitdem war einiges passiert. Er, Sergej und Witalij hatten bereits am Tag ihrer Abreise einen Genossen verloren.
Ist nicht zum Treffpunkt gekommen.
Vermutlich hatten die Schergen des Zaren den treuen und vorsichtigen Pavel gefasst und …
Gefoltert.
Fjodor war wütend.
Fjodor hatte Angst.
Fjodor wurde von einem schlechten Gewissen geplagt.
Er hatte das Vertrauen vieler Menschen missbraucht, um seinem Ziel näherzukommen. »Für eine bessere Zukunft des russischen Volks«, wie Anna es formuliert hatte.
Aber war es nicht auch um Geld gegangen?
Jetzt waren er, Sergej und Witalij ihrem Treffpunkt mit Keegan und Bates sehr nahe.
Und der Gefahr auch. Falls Pawel tatsächlich gefasst wurde und unseren Treffpunkt in Berlin verraten hat.
»Da«, sagte Witalij und zeigte auf die Seelöwen. Die Tiere waren noch immer etwas aufgeregt, denn man hatte sie gerade gefüttert.
Witalij bekam mehr Details mit als seine Genossen, denn er sprach einigermaßen gut Deutsch. Ein kleines Mädchen in einem grünen Samtkleid, das sie ein wenig wie eine Puppe aussehen ließ, fragte eben seine Mutter, was denn mit den Gräten geschehe, wenn die Seelöwen die Fische einfach so runterschlangen.
Witalij spürte einen kleinen Stich im Herzen, als er die beiden sah. Denn die Mutter des Mädchens war sehr schön. Sie lachte über die Frage ihrer Tochter in einer so reizenden und natürlichen Art, als sei sie selbst fast noch ein Kind. Leider gingen die beiden weiter. Das kleine Mädchen wollte die Bären sehen.
Auch Fjodor Judin sah die beiden. Doch sie interessierten ihn nicht für einen halben Heller.
Sie hatten ihren Treffpunkt erreicht, und zwar auf die Minute pünktlich.
Wo ist Anna?
»Da«, sagte Witalij zum zweiten Mal, nachdem er sich vom Anblick der Mutter losgerissen hatte, die nun bereits mit ihrer kleinen Tochter vor dem Bärenkäfig stand. Er zeigte jetzt auf eine kleine Baumgruppe.
Fjodor Judin entdeckte Anna sofort.
Und war alarmiert.
Was macht sie für Zeichen? Und wem überhaupt?
»Da!«, sagte Witalij zum dritten Mal und zeigte auf zwei Männer, die mit gezogenen Revolvern zügig von der anderen Seite eines großen Springbrunnens auf sie zukamen. Es war das Letzte, was von Witalij kam, denn die erste Kugel traf ihn mitten ins Gesicht.
»Нам нужно укрытие!«, schrie Fjodor.
O ja, sie brauchten Deckung. Und sie mussten sich verteidigen. Also zogen Sergej und er ihre Waffen und erwiderten das Feuer, während sie in geduckter Haltung hinter dem Springbrunnen Schutz suchten.
Die beiden Angreifer trugen Bowler und graue Anzüge, wirkten fast vornehm, wenn man von ihren Pistolen absah.
»Oставáйся на месте, Fjodor!«, schrie Sergej, als Fjodor Anstalten machte, seine Deckung zu verlassen.
Einer der beiden Bowlerträger hörte das und rief zurück: »Ты не убежишь, Fjodor!«
Der andere Bowlerträger ergänzte voller Zorn: »Предатель!«
Die Schießerei hatte ohne Vorwarnung begonnen.
Witalij war tot.
Es blieben vier Männer und sechs Pistolen, denn Fjodor und Sergej schossen beidhändig.
Die Magazine wurden mehrfach nachgeladen, es wurde unausgesetzt geschossen. Die Zoobesucher jedoch schienen überhaupt nicht zu begreifen, was da passierte. Zeugen mutmaßten später, dass es am Wasserdunst des Springbrunnens lag, oder dass alle Blicke immer noch wie gebannt auf den Elefanten gerichtet waren. Niemand rannte los oder suchte Deckung. Es sah aus, als habe man eine Anzahl Statisten auf einer Bühne verteilt, in deren Mittelpunkt eine vom Wind verwirbelte, acht Meter hohe Fontäne alles eintrübte. Ein Wunder, dass nicht mehr Menschen von den zahlreichen Kugeln getroffen wurden.
Nur eine! Eine einzige Frau bewegte sich.
Sergej hatte nicht die Zeit, so lange hinzusehen, bis er wusste, ob es der Mutter gelungen war, ihr Kind in Sicherheit zu bringen. Aber er sah noch, wie sie ein kleines, grünes Türchen öffnete. Länger hinzusehen hatte Sergej nicht den Nerv, seine Nerven waren anderweitig beschäftigt. Ein Oberschenkeldurchschuss. Er feuerte trotzdem weiter.
Die Schießerei dauerte fast zehn Minuten. Nach und nach begannen einige Besucher, sich in vermeintliche Sicherheit zu bringen. Reflexhaft gingen sie hinter den Rosen in Deckung, die ihnen nicht viel Schutz boten. Die Menschen liefen nicht zum Ausgang, sie rannten nicht wie die Hasen.
Dann wurde Sergej in den Hals getroffen. Er starb einen längeren und qualvolleren Tod als sein Genosse Witalij.
2
(Kommissar Adler beginnt zu ermitteln)
Eine Schießerei mitten in Berlin.
»Frechheit!« Dieses starke Wort benutzte Lars von Selchow in den Räumen des Preußischen Geheimdienstes am Königsplatz, als man ihn informierte.
Er empörte sich zu Recht. Nur war es eigentlich gar keine Empörung. Lars von Selchow war schockiert. Und auch ein wenig beschämt.
Der deutsche Inlandsgeheimdienst hat offenbar komplett versagt.
Er behielt diesen Gedanken vorerst für sich.
Auch die Zeugen der Schießerei wünschten sich unmittelbar nach der Tragödie Klarheit. Auch sie waren empört. Niemand lief Richtung Ausgang; möglicherweise lag das auch an der Anwesenheit des stark bewegten Elefanten. Ein Glücksfall für Gendarm Habert und Kommissar Adler, die noch vor von Selchow an Ort und Stelle waren.
Alle wollten eine Erklärung. Alle hatten das Bedürfnis, die Uhr zurückzudrehen. Um Ordnung zu schaffen. Um die Dinge noch einmal ablaufen zu lassen. Langsamer diesmal. Es wurde viel geredet. Und es ging ziemlich durcheinander dabei.
Das Verrückte daran: Die Schießerei, so sie diese überhaupt wahrgenommen hatten, schien den Zeugen gar nicht das Wichtigste gewesen zu sein. In erster Linie beschäftigte sie der durchgegangene Elefant. Und von einem kleinen Mädchen und seiner Mutter war immer wieder die Rede.
»Die soll sehr schön gewesen sein, sagt meine Frau.«
»Das kleine Mädchen soll ein grünes Samtkleid angehabt haben.«
»Grün. Richtig. Sagt meine Frau auch.«
Dabei hatten doch Mutter und Tochter ganz gewiss nichts mit der Schießerei zu tun. Wie also war es abgelaufen? Wie stellte sich die Sache für Kommissar Adler dar?
Nun, es hatte als ein ganz normaler Tag begonnen.
Der Nachmittag des 24. August 1910 hätte sich mit knapp dreiundzwanzig Grad Außentemperatur durchaus zum Flanieren angeboten. Allerdings war die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Regelrecht drückend. Kein Wetter also für Männer mit Bluthochdruck oder ältere Frauen in zu eng geschnürten Korsetts. Außerdem bestand seit dem Mittag eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es regnen, eventuell sogar gewittern würde. Im Nachhinein ein glücklicher Umstand. Denn sonst hätten sich sicher noch mehr Menschen entschlossen, dem Berliner Zoo einen Besuch abzustatten.
Das kleine Mädchen mit seiner hübschen Mutter war vielen aufgefallen. Und was die beiden anging, da gab es so was wie ein Rätsel, das die Menschen beschäftigte.
»Wie kam denn die Kleine da überhaupt rein?«
»Genau das fragen wir uns auch.«
»Mir wurde gesagt, ihre Mutter habe sie hinter einem kleinen Türchen in Sicherheit bringen wollen.«
»Das ist aber wirklich ein sehr kleines Türchen.«
»Und jetzt ist die Mutter tot.«
»Haben Sie’s gesehen?«
»Meine Frau … Sie sagt, ihr Gesicht sei regelrecht auseinandergesprungen. Und sie soll wohl sehr schön gewesen sein.«
»Zwei Kriminaler sind schon da!«
»Fragt sich, wann die mal anfangen.«
»Womit?«
»Na, die einzufangen, die das alles angerichtet haben.«
»Glück im Unglück«, sagte nun Gendarm Habert und zeigte dabei in Richtung der dunklen Wolken am Himmel.
Kommissar Adler stimmte ihm zu. »Bei besserem Wetter und dem üblichen dichten Gedränge hätten wir vermutlich zehn, fünfzehn, vielleicht zwanzig Tote zu beklagen. Darunter mit aller Wahrscheinlichkeit mehrere Kinder.«
»Exakt mein Gedanke«, sagte der Gendarm, der sich bei aller Aufgeregtheit um eine vernünftige Haltung bemühte, weil …
Kommissar Adler möchte es so.
Habert kannte seinen Vorgesetzten. Adler bewegte sich für seinen Geschmack zu wenig, hatte etwas zu deutlich Beleibtes und trug stets zu enge Schuhe, die ihn noch mehr einschränkten als sein Bauch. Trotzdem – oder gerade deswegen – wusste Habert, dass Kommissar Adler Haltung schätzte. Mehr noch …
Verlangt!
»Hier einfach eine Schießerei zu beginnen, Herr Kommissar … Nur gut, dass dem Kind nichts passiert ist.«
»Sicher, mein Habert, sicher. Aber wie ist die Kleine überhaupt da reingeraten?«, wunderte sich Kommissar Adler. »Ich meine, es wird ja niemand die Gitterstäbe des Bärenkäfigs auseinandergebogen haben.«
»Ich werde die Zeugen befragen«, versprach Habert. »Irgendwer hat es sicher gesehen.«
»Mit diesen Kreaturen ist nicht zu spaßen«, erklärte Adler ihm mit einem Blick und in einem Tonfall, als wisse er sehr viel über Bären. Woraufhin der Gendarm unwillkürlich in Richtung des Käfigs blickte. Die Tiere dort wirkten noch immer verstört. Kaum, dass Gendarm Habert die Szenerie mit den Bären einigermaßen erfasst hatte, musste er sehr schnell einen Schritt zur Seite machen, ja, fast schon war es ein Sprung. Eine Gruppe von acht langbeinigen Flamingos lief direkt an ihm vorbei, gefolgt von drei Angestellten des Berliner Zoos, die versuchten, die Tiere einzufangen.
»Lieber Gott!«
»Sie sagen es, Habert«, pflichtete Adler seinem Untergebenen bei. »Der liebe Gott hat heute seine beiden Hände schützend über uns gehalten.«
Die feist rosa gefärbten Flamingos waren nicht als einzige Kreaturen außer Rand und Band. Viel Lärm, viel Rufen, Schreien, Pfeifen, Jaulen, Trompeten, Krakeelen. Die Tiere wirkten empört und verstört.
Das stellte die soeben eingetroffenen Leichenbeschauer vor eine ungewohnte Aufgabe. Zumal auch der Elefant noch immer unterwegs war und nicht zu wissen schien, wo er hinwollte.
Überall standen schockierte Besucher, die befragt werden sollten, und tauschten sich aus. Ein Blickfang waren ohne Zweifel die jungen Frauen, die den Augen von Gendarm Habert nicht entgingen. Oder interessierten ihn vielleicht gar nicht die Damen selbst, sondern die klaren Farben ihrer langen, mäßig weit ausgestellten Röcke, ihre kleinen, schmal geschnittenen Jäckchen und ihre Schirmchen?
Kurz gesagt: Es war, vor allem im Zusammenspiel mit dem Sprühdunst der vom Wind noch immer stark zerzausten Fontäne des Michelangelobrunnens, ein Bild für die Götter.
»Wie hinterhältig! An einem Ort zu schießen, wo sich Frauen aufhalten!«
»Und Kinder!«
Einer der vielen, die sich äußerten, war ein Mann Mitte dreißig, der breite Hosenträger, ein Hemd in verschossenem Weiß und einen sehr kleinen Hut trug. Er sprach mit einem Gleichaltrigen, der in seinem Zweireiher mit auffälligem gelbem Einstecktuch recht modisch wirkte. So verschieden, wie die beiden sich gekleidet hatten, war davon auszugehen, dass sie niemals miteinander gesprochen hätten, wäre hier nicht diese Ungeheuerlichkeit geschehen.
Vermutlich kamen beide aus Berlin; bei dem Mann mit den Hosenträgern jedoch wurde dies deutlicher als bei dem mit dem Einstecktuch.
»Ich kriegte ja zuerst jaanüscht mit.«
»Nun, wer rechnet denn auch mit einer solchen Ungehörigkeit?«
»Nur eben, dass der Elefant plötzlich loshoppelte. Als hätte ihn jemand in den Hintern … Na, vielleicht hat er ja auch hinten was abgekriegt. So viele Kugeln, wie hier rumflogen.«
»Denkbar wäre es.«
»Ick wollte mir jerade zum Bierstand begeben.«
»Ich möchte so sagen: Man sollte sich das mit den Kunststücken vielleicht noch mal überlegen und Tiere dieser Größe nicht aus dem Gehege holen, nur damit Kinder sehen, dass man so einen Dickhäuter dazu bringen kann, auf einen bunten Ball zu steigen.«
»Na, meenen jefällt ditt. Die können da stundenlang beisitzen, sich ditt ankieken und sich bekleckern.«
»Kann ich mir vorstellen.«
»Jetzt brennt der Wurststand, und den Dickmann hamse immer noch nich anner Kandare.«
»Welchen Dickmann?«
»Na, den Elefant, wen sonst, du Kanarienvogel?«
»Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.«
All dieses groteske Beiwerk interessierte Kommissar Adler nur am Rande. Ihm war daran gelegen, die Vorgänge nachzuvollziehen und zu ordnen.
Die Schießerei hatte im Bereich des Michelangelobrunnens vor dem Bassin mit den Robben und Seelöwen begonnen, so viel schien festzustehen. Zum Glück fünfzehn Minuten nach der Fütterung. Sonst wären mehr Menschenleben zu beklagen gewesen.
Da die Angegriffenen sich bis zuletzt verteidigten, fielen zahlreiche Schüsse, von denen zwei eine Unbeteiligte trafen. Die Gattin eines adeligen Offiziers wurde von den Kugeln tödlich verletzt, und ihre Tochter geriet in den Einflussbereich der Braunbären. In einer Wurstbräterei brach aufgrund der kinetischen Einflussnahme des nervlich entgrenzten Elefanten ein Feuer aus, das sich schnell in Richtung der Stallanlagen für die Paarhufer ausbreitete. Zwei der Schützen waren tot, die Angreifer verschwunden. Einem dritten Mann, so sagten einige Zeugen, war es gelungen, den Schergen zu entkommen. Von einer ebenfalls entkommenen Frau war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Rede.
3
(Fjodor Judin auf der Flucht)
Fjodor Judin ging zügig, aber er rannte nicht.
Er war klatschnass.
Er lebte.
Und er war anfangs nicht mal verletzt gewesen.
Er tat es nicht bewusst oder mit Absicht, aber Fjodor Judin nahm den gleichen Weg wie zuvor seine Genossin Anna.
Er hatte sie kurz gesehen. Unter einer Gruppe Robinien. Sie hatte jemandem Zeichen gegeben.
Aber wem? Uns? Den Angreifern?
Dann war es nur noch darum gegangen, am Leben zu bleiben. Er hatte ja nicht mal genau gesehen, wohin er eigentlich schoss.
Die verdammte Fontäne. Nur Gischt und Nebel.
Fast zehn Minuten lang hatten er und Sergej sich hinter dem Brunnen verteidigen können. Zuletzt hatte eine Kugel den Genossen am Hals erwischt. Fast im gleichen Moment war der Elefant durchgegangen.
Als hätte er gewusst, dass ich bete.
Der Anblick des zornigen, eindeutig verwirrten und doch zielstrebigen Tiers war so sonderbar und fremdartig gewesen, dass Fjodor zuerst gar nicht begriff, welche Chance sich ihm bot. Erst im letzten Moment hatte er seine Deckung verlassen und das Bassin der Seelöwen in geduckter Haltung umrundet.
Da schossen die immer noch Richtung Springbrunnen. Haben mich nicht gesehen, die Idioten.
Dann kam ein Zaun, den er todesmutig überwand. Wobei er sich das linke Hosenbein vom Schritt bis zum Knie aufriss. Die Haut darunter ebenfalls. Zuerst hatte er gar nichts gespürt, war einfach weitergelaufen.
Anna …
Immer wieder musste er an die Genossin denken. Hatte sie ihn und seine Kameraden mit ihren Zeichen warnen oder verraten wollen?
Jetzt stand Fjodor am Wasser. Er hatte sich die Topografie von Berlin, besonders die zwischen Zoo und dem Schloss Charlottenburg, während seiner langen Reise genau eingeprägt. So wusste er, dass es sich bei diesem Gewässer um den Landwehrkanal handelte.
Nach rechts …
Mit Sicherheit fiel er auf. Erstens, weil er nun doch rannte. Zweitens, weil er klatschnass war und blutete. Drittens, weil seine mit Wasser gefüllten Schuhe auffällige Geräusche von sich gaben. Einen kurzen lichten Moment lang wurde Fjodor bewusst, dass er eine durch und durch lächerliche Figur abgab. Hätte er sich das vor zwei Wochen vorstellen können? Nein. Da war er noch das gewesen, was er seit Jahren war. Einer der leitenden Ingenieure der Baltischen Werft in Sankt Petersburg.
Schnell …
Er erreichte die Lichtensteinbrücke, überquerte den Kanal, hielt sich bald wieder links.
Muss hier gleich sein …
Durchs Gestrüpp. Langsamer. Tappend. Und so leise es ging. Für den Fall, dass die beiden Schützen ihn doch verfolgten.
Es war ein sehr dichtes Gestrüpp, und es wurde immer dichter.
Voller Dankbarkeit bohrte Fjodor Judin sich zuletzt in ein enges, stark belaubtes Haselnussgesträuch von wenigstens fünf Metern Durchmesser hinein. Es war kratzig, aber hier war er vorerst in Sicherheit. Fünf Minuten dauerte es, bis Fjodor sich vom Laufen erholt und von der Enge in seiner Brust ein wenig befreit hatte.
Erst jetzt, so jedenfalls kam es ihm vor, begriff er.
Man wollte mich töten. Aber wer eigentlich?
Er hatte so viele Menschen betrogen, dass einige in Frage kamen. Obwohl …
Wütend vielleicht. Enttäuscht. Aber mich töten?
Oder hatte er sich mal wieder reinlegen lassen? Hatte Anna ihm den Plan zu gut verkauft? Die Sache so hingestellt, als sei sie nur ein Spiel, ein kleiner Betrug, ja fast ein Scherz? Eine gute Sache für ihn und für die gute Sache. Für eine bessere Zukunft des russischen Volkes.
Er wischte die Gedanken an Anna weg.
Der Neue See muss gleich da vorne sein.
Als Ingenieur der Baltischen Werft von Sankt Petersburg verfügte Fjodor Judin über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Er konnte Pläne nicht nur lesen, sondern sich auch merken.
Der Neue See …
Hier also war er nach seiner langen revolutionären Reise gelandet. In einem preußischen Haselnussstrauch.
Ich hab so gut wie kein Geld …
Erst jetzt spürte er sein Bein. Ein Pochen. Seine Hose war zerrissen, sein linker Oberschenkel blutete. Trotzdem würde er hier bis zum Einbruch der Dunkelheit warten.
Sind bestimmt viele Polizisten unterwegs nach der Schießerei.
Wenn er sich, so wie er aussah, auf die Straße begab, konnte er sich auch gleich ein paar Pfauenfedern ins Haar stecken. Also würde er sich erst bei Dunkelheit auf den Weg zum Charlottenburger Schloss machen.
»Du findest sie leicht«, hatte Anna gesagt.
»Wen finde ich leicht?«
»Die gusseiserne Brücke. Da wartest du, falls im Zoo irgendwas schiefgeht, auf Keegan und Bates.«
Blieb nur die Frage, wer ihn dort nachts aufsuchen würde oder bereits erwartete.
Wenn Anna oder Pawel uns verraten haben …
Aber was blieb ihm übrig? Er hatte kaum Geld und kannte niemanden in Berlin.
In seinem Haselnussversteck begriff Fjodor Judin, dass er vieles nicht zu Ende gedacht hatte. Damals in Sankt Petersburg. Als Anna ihnen den Plan erklärt hatte. Sergej und Witalij war es vermutlich ähnlich gegangen.
Und jetzt sind sie tot. Pawel vielleicht auch.
Fjodor wurde immer aufgeregter, Gedanken kamen in widersprüchlichen Schüben. Gedanken voller Angst, Selbstvorwürfen und Wut.
Und er verlor Blut.
Vor seinem geistigen Auge sah er Bilder eines eigentlich ganz guten Lebens, das jedoch lange vergangen schien. Bilder der Russischen Werft. Er war doch nur für Zahlen und Pläne zuständig gewesen. Wie hatte es geschehen können, dass er jetzt hier in Berlin hockte, in einem Haselnussstrauch, in dem er langsam verblutete?
Gott, wie viel Zeit …?
Es kam ihm vor, als läge die Schießerei im Zoo bereits Stunden zurück. Fjodor Judin zog seine Uhr. Sie war feucht, aber sie lief noch. Als einer der leitenden Ingenieure einer Werft kam er bei seinen Kontrollgängen hin und wieder mit Wasser in Berührung. Man hatte ihn also mit einer guten Uhr ausgestattet.
Gerade mal vierzig Minuten.
Ein Pfau schrie, ein zweiter antwortete.
4
(Viele Tiere und eine vornehme Dame)
Die Halbaffen brüllten und rüttelten noch immer an ihren Zweigen, doch ein alter Panther lief bereits wieder geduldig hinter seinen eisernen Stäben hin und her. Einige Bewohner des Zoos hatten sich inzwischen ein wenig beruhigt, nur war es noch immer nicht gelungen, die Flamingos einzufangen.
»Herr Kommissar …«
Immerhin befand sich der Dickhäuter mittlerweile wieder im Elefantenhaus.
»Herr Kommissar, Verzeihung.«
»Was gibt’s denn, Habert?«
»Einige Zeugen werden ungeduldig.«
»Trotzdem festhalten, die werden alle befragt.«
»Unter ihnen ist eine hochgestellte Persönlichkeit.«
»Etwas genauer.«
»Madame Pawlowa ist die Schwester eines Sekretärs der Russischen Botschaft. So jedenfalls habe ich die Dame verstanden.«
»Sie spricht Deutsch?«
»Fließend. Vielleicht ist sie auch gar nicht die Schwester, sondern die Ehefrau des Botschafters … Es war recht laut, als ich mit ihr sprach. Die Pfauen.«
»Die Pfauen, verstehe.«
»Madame Pawlowa wirkte auf mich einigermaßen erregt. Sie meinte, sie hätte etwas Wichtiges mitzuteilen. Und wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf: Was sie zu sagen hat, scheint tatsächlich wichtig. Sie hat Bewegungen unter den Robinien gesehen.«
»Was für Bewegungen?«
»Das eben will sie Ihnen mitteilen.«
»Na, ich hoffe, sie fragt mich am Ende nicht doch nur nach dem Befinden des kleinen Mädchens. Alle reden über dieses Kind und seine hübsche Mutter. Die Schießerei scheint eher nebensächlich gewesen zu sein.«
»Nun«, sagte Gendarm Habert. »Kinder liegen uns Berlinern eben am Herzen.«
»Und die Verbrechen liegen mir am Herzen«, antwortete Kommissar Adler einigermaßen kalt.
Er sah bereits voraus, was aus dieser Sache noch werden konnte.
Eine solche Schießerei mitten in Berlin, das wird man nicht einfach auf sich beruhen lassen.
Wenn es politische Hintergründe gab, würden sich noch ganz andere damit befassen.
Dann werde ich vielleicht Major Craemer wiedersehen.
Er kannte Craemers Gesicht noch gut, denn er hatte bis vor ein paar Jahren mit ihm zusammengearbeitet. Der ehemalige Kollege war dann dem Ruf des Generalfeldmarschalls Moltke gefolgt und bekleidete mittlerweile einen einigermaßen hohen Rang in der Sektion des Nachrichtendiensts. Kommissar Adler gehörte zu den wenigen, die dank seiner Kontakte zu Major Albert Craemer überhaupt von der Sektion wussten.
Und das soll so bleiben.
Er würde also warten, bis man eventuell auf ihn zukam, und in der Zwischenzeit seiner polizeilichen Arbeit nachgehen.
Sein ehemaliger Kollege würde sich gewiss mit ihm in Verbindung setzen, falls man das im militärischen Nachrichtendienst der Preußischen Armee für nötig befand. Adler war bei aller Konkurrenz immer ganz gut mit Craemer ausgekommen und hatte einigermaßen Respekt vor dem Major. Umgekehrt, davon jedenfalls ging Kommissar Adler aus, war es vermutlich ähnlich.
5
(Craemer und Helmine im Kinderzimmer)
»O ja.«
Ein paar Sekunden vergingen. Dann sagte er es noch mal. Und zwar begeistert.
»Oooh ja!«
Major Albert Craemer fühlte sich von dem Anblick ergriffen. Das Zimmer war groß, hell, freundlich. Und hatte gleichzeitig etwas Verspieltes.
»Ein neues Leben wird hier aufs Gleis gesetzt. Und wir werden darauf achten, dass es ein gutes Gleis ist, dass das Land, in dem unser Kind aufwächst, ein friedliches und sicheres Land bleibt.«
»Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst?«
Helmine Craemer kannte das schon. Seit dem Beginn ihrer Schwangerschaft gingen ihrem Mann bisweilen die Pferde, die den schweren Wagen des Pathos und der Rührung zogen, ein wenig durch.
Und das Kind war ja noch gar nicht da.
Dass Albert Craemer beim Anblick des Kinderzimmers von Frieden und Sicherheit sprach, hing mit eher unerfreulichen Prognosen zusammen. Für die militärische Elite des Deutschen Kaiserreichs nämlich schien ein Krieg bereits seit einigen Jahren so gut wie unabwendbar. Daher war schon vor einiger Zeit auf Moltkes Befehl hin das Personal der Sektion III b kräftig aufgestockt worden. Man hatte Mitarbeiter mit militärischer Ausbildung und polizeilicher Erfahrung eingestellt. Einer dieser Männer war Albert Craemer gewesen. Der Fünfundvierzigjährige arbeitete seitdem als Leiter der Unterabteilung Frankreich. Seit einigen Monaten war er auch für Russland zuständig.
»Ich glaube, unser Sohn wird hier sehr glücklich sein.«
»Wenn es ein Sohn wird«, sagte Helmine. »Ich bin jedenfalls froh, dass wir uns für diese Tapete entschieden haben, nicht für deine, mit den Drachen und Chinesen.«
»Ach, nicht noch mal, Helmine. Ich hing doch gar nicht so an den Chinesen.«
Craemer und seine Frau standen in ihrer Wohnung in der Nithackstraße in Charlottenburg, nahe dem großen Oppenheimer Garten, und betrachteten das beinahe fertiggestellte Kinderzimmer.
Dass die beiden in einer so großen, geradezu herrschaftlichen Wohnung leben konnten, hatten sie nicht Craemer zu verdanken. Denn er bezog bei Weitem nicht das Einkommen, um sich so etwas leisten zu können. Wie viele seiner Kameraden hatte er eine gute Partie in Form einer Ehefrau machen müssen. Dass sich diese Frau auch über das Geld, die Wohnung und das damit verbundene Prestige hinaus als Glücksfall erwiesen hatte, war – wie Craemer selten sagte, aber oft dachte – ein Geschenk des Himmels und der Aphrodite.
Die Liebesgöttin hatte es gut mit ihnen gemeint.
Was das Geld anging: Helmine hatte schon vor Jahren das Spirituosengeschäft ihres gesundheitlich angeschlagenen Vaters übernommen. Mit Erfolg. Das Unternehmen war seitdem stark expandiert. Helmine Craemer galt als pragmatische Geschäftsfrau, die keine Gelegenheit ausließ, ihr Geschäft zu vergrößern.
Es gab also noch andere Seiten an Helmine. Manche nannten sie mütterlich, einige rühmten ihren Berliner Humor. So gesehen passte das Halbrelief, das ganz oben am Ziergiebel ihres Hauses prangte, zu ihr. Weithin sichtbar tanzten dort die Aphrodite, die Moneta und der Dionysos einen Reigen.
»Nun geht es also bald los.«
Helmine war erst im fünften Monat schwanger, also wollten die beiden die Zeit nutzen und sich am nächsten Tag auf eine Urlaubsreise nach Kopenhagen begeben.
»Und du bist sicher, Helmine, dass du das schaffst?«
»Ich bin schwanger, nicht krank.«
»Natürlich. Und robust bist du ohnehin.«
»Möchtest du das genauer erklären?«
»Nun, was ich damit sagen will …« Craemer entschied, die Sache mit der Robustheit seiner Frau nicht weiter zu vertiefen. Denn es war durchaus möglich, dass sie nicht alles so verstand, wie er es meinte.
»Was ich sagen wollte, Helmine … Du hast sehr viel gearbeitet und dir einen Urlaub redlich verdient. Trotzdem solltest du dich nicht zu sehr strapazieren. Das Kind braucht seine Ruhe. Es ist zur Genüge damit befasst, sich in Gänze auszubilden. Organisch, meine ich.«
»Organisch.«
»Ganz recht.«
»Aber warum Kopenhagen?«, wollte Helmine nun nicht zum ersten Mal wissen. Die meisten Menschen, die sie kannte, fuhren nach Italien, und Helmine hatte bereits vor einiger Zeit erwogen, im Trentino eine kleine Residenz zu erwerben. Für eine Frau wie sie, die unter anderem mit Wein handelte, war das eine reizvolle Gegend.
»Warum ich nach Kopenhagen möchte? Nun …« Craemer zögerte und berührte mit der Hand seine Stirn. Ihm war plötzlich warm geworden. Angesichts der schwülen Wetterlage und der Tatsache, dass er gerade seine Frau belog, war das nicht verwunderlich.
»Weißt du, Helmine … Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Vielleicht sehne ich mich einfach nach kühler Luft.«
»Soso.«
»Nun gut, ich will dir die Wahrheit sagen. Es ist das Licht. Das nordische Licht. Ich möchte es einmal gesehen haben.«
»Wir fahren wegen des Lichts nach Kopenhagen?«
»Und wegen … Na, du weißt es doch.«
»Wieder dieser Maler? Wie hieß er noch?«
»Munch. Edvard Munch.«
»Wegen dessen Gekleckse fahren wir nach Kopenhagen? Außerdem … Kommt der nicht aus Norwegen?«
»Das Licht, Helmine. Ich bitte dich, hör mir wenigstens zu, wenn du schon so nachhaltig in mich dringst.«
Auf die Malerei von Edvard Munch war Craemer gekommen, nachdem er Bilder von Degas, Matisse und Monet gesehen hatte. Seinerzeit während einer dienstlichen Exkursion nach Paris. An den beiden Tagen vor seiner Begegnung mit dem Farbeimer.
Zuvor war er ganz auf der Linie seines Kaisers gewesen, was die Kunst anging. Es gefiel ihm, wenn alles ganz genau gemalt war, wenn historische Situationen, soldatische Heldentaten oder Krönungsfeierlichkeiten so dargestellt wurden, dass man jede einzelne Person, ja sogar jedes berühmte Pferd wiedererkannte.
Von den Impressionisten, diesen obszönen Laienmalern, hatte er damals nur das gehört, was der Kaiser selbst über sie und ihre Liebe zum Alltäglichen sagte: »Die Kunst soll sich zum Ideal erheben, statt in den Rinnstein hinabzusteigen.«
Dann aber, in Paris, hatte Craemer die Bilder dieser vermeintlichen Rinnsteinkleckser selbst betrachten können. Und war überwältigt gewesen. Denn das, was er sah, entsprach voll und ganz seiner Empfindung, seiner Auffassung von den Dingen.
»Mir war, als seien diese Bilder schon immer in mir gewesen«, so hatte er sich Helmine gegenüber geäußert.
Dabei wusste Craemer natürlich, wie es um den Impressionismus inzwischen stand. Im Grunde war er bereits vom Expressionismus überwunden.
Im Vordergrund des Expressionismus stand, ganz im Gegensatz zum Impressionismus, wie Craemer mehrfach gelesen hatte, die Idee der Erschaffung eines neuen Menschenbilds in der Kunst. Die so dringend gebotene stilistische Neuausprägung hatte – so jedenfalls stand es in einigen Kunstzeitschriften – ihren Kern in der tief greifenden Erfahrung der Verunsicherung, geradezu der Dissoziation des Individuums, sowie der Zerrissenheit der Objektwelt, der Entfremdung also von Subjekt und Objekt.
Helmine war der Linie des Kaisers treu geblieben, favorisierte Bilder in der Machart des Anton von Werner.
»Insgesamt finde ich die neue Malerei unklar und primitiv. Kein Detail, nichts was mir zeigt, dass hier ein Meister den Pinsel geführt hat.«
»Ach komm!«
»Nun lass mich doch sein, wie ich bin.«
Von den französischen Impressionisten war Craemer dann zu dem Deutschen Max Liebermann gekommen, der sein Gewerbe ähnlich handhabte. Und auch wenn Liebermanns Farben gedämpfter waren – vielleicht weil es in Deutschland weniger Sonne und Farben gab –, hatten sie doch ihre Wirkung.
Das alles hatte Craemer beschäftigt. Zuletzt war er dann auf den Norweger gestoßen.
Bilder vom Wald … Stämme, teils rot, in den Schatten blau … Das Meer zwischen den Stämmen … Ein schmaler Streifen Sand als Saum, die Spiegelung des Mondes im Wasser …
In der Sektion erwähnte Craemer seine neue Leidenschaft mit keinem Wort. Er legte es schließlich nicht darauf an, zum Gespött der Kameraden zu werden oder als verweichlicht, womöglich gar als Franzosenfreund zu gelten.
So beschäftigte er sich im Stillen, besorgte sich Bücher und Kataloge mit Abbildungen und war mittlerweile zu einem laienhaften Kenner mit nachhaltigem Interesse geworden. Es fiel ihm daher an diesem Abend nicht schwer, seiner Frau aus dem Stegreif einen längeren Vortrag über das Licht des Nordens zu halten.
Helmine sagte während dieser Erläuterungen mehrfach: »Soso.« Dann schloss sie: »Na, hoffen wir mal, dass es beim Licht bleibt und dir nichts dazwischenkommt.«
6
(Kommissar Adler vernimmt Maria Pawlowa)
»Die Schwester des russischen Botschaftssekretärs ist es nicht gewohnt zu warten.«
»Versteht sich von selbst«, gab Kommissar Adler etwas strack zurück. »Der Adel fordert seine Rechte.«
»Aber sie wartet tatsächlich bereits seit fast einer Stunde«, gab Gendarm Habert zu bedenken.
Zwei der entflohenen Flamingos waren mittlerweile eingefangen, und Kommissar Adler hatte bereits sechs Zeugen befragt. Sie hatten ihm nicht viel berichten können, jedenfalls nicht was die Schießerei anging. Nach dem Kind und seiner hübschen Mutter jedoch erkundigten sich alle. Es war mehrfach von einem kleinen grünen Türchen die Rede.
»Na gut, Habert. Dann bringen Sie die Dame mal her. Wie hieß sie noch?«
»Maria Pawlowa.«
»Kein Adelstitel?«
»Sie hat mir keinen genannt.«
Als Habert ihm die Schwester des Botschaftssekretärs vorführte, entschuldigte sich Kommissar Adler.
Pflichtschuldigst, wie man sagte.
Der berufliche Aufstieg des Kommissars hatte sich langsam vollzogen. Immer wieder waren ihm Männer aus »gutem Hause« mit fragwürdigen Begründungen vor die Nase gesetzt worden …
»Sie müssen das verstehen, Herr Adler, einer seiner Vorfahren hat unter Clausewitz gedient und ist gegen Napoleon angetreten.«
»Ist er wirklich angetreten oder hat er das Kartenmaterial bewacht?«
»Aber Sie wissen doch, Adler, wie es gehandhabt wird. Ginge es nach mir …«
All diese Männer waren deutlich jünger gewesen als er und besaßen keinerlei Erfahrung auf kriminalistischem Gebiet. Sie waren zwar in der Lage, ein elegantes Gespräch zu führen, bekamen aber nur selten mit, wenn sie belogen wurden. Auch hielten sie zu wenig von der Untersuchung des Tatorts und zu viel von dem, was ihnen zugetragen wurde. Nein, Kommissar Adler hatte nicht viel übrig für den Adel und seine Beziehungen.
Auch diese Madame Pawlowa würde ihn vermutlich nur nach dem Befinden des Kindes fragen. Davon abgesehen sprachen ihre geröteten Wangen und großen Augen, denen vermutlich nicht der geringste Unsinn entging, Bände. Sie war eine Neugierige, wie sie im Buche stand. Er sah bereits bildlich vor sich, wie sie auf dem nächsten Botschaftsball ihre Freundinnen über alles, was sie heute erlebt und erfahren hatte, ausführlich in Kenntnis setzte.
»Es tut mir leid, Madame Pawlowa, dass Sie warten mussten.«
»Das muss Ihnen nicht leidtun.«
Die junge Frau war sehr hell und jugendlich gekleidet. Verstärkt wurde der selbst für Kommissar Adler keineswegs unangenehme Eindruck durch ein kurzes, scharf tailliertes Samtjäckchen, das die Rundungen ihrer Hüften gut zur Geltung brachte. Und dann erst ihre Haare! Kunstvoll, voluminös, dabei aber keineswegs matronenhaft aufgesteckt. Sie drehte einen kleinen limettenfarbenen Sonnenschirm über ihrer linken Schulter.
»Wollten Sie etwas sagen, Herr Kommissar?«, fragte sie, nachdem etwas Zeit vergangen war.
»Wieso?«
»Weil Ihr Mund offen steht.«
»Ja … nein. Verzeihung.«
»Nun, wie gesagt, es muss Ihnen nicht leidtun. Es hat schon seine Ordnung, dass Sie mich warten ließen. Sie sind hier ja gewissermaßen der Kapitän.«
»Sicher … Aber man sagte mir, Sie würden schnell unruhig.«
Ihr Lachen war hell, und sie sah dabei ganz reizend aus.
»Unruhig? Ich?« Sie lächelte ihn an. »Was ist denn aus dem kleinen Mädchen geworden, das da bei den Bären rein ist?«
»Der Kleinen ist nichts passiert. Zum Glück hatte sie im Käfig eine Beschützerin mit starken Mutterinstinkten.«
»Russisch, da bin ich mir sicher.«
»Die Bärenmutter?«
»Die beiden Schurken, die auf die drei Männer geschossen haben – oder nein, es waren vier Personen, fast vergessen –, die haben Russisch gesprochen. Die Angreifer benutzten einen bestimmten Jargon. Nicht gerade die beste Ausdrucksweise.«
»Sie reden etwas sprunghaft.«
»Russisch.«
»Wie?«
»Sankt Petersburg.«
»In ganzen Sätzen, wenn es sich machen lässt, ich kann sonst schwer folgen.«
»Na, wie sie gesprochen haben. Da kommen sie her. Ich und mein Bruder ebenfalls.«
»Aus Sankt Petersburg«, ergänzte Habert für den Kommissar.
»Sie erwähnten gerade vier Personen, die angegriffen wurden. Sind Sie da ganz sicher?«, fragte Adler weiter. »Alle Zeugen, die überhaupt etwas beobachtet haben, sprachen von drei Personen.«
»Es waren drei Männer, das ist richtig. Zwei wurden erschossen, einer ist entkommen. Aber da war noch eine Frau. Sie stand dort hinten. Sehen Sie? Da. Unter den drei Robinien. Berühmte Robinien, das werden Sie wissen.«
»Ich kann Ihnen schon wieder nicht folgen.«
»Die drei Schwestern«, erklärte Habert. »So werden sie von den Besuchern genannt. Also die Robinien.«
»Hm.«
»Ich bin sicher, die gehörte dazu«, fuhr sie fort. »Diese Frau ist ebenfalls entkommen.«
»Sie gehörte zu denen, die angegriffen wurden«, erklärte der Gendarm.
»Nun ist es mal gut, Habert. Sehen Sie sich um, befragen Sie Zeugen.«
Gendarm Habert nickte gehorsam, nahm dabei sogar ein wenig Haltung an, blieb aber stehen und hörte weiter zu, was Kommissar Adler nicht unterband. Dieser Gendarm hatte einige Freiheiten.
»Da die Frau ebenfalls geflohen ist, nehme ich doch an, dass sie dazugehörte. Außerdem …« Madame Pawlowa blickte kurz zu Boden. Offenbar versuchte sie sich an etwas zu erinnern. »Ja, das war es, was mir auffiel. Sie hat schneller als irgendwer sonst Deckung gefunden. Auf mich jedenfalls wirkte diese junge Frau, als habe sie mit einem solchen Ereignis gerechnet. Etwa zwei Minuten nach Beginn der Schießerei hat sie sich zurückgezogen. Sie lief dorthin.« Sie zeigte mit dem Finger in Richtung des Landwehrkanals. »Wie gesagt, sie reagierte sehr schnell. Gleich nach den ersten Schüssen ging sie in Deckung. Während wir anderen ja erst mal wie erstarrt … Der Schreck.«
»Natürlich.«
»Die drei Männer, die angegriffen wurden«, fragte Kommissar Adler. »Haben die auch Russisch gesprochen?«
»Ja.«
»Und was haben sie gesagt?«
»›Verdammt.‹ ›Wer ist das?‹ ›Verräter!‹ ›Bleib in Deckung!‹ Solche Dinge.«
»Abgesehen von den Angreifern sind also ein Mann und eine Frau entkommen? Das habe ich richtig verstanden?«
Plötzlich wirbelte ein Windstoß Staub in die Höhe. Der Stoff ihres Schirmchens dehnte sich, zwei blau und grün schillernde Pfauen schrien. Maria Pawlowa verlor darüber nicht die Fassung. »Die Frau war Ende zwanzig und sehr ansprechend gekleidet. Der Mann, der entkam, war etwas älter, vielleicht fünfunddreißig. Schlank, fast dürr. Keine Brille. Leicht gewellte Haare. Ich würde behaupten, der war schon seit einiger Zeit nicht mehr beim Friseur. Er wirkte auf mich weder wie ein Soldat noch wie ein Sportler. Eher wie jemand … Nun, ich will nicht spekulieren. Als Frau hat man natürlich einen Eindruck, aber daraus gleich Schlüsse zu ziehen …«
Gendarm Habert entfernte sich. Er hatte jemanden entdeckt, der das kleine grüne Türchen am Bärenkäfig kontrollierte.
»Wenn Sie sagen, die Frau war ansprechend gekleidet, dann heißt das …?«
»Teuer, Herr Kommissar. Richtig teuer. Das passte so gar nicht zu ihrer ganzen Art. Einerseits diese elegante und sicher nicht ganz unempfindliche Kleidung. Ich weiß, wie es sich damit verhält. Man ist stets auf der Hut, dass nicht etwas an einem Zweig hängen bleibt. Handgewebter Tüll zum Beispiel ist sehr empfindlich.«
»Aber gewiss doch«, sagte Adler.
»Man ist auch zu einer gewissen Körperhaltung verpflichtet. Die Kleidung mitsamt ihren innerlich eingebauten Stäben und Schnüren zwingt einen förmlich dazu. Sie aber … Sie bewegte sich wie ein Soldat im Felde.«
Gendarm Habert und ein Tierpfleger näherten sich den beiden.
Und nun geschah etwas, das Kommissar Adler in seiner langen Laufbahn so noch nie erlebt hatte. Maria Pawlowa beschrieb ihm die Unbekannte unter den Bäumen mit einer Präzision, als habe sie die Frau selbst erschaffen.
Ein Foto, dachte Adler, wäre weit weniger genau.
»Eine richtige Dame und eine sehr hübsche«, beendete Maria Pawlowa ihren Bericht. »Andererseits … Die ganze Art, wie sie blitzschnell in Deckung ging …«
An dieser Stelle wurden sie von Gendarm Habert unterbrochen.
»Der Zeuge Bessler. Tierpfleger«, erklärte Habert, wobei er auf einen Mann Mitte vierzig zeigte. Der Zeuge war an die zwei Meter groß und so dünn, dass er regelrecht mager wirkte.
»Ich soll Ihnen berichten«, erklärte der Pfleger.
»Was sollen Sie berichten?«, fragte Adler, der sich etwas überrumpelt vorkam.
»Na, wie die Kleine da zu den Braunbären reinkam.«
»O ja«, ermunterte ihn Maria Pawlowa und begann ihren Schirm zu drehen.
»Also?«, fragte Kommissar Adler etwas unwirsch.
»Nicht. Meine. Schuld«, erklärte der Pfleger, wobei er jedes Wort einzeln betonte.
»Sondern?«
»Ihre Mutter hat sie da reingeschoben. Wegen der Schüsse. Sie hat das kleine grüne Türchen geöffnet, um ihre Tochter dahinter in Sicherheit zu bringen.«
»Und?«
»Das ist nicht irgendein Türchen, das ist die Futterluke.«
Das Schirmchen von Madame Pawlowa drehte sich schneller, Kommissar Adler blieb ruhig.
»Die Futterluke, verstehe. Und warum war die nicht verschlossen? Warum überhaupt installiert man so eine Futterluke in einem Bereich, der Besuchern zugänglich ist?«
»Weil wir sonntags immer von da aus füttern. Die Leute wollen uns mit den großen Fleischbatzen sehen. Fette Stücke. Manchmal ist der halbe Brustkorb einer Ziege dabei. Die Berliner machen dann immer ihre Witze.«
»Stets dieselben, nehme ich an.«
»Stets dieselben. Gehört zum Programm. Wie auch die Fütterung der Robben und die Sache mit dem Elefanten. Kurz vor der Bärenfütterung wird die Luke aufgeschlossen, dann gehe ich los und hole die Forke, die Schubkarre und die Fleischbatzen. Nach der Fütterung spielt dann das Orchester.« Zur Verdeutlichung zeigte der Tierpfleger in Richtung des Musikpavillons. »Das war schon immer so und war auch immer in Ordnung. Nur heute …«
»… kam es nicht zur Fütterung.«
»Korrekt. Heute wurde geschossen, und man hat ein Kind durch die Luke geschoben. Das hätte schlecht ausgehen können.«
»Wohl richtig«, sagte Kommissar Adler, ohne den Pfleger weiter zu beachten. »Dann wäre dieser Aspekt also schon mal geklärt.«
»Gut, dass Ihre Gendarmen nicht auf die Bärenmutter geschossen haben«, schob der Pfleger nach.
Woraufhin Habert Haltung annahm und fast schon empört erklärte: »Wir sind hier in Berlin, wir schießen nicht auf Bären.«
»Unsere Bärin, Charlotte heißt sie, hat ja auch Junge«, erklärte der Pfleger nicht ohne Stolz. »Stand bereits mehrfach in der Zeitung. Also hat sie das kleine Mädchen ebenfalls beschützt.«
»Brav.«
»Haben Sie sonst noch Fragen? Die Tiere sind hungrig.«
»Keine weiteren Fragen. Danke.«
In diesem Moment entstand ein Gedränge. Stative wurden weiter nach vorne gerückt. Kommissar Adler wies Gendarm Habert an, dafür zu sorgen, dass die Presse Abstand hielt.
»Sollen die Braunbären fotografieren, die haben Junge und werden gleich gefüttert. Erzählen Sie ihnen die Geschichte von dem geretteten Kind, dem grünen Türchen und der Bärenmutter. Das ist für Berliner Leser viel interessanter als irgendeine Zeugenbefragung.«
»Die Presse soll jetzt die Braunbären fotografieren?«
»Korrekt, Habert. Engagieren Sie sich, entwickeln Sie Fantasie und halten Sie mir und den Zeugen diese Leute vom Hals.«
Kommissar Adler war so mit Maria Pawlowa, der Presse und Gendarm Habert beschäftigt, dass ihm der schlanke Mittdreißiger entging, der schon seit einiger Zeit kaum drei Meter von ihnen entfernt stand und so tat, als wäre er an den Rosen und einigen Zeuginnen interessiert. Ganz kurz hatte Adler den etwas dandyhaft wirkenden Mann im Blick gehabt, ihn aber für den Reporter irgendeines Klatsch- oder Gesellschaftsmagazins gehalten, der vermutlich an der Mode der Damen interessiert war.
Auch jetzt beachtete er ihn nicht, denn Maria Pawlowa hatte noch etwas zu sagen.
»Weil es jetzt die ganze Zeit um das Kind und die Bären ging …«
»Ja?«
»Wie ich sagte, es waren vier. Abgesehen von den beiden Angreifern waren vier Personen beteiligt. Zwei wurden erschossen, einer ist entkommen … Und dann war da eben noch diese Frau.«
»Und Sie sind sicher, die gehörte dazu?«
»Sie hat den Beteiligten mehrfach etwas zugerufen.«
»Den Angreifern oder den anderen?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber … Fast hätte ich es vergessen. Einer der Angegriffenen wurde mit seinem Namen gerufen. Fjodor.«
»Weiter nichts?«
»Nein. Nur Fjodor.«
»Ein nicht eben seltener Name.«
»Mehr weiß ich nicht.«
Kommissar Adler bedankte sich, bat noch um ihre Anschrift und ließ sich den nächsten Zeugen vorführen.
Der Mann, der mit so großem Interesse die Rosen und die Damen betrachtet hatte, entfernte sich.
7
(Von Selchow erstattet Oberst Kivitz Bericht)
Russen!
Lars von Selchow hatte genug gehört.
Eine Schießerei zwischen Russen …
Dabei konnte es natürlich um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Banden gegangen sein. Lars von Selchow fielen schnell einige Gründe krimineller Natur ein. Aber die Zeugin hatte von einer Frau gesprochen, die sich offenbar im Hintergrund hielt und doch genau wusste, was sie zu tun hatte.
Das Wort Verräter ist gefallen …
Die Anwesenheit einer von der Zeugin ausdrücklich erwähnten Frau in derart vornehmer Kleidung sprach in von Selchows Augen gegen eine gewöhnliche, kriminell motivierte Straftat zwischen irgendwelchen russischen Gaunern. Nein, da passte so einiges nicht ins Bild.
Warum zwischen all den Leuten, all den Zeugen? Warum an einem Ort mit vielen Mauern und Zäunen, der ein Entkommen doch erschwert? Das wirkt ja fast, als sollten alle es mitkriegen.