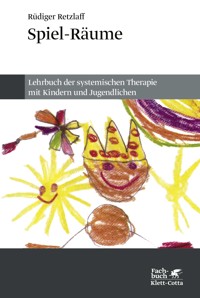37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Welche Stärken zeichnen Familien behinderter Kinder aus, denen es gelingt, »trotz alledem« ein erfülltes Leben zu führen? Und wie können Beratung und Therapie diese Stärken fördern? Rüdiger Retzlaff untersucht, wie Akzeptanz und Resilienz entstehen und gibt detaillierte Anleitungen für die ressourcenorientierte Arbeit. Das Leben mit einem behinderten Kind ist für Eltern eine große Herausforderung - doch viele Familien kommen mit ihrer Lebenssituation bemerkenswert gut zurecht. Welche Stärken zeichnen kompetente Familien aus, denen es gelingt, »trotz alledem« ein erfülltes Leben zu führen? Und wie können Beratung und Therapie diese Stärken fördern? Ausgehend von Konzepten der systemischen Therapie, der Familien- und Kohärenzforschung und Interviews mit Familien vermittelt Retzlaff ein Verständnis davon, welche Familienmuster und Einstellungen dazu beitragen, dass Akzeptanz und Resilienz entstehen. In einem ausführlichen praktischen Teil finden Berater konkrete Hinweise und detaillierte Anleitungen für die ressourcenorientierte Arbeit, die gezielt die Stärken von Familien behinderter Kinder ansprechen. Zielgruppen: - Systemische Familientherapeuten - Kinderärzte - BeraterInnen aus Frühfördereinrichtungen, Sozialpädiatrischen Zentren, Rehabilitationseinrichtungen, Sonderpädagogischen Beratungsstellen, Kinderkliniken - Betroffene
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Rüdiger Retzlaff
Familien-Stärken
Behinderung, Resilienzund systemische Therapie
mit einem Vorwort vonArist von Schlippe
Impressum
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2013 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Cover: Klett-Cotta Design
Unter Verwendung eines Fotos von fotolia/Pawel Nowik
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96119-5
E-Book: ISBN 978-3-608-10470-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Vorwort
I Grundlagen
1 Einleitung
2 Behinderungen
2.1 Einführung
2.2 Körperliche Behinderungen
2.3 Geistige Behinderung
2.4 Genetisch bedingte Syndrome und Behinderungen
2.5 Das Rett-Syndrom
2.6 Seelische Behinderung
2.7 Chronische Krankheiten
2.8 Schwermehrfachbehinderung
2.9 Zusammenfassung
3 Familie und Behinderung
3.1 Einführung
3.2 Das Modell der familiären Anpassung an Behinderung und chronische Krankheit
3.3 Stresserleben und Behinderung
3.4 Studien zu kompetenten Familien
3.5 Zusammenfassung
II Theoretische Modelle
4 Familien-Stresstheorie
4.1 Einführung
4.2 Das ABCX-Modell
4.3 Die Balance von Ressourcen und Stressoren
4.4 Ressourcen
4.5 Bedeutungsgebungsprozesse im Familien-Stressmodell
4.6 Bedeutungswandel und soziokulturelle Faktoren
4.7 Zusammenfassung
5 Familienresilienz
5.1 Einführung
5.2 Resilienz als individuelles Merkmal
5.3 Resilienz von Familien
5.4 Schlüsselprozesse der Familienresilienz
5.5 Kritische Anmerkungen zum Resilienzbegriff
5.6 Zusammenfassung
6 Das Familien-Kohärenzgefühl
6.1 Einführung
6.2 Kohärenz als individuelles Konstrukt
6.3 Kohärenz auf Familienebene
6.4 Eigene Untersuchungen mit dem Familien-Kohärenzbogen
6.5 Zusammenfassung
7 Narrative Ansätze
7.1 Einführung
7.2 Narrative als Sinnstrukturen menschlichen Erlebens
7.3 Krankheit und Bedeutungsgebung
7.4 Leitmotive in krankheitsbezogenen Narrativen
7.5 Familiengeschichten und therapeutische Zugänge
7.6 Zusammenfassung
8 Kohärenzerleben aus Familiensicht
8.1 Einführung
8.2 Narrative Typenbildung
8.3 Geschichte der wiedergefundenen Balance
8.4 Geschichte vom langen, mühsamen Weg bergauf
8.5 Zusammenfassung
III Therapie und Beratung
9 Beratungspraxis
9.1 Einführung
9.2 Allgemeine Beratungsprinzipien
9.3 Aufgaben in der akuten Anpassungsphase
9.4 Aufgaben in der mittleren Anpassungsphase
9.5 Aufgaben in der langen Anpassungsphase
9.6 Persönliche Themen von Beratern
Anhang
Überregionale Behindertenverbände und Selbsthilfegruppen
Literatur
Personenregister
Sachregister
Vorwort
Ein Wort nur, es ist doch nur ein Wort: »Behinderung«. Doch Worte sind nicht harmlos, Beschreibungen können in das Beschriebene eingreifen und es verändern, indem sie es mit besonderen Bedeutungen versehen. »Behinderung« ist eine dieser Beschreibungen, die die Kraft haben, Leben zu verändern, Lebenswelten durcheinander zu schütteln. Unsere Kultur hat hier große Fortschritte gemacht; die Haltung zum Thema Behinderung in der Gesellschaft hat sich gewandelt, von der Schule bis zu den Olympischen Spielen stehen die Zeichen auf Integration. Und doch sind bis heute die Betroffenheit und die Hoffnungslosigkeit, in die Menschen hineinfallen können, groß, wenn sie mit diesem Wort konfrontiert werden. Entsprechend groß sind die Belastungen, denen sich die Familien mit dieser Diagnosestellung gegenübersehen.
In dem vorliegenden Buch wird davon ausgegangen, dass Belastung nur die »eine Seite der Medaille« ist. Die andere Seite zeigt sich darin, dass eine Behinderung Menschen auch dazu herausfordern kann, ungeahnte Stärken zu entwickeln. Menschen können eine Widerstandsfähigkeit gegenüber der Bedrohung und der Belastung zeigen, die sie sich selbst nie zugetraut hätten. Der in diesem Zusammenhang seit einiger Zeit bedeutsam gewordene Begriff heißt Resilienz. Er ist im Gegensatz zu »Behinderung« ein »polysemantisches« Wort, d.h. es können sich daran viele neue Bedeutungsfelder und Geschichten ankoppeln. Denn der Begriff Resilienz weist darauf hin, dass Menschen auch mit sehr massiven Belastungen ganz unterschiedlich umgehen können. Behinderung geht nicht zwangsläufig mit Stress einher, mündet nicht zwangsläufig in einer schicksalhaften Katastrophe. Wenn es gelingt, den Assoziationen, die der Begriff nahe legt, »entdämonisierende« eigene Sinnzuschreibungen entgegenzustellen, dann können in der vermeintlichen Belastung auch besondere Kräfte entfaltet werden. Ich persönlich habe in der Arbeit mit Familien mit chronisch kranken Kindern mehr als einmal gehört, dass sie die Krankheit auch als »Glück« bezeichneten – so schwer ich als Nicht-Betroffener dies nachvollziehen konnte. Die Familien beschrieben die Erfahrung als eine besondere Qualität, auch im positiven Sinn »anders als andere Familien« zu sein:
im Alltag in vielen Momenten das Geschenk, lebendig zu sein, bewusst zu spüren,
symptomfreie Momente und kleine Besserungen beglückend zu erleben und
die Beziehungen zueinander intensiv und stark wahrzunehmen.
Die von Rüdiger Retzlaff in diesem Buch veröffentlichten Studien zeigen, dass es möglich ist, Familien darin zu unterstützen, solche Qualitäten für sich nutzbar zu machen, Resilienz zu entwickeln. Dazu gehört als Wesentlichstes, nicht beim »Stigma« und der »Unveränderbarkeit« stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, sich Unterstützung zu holen, Information aufzunehmen und zu verarbeiten und miteinander in Gesprächen zu bleiben. Die Erfahrungen lassen sich in Geschichten wiederfinden. Sie können zu Geschichten davon werden, wie Hoffnungslosigkeit durch eigene Sinngebung und durch Beziehung gebannt werden kann. Die beiden Typen von »Resilienzgeschichten«, die von der »wieder gefundenen Balance« und auch die mühevollere »vom langen, mühsamen Weg bergauf« sind in diesem Buch eindrückliche Belege für diese Prozesse.
Fachleute sind in diesen Prozessen nicht einfach »objektive Beobachter«, sondern sie sind intensiv mit einbezogen. Sie sind mit beteiligt daran, wie Behinderung erlebt wird, denn diese wird durch den Akt der Versprachlichung und Benennung (auch) eine soziale Konstruktion. Spätestens von dem Moment der Diagnose an re-agieren Fachleute nicht nur auf die Behinderung, sondern sie konstruieren die Phänomene mit, mit denen sie es zu tun haben. Daher ist es besonders wichtig, sensibel für den genauen Auftrag zu sein, mit dem man arbeitet. Die Metaphorik, die sich so schnell bei »Behinderung« einstellt, darf nicht zu einer »Problemtrance« des Therapeuten führen. Es sollte etwa nicht unhinterfragt davon ausgegangen werden, dass die jeweilige Familie emotional bedürftig sei und dringend eine Behandlung brauche. Im Gegenteil: Der Blick auf das Potential an Resilienz, das die Familie mitbringt bzw. entwickelt hat und entwickeln kann, hilft aus der Trance heraus. Weit entfernt von reinem Krankheits- oder Belastungs-»Management« geht es hier darum zu verstehen, also um komplexe Prozesse der Sinngebung. Es kann sinnvoll sein, als Fachperson der Familie eine ganze Reihe nützlicher Informationen zu geben und sie in Fragen des Umgangs miteinander zu beraten. Darüber hinaus aber kann man auch von diesen Familien lernen und erfahren, wie Menschen mit den Herausforderungen umgehen, vor die sie das Schicksal gestellt hat. Es kann sein, dass man als Therapeutin oder Therapeut/Beraterin oder Berater beeindruckt ist von der enormen Kraft, die dann entstehen kann, wenn jemand dieses Schicksal annimmt, sich ihm stellt und an ihm wächst. Wohl so mancher Profi mag sich fragen, ob er/sie in einer vergleichbaren Lage zu ähnlichen Leistungen in der Lage wäre – zumindest kann ich persönlich sagen, dass ich mir diese Frage mehr als einmal gestellt habe.
Doch sollen diese Familien hier auch nicht verklärt werden. Natürlich bleibt auch die Belastung bestehen und es gibt viele Familien und Eltern, die länger andauernde Unterstützung wünschen und brauchen. Und natürlich sind auch die soeben beschriebenen Reifungsprozesse alles andere als »ein Spaziergang«. Die Auseinandersetzungen, die Konfrontation mit heftigen eigenen und fremden Gefühlen hinterlassen ihre Spuren, die manchmal aufgearbeitet werden wollen. Es ist daher gut, dass das Buch neben dem Aufzeigen der beschriebenen Dynamiken auch ein ausführliches Kapitel über Beratungspraxis enthält. Hier wird deutlich, dass es weniger um das korrekte Anwenden therapeutischer Instrumentarien geht als vielmehr darum, einen verstehenden Rahmen bereitzustellen, der den Betroffenen hilft, eine eigene kohärente Geschichte zu entwickeln – im gelegentlichen Innehalten, in der Rückschau und der Reflexion des eigenen Weges. Die Anregungen, die für die BeraterInnen dabei gegeben werden, sind weniger technischer Art (obwohl es auch diese gibt). Vielmehr helfen sie, die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Sie sind geeignet, gemeinsam mit der Familie nach einer neuen Geschichte zu suchen, die einen passenden integrierenden Sinnrahmen bietet – innerhalb dessen die Behinderung einen angemessenen Platz erhält: nicht als alles überschattendes Zentrum des Lebens, wohl aber als ein wichtiger und nicht wegzudenkender Teil der Familie.
Ich wünsche diesem wichtigen Buch viele Leserinnen und Leser, die sich anregen und bewegen lassen, auf die Geschichten betroffener Familien zu hören, Geschichten zu erzählen und neue Geschichten zu (er-)finden.
Arist v. Schlippe
Osnabrück/Witten, im Mai2010
TEIL I Grundlagen
1 Einleitung
Wo aber Gefahr ist,wächst das Rettende auch.
FRIEDRICH HÖLDERLIN
Dieses Buch befasst sich mit dem Zusammenhang von Schlüsselfaktoren, die zur Resilienz von Familien mit Kindern mit Behinderungen beitragen. Die Zahl der Kinder, die an einer körperlichen oder geistigen Behinderung leiden, ist beträchtlich. Die Mehrzahl von ihnen lebt in ihren Familien und ist auf lange Zeit auf deren Fürsorge, Unterstützung und Liebe angewiesen. Die meisten Kinder sind in der Lage, mit zunehmendem Alter mehr Verantwortung für sich zu übernehmen, und erreichen ein höheres Ausmaß an Autonomie (Seiffge-Krenke 1996). Bei schwer mehrfachbehinderten Kindern ist dies jedoch nur sehr bedingt der Fall. Ungeachtet der Fortschritte der Medizin kann bei ihnen kaum auf eine substanzielle Besserung ihrer Einschränkungen gehofft werden. Ihre Eltern bleiben über einen großen Teil der Lebensspanne hinweg in einer verantwortlichen Position und leisten über viele Jahre hinweg Langzeitpflege. Betroffene Familien sind deshalb mit großen, sich ständig wandelnden physischen, psychischen, sozialen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert.
Die Eltern von Kindern mit Behinderung sind oft hochgradig belastet. Die Auswirkungen der Behinderung eines Kindes auf das Leben der Angehörigen werden in der wissenschaftlichen Literatur als ein kritisches Lebensereignis oder als burden konzeptionalisiert. Das Ausmaß elterlicher Hilfeleistungen und der Akzeptanz des Kindes werden allgemein unterschätzt (Eike & Braksch 2009). Zahlreiche Studien bestätigen den hohen Belastungsgrad der Angehörigen; manche Fachleute zeichnen – anders als eine große Anzahl betroffener Familien (Wikler 1981a) – ein wenig positives Bild von der Situation der Familien (Cummings etal. 1965, Cummings 1976, Floyd & Saitzyk 1992, Olshansky 1962), das vorwiegend Pathologie, Defekte, Mängel und neurotische Entwicklungen fokussiert.1 Viele Forscher neigen dazu, jedwede Besonderheit und Variationen normaler Familienprozesse als »typische« Behinderungsauswirkung fehlzuinterpretieren und damit den Fokus vornehmlich auf Defizite zu richten (Antonovsky 1993, Beavers 1989).
In der Medizin, der Psychologie und Psychotherapieforschung hat sich in den vergangenen Jahren neben der pathogenetischen eine ressourcenorientierte Sichtweise etabliert (Holtz & Nassal 2008, Kazak & Marvin 1984). Sie befasst sich mit Faktoren, die zur Resilienz von Menschen und von Familien beitragen und helfen, mit widrigen Lebensumständen fertig zu werden. Für die Situation von Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben, spielen viele verschiedene Ressourcen eine Rolle. Familien2 von Kindern mit Behinderung sind nicht homogen; auch bei schweren Behinderungen eines Kindes entstehen keineswegs in allen Familien Stresssymptome oder dysfunktionale Beziehungsmuster. Die erlebte Stressbelastung, die Qualität der Bewältigung und die Langzeitanpassung hängen nicht ausschließlich von objektiven Faktoren wie dem Grad der körperlichen Beeinträchtigung ab. »Trotz alledem« kommen viele betroffene Familien mit den Folgen schwerer Krankheiten und Behinderungen bemerkenswert gut zurecht und zeigen gegenüber widrigen Lebensumständen Resilienz (Beavers etal. 1986, Goldstein Brooks 2005, Hastings & Taunt 2002, Patterson 1988).
Obwohl die Ressourcenorientierung gerne als Markenzeichen der systemischen Therapie verstanden wird (Schiepek 1999, Sydow etal. 2007), wurde das Thema »Familie und Behinderung« in der deutschsprachigen Literatur mit wenigen Ausnahmen vernachlässigt (Ahlers 1992, Rotthaus 1996, Schubert 1987, Sorrentino 1988). Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe fundierter systemischer Modelle, Konzepte und therapeutischer Vorgehensweisen, die sich in der Arbeit mit Familien von Kindern mit Behinderungen bewährt haben. Die systemische Familienmedizin, die Familien-Stressforschung, die Familien-Resilienzforschung und die salutogenetische Forschung befassen sich mit Faktoren, welche die Resilienz von Familien fördern und auf lange Sicht zu einer günstigen Anpassung beitragen.
All dies spricht für eine resilienz- und familienorientierte Perspektive bei der Untersuchung und Beratung von Familien mit von Behinderung betroffenen Kindern (Imber-Coppersmith 1984). Das Resilienzparadigma erscheint für die Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern mit Behinderung im Rahmen der Frühförderung als eine sinnvolle Orientierung. Es vermeidet eine Pathologisierung, würdigt die herausfordernden Lebensumstände der Familien und versucht im Sinne einer gesundheitsfördernden Zugangsweise, die Eltern in dieser Situation zu unterstützen.
Aus systemischer Perspektive sind drei Klassen von Phänomen zu unterscheiden, die Auswirkungen auf den Umgang mit einer Behinderung haben und die unterschiedliche Ansatzpunkte für Therapie und Beratung bieten:
Greifbare Belastungen der Familie. Dabei handelt es sich um Einschränkungen, die durch eine Behinderung oder Krankheit hervorgerufen werden, und objektivierbare Daten, zum Beispiel die Kinderzahl, weitere Belastungsmomente wie Krankheiten der Eltern und anderes mehr. Diese Ebene der »harten« Wirklichkeitsbeschreibungen ist durch diagnostische Inventare, Pflegegutachten und medizinische Befunde abbildbar.
Funktionsweise und Prozesse von Familien. Dies ist der klassische Gegenstandsbereich der Familienforschung und der systemischen Familientherapie – Interaktionen, Kommunikation, Grenzen und Konflikte innerhalb der Familien und mit externen Systemen, affektiven Prozessen sowie die Verteilung von Aufgaben. Diese Ebene der Wirklichkeit ist deutlich »weicher« und bezieht sich auf Familien als soziale Organisation. Sie wird üblicherweise durch Beobachtungsverfahren und Fragebogeninventare erfasst. Die Bedeutung von gängigen Formulierungen wie »level of family functioning« oder »the quality of family processes in a given family« zu übersetzen, ist nicht einfach. Weitaus stärker als im deutschen Sprachraum ist in der amerikanischen Familientherapie-Tradition die Idee verbreitet, dass eine Familie als soziales System, als ein Team betrachtet werden kann, das seine Aufgaben mehr oder weniger gut erfüllt und besser oder schlechter mit neuen Anforderungen zurechtkommen kann (Beavers & Hampson 1993, Cierpka & Stasch 2003, Cierpka etal. 2005). Mit family functioning oder Funktionsweise der Familie ist hier gemeint, inwieweit eine Familie ein gut aufeinander abgestimmtes Team bildet oder eine lose Gruppierung, die nur wenig miteinander verbunden ist (Patterson 2002a). Die systemische Organisationsberatung beruht auf der Annahme, dass in sozialen Organisationen ein Zusammenhang zwischen einer effektiven Aufgabenerfüllung und der Qualität der Kommunikationsabläufe, des Team-Zusammenhalts, der Flexibilität beim Lösen von Problemen in ungewohnten Situationen und gemeinsamer Team-Überzeugungen besteht (Schmidt 2004); dies gilt analog auch für Familien.
Familiäre Glaubenssysteme sind auf den Lebenswelt-Erfahrungen der Familien und ihren Familien-Geschichten begründet. Dies ist die Ebene einer »weichen Wirklichkeitskonstruktion«. Als geteilte Konstrukte lenken sie die Wahrnehmung und prägen das Handeln der Familie. Familienparadigmen können aus dem Handeln und der Interaktion von Familien erschlossen werden – durch Beobachtung der Familieninteraktion, durch Befragungen und die Rekonstruktion von Leitmotiven aus den Narrativen von Familien.
Für eine präventiv orientierte Beratung von Familien mit Kindern mit Behinderung ist ein besseres Verständnis des Zusammenhangs zwischen der Ausprägung von Krankheiten und Behinderungen, Familienfunktionen und Familienkohärenz von entscheidender Bedeutung. Wiederholt wurde die Forderung nach Beratungsangeboten zur Stärkung der Resilienz für diese Familien erhoben (Hintermair 2002, Sarimski 1998a). In Deutschland gibt es zwar ein breit gefächertes Angebot an Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter in Frühförderstellen und sozialpädiatrischen Zentren. Trotz des gut ausgebauten psychosozialen Versorgungsnetzes gelten die vorhandenen psychotherapeutischen Angebote für Menschen mit Behinderungen als unzureichend (Hoppe 2009, Ramisch & Franklin 2008, Werther 2005); insbesondere fehlen familienorientierte Beratungskonzepte. Das vorliegende Buch befasst sich mit folgenden Fragen, die für die Beratung betroffener Familien relevant sind:
Welche Auswirkungen haben Behinderungen eines Kindes auf das Leben von Familien?
Was hilft Familien, die mit der Behinderung eines Kindes zurechtkommen?
Wie gelingt es manchen Familien, »trotz alledem« ein gutes Leben zu führen?
Welche Familienfunktionen, Haltungen, Rollenverteilungen und familiären Glaubenssysteme helfen ihnen dabei?
In den Versuch, auf diese Fragen Antworten aus Sicht der Familienforschung und der Familientherapie zu geben, fließt meine therapeutische Erfahrung aus der Beratungsarbeit von Familien mit Kindern mit Behinderungen und chronischen Krankheiten ein. Außerdem werden Konzepte der systemischen Familienmedizin vorgestellt, die sich in der Praxis als nützlich erwiesen haben, und durch Befunde aus eigenen Befragungen betroffener Familien ergänzt. In Kapitel6.4 werden Ergebnisse aus drei Studien mit Familien von Kindern mit körperlichen und geistigen Behinderungen dargestellt – einer Gruppe von Kindern mit einem breiten Spektrum an Diagnosen aus der neuropädiatrischen Ambulanz der Universitäts-Kinderklinik in Heidelberg, einer Gruppe von Familien von Mädchen mit einer neurogenetisch bedingten Behinderung – dem Rett-Syndrom – sowie von Familien von Kindern mit geistiger Behinderung, aus einer bundesweiten Befragung an Schulen für Schüler mit geistiger Behinderung. Neben den Familienbögen zur Erfassung der Familienfunktionen wurde dabei auch der Familien-Kohärenzbogen von Antonovsky und Sourani (1988) eingesetzt. Diese Zugangsweise vermittelt eine »Landkarte« des Lebens mit einem Kind mit Behinderung aus der »Außensicht« des Familienforschers und Familientherapeuten.
Aus systemischer Sicht sind die eigentlichen Experten für das Leben mit einer Behinderung nicht Fachleute, sondern die betroffenen Familien selbst. Ihre subjektiven Landkarten vermitteln möglicherweise ein anderes Bild des Lebens mit Behinderung als die Theorien von Familienforschern und Therapeuten. Um Familien direkt zu Wort kommen zu lassen und ihre Geschichten zu erfassen, wurden narrative Interviews mit Familien von Kindern mit Rett-Syndrom geführt. Mit den Methoden der Grounded theory (Glaser & Strauss 1998) und der narrativen Typenbildung wurden Kernressourcen, die zur Resilienz beitragen, und Typen von Resilienzgeschichten rekonstruiert. Die Berichte der Eltern darüber, wie sie mit den Belastungen zurechtkommen, und ihre Empfehlungen für andere Familien werden in Kapitel8 referiert.
Nach einer Diskussion der Konzepte und Ergebnisse der systemischen Forschung werden Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen und praktische Konzepte, Techniken und Vorgehensweisen für die Beratung von betroffenen Familien beschrieben, mit denen sich ihre Stärken entwickeln lassen.
Eine dritte, ergänzende Perspektive, die in dieses Buch einfließt, sind meine Erfahrungen als Vater einer Tochter, die behindert ist. Vor einigen Jahren, unterwegs zu den Lindauer Psychotherapiewochen, stellte mein Kollege Jochen Schweitzer mir die Frage: »Wie schafft ihr es eigentlich als Familie, trotz der Behinderung eurer Tochter gut zu leben?« Als eine Antwort auf seine Frage ist dieses Buch entstanden, das auch Ausdruck einer ganz persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung, Resilienz und Familie ist.
Noch einige Hinweise vorab: Dieses Buch befasst sich vorrangig mit Familien von Kindern, bei denen schwere Entwicklungsstörungen und körperliche und geistige Behinderungen bestehen. Die Konzepte und therapeutischen Herangehensweisen lassen sich weitgehend auf andere Formen von Behinderungen und auf schwere chronische Krankheiten übertragen. Das Wesen des Kindes, seine besondere Persönlichkeit wird von einer ganzen Reihe von Merkmalen und Aspekten bestimmt, die Behinderung ist nur ein Teilaspekt. Im amerikanischen Sprachraum haben sich die Formulierungen children with special needs – Kinder mit besonderen Bedürfnissen – oder people who are physically challenged – körperlich geforderte Menschen – eingebürgert, was sehr viel freundlicher klingt als handicapped children oder etwa der spanische Ausdruck minusvalido (vgl. Efran 1991). Menschen allein über ihre Mängel, Einschränkungen und Defizite zu definieren wäre lieblos und eine unzulässige Einseitigkeit. Wenn im Text gelegentlich die Formulierung »behinderte Kinder« statt »Kind mit Behinderung« verwendet wird, geschieht dies lediglich, um allzu sperrige Sätze zu vermeiden. Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit grundsätzlich die männliche Form verwendet, wobei die weibliche Form selbstverständlich mit eingeschlossen ist. Alle Eigennamen in den Fallbeispielen wurden zur Wahrung der Vertraulichkeit geändert. Bei der Beschreibung von Beratungstechniken und Interventionen habe ich mich um eine möglichst klare Darstellung des Ablaufs bemüht. Es handelt sich dabei um Empfehlungen, die selbstverständlich abgewandelt und an die Arbeitsweise jedes Einzelnen angepasst werden müssen.
2 Behinderungen
2.1 Einführung
Ein erheblicher Teil von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist von körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen betroffen, die eine selbstbestimmte Lebensgestaltung und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erschweren. Was eine Behinderung ausmacht, wird nicht allein durch die Medizin, Psychologie oder Sonderpädagogik, sondern ist auch im Sozialrecht festgelegt:
»Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistigen Fähigkeiten oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist« (§2 Abs.1 Sozialgesetzbuch IX).
Die systemische Therapie nimmt eine kritische Haltung zu Diagnosen und Etikettierungen ein (v. Schlippe & Schweitzer 2007). Diagnoseschlüssel wie die Internationale Klassifikation von Krankheiten ICD-10 (Dilling etal. 2000) und das Diagnostic and Statistical Manual of Diseases DSM IV (APA 1994) wurden wegen ihrer einseitigen Ausrichtung auf Defizite kritisiert (Spitczok von Brisinski 1999). Ein neues ressourcenorientiertes Klassifikationssystem der WHO, die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF – »Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit«), berücksichtigt eine große Bandbreite menschlicher Fähigkeiten und ihrer Ausprägung. Sie hat explizit den Anspruch, neben Defiziten auch Kompetenzen und Fertigkeiten zu erfassen (Nüchtern & Nitzschke 2004). Behinderung wird in der ICF definiert als eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit einer Person. In Anlehnung an das biopsychosoziale Modell schließt der Begriff Funktionsfähigkeit soziale Aspekte mit ein (Engel 1977). Behinderung wird weniger als ein Merkmal einer Person verstanden, sondern als ein komplexer wechselseitiger Zusammenhang von Beeinträchtigungen, die in konkreten Lebenssituationen die Handlungsfähigkeit und Teilnahmemöglichkeiten einschränken. Neben der Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen werden in der ICF auch die Dimensionen der konkret durchführbaren Aktivitäten und das Ausmaß der Teilhabe an der Gemeinschaft für die Feststellung einer Behinderung herangezogen (vgl. Schuntermann 2005). Mit der ICF lassen sich mögliche Beeinträchtigungen in den Bereichen der Strukturen und Funktionen des menschlichen Organismus, Aktivitäten einer Person, der Teilhabe an Lebensbereichen vor dem Hintergrund ihrer sozialen und räumlichen Umwelt beschreiben. Die Definitionen der ICF sind in die Neufassung des Sozialgesetzbuchs IX eingeflossen (Keppner 2009).
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (2008) war in Deutschland zum Jahresende 2007 jeder zwölfte Einwohner (8,4%) schwer behindert; dabei handelte es sich meist um ältere Menschen. Überwiegend wurde die Behinderung durch eine Krankheit verursacht (82%), 4% der Behinderungen waren angeboren oder traten im ersten Lebensjahr auf, 2% waren auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen. Lediglich 2% der Schwerbehinderten waren Kinder und Jugendliche unter 18Jahren. Als schwer behindert gelten Personen, denen vom Versorgungsamt ein Grad der Behinderung von 50% und mehr zuerkannt wurde. Etwa ein Drittel ist von Mehrfachbehinderungen betroffen. In Deutschland gibt es ca. 400 000 bis 450 000 Kinder und Jugendliche mit körperlichen, Sinnes- und geistigen Behinderungen. In 3% der Mehrpersonenhaushalte lebt ein solches Kind (Eike & Braksch 2009).
Lange Zeit wurden der Körper und die Ebene somatischer Prozesse und damit auch Krankheit und Behinderungen als relevante Systemaspekte in der systemischen Therapie vernachlässigt (Weakland 1977, Sloman & Konstantareas 1990). Diagnosen wurden primär als soziales Konstrukt verstanden und weniger als eine Beschreibung objektiver Merkmale einer Person. Aus dem Wunsch, Menschen nicht auf Defizite festzulegen, werden Diagnosen üblicherweise hinterfragt und mit zirkulären Fragen »verflüssigt«, um ihren relationalen Charakter und die Prozesshaftigkeit von diagnostischen Zuschreibungen zu verdeutlichen. Eine ressourcen- und lösungsorientierte Vorgehensweise ist für Familien mit behinderten Angehörigen sinnvoll (de Shazer & Lipchik 1984, Efron & Veenendahl 1993, Lloyd & Dallos 2006). Bei aller Ressourcenorientierung sollte jedoch nicht übersehen werden, dass sich Menschen in ihrer biologischen Ausstattung unterscheiden. Sie lassen sich nicht hinreichend aus dem Familiengeschehen oder aus »Spielen der Familie« ableiten (vgl. Selvini Palazzoli etal. 1989, Sloman & Konstantareas 1990). Ein Handicap löst sich durch psychologische Interventionen nicht einfach auf.
Eine Diagnosestellung hat soziale Folgen, die nachteilig sein können; dies gilt umgekehrt aber auch für den Verzicht auf eine Diagnose. Diagnosen sind nicht an und für sich gut oder schlecht. Fisch etal. (1982) unterschieden zwei Klassen von Problemen – Situationen, die eigentlich kein Problem darstellen, aber dennoch zu einem gemacht werden, und Situationen, in denen ein Problem besteht, das aber nicht erkannt oder eingestanden wird. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Familie nicht wahrhaben will, dass bei ihrem Kind eine Behinderung vorliegt. – Dazu ein Fallbeispiel aus der Beratungspraxis:
▶ Herr K. stellte gemeinsam mit seiner Frau die knapp fünfjährigen Zwillinge zur Beratung vor, bei denen eine Entwicklungsverzögerung unklarer Genese diagnostiziert worden war. Beide Jungen konnten nicht sprechen und hatten auffallende Gesichtsdysmorphien. Der Vater klammerte sich an die Hoffnung: »Das Problem ist, dass sie noch nicht sprechen. Wenn sie erst einmal sprechen, platzt der Knoten, werden sie rasch aufholen!«
Der Umgang mit der Diagnose einer Behinderung ist für Eltern und Behandler nicht immer einfach. Manche Eltern zögern, einen Behindertenausweis oder die Eingruppierung in eine Pflegestufe zu beantragen oder ihre Kinder in einem Sonderkindergarten anzumelden. Sie befürchten negative stigmatisierende Auswirkungen oder glauben, ihr Kind aufzugeben, wenn sie sich eingestehen, dass eine bleibende Einschränkung besteht. Viele Kinderärzte gehen zu Beginn der diagnostischen Abklärungsphase sehr vorsichtig mit Diagnosen um, weil sie die Eltern nicht beunruhigen und sich nicht voreilig festlegen wollen.
Das Eingeständnis, dass eine Behinderung oder eine chronische Krankheit vorliegt, kann eine befreiende Wirkung haben, weil so der Weg für notwendige Anpassungsschritte geebnet ist und wichtige therapeutische Weichenstellungen ermöglicht werden (Grunebaum & Chasin 1978, Rolland 1994).
Diagnosen und Beschreibungen wie »chronische Krankheit«, »Behinderung« oder »geistige Behinderung« beziehen sich auf objektivierbare Merkmale, beruhen aber auch auf sozialen Beurteilungen von Phänomenen. Sie können deshalb besser innerhalb des jeweils gegebenen Sinngebungskontextes verstanden werden (Hennicke 1993, v. Schlippe & Lob-Corzilius 1993). Behinderungen gelten als Abweichungen von der Norm, doch wer legt fest, was normal ist? Die Überlegung »Wer wird von wem als behindert definiert?« verweist auf die Bedeutung der Normen und der Interessen der Person, die das Vorliegen einer Behinderung feststellt. Möglicherweise wird ein Mensch von Außenstehenden als behindert wahrgenommen, ohne sich jedoch subjektiv als behindert zu fühlen (Duss-von Werdt 1995). Menschen eignen sich die Welt entsprechend den ihnen gegebenen strukturellen Möglichkeiten an.
Wenn man Behinderungen als Krankheit begreift, ist es folgerichtig, sie als Gegenstand der Medizin zu betrachten, diese Zuordnung ist jedoch nicht zwingend (Duss-von Werdt 1995). Sie können auch als Ausdruck der Vielseitigkeit menschlichen Seins verstanden werden. In manchen ethnischen Gruppen werden Behinderungen als ein Geschenk, in anderen als Strafe Gottes verstanden. Die Bedeutung von sozialen Normen und Konventionen wird bei der Zuschreibung einer geistigen Behinderung besonders deutlich (vgl. Klee 2004).
Vertreter von Behindertenorganisationen haben wiederholt darauf verwiesen, dass der Begriff »Behinderung« kein absolutes Merkmal darstellt, sondern erst innerhalb eines bestimmten sozialen Kontextes Sinn macht. Was als Behinderung gewertet wird, ist abhängig von der Vorstellung, was als »normal« gilt. Dies wird in der saloppen Formulierung »Wer stört, ist gestört« deutlich (Simon 1993, S.147). Ob das Vorliegen bestimmter körperlicher Einschränkungen als Behinderung gewertet wird, ist auch von sozialen Zuschreibungsprozessen abhängig und von den Erwartungen, die eine Gesellschaft an ihre Mitglieder stellt. Die Unterscheidung normal/behindert kategorisiert Menschen in einer bestimmten Weise, die sich nicht zwingend aus den biologischen Merkmalen der Behinderung ergeben muss (Hohn 1989).
Generell wird das Label »chronisch« für Krankheiten und Zustandsbilder verwendet, die als nicht beeinflussbar gelten. Die Beeinflussbarkeit hängt unter anderem von den Behandlungsmöglichkeiten ab, die in der jeweiligen Gesellschaft verfügbar sind (von Schlippe & Theiling 2002). Kleinwüchsigkeit galt früher als unheilbare Behinderung, heute können einige Formen in Industrieländern mit gut ausgebautem Gesundheitssystem durch die Gabe von Wachstumshormonen therapiert werden. Für Kinder aus ärmeren Ländern ohne Zugang zu teuren Medikamenten stellt sie jedoch nach wie vor eine chronische Krankheit ohne Aussicht auf Heilung dar. Seh- oder Hörbehinderungen können mit einfachen Hilfsmitteln wie Brillen oder Hörgeräten korrigiert werden und lösen in unserer Kultur schwerlich die Assoziation mit dem Begriff »Behinderung« aus. In einer Jäger-und- Sammler-Kultur wären sie jedoch eine ernsthafte Beeinträchtigung, mit nachteiligen Auswirkungen auf die Überlebenschancen. Menschen, die an amelioritischer Lateralsklerose leiden, können mit Hilfe von computerbasierten Hilfsmitteln ihre Behinderungen zumindest partiell kompensieren. Ein anderes Beispiel ist der südafrikanische Sprinter Oscar Pistorius, der mit zwei High-Tech-Beinprothesen die Strecke von 100m in einer Zeit läuft, die ihn für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen qualifiziert hätte. Die Diagnose einer erblichen Krankheit war über zwölf Jahre der deutschen Geschichte hinweg keine »wertfreie« Feststellung, sondern bedeutete eine massive Bedrohung des Lebens der Patienten und ihrer Angehörigen. In vergangenen Jahrzehnten dürfte die Diagnose eines »genetisch bedingten Leidens« überwiegend die Assoziation »nicht therapierbar« ausgelöst haben. Heute bestehen bei genetischen Krankheiten hohe, möglicherweise überzogene Hoffnungen auf Heilungschancen durch die Fortschritte der Gentechnik.
Auf einer pragmatischen Ebene können Diagnosen, Etikettierungen und das Label »Behinderung« als Einschränkung der Freiheitsgrade der Lebensgestaltung verstanden werden, die sich nicht einfach wegdefinieren lassen. Im Sinne von Berger und Luckmann (1966) besitzen sie Realitätscharakter3. Behinderungen werden heute weniger als individuelles Merkmal eines Menschen aufgefasst, sondern als ein mehrdimensionales, relationales Phänomen (Lindermeier 2009). Der Schwerpunkt der Betrachtung verlagert sich damit von der Person auf den Lebensbereich, in dem ein Mensch mit geistiger Behinderung spezielle Unterstützung und Begleitung benötigt.
2.2 Körperliche Behinderungen
Unter einer Körperbehinderung wird üblicherweise eine dauerhafte Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit verstanden. Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Neben anlagebedingten Behinderungen spielen pränatale Faktoren eine Rolle, zum Beispiel eine Infektionskrankheit der Mutter, perinatale Komplikationen, zum Beispiel Sauerstoffmangel bei der Geburt, und postnatale Faktoren, zum Beispiel Unterernährung im Säuglingsalter, Infektionskrankheiten wie eine Gehirnentzündung in der frühen Kindheit, Unfälle, aber auch Umweltschäden und Medikamentenfolgen wie im Falle von Contergan. Körperbehinderungen stellen eine sehr heterogene diagnostische Gruppe dar. Sie betreffen überwiegend das zentrale oder das periphere Nervensystem und das Stütz- und Bewegungssystem. Häufige Erscheinungsformen sind
zerebrale Bewegungsstörungen – wie Spastiken, muskuläre Hypotonie einer Körperseite oder der Extremitäten (Tetraplegie, Hemiplegie, Diplegie); Ataxien. Mit betroffen sind oft die Mimik und die Sprechmotorik. Damit verbunden sind oft Einschränkungen der Intelligenz, Sprach-, Hör- und Sehstörungen, Verhaltensstörungen, Leistungsschwächen und Epilepsien
Querschnittslähmungen durch eine Fehlbildung oder eine Verletzung des Rückenmarks, oft einhergehend mit Störungen der Blasen-, Mastdarmfunktion
Schädigungen des Skelettsystems, zum Beispiel Rückgratverkrümmungen (Skoliosen, Lordosen, Kyphosen)
Angeborene Fehlbildungen von Gliedmaßen, zum Beispiel ein Klumpfuß, Fehlen von Gliedmaßen – etwa durch Unfälle oder Erkrankungen
Muskelsystemerkrankungen, wie zum Beispiel progressive Muskeldystrophie
chronische Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis, die Schäden von Knochen und Gelenken und erhebliche Bewegungseinschränkungen bewirken
andere Behinderungen – zum Beispiel hormonell bedingter Zwergwuchs
Behinderungen von Wahrnehmungsorganen
Fehlbildungen von Seh-, Hör- und inneren Organen, etwa eine fehlende Anlage der Blase (Anton 2003, Keppner 2009).
2.3 Geistige Behinderung
Als allgemeine Kennzeichen von geistiger Behinderung werden üblicherweise eine seit der Kindheit bestehende Intelligenzminderung und eine aktuell gegebene Beeinträchtigung der sozialen Anpassungsfähigkeit genannt, die so gravierend sind, dass voraussichtlich über das ganze Leben hinweg besondere Hilfen benötigt werden (Davison & Neale 2002). In der Vergangenheit wurde bei der Diagnosestellung nach ICD-10 eine Kategorisierung nach dem Grad der kognitiven Beeinträchtigung in leichte, mittelgradige, schwere und schwerste geistige Behinderung vorgenommen. In den USA werden Lernbehinderungen oder mild mental retardation mit einbezogen (Lotz & Koch 1994, Wendeler 1993). Während Kinder mit leichetr geistiger Behinderung sich langsamer als die Norm entwickeln, im Erwachsenenalter jedoch viele praktische Tätigkeiten meistern und sich meist unabhängig versorgen können, ist dies bei einer mittelgradigen Intelligenzminderung nur eingeschränkt der Fall; außerdem hat die letztgenannte Gruppe häufig begleitende Schwierigkeiten beim Spracherwerb. Bei Menschen mit schwerer geistiger Behinderung liegen meist gleichzeitig erhebliche motorische Schwächen vor. Betroffene Personen sind verhältnismäßig passiv und nur für kurze Zeit zu konkreter Kommunikation fähig. Menschen mit schwerster geistiger Behinderung sind meist stark in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt und überwiegend nur zu sehr einfachen Formen nonverbaler Kommunikation fähig. Nach einer Definition des Deutschen Bildungsrats gehört zu dem Personenkreis Menschen mit geistiger Behinderung,
»wer infolge einer organisch-genetischen oder anderweitigen Schädigung in seiner psychischen Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit so beeinträchtigt ist, dass er voraussichtlich lebenslanger sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf. Mit den kognitiven Beeinträchtigungen gehen solche der sprachlichen, sozialen, emotionalen und motorischen Entwicklung einher« (Deutscher Bildungsrat 1973, S.37).
Geistige Behinderung stellt kein klar abgrenzbares Merkmal dar. Holtz etal. (1998) sprechen sich gegen eine Definition von geistiger Behinderung ausschließlich anhand von Intelligenzkriterien aus; die Grenzwerte sind meist willkürlich festgelegt, und eine isolierte Betrachtung des IQ-Wertes bietet kaum Hinweise für die individuelle Förderung. Sarimski (2006a) definiert geistige Behinderung
»als verlangsamte(n) Erwerb von Fähigkeiten, verzögertes Erreichen von Entwicklungsstufen und als asynchrone(n) Entwicklungsverlauf, bei dem einzelne Informationsverarbeitungsprozesse in unterschiedlichem Maße beeinträchtigt sein können« (S.93).
Eine Beschränkung auf die Diagnostik der kognitiven Leistungsfähigkeit ist wenig sinnvoll (Duss-von Werdt 1995) – die Fähigkeiten zur emotionalen Selbstregulation und zur Entwicklung sozial-kognitiver Kompetenzen müssen ebenso berücksichtigt werden. Aussagekräftiger sind Beeinträchtigungen der sozialen Anpassungsfähigkeit. Darunter ist die Fähigkeit zu verstehen, Beziehungen zu anderen aufzubauen und beizubehalten, sich an soziale Normen zu gewöhnen und Erwartungen anderer Personen zu erkennen. Hierzu gehört auch die adaptive Funktionsfähigkeit, zum Beispiel die Fähigkeit des Kindes, sich zu waschen und anzuziehen, mit Zeit und Geld umzugehen oder Werkzeuge zu gebrauchen (Davison & Neale 2002).
Nach der Definition der American Association on Mental Retardation (AAMR) – die sich bezeichnenderweise in die American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) umbenannt hat – ist es sinnvoll, Menschen nicht nach Art und Schwere ihrer Behinderungen zu klassifizieren, sondern nach dem Ausmaß der notwendigen Hilfen und deren Art und Intensität:
»Geistige Behinderung bezieht sich auf substanzielle Einschränkungen der gegenwärtigen Funktionsfähigkeit. Sie ist gekennzeichnet durch erheblich unterdurchschnittliche allgemeine Fähigkeiten, die gleichzeitig mit damit verbundenen Einschränkungen in zwei oder mehreren der folgenden Bereiche des täglichen Lebens auftreten: Kommunikation, Selbstfürsorge, Wohnen daheim, Sozialverhalten, selbstbestimmtes Leben, Gesundheit und Sicherheit, lebenspraktische Schulbildung, Freizeit, Arbeit. Geistige Behinderung tritt vor dem 18. Lebensjahr auf. (…) Geistige Behinderung ist (…) ein spezieller Zustand der Funktionsfähigkeit, der in der Kindheit beginnt und durch eine Begrenzung der Intelligenzfunktionen und der Fähigkeit zur Anpassung an die Umgebung gekennzeichnet ist. Geistige Behinderung spiegelt deshalb das ›Passungsverhältnis‹ zwischen den Möglichkeiten des Individuums und der Struktur und den Erwartungen seiner Umgebung wider« (American Association on Mental Retardation 1992).
Aus ressourcenorientierter Perspektive wird geistige Behinderung zunehmend anhand des Kompetenzkonzepts betrachtet. Das Heidelberger Kompetenz-Inventar (HKI) erfasst nicht die Beeinträchtigungen, sondern die Kompetenzen des Kindes. – Die Theorie multipler Intelligenzen geht davon aus, dass es ein komplexes Spektrum an menschlichen Fähigkeiten, intellektuellen Begabungen und Potenzialen gibt, die mit den üblichen diagnostischen Einteilungen nur unzureichend erfasst werden (Gardner, H. 1993, Stern 2002). Neuere Modelle wie der Kompetenzansatz zielen darauf ab, dieses breite Spektrum der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erfassen (Holtz etal. 1998).
Epidemiologie und Prävalenz geistiger Behinderung
Die Angaben zur Prävalenz geistiger Behinderungen schwanken je nach den Diagnosekriterien, der Operationalisierung und der untersuchten Stichprobe beträchtlich (APA 2003). Nach Davison & Neale (2002) kommt ein Intelligenzquotient unter 70 bei ca. 3% der Bevölkerung vor, darunter 1–2% mit schwerer geistiger Behinderung. In einer epidemiologischen Studie von Bielski (1998) wurde die Prävalenz mit 0,5–1%, im DSM IV mit ca. 1% der Bevölkerung angegeben (APA 2003). Nach DSM IV gehören etwa 85% der Personen mit geistiger Behinderung der Gruppe mit leichter geistiger Behinderung an, etwa 10% der Gruppe mit mittelschwerer geistiger Behinderung, 3–4% zur Gruppe der schweren und 1–2% der schwersten geistigen Behinderung (APA 2003). Häufig bestehen parallele chronische körperliche Erkrankungen und Syndrome.
Auf Basis von Vergleichszahlen verschiedener europäischer Länder wird die Prävalenzrate geistiger Behinderung bei Kindern mit 0,5 bis 1% (Straßburg 1997a) angegeben. Bei Jungen ist die Diagnose 1,5-fach häufiger als bei Mädchen (APA 2003, Bleidick 1992, Davison & Neale 2002, Haupt etal. 1997, Liepmann 1979). In Deutschland betrug der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung an der Gesamtschülerschaft im Jahr 2006 0,9% (KMK 2008). An Sonderschulen ist der Jungenanteil mit 63% deutlich höher als der Mädchenanteil mit 37% (Statistisches Bundesamt 2008).
Die Ursachen für geistige Behinderung können sehr unterschiedlich sein. Trotz Fortschritten in der Diagnostik lässt sich in vielen Fällen keine primäre Ursache herausfinden; nur in etwa 25% der Fälle kann eine primäre, meist organische Ursache der geistigen Behinderung festgestellt werden (Davison & Neale 2002). Neben genetischen Faktoren kommen pränatale oder perinatale Schädigungen, exogene Faktoren wie Substanzmissbrauch der Mutter, Umweltgifte, Folgen chronischer Krankheiten und postnatale Faktoren wie Infektionen und Schädel-Hirn-Traumen oder Stoffwechselerkrankungen und endokrine Störungen durch Vergiftungen in Frage (Davison & Neale 2002, Haupt etal. 1997). Schweren Behinderungen liegt in der Regel eine organische Ursache zugrunde (APA 2003).
2.4 Genetisch bedingte Syndrome und Behinderungen
Eine große Bandbreite seltener genetischer Krankheiten kann zu Behinderung führen (Sarimski 1997). Zahlreiche genetische Syndrome stellen die Eltern durch die mit ihnen einhergehenden Mehrfachbehinderungen vor besondere Herausforderungen, die ihre erzieherischen und psychischen Bewältigungskräfte fordern (Sarimski 1998a). Ein besonderer Faktor ist der Umgang mit dem Wissen um ein in der Familie vererbtes Erkrankungsrisiko, mit der Option von Pränataldiagnostik, und der Umgang mit der so genannten genetischen Unsicherheit über den tatsächlichen Verlauf von Erkrankungen (McDaniel etal. 2004, Retzlaff etal. 2001, Street & Soldan 1998).
Gene spielen bei den allermeisten Krankheiten und Behinderungen eine Rolle, zum Teil direkt, zum Teil mittelbar über die körperliche Anfälligkeit oder Widerstandsfähigkeit, den Verlauf von Erkrankungen und die Reaktion auf Behandlungen. Mit dem Abschluss des Genomprojektes im Jahr 2003 ist das Wissen über die Beteiligung von genetischen Faktoren erheblich gestiegen. Bei vielen genetischen Syndromen besteht neben körperlichen Behinderungen auch eine intellektuelle bzw. geistige Behinderung.
Während die Anlagen für erblich bedingte Krankheiten im engeren Sinn von Generation zu Generation weitergegeben werden, gibt es auch spontane Genmutationen und Chromosomenanomalien, die Entwicklungsretardierungen und Behinderungen nach sich ziehen (Neuhäuser 2007). Genetische Syndrome entstehen durch eine Veränderung der Zahl von Chromosomen – wie bei der Trisomie 21, dem Down-Syndrom –, durch eine Veränderung der Struktur eines Chromosoms oder Veränderungen von einzelnen Gensequenzen. Zum Teil sind nicht nur eine, sondern über 1000 Mutationen beteiligt (Feetham & Thomson 2006). Manche, wie das Down-Syndrom, treten relativ häufig auf, andere, wie Prader-Willi-Syndrom, Fragile-X-Syndrom oder Angelmann-Syndrom, sind dagegen selten. Die Penetranz der Mutation kann sehr unterschiedlich sein, sie muss nicht immer zum Auftreten einer genetisch bedingten Erkrankung führen.
Zahlreiche genetische Störungen lassen sich bereits pränatal diagnostisch erfassen. Lange vor dem Auftreten von Symptomen können Familien möglicherweise erfahren, ob ihr Kind später erkranken wird. Erfolgt diese Diagnostik pränatal, stellen sich manche Eltern die Frage nach einer Fortsetzung der Schwangerschaft. Möglicherweise erhalten Eltern Informationen über langfristig beeinträchtigte Entwicklungsperspektiven, die nicht leicht auszuhalten sind. Manche Krankheiten und Behinderungen manifestieren sich erst in einem höheren Lebensalter. Bei inzwischen über 1000 genetisch bedingten Störungen sind Tests verfügbar, die in der pränatalen Diagnostik, bei Screenings nach Geburt, zur Bestätigung von Verdachtsdiagnosen und zur Auswahl von therapeutischen Maßnahmen eingesetzt werden können. Die Anwendung dieser prädiktiven Tests wird in Deutschland durch das 2009 verabschiedete Gendiagnostikgesetz geregelt.
Die Unsicherheit des genetischen Status kann eine besondere Form von Belastung mit erheblichen Rückwirkungen auf die Eltern sein. Für viele andere Syndrome gibt es bislang noch keine Testverfahren zur Sicherung der Diagnose. Vor Einführung genetischer Testverfahren für die Muskeldystrophie Duchenne mussten Eltern zwei oder drei Jahre mit der Ungewissheit leben; heute ist diese Zeit deutlich verkürzt, es bleibt aber auch sehr viel weniger Zeit für die Auseinandersetzung mit der Diagnose und den sich daraus ergebenden Perspektiven.
Bei bestimmten genetischen Störungen besteht ein erhöhtes Risiko einer Erkrankung, ohne dass diese auch wirklich ausbrechen muss. Gegebenenfalls müssen sich Eltern mit der Möglichkeit auseinander setzen, dass ihr Kind eine genetische Belastung weitergeben könnte, falls es einmal selbst Kinder haben will, und ein Enkelkind später ebenfalls behindert sein könnte.
Für die psychischen Probleme, die sich Familien mit von genetischen Krankheiten betroffenen Angehörigen stellen, gibt es kaum soziokulturelle Leitbilder (Retzlaff etal. 2001). Bei manchen Störungsbildern liegt heute ein sehr viel umfassenderes Wissen über die Ursachen von Behinderungen vor. Präzisere Kenntnisse über die genetisch bedingten Besonderheiten einer Behinderung können Eltern helfen, eine bessere Einschätzung der Fördermöglichkeiten und gegebenen therapeutischen Grenzen zu erlangen. Eine richtige diagnostische Einschätzung kann Eltern von der Suche nach immer weiteren Therapiemöglichkeiten abhalten und Schuldgefühle nehmen (Sarimski 1997). Störende Verhaltensweisen wie lautes Schreien, langsames Essen, übermäßiges Essen oder eine hohe Irritierbarkeit werden rasch auf Fehler von Eltern oder als Unart des Kindes wahrgenommen. Wenn nicht das Kind und nicht die Eltern, sondern das Fragile-X-Syndrom, das Prader-Willi-Syndrom oder Angelmann-Syndrom »Schuld« an einem schwierigen Verhalten haben, entlastet dies potenziell auch die Eltern-Kind-Beziehung, weil die persönlichen Eigenschaften und Möglichkeiten des Kindes jenseits der behinderungsbedingten Aspekte deutlicher wahrgenommen werden können.
Als Prototyp einer genetisch bedingten Behinderung, die sowohl mit körperlichen als auch geistigen und seelischen Beeinträchtigungen einhergeht, wird im Folgenden das Rett-Syndrom beschrieben. Zur Resilienz von Familien von Kindern mit Rett-Syndrom wurden eigene Befragungen durchgeführt, die in Kapitel8 vorgestellt werden.
2.5 Das Rett-Syndrom
Das Rett-Syndrom wurde 1965 von dem Wiener Arzt Andreas Rett entdeckt, erlangte aber erst in den 70er Jahren einen breiteren Bekanntheitsgrad (Hagberg etal. 1983). Es kommt mit einer Häufigkeit von 1:10 000 bis 1:23 000 neugeborener Mädchen vor (Hagberg etal. 2002). Betroffen sind fast nur Mädchen (Kusch & Petermann 2000). Jungen sterben in der Regel vor der Geburt aufgrund der Schwere der Behinderung (Hunter 1999). Das familiäre Wiederholungsrisiko liegt unter 1% (Lindberg 2000).
Das klassische Rett-Syndrom verläuft in vier Phasen. Im frühen Stadium (6–18Monate) kommt es nach einer normalen Schwangerschaft und Geburt zu einer Verlangsamung und einem Stillstand der Entwicklung mit Reduktion des Blickkontaktes und des Interesses an Spielzeug. Die zweite Phase (ein bis vier Jahre) ist gekennzeichnet durch einen vorübergehenden, oft dramatischen, autistisch anmutenden sozialen Rückzug, mit Verlust bereits erworbener Fähigkeiten und weitgehendem Verlust der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und zielgerichteter Handfunktionen. Das Kopfwachstum ist verlangsamt, der Gang ataktisch (Dobslaff 1999, Hagberg etal. 2002, Hunter 1999). Die Kinder sind leicht irritierbar, haben Schreiattacken und beginnen mit charakteristischen stereotypen Handbewegungen, die als Leitsymptom gelten (Sarimski 1997). Die dritte Phase mit einer relativen Stabilisierung kann lange andauern; es kommt zum Wiedererlangen einzelner Fähigkeiten, vor allem der Kommunikation und des emotionalen Kontakts. Bis auf extrem seltene Ausnahmen können die betroffenen Mädchen nicht sprechen und verlieren eine eventuell entwickelte verbalsprachliche Ausdrucksfähigkeit vollständig. Die Mehrheit der Kinder leidet an epileptischen Anfällen, es kommt zu zunehmenden Bewegungsstörungen, Ataxien und orthopädischen Problemen, insbesondere muskulären Dystonien und Kyphosen und Skoliosen. Zwei Drittel der Kinder sind auf einen Rollstuhl angewiesen. Im späten Stadium nehmen die Funktionen nicht weiter ab, die Bewegungsstörungen und orthopädischen Probleme und insbesondere die Wirbelsäulenverkrümmung jedoch zu (Dobslaff 1999, Hunter 1999, Lindberg 2000). Diese Phasen treffen allerdings nur auf einen Teil der Mädchen zu, der Verlauf variiert hinsichtlich des Beginns, des Tempos der Verschlechterungen und des Ausmaßes der Behinderung (Lindberg 2000).
Unterstützend für die Diagnose sind weibliches Geschlecht, Atemregulationsstörungen, EEG-Abnormitäten, Epilepsie, Hypotonie, Skoliose, hypotrophe und kleine Füße, Wachstumsretardierung und Zähneknirschen (Hagberg etal. 2002, Hunter 1999). Die Mädchen gelten als geistig behindert, wegen der fehlenden sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und der Apraxie ist eine genauere Ermittlung der kognitiven Kompetenzen allerdings nur bedingt möglich. Beim Rett-Syndrom handelt es sich um eine neurogenetisch bedingte Behinderung. Seit 1999 ist eine (mit-)verursachende Mutation des MEPC 2-Genoms auf dem X-Chromosom bekannt, seit 2000 gibt es auch in Deutschland einen Gentest (Hunter 1999). Neuere Befunde sprechen für ein komplexes Zusammenspiel von mindestens zwei Genomen, erste Tiermodelle der beteiligten neurogenetischen Prozesse existieren (Chang etal. 2006). Innerhalb des Syndroms besteht eine gewisse Variabilität, genauere Diagnoseschemata für Phänotypen mit unterschiedlichen Verhaltensmerkmalen sind in Entwicklung (Leonard etal. 2001, Mount etal. 2001, 2002, 2003). Die Zuordnung des Syndroms in ICD-10 und DSM IV zu den psychiatrischen Störungen des Kindes- und Jugendalters vermag in Anbetracht der massiven orthopädischen, neurologischen und vegetativen Symptome nicht zu überzeugen (Gillberg 1994), eine Revision steht in DSM V in Aussicht.
Eine Standardtherapie gibt es beim Rett-Syndrom nicht. Verhaltenstherapeutische Maßnahmen greifen kaum. Sinnvoll ist die Kombination mehrerer Verfahren, um die Lebensqualität und Ansätze zur Selbständigkeit und Kommunikation zu verbessern (Dobslaff 1999, Sarimski 1997).
2.6 Seelische Behinderung
Neben körperlichen und geistigen Behinderungen gibt es im deutschen Sozialrecht auch den Begriff der seelischen Behinderung. Grundsätzlich können alle psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter zu einer seelischen Behinderung führen. Psychische Störungen wie körperlich nicht begründbare Psychosen, seelische Störungen als Folge von Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns, von Epilepsien, von anderen Krankheiten oder körperlichen Beeinträchtigungen, Suchtkrankheiten und Neurosen und Persönlichkeitsstörungen können eine seelische Behinderung zur Folge haben (vgl. §3 der Verordnung zum §47 BSHG). Für die Diagnose einer bestehenden oder drohenden seelischen Behinderung muss die seelische Gesundheit des jeweiligen Kindes oder des Jugendlichen mehr als sechs Monate lang von dem für sein Lebensalter typischen Zustand abweichen. Insbesondere bei anhaltenden kindlichen Entwicklungsstörungen können Abgrenzungsprobleme zwischen seelischer und geistiger Behinderung bestehen – oft treten psychische Störungen kombiniert mit körperlichen und geistigen Behinderungen auf.
2.7 Chronische Krankheiten
Schwere chronische Krankheiten eines Kindes stellen Familien vor ähnliche psychosoziale Anforderungen wie eine Behinderung. Sie können zu schweren Beeinträchtigungen führen – beispielsweise wie eine Mukoviszidose oder Epilepsien, sodass sozialrechtlich eine Behinderung vorliegt. Von einer chronischen Krankheit wird gesprochen, wenn diese länger als drei Monate vorliegt und eine Heilung nicht möglich ist. Chronische Krankheiten bestehen meist das ganze Leben und sind – ähnlich wie Behinderungen – für das betroffene Kind und seine Familien eine erhebliche Belastung.
Die Zahl chronisch kranker Kinder ist hoch, betroffen sind je nach Definition ca. 10–18% (Gortmaker & Sappenfeld 1984); bei 10% liegen ernsthafte chronische Leiden vor. Diese Zahlen hängen mit davon ab, ob leichtere Erkrankungsformen dazugerechnet werden. Im Gegensatz zum Erwachsenenalter verteilen sich die Diagnosen im Bereich von Kindern und Jugendlichen auf eine Vielzahl verschiedener Leiden. Die Zahl chronisch kranker Kinder nimmt durch die Fortschritte der Medizin deutlich zu, da heute Kinder mit Krankheiten erfolgreich behandelt werden, die früher keine guten Überlebenschancen hatten. Neben leichteren chronischen Krankheiten mit hoher Prävalenz gibt es seltenere Diagnosen wie Skoliosen, Epilepsie, zystische Fibrose oder Mukoviszidose, die schwere Beeinträchtigungen mit sich bringen (Kamtsirius etal. 2007).
Übersichtsarbeiten zu den Auswirkungen von chronischen Krankheiten auf Kinder, Jugendliche und Familien finden sich bei Petermann und Wiedebusch (1996), Noeker und Petermann (1996), Salewski (2004) und Seiffge-Krenke (1996). Manche Autoren erfassen sowohl chronische Erkrankungen, bei denen ein medizinischer Behandlungsbedarf besteht, als auch körperliche und intellektuelle Behinderungen, bei denen dies nicht der Fall ist (Blanz 1994). Die Zuordnung von Zustandsbildern ist in der wissenschaftlichen Literatur nicht immer eindeutig, ein und dasselbe Syndrom wird manchmal als chronische Krankheit, manchmal als Behinderung gewertet (Blanz 1994).
2.8 Schwermehrfachbehinderung
Eine besondere Herausforderung für Betroffene und ihre Familie ist Schwermehrfachbehinderung, die definiert werden kann als
»das gemeinsame Auftreten mehrerer Behinderungen wie zum Beispiel die Kombination von geistiger Behinderung und Sehbehinderung oder geistiger Behinderung und Körperbehinderung. Es wird keine Zuordnung zu einem Leitsymptom wie körperbehindert, geistig behindert oder sinnesgeschädigt vorgenommen, denn dies würde der Komplexität der Behinderung nicht gerecht. Es handelt sich vielmehr um eine Beeinträchtigung des ganzen Menschen in den meisten seiner Lebensvollzüge. Diese Beeinträchtigung ist so schwer, dass die elementare Begegnung mit anderen Menschen erschwert ist« (Biermann 2001, S.94).
Medizinische Diagnosen sind nur bedingt geeignet, die psychosozialen Belastungen abzubilden, die mit komplexeren Diagnosen einhergehen. Ein Versuch, den Belastungsgrad bei sehr unterschiedlichen Behinderungen zu erfassen, erfolgt bei der Begutachtung, die im Rahmen der Pflegegruppeneingruppierung vorgenommen wird. In Deutschland haben Menschen, die pflegebedürftig sind, nach dem so genannten »Pflegegesetz« (SGB XI) einen Rechtsanspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung in Form von Sachleistung bzw. Pflegeeinsätzen, oder als direkte Finanzleistung bzw. Pflegegeld. Abhängig vom Ausmaß der erforderlichen Hilfe werden drei Pflegestufen unterschieden. Außerdem wurde für den erhöhten Pflegeaufwand bei verwirrten, nicht orientierten Menschen mit geistiger Behinderung eine Zusatzpflegestufe eingeführt.
Gegenwärtig erfolgt die Eingruppierung in Pflegestufen durch Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), in der Regel Fachärzten oder -pflegern. Im Abstand von zwei Jahren werden bei einem Hausbesuch in einem Fremdrating der Grad der Einschränkungen des Kindes mit Behinderung und der konkrete Hilfebedarf in einem Manual erfasst (Spitzenverbände der Pflegekassen 1997). Diese Einstufung bezieht sich nicht primär auf Diagnosen oder Krankheitsbilder, sondern auf das Ausmaß an funktionellen Einschränkungen (vgl. Hohmeier & Veldkamp 2004). Wegen der uneindeutigen diagnostischen Befundlage und wegen häufiger komorbider Beeinträchtigungen sind spezifische Diagnosen kein geeignetes Kriterium, um die Beanspruchung von Pflegepersonen zu erfassen. Bei Kindern gilt die Regelung, dass anhand einer Tabelle der Betreuungsaufwand abgezogen wird, der für ein gleichaltriges gesundes Kind zu leisten wäre. Kritiker bemängeln, dass diese Tabelle den Betreuungsbedarf von gesunden Kindern als Vergleichsmaßstab unrealistisch hoch einschätzt und den Mehraufwand systematisch unterschätzt (Wendt & Schädler 1996).
Für eine bestimmte Pflegestufen-Eingruppierung muss der Nachweis von erheblichen Kompetenzdefiziten erbracht werden, und die Begutachtung durch den MDK ist primär defizitorientiert. Dies kann den Effekt haben, die Aufmerksamkeit von Eltern allzu sehr auf das zu lenken, was ihr Kind im Vergleich zu seiner Altersgruppe alles nicht kann, statt auch seine Kompetenzen zu erkennen und zu würdigen, wie sie etwa mit dem Heidelberger Kompetenz-Inventar von Holtz etal. (1998) erfasst werden (Doege 2008). Wie später gezeigt werden soll, besteht eine gelungene Anpassung an eine Behinderung aber gerade in der Wahrnehmung selbst sehr geringer Kompetenzen und liebenswerter Seiten des Kindes.
Der vom Bundesministerium für Gesundheit eingesetzte Beirat zur Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs kommt in seinem Abschlussbericht (2009) zu der Empfehlung, im Sozialgesetzbuch XI den Pflegebedürftigkeitsbegriff so zu formulieren, dass für die Zuordnung zu Pflegestufen nicht mehr der Hilfebedarf zur Vornahme der »gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens« maßgebend sein soll, sondern der Bedarf an Hilfen, die sich den Bereichen oder Modulen Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsbzw. therapiebedingten Aufwendungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte, außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführung zuordnen lassen. Der deutsche Pflegebeirat hat deshalb vorgeschlagen, ganz auf den Faktor Zeit zu verzichten und die Zuordnung zu bestimmten Pflegegraden, die in der sozialen Pflegeversicherung eingeführt werden sollen, vom Aufwand oder Grad an personeller Hilfe durch Dritte abhängig zu machen (Bundesministerium für Gesundheit 2009).
2.9 Zusammenfassung
Unter einer Behinderung ist ein anhaltender Zustand zu verstehen, der die Funktionsweise einer Person beeinträchtigt und ihre Freiheitsgrade bei der Entfaltung ihrer Lebensgestaltung einschränkt. »Behinderung ist nicht das Merkmal eines Individuums, sondern eine Beziehung zwischen System und Umwelt. Sie ist ein Interaktionsmuster zwischen beiden« (Duss-von Werdt 1995, S.79). Behinderungen sind mehr als ein individuelles Merkmal einer Person. Sie lassen sich besser verstehen, wenn das sozial-ökologische System als Betrachtungseinheit gewählt wird, in dem sie leben – in vielen Fällen ist dies die Familie, mit ihrem sozialen Netz, dem Wohnumfeld und der weiteren Lebensumwelt.
Ein Modell für ein besseres Verständnis der Schwierigkeiten von Familien und die mit Behinderungen einhergehenden Probleme bieten die systemische Familienmedizin und das Modell familialer Anpassung an Krankheiten und Behinderungen von Rolland (McDaniel 2005, Retzlaff etal. 2001, Sundermeier & Joraschky 2003).
3 Familie und Behinderung
3.1 Einführung
Die Anfänge der Familientherapie bei körperlichen Erkrankungen reichen zurück bis in die 60er Jahre (Barth 1996, Minuchin etal. 1981). Sie entstand als Teil eines breiteren Paradigmenwandels in Medizin und Psychologie: Menschliches Verhalten, Symptome und Beschwerden werden nicht isoliert, sondern innerhalb ihres jeweiligen Entstehungskontextes verstanden. Das sozialökologische Modell von Bronfenbrenner (1979) ist eine parallel entstandene Richtung der Entwicklungspsychologie. Unter dem Einfluss des biopsychosozialen Modells von Engel (1977) wurde die systemische Familienmedizin als Behandlungsansatz für Familien und Patienten mit körperlichen Erkrankungen entwickelt (Altmeyer & Kröger 2003, Doherty etal. 1998, McDaniel etal. 1997, Simon 2000). Betrachtungsfokus der medizinischen Behandlung ist der Patient im Kontext seiner Familie und seines psychosozialen Umfeldes (Cierpka etal. 2001). Bei körperlichen und insbesondere bei chronischen Erkrankungen geht es um das System, das aus den Interaktionen einer Erkrankung mit dem Individuum, der Familie und anderen biopsychosozialen Systemen gebildet wird. Eine relevante Beschreibung muss auch Krankheit als biologisches Geschehen als einen Teilaspekt des Systems umfassen. Familiäre Faktoren können den Krankheitsverlauf günstig oder ungünstig beeinflussen und sind ein wichtiger Ansatzpunkt für therapeutische und präventive Maßnahmen, gerade bei schweren Krankheiten und Behinderungen (Rolland 1994). Sie werden nicht für die Genese von körperlichen Erkrankungen verantwortlich gemacht, biomedizinische Vorgänge und psychosoziales Geschehen beeinflussen sich vielmehr wechselseitig. Körperliche Erkrankungen machen etwas mit einer Familie, aber was Patient und Familie aus der Krankheit machen, ob sie zu einer günstigen oder weniger günstigen Konstruktion von Wirklichkeit finden, hängt unter anderem von Prozessen in der Familie ab, die einer Familientherapie zugänglich sind (Reiss & Oliveri 1980; Reiss etal. 1993). Zum maßgeblichen Betrachtungssystem zählen neben dem Patienten und seiner Familie auch die Behandler und weitere soziale Systeme, die mit beeinflussen, welche Wirklichkeitssicht die Familie von der Krankheit entwickelt. Neben biologischen Faktoren, die einer »harten« Wirklichkeitsebene zugeordnet werden können, sind besonders die Bedeutungsgebungsprozesse und die Erzählungen um das Krankheitsgeschehen herum relevant (Boss 1993, McDaniel etal. 1997b, Patterson 1993, Welter-Enderlin & Hildenbrand 1996). Die Einbeziehung von Angehörigen in die Behandlung von Patienten mit körperlichen Krankheiten kann den Krankheitsverlauf, die Lebensqualität der Patienten und der Angehörigen günstig beeinflussen (Martire etal. 2004, Retzlaff etal. 2009, Sprenkle 2002). Behinderungen und chronische Krankheiten wirken im Familiensystem als organisierendes Prinzip, das die Familienabläufe nachhaltig beeinflusst. Familien müssen ihre Rollenverteilung auf die veränderten Erfordernisse abstimmen und Verantwortungsbereiche zwischen den Familienmitgliedern neu verteilen. Jede Behinderung hat erhebliche psychosoziale Folgen für die Angehörigen; die maßgebliche Betrachtungseinheit ist deshalb nicht allein das von einer Behinderung betroffene Kind, sondern sein soziales und insbesondere sein familiäres Umfeld.
3.2 Das Modell der familiären Anpassung an Behinderung und chronische Krankheit
Dieses von Rolland (1994) entwickelte Modell geht von diagnoseübergreifenden Faktoren aus, die bei unterschiedlichen Formen von Behinderungen und Krankheiten wirksam sind und weitgehend bestimmen, mit welchen psychosozialen Anforderungen betroffene Familien konfrontiert sind.
Um den Umgang mit den Folgen einer Behinderung verstehen zu können, ist es notwendig, drei ineinander verwobene Entwicklungsfäden zu betrachten: den Krankheitsprozess, das Individuum und Zeitfaktoren, insbesondere die Lebenszyklusphase der Familie. Zentrale Faktoren für den Anpassungsprozess sind der Schweregrad der Krankheit, spezifische krankheitsbedingte Einschränkungen, die Prognose der Krankheit, Zeitphasen der Krankheitsentwicklung und Verlaufscharakteristika (Rolland 2000; vgl. Corbin 1993, Corbin & Strauss 1988). Weitere Faktoren des Modells sind die Balance zwischen Stressoren und Ressourcen der Familie, die Phase im Lebenszyklus, generationsübergreifende familiäre Vorerfahrungen mit Krankheiten und Behinderungen und die Qualität der Familienfunktionen, insbesondere Kohäsion, Flexibilität, Kommunikation, emotionaler Austausch.
Neben »harten Fakten« wie dem Schweregrad einer Behinderung haben familiäre Prozesse und familiäre Glaubenssysteme eine Schlüsselfunktion für die Anpassung. Neben dem körperlichen Krankheitsgeschehen sind auch Einstellungen, Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich der Behinderung von Bedeutung (v. Schlippe & Lob-Corzilius 1993). Die Frage, warum eine Behinderung ausgerechnet die eigene Familie getroffen hat, Vorwürfe an die Herkunftsfamilie, Ideen über Leben und Tod, Schuldgefühle, Hilflosigkeit und eine hektische Suche nach dem »richtigen« Arzt sind Beispiele für emotionale und sprachliche Prozesse, die sich aus den Überzeugungen der Familie ergeben. Welcher Sinn der Behinderung auf einer globalen Ebene angesichts der konkreten Lebenssituation der Familie und ihrer Familiengeschichten gegeben wird, hat erheblichen Einfluss darauf, wie mit den Belastungen umgegangen wird. Als zentrales Glaubenssystem sieht Rolland das Familien-Kohärenzgefühl an (Antonovsky & Sourani 1988), das in Kapitel6 behandelt wird.
Die Anforderungen, die sich aus einer Behinderung ergeben, variieren nach Rolland (1994) mit behinderungsübergreifenden Faktoren. Das von ihm entwickelte, im Folgenden beschriebene Modell von Krankheiten und Behinderungen bildet besser als die einfache medizinische Diagnose das krankheitsbezogene Erleben betroffener Familien ab.
Familiäre Anpassung an Behinderung und chronische Krankheit (Rolland 1993)
Auftreten der Behinderung
Verlaufscharakteristika
Prognose
Merkmale der Behinderung
Schweregrad
spezifische Einschränkungen
Ungewissheit
Zeitphasen der Anpassung
ZeitphaseimLebenszyklus
Familienprozesse
Familienstruktur
Konfliktmuster
Generationsübergreifende Erfahrungen im Umgang mit Krankheiten
Kumulation von Belastungsereignissen
Balance von Stressoren und Ressourcen
Krankheitsbezogene Glaubenssysteme
Auftreten der Behinderung
Krankheiten und Behinderungen können akut auftreten, etwa nach einem Unfall oder bei einer schweren Gehirnhautentzündung. In anderen Fällen manifestieren sie sich allmählich, wie im Fall von Entwicklungsbehinderungen mit unklarer Ätiologie. In beiden Fällen mag die messbare Pflegebelastung ähnlich sein, die psychischen Anforderungen sind jedoch sehr unterschiedlich. Bei einer plötzlich auftretenden Behinderung müssen sehr rasch Ressourcen aktiviert und eine Krisensituation emotional ertragen werden; bei einem schleichenden Beginn besteht dagegen über lange Zeit eine Ungewissheit, die schwer zu ertragen sein kann (vgl. auch Corbin 1993).
Verlauf der Behinderung
Bei progressiven Krankheiten wie beispielsweise einer Muskeldystrophie nehmen die Einschränkungen und Belastungen mit der Zeit zu, und es gibt bestenfalls kurzzeitige Erholungspausen. In manchen Fällen müssen sich die Angehörigen auf eine verkürzte Lebenserwartung ihres Kindes einrichten. Zu den Behinderungen mit konstantem Verlauf zählen unter anderem genetisch bedingte Behinderungen wie das Down-Syndrom. Die Belastung für die Familie ist eher konstant, mit einem gewissen Ausmaß an Stabilität und Vorhersagbarkeit, etwa bei Seh- und Hörbehinderungen oder Kindern mit einem Klumpfuß. Episodische Krankheiten und Syndrome wie beispielsweise epileptische Anfälle fordern ein rasches Wechseln zwischen normalen Zeiten und Krisen, der besondere Stress für die Familie entsteht aus der Frequenz des Wechsels von Normalität zu massiven Krisen und verlangt ein besonders hohes Maß an Flexibilität.
Prognose
Viele Behinderungen bleiben ohne Einfluss auf die Lebenserwartung, bei anderen ist diese verkürzt oder es besteht das Risiko plötzlicher Todesfälle, was neben der emotionalen Belastung für die Familien eine hohe Abhängigkeit von medizinischen Einrichtungen bedeuten kann. Bei Behinderungen mit tödlichem Verlauf geht es darum, ein Leben im Schwebezustand zu führen, mit den Belastungen intensivmedizinischer Maßnahmen und mit dem bevorstehenden Abschied zurechtzukommen und das Beste aus der verbleibenden Zeit zu machen (Kröger etal. 2000, Rolland 1990).
Merkmale der Behinderung
Der Schweregrad der Behinderung und spezifische krankheitsbedingte Einschränkungen beeinflussen nach Rolland (1994) den Umgang mit der Behinderung.
Schweregrad der Behinderung
In empirischen Untersuchungen zum Zusammenhang des Schweregrades einer Behinderung mit dem Belastungserleben werden sehr heterogene Definitionen und Kriterien verwendet. Entsprechend unterschiedlich fallen die Befunde über den Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Behinderung und dem Belastungserleben aus. Die Kombination der Einschränkungen kann einen erheblichen Unterschied machen; eine Familie mit einem Kind, das nicht laufen kann und gleichzeitig geistig behindert ist, befindet sich in einer gänzlich anderen Situation als eine Familie mit einem Kind, das neben einer Mobilitätseinschränkung zusätzlich sehbehindert ist. Intellektuelle Beeinträchtigungen wiegen besonders schwer, weil sie zusätzlich den kommunikativen Austausch beeinträchtigen und eine soziale Barriere aufbauen.
Als Schweregrad werden unter anderem der Grad an funktionalen Beeinträchtigungen, das Ausmaß intellektueller Beeinträchtigungen, die Prognose, das Vorhandensein von Verhaltens- und Kommunikationsproblemen des Kindes, Pflegeanforderungen oder die wahrgenommene Familienbelastung verstanden (Scorgie etal. 1998).
Zwischen Stresserleben und dem Schweregrad findet sich oft, aber nicht durchgängig ein positiver Zusammenhang (Dyson 1991, Folkman etal. 1979, Frey etal. 1989, Hintermair 2002, Yau & Li-Tsang 1999). Der Schweregrad der kognitiven Beeinträchtigung hatte in einer Untersuchung von Krauss Wyngaarden (1993) keinen Einfluss auf das subjektive Belastungsausmaß. Nach einer Studie von Engelbert (1999) war die Belastung von Eltern bei einem höheren Schweregrad und Mehrfachbelastungen größer, die Lebenszufriedenheit niedriger. Sowohl der Informationsgrad der Eltern als auch die Nutzung von Krankenkassen- und Behördenleistungen stiegen mit der Schwere der Behinderung.
In einer eigenen Untersuchung gingen geringere Kompetenzen (HKI) von Kindern mit geistiger Behinderung mit einer höheren Stressbelastung der Eltern einher (Aschenbrenner 2008), allerdings bestand kein linearer Zusammenhang. Bei Stärken der Familienfunktionen war die Stressbelastung geringer. Bei einem erhöhten Schweregrad und dem Vorliegen von Mehrfachbehinderungen waren die Lebensunzufriedenheit und die Belastung der Eltern ausgeprägter (Engelbert 1999). Ein hohes Maß an Behinderung führt nach Schatz (1987) zu einer Reduzierung der außerhäuslichen Aktivitäten, einem Rückzug aus dem Bekanntenkreis sowie einer Stabilisierung der Kontakte zu engeren Familienangehörigen, die größere emotionale und praktische Hilfen bieten.
Der Umgang mit einem Kind, das eine Behinderung von einem mittleren Schweregrad hat, kann schwerer fallen als bei einem Kind mit einer sehr starken Behinderung; je normaler ein Kind nach außen wirkt, desto eher können sich Eltern unrealistischen Hoffnungen hingeben (Fewell & Gelb 1983).
Spezifische Einschränkungen
Das Ausmaß der subjektiven Belastung hängt unter anderem von spezifischen Merkmalen der Behinderung ab, wie Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten, der Wahrnehmungsfunktionen, des Antriebs, der Mobilität, und dem Grad der sozialen Stigmatisierung etwa durch ein entstelltes Äußeres. Neben dem medizinisch definierten Schweregrad der Behinderung wird das Stresserleben besonders von spezifischen Entwicklungs- und Verhaltensproblemen und funktionellen Einschränkungen (Canning etal. 1996) und dem Ausmaß der erforderlichen täglichen Pflege (Breslau etal. 1982) der Kinder bestimmt. Weitere Faktoren sind die Sichtbarkeit der Behinderung, mit möglicherweise stigmatisierenden Folgen, und die Beteiligung genetischer Faktoren.
Spezifische Funktionseinschränkungen (Rolland 1994)
kognitiv
perzeptuell
motorisch
internistisch
sozial stigmatisierend
optisch entstellend