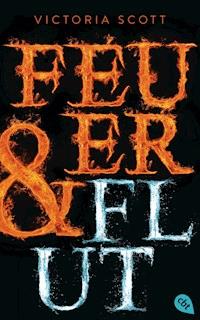
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Feuer & Flut-Romane
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubendes Wettrennen um Leben und Tod
Die 17-jährige Tella zögert keine Sekunde, als sie eine Einladung zum mysteriösen Brimstone Bleed erhält, einem tödlichen Wettrennen, das sie und andere Teilnehmer durch einen tückischen Dschungel und eine sengend heiße Wüste führt. Als Preis winkt das Heilmittel für ihren todkranken Bruder. Zur Seite steht ihr ein Pandora, ein genetisch verändertes Tier, das sie bei ihrer Aufgabe unterstützen soll. In ihrem Fall ist es ein Fuchs namens Madox, und gemeinsam kämpfen sie sich durch die erste Etappe des mörderischen Rennens. Doch es kann nur einen Sieger geben, und jeder Teilnehmer ist bereit, sein Leben für das eines geliebten Menschen aufs Spiel zu setzen. Tella muss mehr über das Brimstone Bleed erfahren, bevor ihre Zeit abläuft. Doch dann verliebt sie sich in den mysteriösen Guy – und alle freundschaftlichen Gefühle scheinen dahin, als es auf die Zielgerade zugeht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Victoria Scott
Feuer & Flut
Aus dem Englischen von Michaela Link
Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage 2015
© 2014 by Victoria Scott
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem
Titel »Fire & Flood« bei Scholastic Press, an imprint of Scholastic Inc., New York
© 2015 für die deutschsprachige Ausgabe by cbt Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück, 30287 Garbsen.
Aus dem Englischen von Michaela Link
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Shutterstock
MG · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-13686-4
www.cbt-buecher.de
Für meine Schwester, die wusste, dass das hier das Eine war
DAS ANGEBOT
Kapitel 1
Wenn mein Haar noch krisseliger wird, schneide ich es raspelkurz.
Oder ich zünde es an.
Was auch immer einfacher ist.
Ich blicke auf mein Spiegelbild im Teich und fahre mir durch den Fluch meiner Existenz. Für einen Moment scheine ich meine kastanienbraunen Locken gebändigt zu haben. Aber als ich die Arme sinken lasse, kräuseln sich die Locken schlimmer als vorher. Ich zeige mit einem Finger, dem eine Maniküre guttäte, auf das Wasser. »Ich hasse dein Gesicht.«
»Tella«, ruft meine Mutter in diesem Moment, »was siehst du dir da an?«
Ich wirble zu ihr herum und fasse mit meiner Hand in mein Haar. Beweisstück A.
»Es ist schön«, sagt sie.
»Das hast du mir angetan«, erwidere ich.
»Nein, die Locken hast du von deinem Vater.«
»Aber du warst es, die mich mitten in die Pampa, Montana, geschleppt hat, um in einem kranken Experiment zu testen, wie furchtbar ich aussehen kann.«
Mom lehnt sich an den Türrahmen unseres Schrotthauses und lächelt beinahe. »Wir sind seit fast einem Jahr hier. Wann akzeptierst du, dass dies unser Zuhause ist?«
Ich gehe auf sie zu und balle meine Hand zur Faust. »Ich kämpfe bis zum Tod.«
Ein Schatten gleitet über die tiefen Falten in ihrem Gesicht, und ich bedauere sofort, das Thema angesprochen zu haben. »Tut mir leid«, sage ich. »Du weißt, dass ich nicht …«
»Ich weiß«, unterbricht sie mich.
Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und küsse Mom auf die Wange, dann schiebe ich mich an ihr vorbei ins Haus. Mein Dad sitzt im Wohnzimmer und schaukelt auf einem Holzstuhl, als sei er zweihundertsechsundfünfzig Jahre alt. In Wirklichkeit ist er ein paar Jahre jünger.
»Hey, Pa«, sage ich.
»Hey, Kind«, antwortet er.
Seit meine Mom darauf bestanden hat, Boston zu verlassen und ins Niemandsland zu ziehen, nenne ich Dad Pa. Es erinnert mich an diese alten Schwarzweißfilme, in denen die Töchter grauenvolle Kleider tragen und sich gegenseitig die Haare flechten. Er ist kein Fan meines neuen Namens für ihn, aber mit der Zeit hat er sein Schicksal akzeptiert. Wahrscheinlich hatte er erwartet, dass ich deutlich mehr rebellieren würde wegen unseres Umzugs ins Fegefeuer.
»Was machen wir heute Abend?«, frage ich und setze mich auf den Boden. »Abendessen in einem schicken Restaurant? Theater in der Stadt?«
Dads Mundwinkel gehen nach unten. Er ist enttäuscht.
Damit sind wir schon zu zweit.
»Sei so gut und tu so, als wärst du glücklich«, antwortet er. »Das wäre schon verdammt unterhaltsam.«
»Ausdrucksweise«, sage ich und schnalze missbilligend mit der Zunge.
Er winkt ab und tut so, als sei er der Mann im Haus und könne sagen, was immer er verdammt noch mal wolle. Ich lache auf, als er kurz darauf Mom einen verstohlenen Blick zuwirft, um zu sehen, ob sie es gehört hat.
»Ich gehe in mein Zimmer«, verkünde ich.
Dad starrt wieder nach draußen, als sei er komatös. Ich weiß, dass ich genau das Gleiche tun werde, wenn ich in meinem Zimmer bin, aber zumindest bin ich dabei ungestört.
Die Dielen knarren, als ich durch den schmalen Flur zu meinem persönlichen Kerker gehe. Einige Schritte vor meinem Zimmer bleibe ich vor einer offenen Tür stehen. Ich kann nicht anders und nähere mich dem Bett, das in dem Raum steht. Dann beuge ich mich über die schlafende Gestalt und prüfe, ob sie noch atmet. Das ist mein bescheuertes Ritual.
»Ich bin nicht tot.«
Ich zucke zusammen, als die Stimme meines großen Bruders mich erschreckt.
»Schade«, antworte ich. »Ich hatte gehofft, dass du abkratzt, damit ich das größere Zimmer kriege. Du nimmst nämlich viel mehr Platz ein, als dir zusteht, weißt du.«
Er dreht sich herum und grinst mich an. »Ich wiege hundert Pfund.«
»Eben.«
Es bringt mich um, Cody krank zu sehen. Und es ist kein tolles Gefühl, mit ihm zu streiten, wenn ich in Wirklichkeit einfach nur heulen und ihn anflehen will, nicht zu sterben. Aber er mag unsere Wortgefechte. Sagt, sie geben ihm das Gefühl, normal zu sein. Also zicken wir uns an.
»Du siehst alt aus«, bemerkt Cody.
»Ich bin sechzehn.«
»Fast achtzig.« Er zeigt auf mein Gesicht. »Du hast Falten.«
Ich renne zum Spiegel, der über seiner Kommode hängt, und schaue nach. Vom Bett aus höre ich Cody lachen und dann husten. »Du bist so was von eitel«, sagt er, während seine Brust sich krampfhaft hebt und senkt.
»Vollidiot.« Ich gehe zu ihm und ziehe ihm die schwere Decke bis ans Kinn. »Mum will wissen, wie du dich heute fühlst«, lüge ich.
»Besser«, erwidert er. Ebenfalls eine Lüge.
Ich nicke und drehe mich um, um zu gehen.
»Sag ihr, sie soll aufhören, sich Sorgen zu machen«, fährt er fort.
»Ich bezweifle, dass sie sich wirklich für dich interessiert.«
Ich kann ihn immer noch lachen hören, als ich mein Zimmer erreiche, die Tür hinter mir schließe und auf die Knie sinke. Ich ringe nach Luft. Es wird schlimmer mit Cody. Ich kann es an der Art hören, wie seine Worte zittern. Als koste ihn das Sprechen alle Kraft, die er hat. Am Anfang war es nur der Gewichtsverlust. Dann kamen nächtliche Schweißausbrüche und zitternde Hände. Danach ging der Spaß erst richtig los: Krämpfe. Haarausfall. Undeutlich gesprochene Sätze – das begann am Mittwoch und endete am Freitag mit einem Koma. Drei Tage später kam er wieder zu sich. Mom sagte, weil er ein Fußballspiel nicht verpassen wollte. Nicht, dass er noch spielte. Das hatte sich schon lange vorher erledigt.
Jetzt kann er nur noch so tun als ob. So tun, als sei er der Bruder, der, um meine Ehre zu verteidigen, einem anderen Jungen einen rechten Haken verpasst hat. So tun, als sei er der Sohn, der in der Endzone einen Jig tanzte, den sein Dad ihm beigebracht hat. Er ist immer noch der Typ, der keine Angst davor hat, auf eine Grußkarte mehr als seinen Namen zu schreiben. Immer noch der Typ, der Backsteinhäuser liebt und Autos, die schnurren wie ein Kätzchen, und der sich Cheez Whiz direkt aus der Dose in den Mund sprüht.
Er ist immer noch mein Bruder.
Er ist überhaupt nicht mein Bruder.
Ich weiß nicht, warum Mom dachte, dieser Ort würde helfen. Ein Dutzend Ärzte konnten nicht herausfinden, was er hat, doch sie denkt, Montanas »frische Luft« würde etwas bringen. Der Ausdruck in ihren Augen, während wir den Umzugswagen gepackt haben, verfolgt mich immer noch. Als warte sie auf etwas.
Oder laufe vor etwas davon.
Ich stehe auf und gehe zum Fenster. Draußen kann ich Gelbkopf-Schwarzstärlinge rufen hören. In Boston habe ich selten so was wie Vögel bemerkt. In Boston haben wir in einem Sandsteinhaus gelebt, das nicht aus Sandstein war, und zwei Häuser weiter haben Freunde von mir gewohnt. Unsere Familie hat drei Stockwerke mit superviel Platz gehabt, und wir konnten zu Fuß ins Restaurant gehen.
Hier gibt es Felsen. Und einen Bach ohne Fische, der an unserem Haus vorbeifließt. Der Himmel ist frei von Dachgiebeln und vollgestopft mit Wattewolken. Es gibt keine Nachbarn. Keine Mädchen in meinem Alter, mit denen ich über die neuesten Trends reden kann. Eine einsame Straße führt von unserem Haus in die Stadt. Wenn ich sie betrachte, möchte ich wie ein Vagabund mit einem Bündel an einem Stock über der Schulter darauf entlanghinken.
Unser Haus ist von hohen Kiefern umgeben, als sei es ihr Job, uns vor der Welt zu verstecken. Ich stelle mir vor, kettensägenschwingend mit einer Eishockeymaske vor dem Gesicht auf sie zuzurennen. Sie würden wahrscheinlich ihre Wurzeln aus dem Boden ziehen und mich wie einen Käfer zerquetschen. Mich unter ihren knorrigen Wurzeln begraben.
So möchte ich sterben, wenn meine Zeit gekommen ist.
Mit einem Knall.
Ich schiebe das Fenster hoch und strecke den Kopf hinaus. Was würde ich nicht dafür tun, meine Freunde wiederzusehen. Eine Maniküre und Pediküre machen zu lassen und zum Friseur zu gehen. Oder einen griechischen Salat zu essen. Oh mein verdammter Gott, Fetakäse und Kalamata-Oliven. Ich suhle mich noch einen Moment in Selbstmitleid, bis mir mein Bruder einfällt. Dann verbringe ich genau drei Minuten damit, mich wie der weltgrößte Arsch zu fühlen.
Wir sind seinetwegen hier. Und ich würde alles darum geben, meinen Bruder aus dem Bett steigen und auf der Straße tanzen zu sehen wie vor zwei Jahren an Halloween. Oder ihn nur für ein paar Minuten aufrecht sitzen zu sehen, ohne dass er hustet.
Ich mache einen Schmollmund, pruste und drehe mich wie eine Ballerina im Kreis. Ich drehe mich immer schneller, bis alles verschwimmt. Als ich anhalte, rauscht mein Zimmer immer noch an mir vorbei und ich lache wie eine Irre darüber, dass ich mittlerweile so etwas unterhaltsam finde.
Schließlich hört mein Zimmer auf, sich zu drehen, und mein Blick fällt aufs Bett.
Auf meiner weißen Tagesdecke liegt eine kleine, blaue Schachtel.
Kapitel 2
Mein Kopf zuckt nach rechts und links, als ich nach jemandem in meinem Zimmer suche. Aber natürlich ist niemand da. Dann begreife ich, was los ist. Mom und Dad wissen, wie schwer dieser Umzug für mich war, und jetzt versuchen sie, mein Glück zu kaufen. Oder zumindest eine Pause von meinem Gejammer.
Bin ich wirklich so einfach gestrickt?
Bitte! Hätten sie kleine blaue Schachteln hinten an den Umzugswagen gebunden, wäre ich ihnen nachgejagt, bis meine Füße geblutet hätten.
Ich fliege förmlich durch mein Zimmer und springe aufs Bett, ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Ich habe die letzten neun Monate ohne Internet oder Handy verbracht, und in diesem Moment fühle ich mich wie ein wilder Hund, der seine Beute beäugt.
Ich halte mir die Schachtel nah an die Lippen und flüstere ihr zu: »Du gehörst mir, Süße. Ganz allein mir.«
Ich will sie gerade aufreißen, als ich mich bremse. Dieser Moment, in dem ich mich frage, was darin ist, wird so schnell vorbei sein. Und sobald er vorüber ist, habe ich nichts, worauf ich mich freuen kann. Vielleicht sollte ich die Befriedigung meiner Neugier aufschieben, damit warten, bis ich es nicht mehr ertragen kann. Ich könnte tagelang glücklich sein, nur weil ich weiß, dass ich etwas habe, worauf ich mich freuen kann.
Ich schüttele die Schachtel sanft.
Leg die Schachtel hin, Tella, befehle ich mir.
»Vergiss es«, sage ich laut.
Ich lege die Hand auf den Deckel und nehme ihn ab. Und blicke auf ein winziges Kissen. Ich stelle mir alle möglichen Miniaturtiere vor, die so ein Kissen in ihren Miniaturbetten benutzen. Aber das ist blöd, denn wie würden sie jemals einen passenden Kissenbezug finden?
Ich packe das Kissen mit den Fingerspitzen, und als ich es hochhebe, bin ich überrascht über das, was ich darunter schlafen sehe. Ich schnippe das Kissen auf mein Bett und greife in die Schachtel nach einem kleinen, weißen Gerät. Es ist nicht größer als ein Fünf-Cent-Stück und total komisch verbogen. Es sieht aus … es sieht aus wie ein Hörgerät.
Ich rümpfe die Nase, während ich es in der Hand drehe und wende. Dann kreische ich fast vor Aufregung los, als ich auf der anderen Seite ein rotes Blinklicht sehe. Blinklichter sind cool. Sie sind ein Zeichen für Technologie und Fortschritt und vielleicht sogar eine Verbindung zur Außenwelt – zu meinen Freunden. Oder vielleicht ist es Musik. Wer weiß, was für abgefahrenes Zeug im letzten Jahr auf den Markt gekommen ist? Ich wette, dieses Baby speichert ungefähr eine Million Songs. Und ich werde sie mir alle anhören. Jeden. Einzelnen. Song.
Während ich mir schwöre, mich echt und halbherzig bei meinen Eltern zu entschuldigen, und hoffe, dass ich gleich Lady Gagas neuesten Hit hören kann, stecke ich mir das Gerät ins Ohr. Halleluja, es passt! Ich könnte nicht glücklicher sein, wenn mein Bostoner Objekt der Begierde mir gerade Diamanten geschenkt hätte.
Ich fummele eine Sekunde lang herum, bevor meine Finger auf dem roten, blinkenden Knopf landen. Uuuuuund … ab gehts, Baby.
Sobald ich auf den Knopf gedrückt habe, höre ich ein Klicken. Das Geräusch hält mehrere Sekunden an. So lange, dass ich mich schon völlig fertig fühle. Aber dann verwandelt sich das Klicken in ein Rauschen, als schalte sich jemand an einem Funkgerät zu.
Ich springe vom Bett auf, gehe durch den Raum und neige den Kopf, als suche ich nach einem Signal. Ich komme mir vor wie ein Idiot, und doch ist es das Tollste, was ich seit einer Ewigkeit erlebt habe. Ich zucke zusammen, als ich eine Frauenstimme höre. Sie ist klar und deutlich. Als hätte diese Dame noch nie in ihrem Leben ein Wort falsch ausgesprochen. Voller Konzentration starre ich auf den Boden. Und lausche.
»Wenn Sie diese Nachricht hören, sind Sie eingeladen, als Kandidat am Brimstone Bleed teilzunehmen. Alle Kandidaten müssen sich binnen achtundvierzig Stunden melden, um ihre Pandora-Gefährten auszuwählen. Wenn Sie nicht…«
»Tella?« Mein Dad. »Was machst du da?«
Ich wirbele herum und vollführe einen kleinen Freudentanz. »Was ist das für ein Ding?« Ich zeige auf das Gerät in meinem Ohr. »Wo habt ihr es gekauft? Das ist der absolute Wahnsinn.«
»Was gekauft?« Das Gesicht meines Dads wechselt von verwirrt zu … alarmiert. Einen Moment fühle ich mich wie ein kleines Kind. Als würde ich jede Sekunde in die Ecke gestellt und müsse da vor Wut vor mich hin kochen, während Cody mit seiner Freiheit angibt wie damals, als wir vier und sieben Jahre alt waren. »Was hast du da im Ohr?« Mein Dad klingt merkwürdig. Seine Worte sind genau gewählt, er spricht langsam und deutlich. »Gib es her.«
»Was? Warum?«, frage ich.
Dad streckt die Hand aus. »Sofort.«
Sein Ton lässt keine Widerrede zu. Mein Dad ist ein ziemlich kleiner Mann, aber in diesem Moment kommt er mir riesengroß vor. Ich ziehe das Gerät aus dem Ohr und lasse es in seine ausgestreckte Hand fallen. Als er die Faust darum schließt, bin ich mir sicher, dass mein neues Spielzeug für immer konfisziert ist.
»Warum habt ihr es mir geschenkt, wenn ihr es mir sofort wieder wegnehmt?«, frage ich.
Dad sieht mich an, als würde er gleich etwas Tiefgründiges sagen, aber dann murmelt er: »Deine Mom braucht Hilfe in der Küche.« Er verlässt das Zimmer, meine einzige Chance auf ein bisschen Spaß innerhalb des nächsten Äons in seiner Tasche.
Ich halte mich am Türrahmen fest und lasse den Kopf hängen. Der Ausraster meines Dads bedeutet, dass nicht er das funkende Hörgerät in mein Zimmer gelegt hat, was die Frage aufwirft, wer es war. Dann dämmert es mir. Als ich an Codys Zimmer vorbeikomme, brülle ich: »Netter Trick, du Arsch.« Noch während ich das rufe, stelle ich mir vor, was wäre, wenn er es nicht gewesen ist. Mir passiert nie etwas Aufregendes. Niemals. Aber das hindert mich nicht daran, Tagträumen nachzuhängen.
In meinem Kopf existiert eine Welt voller Möglichkeiten. Jetzt gerade stelle ich mir vor, dass mich der Anführer eines mysteriösen Geheimkultes angeworben hat, um am Brimstone Blood teilzunehmen. Oder Bleed. Oder wie auch immer Cody es genannt hat. So oder so, es klingt irgendwie gruselig. Die Gemeinheiten seiner kleinen Schwester gegenüber sind offenbar noch fieser geworden. Und ich finde es so richtig gemein, mir falsche Hoffnungen zu machen.
Die eigentliche Frage ist, wie er die Stimme dieser Frau aufgezeichnet hat. Anscheinend hat der Knabe mir etwas verheimlicht. Mom hat darauf bestanden, dass Cody sich entspannt, nachdem wir hierhergezogen waren, daher das Technikverbot, aber er muss trotzdem etwas versteckt haben. Einen Laptop. Ein Smartphone. Irgendetwas.
Beim bloßen Gedanken daran bildet sich Schaum vor meinem Mund.
Ich frage mich flüchtig, ob ich vielleicht Tollwut bekomme.
Mom ist nicht in der Küche, aber ich sehe sie im Schlafzimmer, wo sie leise mit Dad spricht.
»Du hast es versprochen!«, zischt mein Dad. »Du hast versprochen, dass sie sie hier nicht finden würden.«
»Es tut mir leid. Jetzt ist es zu spät.«
»Noch nicht, es ist noch nicht …«
Als meine Mom mich sieht, bringt sie ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen.
»Tella«, sagt sie, »ich möchte, dass du das Abendessen machst und dann zu uns in Codys Zimmer kommst.« Damit schließt sie die Tür.
»Boah, krass unhöflich«, murmele ich, hauptsächlich zu mir selbst. Einen Moment frage ich mich, worüber meine Eltern geredet haben. Ich kann nicht behaupten, dass es mich nicht verunsichert hat, was ich gehört habe, aber wenn man mit einem chronisch kranken Bruder lebt, gewöhnt man sich daran, seine Eltern hinter geschlossenen Türen jede Menge schrägen Mist sagen zu hören. Also tue ich ihre Gereiztheit ab und richte meine Aufmerksamkeit auf meinen Marschbefehl.
Heute ist Sunday-Funday, den mein Dad erfunden hat und der darin besteht, dass wir in Codys Zimmer Spaghetti essen. Wir sitzen alle mit Papptellern um sein Bett und niemand darf etwas Negatives sagen. Tatsächlich bedeutet es, dass sich alle alles Schreckliche für Montag aufheben, was für einen echt positiven Start in die Woche sorgt.
Ich gieße die Spaghetti ab und gebe eine Dose Tomatensauce hinzu. Dann küsse ich mir die Fingerspitzen wie ein italienischer Fernsehkoch. Ich nehme den übergroßen Edelstahltopf, fülle vier Teller mit Nudeln, bestreue sie mit Parmesan aus der Tüte und lege eine Scheibe aufgebackenes Knoblauchbrot dazu.
Alles, was wir essen, wird mit viel Liebe zubereitet und ist so voll mit Konservierungsstoffen wie nur menschenmöglich. Da wir dreißig Meilen vom nächsten Lebensmittelladen entfernt wohnen, ist dafür gesorgt, dass wir nie wieder etwas Frisches essen werden, es sei denn, wir bauen es selbst an, und das wird so was von nicht passieren. Meine Eltern haben ihre Brieftaschen schon immer körperlicher Arbeit vorgezogen; noch ein Grund, warum wir nicht aus der Stadt hätten wegziehen dürfen.
Wie eine Kellnerin, die ein gutes Trinkgeld bekommen hat, trage ich ein Tablett mit Tellern und Gläsern in Codys Zimmer. Ich stütze sogar eine Hand in die Hüfte, damit ich es an unseren Möbeln, die für dieses Haus zu teuer sind, vorbeibalancieren kann. Als ich in den Flur komme, höre ich Mom und Dad hastig mit Cody tuscheln. Ich bleibe stehen und lausche, aber die Dielenbretter wählen genau diesen Moment, um unter meinen Schuhen zu knarren.
Alle verstummen.
»Hast du die Spaghetti?«, fragt mein Dad. Dabei klingt er, als grabe er nach Informationen, die nichts mit dem Abendessen zu tun haben.
Ich biege mit meinem bis dahin elegantesten Schwung um die Ecke. Er ist so gut, dass ich das Tablett beinahe ganz fallen lasse. Trotzdem, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem schwungvollen Durchschlängeln und der Vermeidung von Bodenkontakt der Spaghetti würde ich das Erstere wählen. »Das Abendessen ist serviert, edle Gäste.« Ich halte das Tablett fest und verteile die Teller an meine Familie. Als ich Dad die Nudeln gebe, halte ich kurz inne und schaue ihm prüfend ins Gesicht. Ich weiß, dass es Cody war, der die Schachtel in mein Zimmer gelegt hat, aber es macht mir zu schaffen, dass mein Dad sich deswegen so aufgeführt hat. Er hasst es, wenn Cody und ich uns zum Spaß anzicken, und ich schätze, er war einfach nicht in der Stimmung für eine weitere Runde. Trotzdem will ich wissen, dass er nicht mehr sauer ist. Und vor allem möchte ich dieses Gerät aus seiner Tasche zurückhaben. Streich oder nicht, es ist mein Rettungsanker im Kampf gegen Langeweile und Vereinsamung.
Beim Essen redet Mom bis zum Erbrechen darüber, was morgen im Unterricht ansteht. Ich will sie daran erinnern, dass Sunday-Funday Gespräche über negative Themen verbietet, aber ich halte den Mund. Wir haben August, was zwei Sachen bedeutet: A) Es beginnt ein neues Semester im Haushalt der Holloways, und B) Mom ist auf einer chronischen Übereifer-Diät. Und vielleicht auch auf Crack.
Sobald wir hierhergezogen waren, hat Mom angefangen, Cody und mich zu Hause zu unterrichten. Es war ein herber Schlag für mein soziales Leben, nur noch übertroffen von den Worten: Stell dir vor! Wir ziehen nach Montana. Ich hätte nie gedacht, dass meine Mutter der Typ ist, der in die Wildnis zieht und ihren Kindern Hausunterricht gibt, aber es stellte sich heraus, dass sie voller angenehmer Überraschungen steckt. Ich gebe zu, in puncto Lehrerin ist sie die Beste, die ich je hatte. Vielleicht weil sie jedes Mal strahlt, wenn ich eine richtige Antwort gebe, oder weil sie tanzt, wenn wir unsere Prüfungen mit Auszeichnung bestehen.
Cody sitzt im Bett und nickt, während Mom über Unterrichtspläne redet. Irgendwie klingt sie heute Abend zu eifrig, als gebe sie sich zu große Mühe, uns alle zum Lächeln zu bringen. Ich schaue meinen Dad an und sehe, dass sie zumindest bei einem von uns gescheitert ist. Die Gabel meines Dads dreht sich in einem endlosen Kreis und verwandelt mein Spaghetti-Meisterwerk in rötlich-orangefarbenen Matsch.
Ich kann den Ausdruck auf seinem Gesicht nicht länger ertragen. »Dad, bist du okay?«
Er reißt den Kopf hoch, aber es dauert eine Weile, bis sein Mund den Ansatz eines Lächelns zeigt. »Ja, alles bestens.«
Bestens? Jetzt weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Unwillkürlich blicke ich zu seiner Tasche, in der er das Gerät verstaut hat. Er legt eine Hand darüber, und unsere Blicke begegnen sich.
»Lass uns spülen gehen, Andrea.« Dad löst den Blick von mir und richtet ihn auf Mom. Sie könnten heute Abend nicht unterschiedlicher sein: Dad in seiner düsteren Nervosität und Mom mit ihrem gekünstelten Lächeln.
Meine Mom nickt und sammelt unsere Pappteller ein. Dann verlässt sie das Zimmer, nachdem sie meinem Dad einen letzten Blick zugeworfen hat. Diese schrägen Schwingungen bringen mich um, daher öffne ich den Mund, um etwas zu sagen, irgendwas. »Netter Streich, Cody. Zu blöd, dass Dad deine Pointe gekillt hat.« Es ist nicht gerade super, aber ich habe das Gefühl, dass die schlechte Laune meines Dads mit der blauen Schachtel begonnen hat. Warum es nicht ansprechen, solange Dad noch im Zimmer ist?
Cody ist gerade dabei, sich im Bett höher aufzusetzen, aber er hält inne, als er hört, was ich gesagt habe. Er senkt den Blick und krallt die Faust in die Decke. Sein Gesicht wirkt beinahe gequält. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Was, wenn Cody diese Schachtel nicht in mein Zimmer gelegt hat? Aber wenn er es nicht war, wer dann? Dad ist zu sauer, er kann es nicht gewesen sein, und Mom würde so etwas nicht machen. Zumindest glaube ich das. Sie hat mich im letzten Jahr jedoch zu oft überrascht, als dass ich mir da sicher sein könnte.
Der Schauer, der meinen Rücken hinabläuft, verwandelt sich allmählich in eine Gänsehaut. Aber genau in dem Moment hebt Cody den Kopf und grinst. »Ich musste mein Hirn ganz schön anstrengen, kleine Schwester«, sagt er und tippt sich an die Schläfe. Dann schüttelt er den Kopf, als sei ich eine große Enttäuschung. »Hätte so toll sein können.«
Ich seufze vor Erleichterung. Ein Abenteuer klingt viel verlockender, wenn es sich sicher in meinem Kopf abspielt. Kurz dachte ich, er würde vielleicht sagen: »Wovon redest du?« Und dann hätte ich überlegen müssen, ob ich wirklich gewollt hatte, dass etwas Aufregendes passiert, oder ob ich davon nur hatte träumen wollen.
Ich verdrehe die Augen und sage: »Total lahm. Das war echt so lahm.«
Ich gehe zur Tür, überrascht, dass Dad geschwiegen hat. Wenn er wirklich deshalb sauer ist, warum hat er dann nichts gesagt? Als ich hinausgehe, um Mom in der Küche zu helfen, schaue ich noch einmal über die Schulter. Ich sehe, wie Dad Cody zunickt. Es ist nur ein Nicken, nichts Besonderes. Aber irgendetwas ist da. Sie wirken erleichtert, und es ist ein äußerst beunruhigendes Gefühl – nicht zu wissen, worüber sie sich solche Sorgen gemacht haben.
Während ich durch den Flur in Richtung Küche gehe, wo meine Mutter vor sich hin summt, kann ich nicht aufhören, an das Gerät zu denken. Was es wirklich ist. Wie Cody es in die Finger bekommen hat.
Ob es überhaupt Cody war.
Sein Gesichtsausdruck, als Dad genickt hat, lässt mich alles hinterfragen. Ich stelle mein Glas auf die Küchentheke, und obwohl ich weiß, dass meine Mom mit mir redet, höre ich kein einziges Wort. Ich kann nur noch daran denken, dass ich das kleine weiße Gerät zurückbekommen muss. Und zwar heute Abend.
Kapitel 3
Diese blaue Schachtel war für mich bestimmt, und mein Dad hat sie gestohlen. Selbst wenn Cody sie nicht in mein Zimmer geschmuggelt hat, woran ich mittlerweile ernsthafte Zweifel hege, hatte mein Dad kein Recht, sie mir wegzunehmen. Wie alt bin ich – fünf?
Ich sitze mit meiner Mom und meinem Dad im Wohnzimmer und starre auf das Buch in meiner Hand. Ich lese nicht – ich denke mir einen komplizierten Rettungsplan für mein Gerät aus. Bisher habe ich in puncto Rettung noch nicht viel vorzuweisen, aber mir sind jede Menge Dinge eingefallen, die als kompliziert durchgehen können.
Das Einzige, was ich höre – und das mich in den Wahnsinn treibt –, ist das Geräusch, mit dem meine Mom und mein Dad die Seiten ihrer eigenen Bücher umblättern. Gott bewahre, dass wir einen Fernseher für dieses Haus kaufen. Wir würden doch keine Verbindung zum Leben jenseits des Hollowayschen Haushalts aufnehmen wollen. Ich schwöre, in der Sekunde, in der Cody krank wurde, haben meine Eltern jedes Gefühl für die Realität verloren.
Aber im Moment spielt das alles keine Rolle. In Wahrheit bin ich sauer auf meine Eltern, weil sie eigentlich im Bett sein sollten. Schlafend. Damit sie nicht mitbekommen, wie ich durchs Haus schleiche und nach meinem Gerät suche. Und ich werde schneller schleichen, als man gucken kann.
Ich sehe auf die Uhr. Es ist zehn am Abend, und meine Eltern wirken, als könnten sie einen Marathon laufen. Ich starre sie an, während sie auf ihre Bücher starren, und möchte sie zwingen, müde zu werden. Nach fünf Minuten mentaler Kriegsführung gebe ich auf. Aber genau in dem Moment gähnt mein Dad. Der Sieg ist mein!
»Ich denke, ich haue mich hin«, sagt er.
»Ich auch«, erwidert meine Mom, ohne auch nur aufzuschauen. Sie rührt sich nicht.
In der Hoffnung, dass sie sich der Mehrheit anschließt, recke ich die Arme über dem Kopf und verkünde: »Ich bin erledigt. Ich glaube, ich gehe auch schlafen.«
Das funktioniert. Sie streicht mit dem Finger über die Seite. Das ist das Zeichen, dass sie nach einer Stelle sucht, an der sie aufhört. Sie greift nach dem zerfledderten Lesezeichen, das ich ihr zum Muttertag geschenkt habe, als ich ungefähr neun war, und schiebt es ins Buch.
»Gehst du auch ins Bett?«, frage ich.
Sie schaut zu mir auf und lächelt, aber das Lächeln erreicht ihre Augen nicht ganz. Plötzlich frage ich mich, ob meine Eltern nicht genau wie ich nur vorgegeben haben zu lesen.
»Jepp«, ist alles, was sie sagt. Damit sind wir in einer Pattsituation: Ich warte darauf, dass sie aufsteht, und sie wartet auf … was?
»Okay«, gebe ich nach. »Ich gehe dann mal.« Ich stehe auf, werfe das Buch, in dem ich nicht gelesen habe, aufs Sofa und gehe in mein Zimmer. Unmittelbar bevor ich den Raum verlasse, drehe ich mich noch einmal um. Sie sieht mir nach, also winke ich kurz. Mom winkt zurück, aber ihr Lächeln ist längst verschwunden.
Hier stimmt definitiv etwas nicht.
Entweder das, oder meine Familie bewirbt sich für die Hauptrollen in einer Neuverfilmung von Shining.
Auf dem Weg in mein Zimmer mache ich an Codys Tür halt. Ich möchte weitergehen, möchte ausnahmsweise einmal so tun, als sei er okay und alles wieder wie früher. Aber ich kann nicht. Also tappe ich auf Zehenspitzen in sein Zimmer und beuge mich über sein Bett. Jetzt benehme ich mich total gruselig.
Sobald ich mich davon überzeugt habe, dass mein Bruder noch atmet, gehe ich in mein eigenes Zimmer und werfe mich aufs Bett. Eine Stunde. So lange warte ich, bevor ich jeden Winkel dieses verdammten Hauses durchsuche. Dann gehört der Inhalt dieser geheimnisvollen blauen Schachtel wieder mir.
Vier Stunden später wache ich auf.
So viel zur Operation Heimlich.
Ich stemme mich vom Bett hoch, reibe mir über das Gesicht und mache mir Vorwürfe, weil ich eingeschlafen bin. Ich bin der größte Schwächling auf dem Planeten Erde. Nachdem ich die Schuhe abgestreift habe, um so wenig Lärm wie möglich zu machen, stelle ich in Gedanken eine Liste auf, wo ich zuerst nachsehen will: im Flurschrank, im Badezimmer, vielleicht in der Küche. Die Küche. Ich frage mich, ob noch ein Rest Kirschkäsekuchen im Kühlschrank ist. Nein, halt. Erst Gerät finden. Dann Käsekuchen.
Gerade als ich meine Tür öffnen will, stutze ich.
Da ist Rauch. Viel Rauch. Und er ist draußen vor meinem Fenster.
Ich durchquere das Zimmer und behalte den Rauch im Auge, während meine Kopfhaut nervös kribbelt. Ich beginne mir auszumalen, dass unser Haus in Flammen steht. Oder eins der Autos meiner Eltern. Wie soll uns hier draußen jemand finden? Ich möchte gern glauben, dass es jemandem auffallen würde, irgendwann. Wahrscheinlich einem Feuerwehrmann, der zufällig in meinem Alter ist und wie ein griechischer Gott aussieht, eine Axt über der linken Schulter. Das Feuer würde hinter ihm wüten, während er uns alle rettet, und mich würde er dabei beruhigend anlächeln, und natürlich hätte er Grübchen.
Ich schiebe mein Fenster hoch und der Geruch von brennendem Holz erfüllt den Raum. Obwohl ich Angst habe, dass etwas Schreckliches passiert ist, kann ich den Duft genießen. Er erinnert mich an unser Zuhause in Boston, an kalte Abende, an denen Dad den Kamin angezündet hat und wir heiße Schokolade mit pastellfarbenen Marshmallows getrunken haben.
Der Rauch weht von links nach rechts und lässt mich vermuten, dass das Feuer vor dem Haus ist. Ich will gerade meine Eltern wecken, als ich etwas Rotes und Schwarzes aufblitzen sehe. Dieses Hemd würde ich überall erkennen. Es ist das karierte Flanellhemd, das mein Dad trägt, wenn er mit Onkel Wade auf die Jagd geht.
Was macht mein Dad um zwei Uhr morgens vor unserem Haus?
Ich überlege, zur Vordertür zu gehen, um ihn zu fragen. Es ist eine vernünftige Frage. Niemand möchte mitten in der Nacht aufwachen und feststellen, dass sein Dad unter die Pyromanen gegangen ist. Aber irgendetwas hält mich zurück. Vielleicht liegt es an der Art, wie er sich verhalten hat, seit er dieses Gerät gesehen hat, oder wie er vor dem Abendessen mit meiner Mom getuschelt hat, oder wie er Cody zugenickt hat, als würden die beiden ein großes Geheimnis haben. Wie dem auch sei, ich beschließe, mich stattdessen an ihn heranzuschleichen.
Während ich aus dem Fenster krieche, denke ich darüber nach, wie lächerlich ich aussehen muss. Dass Hannah, meine beste Freundin in Boston, wie eine Irre lachen würde, wenn sie mich so sehen könnte. Der Gedanke an ihr Gelächter lässt mich ebenfalls lachen, und ich muss mir den Mund zuhalten, als ich an der Seite des Hauses hinabspringe. Heute Nachmittag war ich zu Tode gelangweilt, und jetzt benehme ich mich wie eine verdammte CIA-Agentin.
Ich verliere hier draußen wirklich den Verstand.
Ich schleiche an der Wand entlang zur Vorderseite des Hauses und halte den Atem an, als ich um die Ecke spähe. Mein Dad steht vor einem Feuer und starrt in die Flammen. Er sieht aus wie ein Meuchelmörder, mit total verrücktem Gesichtsausdruck. Das Feuer ist viel weiter von unserem Haus entfernt, als ich ursprünglich gedacht habe, was mich noch nervöser macht. Es wirkt, als wolle er etwas vertuschen. Aber die Ausführung ist ziemlich ungeschickt.
Mein Dad fährt sich mit der Hand durch sein dichtes, gelocktes Haar und seufzt. Dann öffnet er die andere Hand und betrachtet etwas. Ich kneife die Augen zusammen und versuche zu erkennen, was er da hat, aber ich kann es nicht sehen. Was immer er in der Hand hält, hat eine kurze Lebensdauer, denn er holt tief Luft und wirft es ins Feuer. Einen Moment lang fliegt es durch die Luft, und das reicht, damit ich das weiße Aufblitzen sehen kann.
Es ist mein Gerät.
Und jetzt ist es weg.
Von Panik erfasst, lehne ich mich an die Seite des Hauses. Jetzt bin ich mir sicher, dass es kein Streich war. Mein Dad würde nie so weit gehen, um ein bedeutungsloses Stück Plastik loszuwerden. Und noch dazu mitten in der Nacht. Irgendetwas war auf diesem Ding, und jetzt werde ich es nie erfahren. Ich zermartere mir das Hirn und versuche, mich an alles zu erinnern, was die Frau gesagt hat.
Das Brimstone irgendwas.
Eine Einladung.
Achtundvierzig Stunden.
Als ich wieder zu Dad hinübersehe, begegnen sich unsere Blicke. Ich drücke mich wieder ans Haus und murmele eine Reihe von Flüchen. Wie aus weiter Ferne höre ich seine Schritte. Sie kommen näher, und ich kneife die Augen zu. Ich bin wie ein Vogel Strauß, der hofft, unsichtbar zu sein, wenn er selbst nichts sehen kann. Sekunden später wird die Haustür geöffnet und wieder geschlossen. Meine Muskeln entspannen sich, und ich lache beinahe auf, weil ich nicht geschnappt worden bin.
Ich bin mir nicht sicher, wovor ich solche Angst habe. Ich habe ja nichts falsch gemacht. Er hat das Hörgerät gestohlen. Er hat sich deswegen seltsam benommen. Er hat ein Feuer gemacht und das Gerät verbrannt, das eigentlich mir gehört.
Ärger durchflutet mich. Diese blaue Schachtel war für mich bestimmt. Und ich habe das seltsame Gefühl, dass der Inhalt extrem wichtig war. Wie kann er es wagen, mir das wegzunehmen?
Ich warte noch lange, länger, als ich es mir zugetraut hätte, und dann gehe ich zum Feuer. Das weiße Gerät wird zu einem Plastikklumpen verbrannt sein, aber ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Ich frage mich, ob ich es nicht aufheben und in das Schlafzimmer meiner Eltern stürmen soll, um endlich zu fragen, was eigentlich los ist.
Als ich mich dem Feuer nähere, ist es schon viel kleiner geworden. Nur wenige Flammen züngeln noch in der kühlen Nachtluft, während der Rest des Holzes rot glüht und sich rasch zu Asche verwandelt. Ich bleibe an der Stelle stehen, an der mein Dad gestanden hat, und untersuche sie. Als ich es entdecke, mache ich unwillkürlich einen Schritt rückwärts.
Das Gerät liegt da, auf einem Haufen Asche und Glut. Es sieht weder geschmolzen noch verformt aus. Ich nehme einen Stock und versuche, es aus der Feuerstelle herauszuschnippen. Nach einigen Versuchen landet es mit einem leisen Geräusch neben meinen nackten Füßen.
Ich gehe in die Knie, strecke einen Finger aus und stupse das Gerät an. Es ist nicht heiß. Es ist noch nicht einmal warm. Ich nehme es in die Hand und stehe auf. Ich habe meine Umgebung vergessen. Vergessen, dass mein Dad mich von drinnen beobachten könnte. Ich kann nur darüber staunen, dass das Gerät von dem Feuer unberührt geblieben ist. Ich wende es, um die andere Seite zu untersuchen, und mir klappt der Unterkiefer herunter.
Das rote Licht.
Es blinkt immer noch.
Ich denke nicht nach; ich renne einfach los. Zurück zum Haus. Zurück zu meinem Fenster. Zurück in mein Zimmer, wo ich mir die Nachricht ungestört anhören kann. Ich bete, dass sie immer noch drauf ist. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund kann ich mir einfach nicht vorstellen, die Nachricht nicht zu hören. Ich muss es wissen – muss es unbedingt wissen.
In meinem Zimmer schließe ich das Fenster und krieche ins Bett. Ich schalte die Lampe aus und lege mich so hin, als würde ich schlafen. Falls jemand hereinkommt, wird er denken, ich sei im Nimmerland. Ich zögere nur kurz, dann stecke ich mir das Gerät, das wie ein Hörgerät aussieht, ins Ohr. Mein Finger findet den winzigen, beleuchteten Knopf, und ich schlucke einen Kloß herunter, der sich in meinem Hals gebildet hat.
Dann drücke ich auf den Knopf.
Zuerst höre ich nichts, aber nach einem Moment kommt das gleiche Klicken. Es funktioniert, denke ich. Es funktioniert immer noch. Das Klicken verwandelt sich in ein Rauschen, und ich halte mir das andere Ohr zu, damit ich mich konzentrieren kann.
»Wenn Sie diese Nachricht hören, sind Sie eingeladen, als Kandidat am Brimstone Bleed teilzunehmen. Alle Kandidaten müssen sich binnen achtundvierzig Stunden melden, um ihre Pandora-Gefährten auszuwählen. Wenn Sie nicht innerhalb von achtundvierzig Stunden erscheinen, verfällt Ihre Einladung.«
Ich bin so glücklich darüber, dass die Nachricht noch da ist, dass ich mich kaum beherrschen kann. Ich richte mich auf und sehe mich nach einem Stück Papier um, weil ich mir die Nachricht wohl besser aufschreiben sollte. Aber bevor ich noch entscheiden kann, was ich tun soll, fährt die Frauenstimme fort.
»Die Auswahl der Pandoras wird im Old Red Museum stattfinden. Der Pandora, den Sie auswählen, ist von äußerster Wichtigkeit, denn er wird während des Rennens Ihre einzige Hilfsquelle sein.
Das Brimstone Bleed wird drei Monate dauern und in vier Ökosystemen stattfinden: Wüste, Meer, Berge, Dschungel. Der Gewinn wird das Mittel sein– ein Heilmittel für jede Krankheit für jeden Menschen.«
Ich halte mir den Mund zu und versuche, nicht aufzuschreien. Ein Mittel. Ein Heilmittel für Cody. Dafür würde ich alles tun. Ich lausche, während die Frau innehält.
»Es kann nur einen Champion geben.«
Kapitel 4
Mit klopfendem Herzen springe ich aus dem Bett. Das muss ein Scherz sein. Ein Streich. Das kann nicht echt sein.
Oder doch?
Wenn dies ein Scherz ist, dann ist es ein Scherz der übelsten Sorte. Denn ich würde alles tun, um Codys Leben zu retten. Und dieses Gerät – diese Frau – hat mir gerade gesagt, dass es eine Möglichkeit gibt. Hat mein Dad sich das angehört? Meine Mom? Wissen sie, was die Frau gesagt hat? Wenn sie es wussten und dachten, es bestünde auch nur eine Chance, dass die Nachricht echt sein könnte, warum sollten sie dann versuchen, das Gerät zu zerstören?
Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Es geht jetzt um mich. Die blaue Schachtel lag auf meinem Bett. Ich bin diejenige, die diese Einladung erhalten hat.
Aber das alles kann nicht real sein. Oder?
Mein Herz tut weh, als ich an meinen Bruder denke. Das Verrückte daran ist – so absurd wie dieses Rennen auch klingt, ich kann einfach nicht aufhören, zu denken: Was, wenn das wahr ist? Ich will glauben, dass es echt ist. Ich will glauben, dass es Codys Bluttests und Kernspins ein Ende bereiten könnte. Dass meine Mom wieder schlafen könnte und dass mein Dad nicht mehr still vor sich hin wütet. Ich möchte kein Desinfektionsmittel mehr riechen oder eine weitere gutherzige Krankenschwester kennenlernen, die toll darin ist, eine Ader beim ersten Versuch zu treffen. Wie wäre es, wenn du Cody stattdessen einfach mal in Ruhe lässt?
Wie wäre es, wenn du ihn stattdessen gesund machst?!
Inmitten dieses Gefühlschaos versuche ich, meine Möglichkeiten abzuwägen. Die Nachricht der Frau ignorieren und wieder ins Bett gehen.
Oder.
Das Risiko eingehen, die winzig kleine Chance nutzen, dass mein Dad wusste, dass es etwas zu verbergen gibt.
Die Erkenntnis, dass ich da vielleicht auf der richtigen Spur bin, trifft mich wie ein Schlag. Meine Eltern haben versucht, mir diese Nachricht vorzuenthalten. Mein Bruder hat die Sache als einen Scherz abgetan. Aber ich will verdammt sein, wenn ich mich von irgendjemandem in meiner Familie davon abhalten lasse, Cody zu helfen.
Vorausgesetzt, das alles ist echt.
»Das muss es sein«, flüstere ich in der Dunkelheit.
Zorn ballt sich in meinem Magen zusammen. Mein Dad traut mir so etwas nicht zu. Deshalb hat er versucht, das Gerät zu zerstören. Aber vielleicht kennt er sein kleines Mädchen nicht so gut, wie er gern glauben möchte. Denn wenn es darum geht, etwas für meine Familie zu tun, bin ich nicht einfach seine Tochter.
Ich bin stark.
Ich werde für meinen Bruder stark sein.
Ich packe das Gerät, das ich mir aus dem Ohr gezogen habe. Die Frau sagte, ich müsse binnen achtundvierzig Stunden im Old Red Museum sein. Wie lange ist es her, seit ich die Schachtel das erste Mal gesehen habe? Wie lange hat es gedauert, bis sie bei mir ankam?
Während ich meinen alten Rucksack aus dem Schrank hole, überlege ich, was ich einpacken muss: Kleider, Essen, Wasser, das Gerät … vielleicht etwas Nagellack. Nur weil ich an einem Wettkampf teilnehme, bedeutet das nicht, dass ich nicht zum Anbeißen aussehen will. Ich schlüpfe hastig in ein schwarzes, langärmeliges T-Shirt, Jeans und gelbe Ballerinas. Dann stopfe ich Sachen in meine Tasche, so schnell ich kann, denn ich weiß, dass ich vor Sonnenaufgang aufbrechen muss, bevor meine Eltern aufwachen. Als Erstes muss ich herausfinden, wo das Old Red Museum ist. Wir haben hier keinen Internetanschluss, aber irgendwo in der Stadt wird es einen geben. Dort kann ich nachsehen. Zumindest hoffe ich das.
Bei dem Gedanken, fortzugehen, spüre ich einen Kloß in meiner Kehle. Meine Eltern werden zurechtkommen, aber was ist mit Cody? Wird er okay sein, während ich weg bin? Ich schaue auf die Tasche in meinen Händen, dann lasse ich sie aufs Bett fallen. Ich bin mir nicht einmal sicher, was ich tue, als ich mein Zimmer verlasse und zu Cody gehe. In seiner Tür bleibe ich stehen und lausche auf seinen gleichmäßigen Atem.
Ich bin froh, dass er schläft. In diesem Moment möchte ich nicht mit ihm herumalbern, auch wenn er es mag. Ich möchte ihm einfach sagen, dass ich ihn liebe. Also tue ich es.
»Ich hab dich lieb, Cody«, sage ich. Und dann: »Bitte stirb nicht.«
Tränen brennen mir in den Augen, als ich zu meinem Zimmer laufe. Ich möchte mir dieses Bild von Cody bewahren, wie seine Brust sich im Schlaf unter der schweren, blauen Decke hebt und senkt. Dieses Rennen mag absoluter Schwachsinn sein, und vielleicht jage ich auch nur einen Tag lang einem Phantom hinterher, aber er wird mir trotzdem fehlen.
Als ich fast wieder in meinem Zimmer bin, höre ich ein Knarren. Mist. Jemand kommt. Ich schaffe es, mir die Tränen aus den Augen zu wischen und meinen Rucksack in den Schrank zu werfen, aber dann steht auch schon meine Mom in der Tür, bevor ich noch ins Bett springen konnte.
Sie geht rüber zu meiner Lampe und schaltet sie ein. Warmes Licht durchflutet mein Zimmer. Sie sieht mich lange an, so lange, dass ich mich frage, ob sie vergessen hat, wer ich bin. Dann setzt sie sich aufs Bett.
»Du bist wach«, sagt sie. Sie klingt nicht überrascht. Es ist mehr eine Feststellung.
»Ja«, antworte ich, nicht sicher, was ich sonst sagen soll. Ich überlege, sie nach dem Gerät zu fragen, ob sie weiß, was darauf ist. Aber ich habe Angst vor ihrer Antwort.
»Ich habe dich gehört«, fährt sie fort. Sie hält etwas in der Hand und fährt darüber, als würde sie es glatt streichen. Sie bemerkt meinen Blick und hält es hoch. Im Schein der Lampe erkenne ich, dass es eine grünblaue Feder ist, die an einer dünnen Lederschnur hängt.
»Das hat meiner Mutter gehört«, sagt sie. »Ich kann mich kaum noch an sie erinnern.« Meine Mom hat selten von ihrer eigenen Mutter gesprochen, und mich daran zu erinnern, dass sie eine hatte, überrascht mich fast schon. Aber natürlich hatte sie eine. Ihre Mutter starb, als sie noch klein war. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht existiert hat. Mom hält sich die Feder an den Kopf und lächelt. »Ich erinnere mich, dass sie die im Haar getragen hat.«
Das Lächeln verschwindet aus dem Gesicht meiner Mom. Ich setze mich neben sie aufs Bett. Ich will ihr sagen, was ich weiß, aber sie hebt die Hand. Zuerst denke ich, dass sie mich am Sprechen hindern will, aber dann berührt sie mein Haar. Sie streicht mir über den Hinterkopf, und ich schließe unwillkürlich die Augen. Zum zweiten Mal heute Abend habe ich das Gefühl, ich würde gleich durchdrehen.
»Du hast das Haar deines Vaters«, bemerkt sie. Dann sieht sie mir ins Gesicht. »Aber du hast meine Augen.«
Ich weiß nicht genau, was sie mir sagen will, aber es ist nicht so, als hätten wir die gleiche Augenfarbe.
Mom streicht mir mein Haar über die Schulter. Dann nimmt sie die Feder und hält sie an den Haaransatz im Nacken. Ein Kribbeln überläuft mich, während sie mir die Lederschnur mit der Feder ins Haar bindet. Als sie fertig ist, lässt sie mir die Locken über den Rücken fallen.
»Du siehst wunderschön aus, Tella.«
Ich stehe auf und schaue in den Spiegel. Die leuchtend grünblaue Feder liegt auf meiner rechten Schulter, inmitten meiner dichten Locken. Ich betrachte meine großen, braunen Augen und frage mich, was meine Mom in ihnen sieht. Abgesehen von Angst.
Meine Mom steht plötzlich auf und durchquert den Raum. Sie nimmt mich in die Arme und hält mich sekundenlang fest, bevor sie mich loslässt. Kurz denke ich, dass sie etwas gestehen will, aber dann sagt sie nur: »Gute Nacht.«
Ich lege mich aufs Bett und tue so, als würde ich schlafen wollen. An der Tür bleibt sie stehen und schaut zurück. Ihr Blick fällt auf meinen offenen Schrank, in dem gut sichtbar mein Rucksack liegt. Dann schaut sie wieder zu mir, und ihre Miene verzerrt sich. »Deine Mama hat dich lieb.«
Und dann ist sie weg.
Ihre Worte schnüren mir die Kehle zu. Ich zwinge mich, aus dem Bett zu kriechen und wieder nach meinem Rucksack zu greifen. Nachdem ich die Kleider unten hineingestopft habe, beschließe ich, mir kein Essen aus der Küche zu holen. Ich muss jetzt los, und ich kann mir in der Stadt etwas kaufen. Aber ich nehme mein gespartes Taschengeld mit, das ich monatelang gehortet habe, weil mir die Gelegenheit zum Ausgeben fehlt. Inzwischen muss ich fast zweihundert Dollar haben. Weil ich keine Ahnung habe, was ich brauchen werde, werfe ich auch einige Sachen von meinem Schreibtisch in den Rucksack: Stifte, Papier, eine Schere, Tesafilm. Das Letzte, was ich einpacke, ist ein Foto von meiner Familie, das an meinem Spiegel steckt – ich kann nicht weggehen, ohne ein Stück von ihnen mitzunehmen. Und meinen lila Glitzernagellack.
Ich verlasse das Haus durch die Vordertür. Es fühlt sich so endgültig an. Als würde ich damit ein Zeichen setzen. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, was für eins.
Wir haben keine Garage, daher parken meine Eltern ihre Autos in der Einfahrt am Haus. Ich biege um die Ecke und überlege, welchen Wagen ich nehmen soll. Da wäre der glänzende, schwarze SUV mit Navigationssystem und Geländereifen. Als ich meinen Führerschein neu hatte, habe ich meine Eltern immer wieder damit genervt, dass ich ihn unbedingt fahren möchte. Und dann ist da noch Bob. Bob ist schon eine Weile bei uns, praktisch seit meiner Geburt. Und nach fast zweihunderttausend Meilen ist der Wagen ein Schandfleck.
Ich beschließe, Bob zu nehmen. Wenn meine Eltern aufwachen, werden sie feststellen, dass ihre Tochter fort ist. Da möchte ich ihnen nicht auch noch die Schrottkarre überlassen.
ENDE DER LESEPROBE


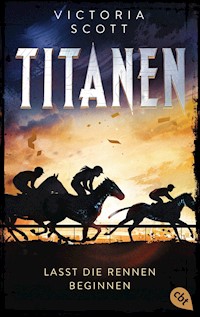














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











