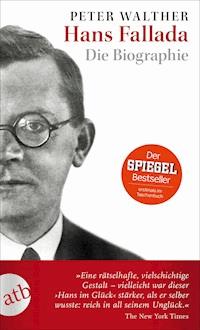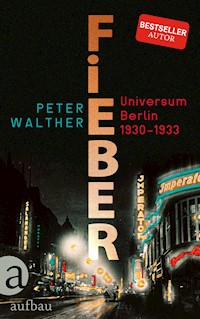
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt im Fieber – die Schicksalsjahre 1930 bis 1933. Berlin, März 1930: Mit der Amtsübernahme des Kanzlers Heinrich Brüning beginnt das letzte Kapitel der Weimarer Republik. In den kommenden drei Jahren wird Berlin in den Bürgerkrieg und schließlich ins „Dritte Reich“ taumeln. Als spannende Literatur liest man Peter Walthers Schilderung, und doch basiert alles auf historischen Tatsachen. Unerwartet führt er die Lebenswege seiner neun so unterschiedlichen Protagonisten auf dem Schauplatz eines politischen Kriminalfalls zusammen, der das Gesicht der Welt verändert hat. Mit pointierten, aussagestarken Porträts u. a. von Heinrich Brüning, Erik Jan Hanussen, Maud von Ossietzky, Ernst Thälmann und Dorothy Thompson. »Berlin ist am Ende der Weimarer Republik Schauplatz eines politischen Dramas. Peter Walther zeichnet ein facettenreiches Bild dieser Jahre – so packend erzählt wie ein Roman.« LUTZ SEILER
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Peter Walther
Peter Walther, geboren 1965 in Berlin, studierte u. a. in Falladas Geburtsstadt Greifswald Germanistik und Kunstgeschichte und wurde 1995 in Berlin promoviert. Zusammen mit Birgit Dahlke, Klaus Michael und Lutz Seiler gab er die Literaturzeitschrift »Moosbrand« heraus. Heute leitet er gemeinsam mit Hendrik Röder das Brandenburgische Literaturbüro in Potsdam. Er ist Mitbegründer des Literaturportals »literaturport« und veröffentlichte Bücher zur Geschichte der Fotografie sowie zu Schriftstellern wie Johann Wolfgang von Goethe, Peter Huchel, Günter Eich und Thomas Mann.
Informationen zum Buch
Eine Stadt im Fieber – die Schicksalsjahre 1930 bis 1933.
Berlin, März 1930: Mit der Amtsübernahme des Kanzlers Heinrich Brüning beginnt das letzte Kapitel der Weimarer Republik. In den kommenden drei Jahren wird Berlin in den Bürgerkrieg und schließlich ins »Dritte Reich« taumeln. Als spannende Literatur liest man Peter Walthers Schilderung, und doch basiert alles auf historischen Tatsachen. Unerwartet führt er die Lebenswege seiner neun so unterschiedlichen Protagonisten auf dem Schauplatz eines politischen Kriminalfalls zusammen, der das Gesicht der Welt verändert hat.
Mit pointierten, aussagestarken Porträts u. a. von Heinrich Brüning, Erik Jan Hanussen, Maud von Ossietzky, Ernst Thälmann und Dorothy Thompson.
»Berlin ist am Ende der Weimarer Republik Schauplatz eines politischen Dramas. Peter Walther zeichnet ein facettenreiches Bild dieser Jahre – so packend erzählt wie ein Roman.« Lutz Seiler
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Peter Walther
Fieber
Universum Berlin 1930–1933
Inhaltsübersicht
Über Peter Walther
Informationen zum Buch
Newsletter
Der Tugendhafte: Heinrich Brüning
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Der Windige: Erik Jan Hanussen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Der Sturkopf: Ernst Thälmann
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Die Liebende: Maud von Ossietzky
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Der rote Zar: Otto Braun
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Der Unhold: Graf von Helldorff
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Die Unverzagte: Dorothy Thompson
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Der Herrenreiter: Franz von Papen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Der Strippenzieher: Kurt von Schleicher
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Der Untergang von New York
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Halma
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Der Staatsstreich
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Schicksalsbälle
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Der Streik
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Endspiel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Rote Kreise
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Finale furioso
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Anhang
Chronologie
Anmerkungen
Literatur
Personenregister
Bildnachweis
Impressum
Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts, als mutig gefaßt die Zügel festzuhalten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es?
Goethe, »Egmont«, 2. Akt
Der TugendhafteHeinrich Brüning
Reichskanzler Heinrich Brüning während eines Festessens, 1931/32.
1
Das kleine, rostrot angestrichene Holzhaus in der Carpenter Street in Norwich in Vermont liegt nur wenige hundert Meter vom Connecticut River entfernt. Nach Osten breiten sich weite Felder aus, im Norden und Westen grenzt ein Waldstück an, Richtung Süden aber ist das Städtchen zu sehen. Die größte Attraktion in Norwich ist der General Store.
Der alte Mann, der vor dreizehn Jahren Haus und Garten mit einer Anzahlung von fünfundzwanzigtausend Dollar gekauft hat, freut sich, die Bäume Jahr um Jahr wachsen zu sehen. Durch die breiten Fenster des Hauses schaut er im Herbst den Vögeln hinterher, die sich zum Zug formieren. Claire Nix, seine dreiunddreißig Jahre jüngere Lebensgefährtin, liest ihm manchmal aus Büchern von Alexander von Humboldt und Annette von Droste-Hülshoff vor. Gemeinsam hören sie das »Kaiserquartett« von Haydn und die »Winterreise« von Schubert. Bewacht wird das kleine Anwesen von Puli, dem ungarischen Schäferhund.
Die deutschen Zeitungen und Zeitschriften kommen stets mit ein paar Tagen Verzögerung an. Aber die Nachrichten, die der Rundfunk aus Bonn sendet, sind aktuell. Jahrelang schon verfolgt der alte Mann die Sendungen auf Kurzwelle. Längst vorbei ist die »Oberbürgermeisterei« Adenauers, wie er die Regierungsarbeit seines einstigen Kontrahenten etwas despektierlich nennt, auch Heinrich Lübke, sein alter Bekannter, ist nicht mehr Präsident in der Heimat. Dagegen hat Walter Ulbricht, dessen Fistelstimme ihm von damals noch im Ohr klingt, im Osten weiter das Sagen.
Verrutscht er auf der Skala seines Radios mit dem Zeiger, hört er »Honky Tonk Women« von den Stones oder »I Heard It Through the Grapevine« von Marvin Gaye. Es ist der 30.März 1970. Auf den Tag genau vier Jahrzehnte nach seinem Amtsantritt stirbt Heinrich Brüning, der ehemalige Kanzler des Deutschen Reichs, im fernen Vermont. Sein Hausrat ist nach Unterlagen des Gemeindearchivs Norwich fünfhundertvierzig Dollar wert, seine unveröffentlichten Papiere werden auf hundert Dollar taxiert.
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus.
2
»Ihr Werk, Ihr Mann«, gratuliert Theodor Wolff, Chefredakteur des »Berliner Tageblatts«, dem General Kurt von Schleicher am Abend des 30.März 1930 nach der Vereidigung Heinrich Brünings zum Reichskanzler. Drei Tage zuvor sitzt Brüning im Kreis von Freunden aus der Zentrumspartei in seinem Lieblingsrestaurant, im »Weinhaus Rheingold«.
Das Restaurant an der Potsdamer Straße ist in vierzehn Säle aufgeteilt. Wie in einem großen Themenpark ist jeder Saal von einer bestimmten Epoche oder einem Kulturkreis inspiriert. Für das weltläufige Publikum ist die »Bar Americain« gedacht, während die vaterländische Kundschaft den »Kaisersaal« vorzieht, den sich die Gäste mit Skulpturen von Karl dem Großen, Otto dem Großen, Barbarossa und Wilhelm I. teilen.
Die Ausstattung ist luxuriös – Mahagoni, Onyxmarmor und Ebenholz –, die Küche gehoben. Bis zu viertausend Gäste finden Platz im »Weinhaus Rheingold«, was den überbordenden Luxus in einem befremdlichen Kontrast zur fehlenden Exklusivität des Ortes erscheinen lässt. Das Großrestaurant ist auch bei anderen Parteiführern beliebt, etwa bei den Nationalsozialisten. Wenn der »Chef« in Berlin ist und die Parteikasse es zulässt, steigt er im »Kaiserhof« ab und lädt am Abend ins »Rheingold«. Hier sitzt er dann mit seiner hübschen Nichte Geli, mit Heß und Göring, Amann und Goebbels.
Thema des Abends in Brünings Stammkoje ist der Sturz des Kabinetts Müller. Allgemein gilt es als Wunder, dass die Regierung mit den Sozialdemokraten überhaupt so lange gehalten hat. Am Ende sei Reichskanzler Hermann Müller, meint Brüning über das Regierungsende seines Vorgängers, »von der eigenen Partei langsam zu Tode gequält« worden. Zu lange schon hat die SPD alle möglichen Kröten geschluckt, zuletzt noch das Lieblingsprojekt des Reichspräsidenten, den »Panzerkreuzer A«. Was haben die Sozialdemokraten vor den Wahlen plakatieren lassen? »Für Kinderspeisung – gegen Panzerkreuzerbau!« Und dann doch für den Panzerkreuzer gestimmt.
In der Wilhelmstraße, dem Zentrum des Regierungsviertels, versucht Hindenburgs Staatssekretär Otto Meissner an diesem Abend zunächst vergeblich, Brüning zu erreichen. Schließlich wird die Gesellschaft im »Rheingold« ausfindig gemacht, nur zehn Gehminuten entfernt, und Brüning über dessen alten Studienfreund Treviranus die Bitte übermittelt, sich am kommenden Morgen um 9 Uhr im Palais des Reichspräsidenten einzufinden. Alle am Tisch wissen, worum es geht: Joseph Wirth, der die Bürde des Amts, das seinen Parteifreund jetzt erwartet, schon einmal getragen hat, bringt es auf den Punkt: »Heinrich, du musst ans Ruder.«
3
Der Eintrag im Taufbuch von St. Ludgeri in Münster vom November 1885 lautet auf Heinrich Aloysius Maria Elisabeth Brüning, aber in der Familie wird der Junge kurz Harry genannt. Heinrich ist das jüngste von sechs Kindern, drei seiner Geschwister sind im frühen Alter gestorben. An seinen Vater, der eine Essigbrennerei und eine Weinhandlung betrieb, hat er keine Erinnerungen, er ist anderthalb Jahre bei dessen Tod. Nun ist die Mutter allein mit den drei verbliebenen Kindern, dem elfjährigen Bruder Hermann Joseph, der sechsjährigen Schwester Maria und Heinrich. Wenn der Junge mit der Mutter in Münster spazieren geht, schlägt er gern Rad oder Purzelbäume vor Übermut. Der kleine Heinrich legt sein Ohr an die Telegrafenmasten und deklamiert Botschaften, die er um die Erde zu senden gedenkt.
Seit elf Jahrhunderten ist die Stadt Bischofssitz. Katholizismus und Preußentum, die tiefe religiöse Bindung und zugleich die Vorstellung, es sei das Höchste, dem Gemeinwohl »in Freiheit zu dienen«, prägen sich schon dem Heranwachsenden ein. Vom »Pater Filucius mit dem E.K.I am Rosenkranz« wird Carl von Ossietzky 1930 mit Blick auf den Reichskanzler schreiben, vom »spitznasigen Pergamentgesicht«. Streicht man das verächtlich Gemeinte ab, das bewusst Verletzen-Wollende in der Formulierung: Hat der Politiker Brüning nicht wirklich etwas Jesuitisches, etwas Elitär-Asketisches? Als Reichskanzler wird er Entscheidungen aus eisiger Höhe »rein nach Sachzwängen« treffen und sich nicht beirren lassen »vom Geschrei der Welt«. Dann wieder, in Zeiten nachlassender Belastung, ereilen ihn Anfälle von Schwermut.
Die Grundzüge seiner seelischen Gestimmtheit, ein Hang zur Melancholie und zur Depression, sind ererbt. Doch scheinen Ereignisse in der Kindheit diese Anlagen verstärkt zu haben. Der schmächtige Junge muss wegen Kurzsichtigkeit schon früh eine Brille tragen. Mit sieben Jahren erleidet Heinrich bei einem Unfall einen Herzkrampf. Heftige Schmerzen greifen das Herz an, der Puls rast und scheint dann wieder stillzustehen, minutenlang halten Atemnot und Angstgefühle an. Bis er fünfzehn ist, muss er körperliche Anstrengungen meiden. Er ist von Sport und Spiel, vom Toben mit den Klassenkameraden ausgeschlossen und flüchtet sich in die Welt der Bücher.
Am Paulinum, das er nach der Grundschule besucht, gehört er zu den guten Schülern. Es ist die älteste humanistische Lehranstalt Deutschlands, gegründet in legendenhafter Urzeit, im Jahr 797.Joseph Frey, der Direktor des Gymnasiums, führt ein unnachgiebiges Regiment: Wirtshausgänge der Schüler sind generell verboten, Besuche des städtischen Theaters werden nur in besonderen Fällen gestattet. Dagegen wird die Anwesenheit beim Gottesdienst in der Jesuitenkirche zweimal die Woche streng überwacht, ebenso die Beteiligung an der Beichte, die alle sechs Wochen zu erfolgen hat. Die Sommerferien verbringt Heinrich fast jedes Jahr bei Freunden der Mutter in der Normandie, in Elbeuf. Hier lernt er die Sprache und Lebensweise der westlichen Nachbarn kennen, eine Erfahrung, die ihn imprägniert gegen den Hass auf den »Erbfeind«.
Heinrich liest eifrig die katholische Zeitung des Elternhauses, vergleicht sie mit anderen Blättern und legt sich ein kleines Archiv an. Er muss am Paulinum wenig Grund zur Klage gegeben haben, sonst hätte ihm der Gymnasialdirektor nicht die »Libri Carminum« von Horaz geschenkt, versehen mit einer handschriftlichen Widmung in lateinischer Sprache: »Den Mann des Rechts, der fest am Entschluss hält, lässt nicht der Volkszorn, der ihn zu Schlechtem drängt, nicht eines Zwingherrn drohendes Antlitz wanken«, beginnen die Verse des Horaz, und Dr. Frey lässt sie in gespenstischer Hellsichtigkeit mit dem Satz enden: »Selbst wenn der Weltbau krachend einstürzt, treffen die Trümmer noch einen Helden!«
4
Der Abend im »Weinhaus Rheingold« dauert länger als gedacht. Brüning hat Bedenken, sich in die Abenteuer zu stürzen, die ihn jetzt erwarten, nicht nur politische, sondern auch gesundheitliche. Sein Parteifreund, der Ex-Kanzler Joseph Wirth, ist robuster, er bietet sich sogleich als Außenminister an. Brüning lässt sich ein Taxi kommen. Früher ist er häufig mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Doch als Geschäftsführer des Dachverbands christlicher Gewerkschaften hält er das mit seiner Stellung nicht länger für vereinbar. Seine Bleibe liegt auf der anderen Seite des Tiergartens, in Alt-Moabit. Hier wohnt er in zwei möblierten Zimmern zur Untermiete bei Frau Heidemann. Brüning ist Junggeselle geblieben, ebenso sein Bruder, der Missionar und Priester, der nach Reisen um die Welt nun in den USA lebt. Auch seine Schwester hat keine Familie gegründet.
Vorzeigbar ist die Wohnung in der Kirchstraße 15 nicht. Für den Fraktionschef einer großen Partei, des katholischen Zentrums, ist das von Nachteil, denn in Zeiten, da man sich im Parlament kaum noch etwas zu sagen hat, ist es üblich geworden, sich zu politischen Verhandlungen abends in den privaten Wohnräumen zu treffen. Was Brüning in späteren Jahren einem Freund gesteht, wirft ein Licht darauf, wie stark er in seiner Jugend an die Planbarkeit des eigenen Weges geglaubt haben muss und wie sehr er sich den Überraschungen des Lebens verschlossen hat: Es sei »ein Fehler« gewesen, nicht geheiratet zu haben. Er habe geglaubt, »wer sich dem Dienst an der Menschheit, dem Gemeinwohl verschreibt, der sollte sich keinem anderen allein zuwenden, keine Familie gründen«.
Wäre es nach der Mutter gegangen, hätte er, wie sein Bruder, Priester werden sollen. Aber während des Studiums in München und Straßburg weitet sich das Feld seiner Interessen, er hört Philosophie, Geschichtswissenschaften, Germanistik und Staatswissenschaften. Platons »Politeia« liest er im altgriechischen Original und begeistert sich für Sparta als Idealstaat. Ein Spartaner, ein Aristokrat des Geistes: Er habe ihn selten lachen hören, häufig aber lächeln sehen, erinnert sich sein Straßburger Kommilitone Gottfried Treviranus. Den Studenten Brüning sprechen die wortkarge Philosophie und die musikalische Erziehung der Dorier an: »Gesetze, Hymnen und Enkomien – also das Recht, die Religion und die Geschichte, lernte man bei ihnen singend.« Mit Freunden besucht er Orgelkonzerte von Albert Schweitzer und spielt selbst gern Klavier. Er liest Dostojewski, Baudelaire, Voltaire und überträgt Vergil in deutsche Verse. Ihn fesselt das Werk des englischen Dichters Walter Pater, eines Ästheten aus eigenem Recht, den sein Schüler Oscar Wilde als den besten englischen Prosaautor seiner Zeit rühmte. Ein Buch über Pater zu schreiben bleibt über Jahrzehnte ein unausgeführter Plan, noch im Arbeitszimmer des Reichskanzlers liegen dessen Schriften in Griffnähe.
Am Ende legt Brüning eine Prüfung für das höhere Lehramt ab. Doch statt den Lehrerberuf zu ergreifen, wendet er sich dem Studium der Nationalökonomie zu, das er an der »London School of Economics« und danach in Bonn absolviert. Als er, nach mehr als einem Jahrzehnt, 1915 seine Studien mit einer Dissertation abschließt, ist der Weltkrieg in vollem Gange. Der kurzsichtige Doktor der Nationalökonomie wird eingezogen, steigt auf zum Leutnant und Kompanieführer und wird wegen Tapferkeit mit dem EKI ausgezeichnet. In der dienstlichen Beurteilung eines Vorgesetzten heißt es: »Unter den Kameraden war er hochgeehrt, von den Untergebenen wurde er geliebt und verehrt. Er gehörte zu den seltenen Persönlichkeiten, die keine Feinde haben.«
Die Erfahrungen der Kriegszeit bestärken ihn, auf eine akademische Laufbahn zu verzichten und seine Zukunft in der Politik zu suchen. Er engagiert sich in der katholischen Sozialarbeit, wird Mitarbeiter des Großstadtseelsorgers Carl Sonnenschein, des »Zigeuners der Wohltätigkeit«, wie Kurt Tucholsky ihn einmal nannte, und Referent des preußischen Wohlfahrtsministers. 1919 übernimmt er die Geschäftsführung des christlichen Gewerkschaftsbundes und lässt sich 1924 für die Zentrumspartei in den Reichstag wählen. Schnell findet er Anerkennung wegen seiner finanzpolitischen Kenntnisse. Doch die Schweigsamkeit, der Ernst und die asketische Ausstrahlung des Junggesellen lassen den Kreis seiner Freunde klein bleiben. Er selbst sucht auch keinen Beifall. Den Maßstab, mit dem er sein Gegenüber einzuschätzen versucht, hat er aus dem Krieg mitgebracht: »Wie würde er unter Feuer, nach Gefechtsende, ohne Befehl handeln?«
5
Brüning findet nach dem Abend im »Rheingold« in der Nacht zum Freitag nur zwei Stunden Schlaf. Am Morgen des 28.März 1930 macht er sich auf den Weg durch das regnerische Berlin in die Wilhelmstraße. Vorbei an der Doppelwache, geht er ins Büro von Dr. Meissner, der ihn beim Reichspräsidenten anmeldet. Hindenburg ist nicht begeistert, den Fraktionschef des katholischen Zentrums mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Nie ist das alte, seit den Tagen des Kulturkampfes gepflegte Ressentiment gewichen, bei den Katholiken handle es sich um eine »undeutsche«, aus der Ferne gesteuerte Kraft. Aber der General von Schleicher hat ihm den Mann ans Herz gelegt. Wenn überhaupt mit dem Parlament weiterregiert werden soll, dann braucht man jemanden wie ihn: einen Konservativen, der als Gewerkschaftler zugleich den Ausgleich mit den Sozialdemokraten finden kann und auch noch das Vertrauen der Reichswehr besitzt.
Aufrecht begrüßt der zweiundachtzigjährige, längst schon zum Denkmal seiner selbst gewordene Sieger von Tannenberg den schmächtigen Leutnant der Reserve. Hindenburg ist elffacher Ehrendoktor und Ehrenbürger von einhundertzweiundsiebzig deutschen Städten. Damals, 1915, hat er das Vaterland vor den russischen Invasoren gerettet. Im Westen steckte die »schimmernde Wehr« schon fest in den Schützengräben, die ganzen Jahre wurden »blutig vertrödelt«, wie der Feldmarschall später bemerkte, nur im Osten konnten die Russen, die schon tief in Ostpreußen standen, aus dem Land geschlagen werden. Aus sechsundzwanzig Tonnen Erlenholz haben sie den Retter noch im gleichen Jahr nachgebaut und direkt vor dem Reichstag aufgestellt, den »eisernen Hindenburg«, die größte Holzskulptur der Welt, und gegen eine Spende Nagel um Nagel in ihn hineingetrieben. Am Ende sah er wenig heldisch aus, eher wie ein Igel.
Zwei Tage nach dem Termin beim Reichspräsidenten hat Brüning seine Ministerliste zusammen. Bei der Vereidigung verspricht Hindenburg den Ministern: »Ich verlasse Euch nicht, und Ihr sollt mich nicht verlassen.« Der neue Reichskanzler zieht in die Wilhelmstraße mit einer Reisetasche ein, er begnügt sich mit drei Zimmern im Reichskanzlerpalais. Die Lage ist alles andere als rosig. Das Parlament ist zerstritten, während das Land unter der Wirtschaftskrise ächzt, die inzwischen auch die besseren Gegenden erreicht hat. Auf dem Ku’damm wird »Mittagessen auf Teilzahlung« angeboten: »Leuten, die sich in einer nur vorübergehenden Geldverlegenheit befinden, soll Gelegenheit gegeben werden, ohne großen Kostenaufwand gut und billig Mittag essen zu können«, heißt es in der »Deutschen Allgemeinen Zeitung«: »Voraussetzung ist nur, daß der Gast sich verpflichtet, mindestens sieben Mahlzeiten innerhalb von zwei Wochen hier einzunehmen, wofür er jedes Mal nur ein Viertel des Preises zu bezahlen braucht. Die restlichen drei Viertel werden in drei Monatsraten abbezahlt.«
Das Kabinett Brüning ist die siebzehnte deutsche Regierung in den zwölf Jahren nach dem Ende der Monarchie. Es ist die erste, die sich auf keine stabile politische Mehrheit im Reichstag mehr stützen kann, eine Regierung im Notstand. Nach seiner Vereidigung am Sonntag kommentiert Brüning: »Ich übernehme eine Aufgabe, die zu neun Zehnteln verloren ist.« Drei Millionen Arbeitslose, zwanzigtausend Konkurse, über dreihundert Bankenschließungen seit dem Crash der New Yorker Börse im Vorjahr, die Landwirtschaft dicht am Kollaps, blutige Zusammenstöße auf den Straßen, Pöbeleien im Reichstag, Reparationspflichten bis 1988 und an der Spitze des Landes ein Mann, der von sich selbst sagt, er habe »das beklemmende Gefühl, unter den meisten Menschen ein Fremder« zu sein: So sieht es aus in Deutschland am 30.März 1930.
Der WindigeErik Jan Hanussen
Erik Jan Hanussen sucht mithilfe eines Mediums nach einem versteckten Gegenstand, Potsdamer Platz, Berlin, 1932.
1
Berlin ist 1930 wahrlich nicht arm an Attraktionen. Fast dreihunderttausend Touristen zählt die Stadt in diesem Jahr. Es kommen viele Amerikaner, Briten und Franzosen, die von der Theater- und Kunstszene und dem freizügigen Nachtleben angezogen werden. Für sie ist das Leben günstig in der Stadt. In der Lutherstraße gegenüber der »Scala«, dem größten Revuetheater des Landes, hat sich »Deutschlands erste Negerbar« etabliert. Unter den über hundert Lokalen für Schwule und Lesben nimmt das »Eldorado« in der Motzstraße eine besondere Stellung ein. Hier verkehrt gelegentlich auch SA-Chef Ernst Röhm, der »kleine, untersetzte, energiegeladene Stabschef, in dessen kugelrundem, zerhackten Gesicht die Augen voll fröhlicher Erwartung glänzten«. Ein junger Brite berichtet von einem Besuch im Lokal mit seiner aus England angereisten Verwandtschaft: »Mein Onkel Geordie war so unerfahren, dass er nicht begriff, was um ihn herum vor sich ging, und er war maßlos entsetzt, als er unter dem Chiffonkleid des ›Mädchens‹, das auf seinen Knien saß, ein männliches Geschlechtsteil entdeckte.«
Am Bahnhof Friedrichstraße teilen sich die »Berliner Morgenpost«, der »Vorwärts« und »Die Rote Fahne« die Auslagen des Verkaufsstandes mit homosexuellen Magazinen wie »Die Freundschaft« oder »Frauen Liebe und Leben«. Auf den Titelbildern dieser Blätter sieht man nackte, knabenhaft schlanke junge Frauen in gespielt-verschämter Pose oder, gleichfalls komplett hüllenlos, junge Männer bei sportlicher Betätigung. Das wirklich Anstößige hat auf dem Titel nichts zu suchen, dafür macht es sich in den Anzeigenspalten breit. Hier trifft man, nur nachlässig in die vermeintlich aufklärerische Absicht verhüllt, auf das gerade noch Unaussprechbare. Beworben wird etwa die Privatschrift von Dr. Ernst Schertel, die, wie es heißt, »mit ihrem enorm reichen Bildmaterial eine ganze Bibliothek« ersetzt. Der Autor verspricht Aufklärung über alle Stilarten der »Flagellation«: »Peitsche, Nadel und Messer«. Oder der Privatdruck »Sexuell Perverse« des pensionierten Kriminalkommissars Polzer: »Sämtliche geschlechtliche Perversionen werden populärwissenschaftlich dargestellt. Masseusen und Prostituierte erzählen ganz offen.«
Ins Belletristische spielt das Buch von Dr. Gitta. Die Leser erwartet für zwei Mark fünfzig »ein Roman voll erotischer Hochspannungen« unter dem Titel »Der sonderbare Turnlehrer«. Andere Publikationen handeln von »dämonischen Weibern«, vom »Entblößungstrieb«, vom »Problem der lesbischen Liebe« oder von »entfesselten Gluten«. Erzählt wird stets »mit unerhörter Offenheit«, selten fehlt der Hinweis auf die »zahlreichen Photobeilagen und Kunstdrucktafeln«. Es ist die Zeit der großen Verheißungen. Glück gibt es nicht nur für die Schönen und Reichen, Glück verdient hat auch das »gnädige Fräulein«, an das sich die Zeitschrift »Berliner Wochenschau« wendet: »Nur Sie allein wissen, welchen Kummer Sie empfinden, wenn Sie immer wieder, alle Tage, feststellen, daß Ihre Büste nicht die strotzende Fülle aufweist, wie sie eine wirklich schöne Frau besitzen muß. Verlieren Sie daher keine kostbare Zeit: verlangen Sie heute noch kostenfrei […] Prospekt und Beweise über grundsätzlich neues Verfahren über erschlaffte oder unentwickelte Büste.«
Die Prüderie der Kaiserzeit hat einer erstaunlichen Freizügigkeit Platz gemacht. Nur wenige Jahre zuvor galt das Tragen von Kleidern des jeweils anderen Geschlechts in der Öffentlichkeit noch als kriminell. So wird der junge Georg von Zobeltitz 1912 wegen »groben Unfugs« verhaftet, weil er auf der Straße selbstgeschneiderte Frauenkleidung trägt. Zobeltitz beschäftigte sich seit frühester Kindheit mit weiblicher Handarbeit. »Namentlich im Garnieren von Damenhüten« habe er, wie es in einer bloßstellenden Notiz im »Berliner Tageblatt« heißt, »eine außerordentliche Gewandtheit« entwickelt. Als sich auf dem Revier in Weißensee aufklärt, dass Zobeltitz als Transvestit schon seit längerer Zeit in Behandlung bei Dr. Magnus Hirschfeld ist, wird er entlassen. Später erhält er einen »Transvestitenschein« für seinen Wohnort Potsdam, der ihn vor weiteren Ungelegenheiten schützt. Einige Jahre darauf, 1919, etabliert Hirschfeld mit seinem privaten Institut für Sexualwissenschaft in der »Villa Joachim« im Berliner Tiergarten eine Anlaufstelle für Bedrängte wie auch für die wachsende Zahl der an Sexualreformen Interessierten.
2
Eine neue Form des Journalismus hat sich nach dem Krieg in der Hauptstadt etabliert: die Gesellschaftsreportage. Begierig saugt das Publikum die Nachrichten vom Leben und Treiben der »höheren Kreise« auf. Die Bilder und Berichte vom Überfluss und der vermeintlichen Sorglosigkeit der Reichen werden umso dankbarer aufgenommen, je düsterer die eigene Lage ist. Fast jede größere Zeitung leistet sich einen Gesellschaftsreporter. Ungekrönte Königin des Metiers ist Bella Fromm. Sie ist eingeladen zu den Empfängen, Teepartys und Banketten der diplomatischen Vertretungen und hat Zugang zu den Spitzen der Politik. Bella Fromm hält aber auch Kontakt zur alten Berliner und Potsdamer Hofgesellschaft. Sie leitet Wohltätigkeitsveranstaltungen und organisiert Modeschauen, berichtet von Bällen und Sportveranstaltungen. Am liebsten jedoch sind ihr politische Interviews. Ihre Kolumnen in der »Vossischen Zeitung« sind selbst häufig Glanzstücke der Diplomatie, denn was in welchem Licht berichtet und wer erwähnt wird, ist Gegenstand gewissenhaft-prüfender Lektüre bis in die höchsten Kreise. Selbst Hindenburg liest gelegentlich die Beiträge von Bella Fromm.
In dieser überhitzten Zeit ist Berlin auch für ausländische Journalisten ein interessanter Ort. Zur Kolonie der amerikanischen Pressebeobachter gehört Dorothy Thompson. Als ein »schlankes und scheues ›girl‹« beschreibt sie Klaus Mann, der, ebenso wie seine Schwester Erika, zu ihrem Freundeskreis gehört. Seit 1923 versucht Dorothy Thompson, den Führer der Nationalsozialisten zu einem Interview zu bewegen, bisher erfolglos.
Ihr britischer Kollege Sefton Delmer, der Korrespondent des »Daily Express«, ist einen Schritt weiter auf diesem Weg. Er hat sich in das Vertrauen der SA-Größen eingeschlichen, reist ihnen in seinem kleinen BMW hinterher oder begleitet sie beim Wahlkampf im Flugzeug. Hier beobachtet er, wie die Angehörigen von Hitlers Leibwache Fotos ihrer Liebhaber aus ihren Brieftaschen ziehen und unter sich herumreichen: »Ist er nicht süß?« Er heftet sich an die Fersen von Ernst Röhm, den er »einen lustigen und mitteilsamen kleinen Gangster« nennt, oder trinkt in der Privatwohnung von Goebbels Mokka aus »hübschen kleinen Rosenthal-Tassen«. Die Gesellschaften, die er selbst gibt, sind in dieser Zeit »die einzigen in Berlin, auf denen meine neuen nationalsozialistischen Freunde mit Juden tranken und sich unterhielten«.
Der »populärste Mann Berlins« ist im Frühjahr 1930, glaubt man der Presse, Joseph Weißenberg. Der Sohn eines katholischen Tagelöhners hat 1903 die Abdankung Kaiser Wilhelms II. »in fünfzehn Jahren« prophezeit und 1918 die Hyperinflation von 1923 geweissagt. Nach einer Christusvision gab er seinen Maurerberuf auf und gründete bald darauf eine eigene Kirche. Jetzt entwickelte er eine Heilmethode, die Erfolg durch Handauflegen und die Verabreichung von weißem Käse versprach. 1925 war seine Anhängerschaft bereits auf zwanzigtausend »ernste Forscher« angewachsen, die Zeitschrift der Gemeinde nennt sich konsequenterweise »Der Weiße Berg«. Populär ist Weißenberg nicht zuletzt wegen der über dreißig Prozesse, die für andauernde Aufmerksamkeit sorgen. Gerade wird der Fall des fünfzehnmonatigen Mädchens Hildegard Hensicke verhandelt. Die Eltern, strenge Weißenbergianer, gaben das Kind bei ihrem Meister wegen einer Augenentzündung in Behandlung. Weißenberg therapierte es mit Handauflegen und schickte die Eltern mit der Empfehlung nach Hause, die Augen der kleinen Hildegard in kurzen Abständen mit weißem Käse einzureiben. Durch die dauernde Feuchtigkeit konnte die Entzündung nicht abheilen. Das Martyrium endete für das unglückliche Mädchen mit dem Verlust des Augenlichts.
Im »Wintergarten« am Bahnhof Friedrichstraße tritt ein junger schlesischer Bergmann namens Paul Diebel als weltliches Gegenstück zu Theresa von Konnersreuth auf. Die sensationsheischende Berichterstattung lockt immer neue Zuschauerströme in das Varieté. »Unter genauester Kontrolle«, heißt es in einem der Zeitungsberichte, »gelang es ihm, während er fast völlig nackt auf einem Stuhle saß, das ›Wunder‹ des Blutweinens vorzuführen. Ungefähr 15 Minuten nach der Ankündigung begannen sich seine Augen dunkelrot zu färben, und kurz darauf rann bereits das Blut aus den Augen. Sodann rief Diebel ein blutiges Kreuz auf seiner Brust hervor, was nur wenige Sekunden in Anspruch nahm.« In einer weiteren Nummer seines Programms demonstriert der Bergmann seine Unempfindlichkeit gegen körperlichen Schmerz: »Er ließ sich nicht nur zahlreiche Nadeln und dünne Dolche durch die Bauchdecke und den Unterarm stoßen, ohne daß Blut floß, sondern er ließ sich sogar aus einem Gewehr spitzige Bolzen in den Leib schießen. Sodann legte er eine Hand auf den Tisch und ließ durch sie einen starken Nagel schlagen. Beim Herausziehen des Nagels«, staunt der Verfasser des Berichts, »war abermals kein Blutstropfen in der Wunde zu sehen.«
Berlin ist ein Tummelplatz für Scharlatane und Propheten, Verrückte und Gauner. Für Carl Zuckmayer ist die Stadt wie eine »sehr begehrenswerte Frau«: »Wir nannten sie arrogant, versnobt, parvenuhaft, kulturlos, ordinär. Insgeheim aber sah sie jeder als das Ziel seiner Wünsche: Der eine füllig, mit hohem Busen in Spitzenwäsche, der andere schlank mit Pagenbeinen in schwarzer Seide. Unmäßige sahen beides, und der Ruf ihrer Grausamkeit reizte erst recht zum Angriff.«
Vom »Ruf ihrer Grausamkeit« zum Angriff gereizt, zieht es auch den Varietékünstler und einstigen Wiener Gesellschaftsreporter Hermann Steinschneider in die Stadt. Es gelingt ihm in kurzer Zeit, zum Tagesgespräch zu werden. Während die Fachkollegen mit konventionellen Nummern wie »Schau-Hungern« aufwarten – ein »Hungerkünstler« stellt sich Tag und Nacht in einer Passage der Friedrichstraße in einem Glaskasten gegen Eintrittsgebühr dem Publikum zur Schau –, während die Konkurrenz also die bittere Not zur gewinnträchtigen Tugend macht, sorgt Steinschneider für die wirkliche Sensation: Er präsentiert »Omikron«, den »lebenden Gasometer«. Als solcher tritt der junge arbeitslose Artist Fritz Jung auf, der sich, glaubt man dem Conférencier, unter Hypnose aus einem Siphon den Magen mit Acetylengas vollpumpt. Anschließend bekommt er von Steinschneider zwei Gummischläuche an den Mund gesetzt, von denen einer zu einer Tischlampe führt, ein zweiter zu einem Gasherd. Auf Anweisung des Hypnotiseurs entlässt »Omikron« nun das aufgesogene Gas in die Schläuche, worauf zum unbändigen Erstaunen der Besucher die Tischleuchte zu brennen beginnt, während eine Assistentin zugleich auf dem angeschlossenen Gasherd Spiegeleier brät. Was die Zuschauer nicht wissen: Der junge Arbeitslose hat sich vor der Aufführung einen mit Leichtbenzin gesättigten Schwamm in den Mund gesteckt.
»Eigentlich gibt es gar keine Zukunft, es gibt keine Zeit, keinen Raum! Wieso? Nun, gäbe es sie wirklich, so müssten sie ein Ende haben, eine Begrenzung. Aber das haben sie ja gar nicht, und deshalb existieren sie nur begrifflich. […] Das Individuum ist doch nur eine krankhafte Form der Schöpfung. Der Mensch ist wie ein Karzinom am Bauch der Schöpfung. Das Ideal dieser Schöpfung ist er sicher nicht. Es ist doch alles Kampf! Wären wir etwas Vollkommenes, wie könnten wir Magenschmerzen haben? Das, was wir vom Weltall sehen, ist ja nur ein Teil. Unsere Welt aber«, schreibt Hermann Steinschneider, der sich als Bühnenkünstler Erik Jan Hanussen nennt, »ist eine Beule am After des Kosmos.«
3
Kaum etwas von dem, was man über die Kindheit Steinschneiders zu wissen glaubt, ist verbürgt, da es zu großen Teilen aus seinen eigenen Auskünften stammt. Wie schreibt Hanussen im Vorwort seiner Autobiographie über die Glaubwürdigkeit seiner Erinnerungen? Es seien »die Erlebnisse eines Menschen, der immer hart an der Grenze des Wahrscheinlichen stand«. Steinschneider kommt 1889 in Ottakring bei Wien zur Welt, im gleichen Jahr wie Hitler. Sein Vater Siegfried und seine Mutter Julie, geborene Kohn, tingeln in dieser Zeit mit wechselnden Engagements durch das Habsburgerreich. Als »Schauspieler bei einer Schmierengesellschaft« hat Hanussen den Vater in seinen Erinnerungen beschrieben, die Mutter nennt er »eine Dichterin«, sie kränkelt lange und stirbt früh. Schon der Dreijährige will in Hermannstadt Vorahnungen gehabt haben, die zwei Menschen das Leben gerettet hätten. Neunjährig, will er, um berühmt zu werden, ein Haus angezündet und auf diese Weise den Räuberhäuptling Grasel aufgestöbert haben. Der historisch bezeugte Johann Georg Grasel wurde allerdings schon 1813, fast ein Jahrhundert zuvor, in Niederösterreich gefangen genommen.
Zur Schule geht Hermann, der sich von seinen Freunden Harry nennen lässt, zunächst in Wien, später im mährischen Boskowitz. Nach dem Tod der Mutter heiratet Hermanns Vater wieder, abermals wohnen sie in Wien, im 16. Bezirk, seinerzeit nicht die beste Gegend. »Wenn jemand nachts dort zu tun hat«, schreibt Hanussen, »nimmt er sich ein Maschinengewehr mit.« Der Vierzehnjährige verliebt sich in eine fünfundvierzigjährige Soubrette, mit der er auswandern will, was der Vater verhindert. Ersatzweise schließt sich der Junge einer Theatergruppe an, die in Mähren gastiert, wechselt nach einer Weile die Kompagnie, versucht sich selbst als Unterhalter und ist bald ganz am Boden. Halb verhungert, so heißt es in seiner eulenspiegelhaft geschriebenen Autobiographie, übernachtet er in einer Hundehütte, wo ihm »eine Kreuzung zwischen Schakal und Grizzlybär« Unterkunft gibt. Wenig Besserung bringt das Engagement bei einer kleinen Theatertruppe, die in den Dörfern Stücke aufführt wie »Das Mädchen mit den Flammenaugen« oder »Bruderzwist und Bruderhaß im Grafenschloß«. Hermann geht von Tür zu Tür und verteilt Theaterzettel in der Hoffnung auf ein kleines Trinkgeld: »Der Himmel schenk’ Dir Glück und Ehr’«, kann man auf den Zetteln lesen, »doch Du gewähr’ mir ein Douceur.«
Die Geschäfte gehen schlecht, weshalb Hermann in die »Zirkusfakultät« wechselt. Mit seinem ganzen Gepäck, das, wie er schreibt, »in eine Zigarettenschachtel« passt, zieht er nun gemeinsam mit Mischko dem einäugigen Clown, mit Heinrich dem Riesen, dem Schimmel »Regent« und dem Pony »Sandor« auf Parade durch die Dörfer. Beim fahrenden Volk findet er sein Auskommen und Kameradschaft, er schämt sich nicht wegen der billigen Effekte, mit denen sie das Publikum unterhalten. Zugleich bleibt der hochintelligente Junge ein Beobachter, er geht nicht auf im Zirkusmilieu, sondern lernt, wie einfach es sein kann, Menschen in ihrer Glaubensbereitschaft zu bestärken. Er macht gelegentlich gute Erfahrungen mit der Solidarität unter den Armen und häufig gegenteilige mit der Engherzigkeit der Besitzenden. Vielleicht beginnt er in dieser Zeit, sein Publikum zu verachten.
Keiner seiner Zirkuskollegen, sondern der Schimmel »Regent« wird ihm zum besten Freund. Wenn Hanussen in seiner Biographie darauf kommt, verliert seine Beschreibung den sonst gepflegten Ton forcierter Heiterkeit: »Regent, du weißes gutes Tier, wie habe ich dich gestriegelt und gepflegt, wie habe ich dir die Streu gebettet, und wie freudig war das Wiedersehen zwischen uns beiden […]. Wie weich hast du mich dafür auf deinem warmen Pferdebauch gebettet, wenn es in den Ställen zu kalt war […]. Dein tiefbraunes Auge drang feucht schimmernd in mich hinein bis tief, tief in die Seele, und wenn mir etwas weh tat, dann spürtest du es auch, und wenn ich mich freute, dann war es auch deine Freude, und wenn […] ich mich auf deinen treuen Rücken schwang, dann ging’s im Sturm und Galopp über das Feld. Wer hätte uns da nachkommen können, Regent, mir und dir, wer konnte es mit uns aufnehmen, wer uns fangen?«
4
Im Beethoven-Saal der Philharmonie in der Köthener Straße finden bis zu tausendfünfhundert Besucher Platz. Wie immer bei den Programmen von Hanussen bilden auch an diesem Abend im März 1930 Frauen die große Mehrheit im Publikum. Der stechende Blick seiner graublauen Augen, der auf den Plakaten effektvoll abgebildet ist, verfehlt zwar auf die Distanz seine suggestive Wirkung, dennoch folgt das Publikum gespannt der Ansprache Hanussens, mit der er in nur wenigen Sätzen zum Wesen des Okkultismus vordringt: »Wie? Sollte das Leben nur dazu gelebt werden, die Welt – der ungeheure Kosmos mit all seinen millionenfältigen Erscheinungen – nur dazu geschaffen sein, daß Herr Müller, Schulze oder Lehmann geboren wird, eine Frau nimmt, fünf Kinder mit ihr zeugt, Jahrzehnte hinter dem Ladenpult steht, eine Reihe von metallenen Münzen zusammenscharrt, um sich dann hinzulegen und zu sterben – für immer aus dem Ablauf des Geschehens zu verschwinden? Ist damit der Zweck der Schöpfung erfüllt? Stehen wir in keiner tieferen Beziehung zur Natur? Gibt es keine Wunder mehr oder sind wir nur nicht imstande, sie zu erfassen, ihrer teilhaftig zu werden?«
Und mit einer weiteren Suggestivfrage baut er die Brücke zur ersten Nummer im Programm, der »telepathischen Post«. Wer würde bestreiten wollen, dass ein Radio, »ein aus Drähten und Holz verfertigter plumper Apparat, von Menschenhirn ersonnen, von Menschenhand erbaut, Wellen auffangen […] kann, die Tausende von Kilometern entfernt ausgesendet werden. Warum soll das menschliche Hirn, dieser feinste aller Apparate der Natur, nicht Vorrichtungen haben, um Gedankenwellen anderer Gehirne aufzufangen?«
Noch gibt es einige Spötter im Publikum. Aber anders als für Hanussen ist für die Besucher seiner Vorstellung alles neu. Er bittet nun einen Zufallsgast, den Namen eines im Saal anwesenden Bekannten auf einem Blatt zu notieren. Das Blatt wird in einen Umschlag gesteckt. Jetzt wird der Gast zum Medium. Hanussen instruiert den Betreffenden, stark an den Standort zu denken, an dem sein Bekannter im Saal platziert ist, und greift ihn bei der Hand. Im hektischen Tempo geht der Gedankenleser nun mit seinem Medium durch den Mittelgang, dann etwas langsamer durch die Reihen. Es sind kaum dreißig Sekunden vergangen, bis Hanussen am Platz des zu Erratenen steht. Die Zuschauer applaudieren begeistert.
Als Nächstes sucht der Magier eine im Saal versteckte Nadel und findet sie zum grenzenlosen Erstaunen des Publikums in der Zigarettendose eines anwesenden Lehrers. Dann errät er die Nummer eines Anschlusses aus dem Telefonbuch von Athen. Immer wieder gibt es Pausen, in denen der Sekretär des Hellsehers im Publikum Zettel einsammelt, auf denen zu erratende Ereignisse und Daten stehen. Der Adlatus gibt hier und da vor, die Schrift auf den Zetteln nicht lesen zu können, und stellt kurze Nachfragen. Dann geht es weiter. Nicht alles kann Hanussen erraten, aber gerade diese Fehlbarkeit steigert den Wert des richtig Getroffenen und die Glaubwürdigkeit der Prophezeiungen.
Das Programm des Abends ist weit gespannt, »Muskellesen« und »Nadelsuche« gehören dazu, »Graphologie und Liebe«, »Television« und das »Wunder von Konnersreuth«. Der »Psychographologe« Hanussen behauptet, sich die Handschrift von ungefähr fünftausend berühmten Persönlichkeiten zu eigen gemacht zu haben, und lässt sich vom Publikum Namen zurufen: Napoleon, Hindenburg, Goethe, Edison, Beethoven. Besonderes Aufsehen erregt er, als er die Unterschrift von Rabindranath Tagore in Brahmi-Schrift anzuzeichnen beginnt und ein Indologe, eine würdige akademische Autorität, im Effekt ein lautes »Stimmt!« in den Saal hineinruft. Die nächste Nummer lässt die Zahl der Skeptiker weiter schrumpfen. Hanussen erbittet sich vom Publikum Briefe und Schriftproben und gibt Auskunft über den Schreiber und die Entstehungsumstände. So errät er nach einem kurzen Blick auf ein ihm gereichtes Blatt: »Dies ist die Schrift eines Mannes, der im Krieg an einem Lungenschuß gestorben ist.«
Bei einer anderen Nummer im Programm verspricht Hanussen, den Beruf eines beliebigen Gastes hellzusehen. Sein Sekretär Erich Juhn hat sich in der Pause dezent erkundigt und gibt ihm heimliche Zeichen: »Ein Richter wurde avisiert durch ›Richten‹ der Krawatte, ein Advokat durch Wenden des Kopfes unter Anspielung auf Rechtsverdreher, ein Arzt durch Kreuzen der Arme und Beine, da es ein Kreuz war, mit Ärzten zu tun zu haben, ein Dichter durch Streichen übers Haar, was schlechthin auf Kunstberufe schließen ließ […], Beamter wurde treffend durch Gähnen charakterisiert.«
Im Enthüllungsbuch, das der einstige Sekretär nach dem Bruch mit seinem Meister schreibt, wird vieles von dem, was vom Publikum als unerklärlich wahrgenommen wird, als Taschenspielertrick entlarvt. Erich Juhn offenbart das Wesen des Hellsehergeschäfts: »Den Propheten erfasst die Idee – er dient ihr, er geht in ihr auf, er stirbt für sie. Der Scharlatan erfindet eine Idee – er macht sie sich dienstbar, er lebt von ihr.« Doch Juhn führt einen ungleichen Kampf, und Hanussen bleibt sein Meister. Oder, um es mit den Worten des Verführers zu sagen: »Wer den Menschen das Wunder zu geben vorgibt, wird immer mehr Erfolg haben als der, der sie von der Unmöglichkeit dieses Wunders überzeugen will.«
5
Niemand in der Welt wartet auf Hermann Steinschneider, auf eine ausgerissene Halbwaise aus einer mittellosen jüdischen Schaustellerfamilie. Die Freiheit des jungen Steinschneider ist die kalte Freiheit des Heimatlosen, es bleibt ihm nichts übrig, als sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Immerhin, intelligent ist er, sogar intelligent genug, es die anderen nicht merken zu lassen. Wohin er kommt, spürt er sogleich seine Überlegenheit. Und er sieht passabel aus, hat seine physischen Kräfte gefestigt im Umgang mit seinem Freund Heinrich, der als »stärkster Mann der Welt« mit ihm im Zirkus auftritt. Der junge Steinschneider liebt die Frauen, aber er braucht sie nicht, und das macht einen Teil der Anziehungskraft aus, die er auf sie ausübt.
Während sich seine Altersgenossen in Wien auf dem Gymnasium mit Platon und Thukydides, mit Cicero, Plinius und Seneca quälen, lernt Hermann »Glas fressen, Feuer und Kieselsteine schlucken, Degen verschlingen, mit den Knöcheln der Hand eine Tischkante abbrechen und mit der Faust dicke Nägel durch Bretter schlagen«. Und während sich seine Altersgenossen in Wien auf die Matura vorbereiten, verfolgt Steinschneider einen entschieden anderen Bildungsweg: Er wird »Geschäftsführer des größten elektrisch betriebenen Karussells Europas«. Die elektrische Kraft geht in diesem Fall von vier Kindern aus, die verdeckt unter einer Plane ein Holzkreuz schieben müssen: »Für zehnmal Schieben durften sie einmal Reiten. Das war unsere Elektrizität«, erinnert sich Steinschneider.
Weitere Hochstapeleien führen ihn nach Athen und Konstantinopel und vor dort auf das noble Schiff »Baron Beck«. Hier erschleicht er sich ein Ticket erster Klasse für die Passage nach Brindisi in Italien, indem er sich für den berühmten Bariton Titta Ruffo ausgibt und dem Kapitän verspricht, am Ende der Überfahrt fürs Publikum zu singen. So geht es Schlag auf Schlag. Er wird Löwenbändiger und Artist, brennt mit der Abendkasse durch, verfasst Couplets und tritt mit Chansons auf. 1911 ist er Journalist bei einer Gazette im slowenischen Essegg. In Wien bringt es Steinschneider zum Mitarbeiter einer »Trickzeitung«, die auf Hochzeiten verkauft wird. Diese Zeitung, von der die Macher behaupten, sie sei namhaft und erscheine in großer Auflage, bietet einen feststehenden Inhalt. Nur eine Seite wird jeweils neu gesetzt, sie enthält ein Foto der Hochzeitswilligen, verbunden mit ein paar Zeilen, die dem Brautpaar und der Familie schmeicheln. Für diese Leistung lässt sich die Redaktion üppig entlohnen. Als Beleg erhält die Hochzeitsgesellschaft die einzigen fünfzehn Abzüge, die überhaupt gefertigt werden.
Steinschneider lernt schnell und variiert das Geschäftsmodell. Er tritt in die Redaktion eines Wiener »Illustrierten Wochenblatts« ein, das unter dem Titel »Der Blitz« vertrieben wird. Dieses Blatt lebt wahlweise davon, alle möglichen Lokalskandale, Themen rund um Prostitution, Korruption und Homosexualität entweder breitzutreten und über die Auflage Geld einzunehmen oder umgekehrt auf eine Bloßstellung der Betroffenen zu verzichten, wofür dann eine entsprechende Gebühr fällig wird. Unter der Ägide von Steinschneider erfährt diese gewinnträchtige Idee eine literarische Veredelung. Der neue Redakteur betätigt sich als Verfasser von zwei Romanwerken. Zunächst publiziert er die angeblich authentischen »Memoiren einer Schlangentänzerin«, deren Beziehungen, wie behauptet wird, in »die höchsten Kreise der Berliner Finanz- und Künstlerwelt« reichen: »Für sämtliche geschilderten Vorfälle besitzen wir die Beweise, welche in eisernem Tresor der Redaktion aufbewahrt werden.«
Dann beginnt er, den Fortsetzungsroman »Die Abenteuer des Major Quitsch« zu schreiben, der an verschiedenen Orten in Wien spielt. Die Protagonisten treten mit den ihnen im Roman zugeschriebenen Attributen als lebende Personen in der Stadt auf. Für deren Entdeckung durch Leser im »wirklichen Leben« setzt die »Blitz«-Redaktion einen Preis aus. Der Romanschreiber lässt in den jeweils frisch geschriebenen Kapiteln seine Figuren diverse Abenteuer in Wiener Vergnügungslokalen erleben, später auch in Kaufhäusern, bei Schuhmachern, Optikern oder Lackierern. Ob die Orte im Roman in einem positiven Licht erscheinen oder als abstoßend geschildert werden, hängt von der Zahlungswilligkeit der Inhaber ab, die der Romanautor persönlich erkundet, bevor eine neue Folge geschrieben wird.
Im Krieg ist Steinschneider zunächst in Olmütz stationiert, wo er Gedichte und Geschichten in der Lokalpresse publiziert. Er organisiert »Schützengrabentheater, Läusewettrennen, Tombolaspiele« und betätigt sich zum ersten Mal als Telepath. Mithilfe eines Freundes bei der Militärzensur lässt er Briefe zurückhalten, um dann in Séancen im Offizierskasino Informationen aus der Heimat zu »prophezeien«, die die Empfänger der Briefe erst mit drei bis vier Tagen Verspätung erfahren. Im mährischen Freiwaldau tritt er auf mit Programmpunkten wie »Das telepathische Kinedrama« und »Das Hypnotisieren von Fischen«. Er veröffentlicht 1917 im Selbstverlag eine Schrift über Telepathie. Auf diese Zeit gehen auch Steinschneiders frühe Erfahrungen mit der Wünschelrute zurück. Noch während des Krieges, im Frühjahr 1918, gibt er unter dem Pseudonym Erik Jan Hanussen – dem »Unteroffizier Steinschneider« ist der Auftritt untersagt – eine erste große Vorstellung vor dreitausend Gästen im »Wiener Konzerthaus«. Die Erzherzogin Blanca und der Erzherzog Leopold Salvator wohnen der Vorführung in der Loge bei. Es werden vier Stecknadeln versteckt, die der Magier mithilfe eines Mediums auffindet. Von seinem Lehrer Labéro hat er gelernt, dass sich junge Frauen als Medium am besten eignen, am wenigsten hingegen korpulente Männer. Eine Kommission von Ärzten überwacht die telepathische Übung, alles läuft nach Plan.
Jetzt endlich kommt der Durchbruch, Hanussens Ruhm verbreitet sich auch in der Armee, das Gezerre zwischen den Militärinstanzen wird zu seinen Gunsten entschieden. Er muss nicht zurück an die Front, sondern wird, auch das gibt es im bunten Kosmos der k.-u.-k.-Welt, Kompanieführer eines »Rutenkommandos der österreichischen Armee«. Hier bildet er Soldaten, die Wasseradern muten sollen, an der Wünschelrute aus. Er verfügt über ein eigenes Haus mit Büro, einen Wagen mit Pferden und lässt sich eine Paradeuniform mit Wünschelruten auf den silbernen Kragenspiegeln schneidern.
Nach dem Krieg kann Hanussen an seinen Erfolg anknüpfen. 1919 tritt er in Wien in sechzehn ausverkauften Vorstellungen vor beinahe fünfzigtausend Personen auf. Doch treibt er es auch hier bald wieder zu weit. Er hypnotisiert Männer und Frauen und bringt sie dazu, sich als Hund oder Katze, bellend und miauend, auf allen vieren durch den Saal zu bewegen. Daraufhin ergeht ein behördliches Hypnoseverbot, das der Magier für kurze Zeit mit der originellen Behauptung umgehen kann, bei der von ihm geübten Praxis handle es sich nicht um Hypnose, sondern um »Wachsuggestion«. Zur gleichen Zeit will Hanussen einen Wiener Großindustriellen, der aus Angst vorm Ersticken nicht schlucken konnte, durch Hypnose geheilt haben. In Nürnberg wettet er mit dem Luftverkehrsverein um zehntausend Mark, dass er ihm aus der Höhe von fünfhundert Metern von einem Flugzeug aus zugestellte »Gedankenbefehle« exakt ausführen könne. Sodann soll Hanussen aus dem Flugzeug Personen aus dem Publikum »Suggestivbefehle« übermitteln: »Auch dieses Experiment gelang vollkommen.«
Eine Tournee führt den Varietékünstler durch Nordafrika und den Nahen Osten. In Port Said verliebt er sich in die junge Tochter des Gouverneurs. Zum ersten Mal, so gesteht er später seinem Sekretär, empfindet er wirkliche Zuneigung zu einer Frau. Es findet sich die Gelegenheit für ein ungestörtes Zusammensein, und er offenbart ihr seine aufrichtigen Gefühle. Sie ist ihm zugeneigt, aber etwas hindert ihn daran, den leichten Sieg zu kassieren, vielleicht die Ahnung, dass es auch ihm selbst nicht guttun würde, diese Grenze zu übertreten. Jedenfalls bekommt er Skrupel und flieht. Für Wochen stürzt er sich in einen wilden Vergnügungstaumel.
Nach seiner Rückkehr liefert sich der inzwischen berühmte Magier einen Kleinkrieg mit der Wiener Konkurrenz in Gestalt von Siegmund Breitbart, einem der vielen »stärksten Männer der Welt«, die in jenen Tagen die Bühnen bevölkern. Hanussen möchte den Konkurrenten bloßstellen, indem er dessen vermeintliche Attraktionen von einem »schwachen Weib« imitieren lässt. Zu diesem Zweck engagiert er eine stellungslose Probiermamsell, die achtzehnjährige Martha Kohn. Sie erhält den Künstlernamen »Martha Farra« und tritt fortan als »Eisenkönigin« auf, die Ketten zerbeißt und dicke Eisenstangen verbiegt. Breitbart antwortet auf diese Herausforderung, indem er sich im Etablissement »Ronacher« auf ein Nagelbrett legt und von einem mit zwölf Insassen besetzten Automobil für wohltätige Zwecke überfahren lässt – der Erlös kommt einer Lungenheilanstalt zugute. Daraufhin lässt sich Martha Farra »mit ungeschütztem Rücken« von einem Vierzylinder-Steyr-Auto überfahren. So geht das eine Weile weiter, in jeder Vorstellung gibt es Störer und Provokateure der Gegenseite und Handgemenge vor den Aufführungsorten. Der Wiener Polizei wird es mit der Zeit zu bunt, sie weist Hanussen für die Dauer von zehn Jahren aus der Stadt aus.
Seinem Ruhm tut das keinen Abbruch. Die Stadthallen sind voll, wenn er auf Tournee durch die Tschechoslowakei oder Deutschland zieht. Ein Gastspiel führt ihn und Martha Farra nach New York. Die Amerikaner treiben es auf die Spitze und lassen ihn gemeinsam mit seinem Lieblingsfeind Breitbart auftreten. Martha Farra soll auf dem Times Square einen Baby-Elefanten angehoben haben. Zurück in Europa, wird Hanussen zur Aufklärung von spektakulären Kriminalfällen herangezogen. Bei Planung seiner Tourneen strebt er immer auch eine Séance in der lokalen Gendarmerie an, um den polizeilichen Eifer bei möglichen Betrugsanzeigen zu dämpfen, Honoratioren werden überdies mit Freikarten bedacht. Die Mitarbeit bei der Auflösung von Verbrechen beutet der Magier im Erfolgsfall werbeträchtig aus, im andern Fall lässt er sie unter den Tisch fallen. Im Herbst 1927 soll Hanussen einer Dame im Publikum Schmerzen durch Peitschenhiebe suggeriert haben. Nicht jedem gefällt das. Bekannt ist, dass Hanussen auf Skeptiker im Publikum barsch reagiert, sie bloßstellt und lächerlich macht. Misslingt ein Versuch, so herrscht er das Medium an: »Sie sind kein Medium! Melden Sie sich nie mehr zu solchen Experimenten!«
Nach einer Veranstaltung im böhmischen Teplitz wird der Hellseher wegen Betrugs verhaftet und in das Bezirksgefängnis eingeliefert. Über den Prozess im tschechischen Leitmeritz wird europaweit berichtet, Zeugen sprechen für und wider Hanussen, er selbst gibt eine Probe seiner Kunst im Gerichtssaal. Es geht um nichts Geringeres als darum, auf rechtlichem Weg die Frage zu klären, ob es übersinnliche Kräfte gebe. Auch wenn sich das Verfahren letztlich über mehr als zwei Jahre hinzieht, wird bald deutlich, dass juristische Instrumente wenig geeignet sind, diese Frage abschließend zu beantworten. Der Prozess endet im Mai 1930 mit einem Freispruch für den Hellseher. »Nichts ist unbarmherziger und grausamer«, schreibt er in seiner Autobiographie, »als das Publikum, wenn es seine Überlegenheit fühlt. Nichts ist kleiner und furchtsamer als das Publikum, wenn es gebändigt ist.«
6
Weit gebracht hat es Hanussen 1930 in Berlin, in der Stadt, die er am meisten liebt »von allen Städten der Welt. Man mag auf die Preußen schimpfen, soviel man will, mir gefallen sie großartig. […] Beim Berliner weiß man wenigstens, woran man ist. Er ist kotzengrob und hat die größte Fresse von der Welt. Trifft er aber einen, der eine noch größere Fresse hat als er, dann wird er ganz klein und zierlich. In Berlin ist alles da, Amerika und Nizza, Port Said und Lemberg, alles ist da, und darum liebe ich diese Stadt wie keine zweite in der Welt.« Aber auch Berlin liebt Hanussen: ausverkaufte Vorstellungen im »Alhambra«, im Bach- oder im Beethoven-Saal der Philharmonie vor bis zu zweitausend Besuchern, nicht selten zweimal täglich, nachmittags und abends. Lange hat er gefeilt an den Details seiner Auftritte und die Wirkung getestet: Beim Hellsehen legt der Magier eine schwarze Binde um die Augen und lässt die Perlen des Gomboloy, einer orientalischen Perlenschnur, die er als »Hypnoskop« benutzt, durch seine Finger gleiten. Hanussen, von gedrungener Gestalt, etwa 1,65 Meter groß, setzt seinen ganzen Körper ein, er gerät in Trance, beginnt zu zittern und zu zucken, bäumt sich auf und sinkt bewegungslos zusammen. Am Ende wirkt es, als wäre der Meister kurz davor, zusammenzubrechen. Gestützt von seinem Assistenten, wird er von der Bühne geleitet, zweimal am Abend …
Inzwischen kann Hanussen den Ansturm seiner Klienten nur noch mit der Unterstützung zweier Sekretärinnen bewältigen, er besitzt zwei Wagen und hat sich die Luxusmotoryacht »Ursel IV« zugelegt. Der steile Aufstieg vom Nachtasyl in der Hundehütte bis zur Luxussuite im »Eden-Hotel« in der Budapester Straße hat jedoch seinen Preis. Drei Ehen ist er eingegangen, alle drei sind gescheitert an seiner Egomanie und seiner sexuellen Unersättlichkeit – dreißig Fälle von Ehebruch will sein einstiger Sekretär Juhn in den zwei Jahren ihrer Zusammenarbeit gezählt haben. Hanussens Straße zum Ruhm ist gepflastert mit juristischen Scharmützeln, mit Klagen von Konkurrenten und einstigen Mitarbeitern, die sich plagiiert oder in ihrer Berufsehre angegriffen glauben, und von Klienten, die sich betrogen fühlen. Natürlich ist er auch in Berlin nicht ohne Konkurrenz in seinem Metier. Was ihn von seinen Zunftgenossen abhebt: Er schraubt in der Frage um Betrug oder Glaubwürdigkeit die Spirale noch um eine Drehung weiter, indem er sich in die Trickkiste schauen lässt. Er setzt sich offensiv der Kontrolle aus und lädt dazu ein, die Stimmigkeit seiner Prophezeiungen zu überprüfen. In seinen Büchern schreibt er sogar frei darüber, wie es ihm gelingt, das Publikum zu manipulieren, freilich nicht ohne den Hinweis zu versäumen, es gebe einen Rest, der auch ihm unerklärlich sei.
Die Zeiten sind fruchtbar für Magie, was könnte anderes noch helfen angesichts der Not? Die Krise erfasst alle Schichten der Gesellschaft, die Angestellten und Arbeiter nicht weniger als die Selbständigen. Sprunghaft steigt die Zahl der Selbstmorde aufgrund von Firmenpleiten. In Nürnberg erregt im Oktober 1930 der Fall des Kaufmanns und Kapitäns a. D. Staufer Aufsehen. Er erschießt zunächst seine Ehefrau: »Als kurz darauf sein zwölfjähriger Sohn von der Schule heimkam, tötete er auch diesen. Hierauf brachte er sich selbst einen lebensgefährlichen Schuss bei. Er starb im Krankenhaus. Der Grund zur Tat ist in wirtschaftlicher Notlage zu suchen.«