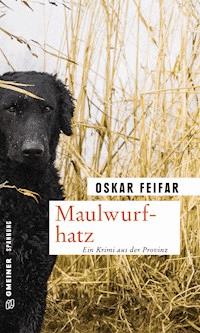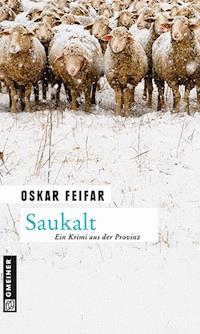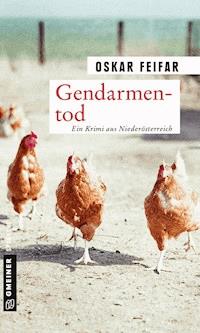Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Postenkommandant Poldi Strobel
- Sprache: Deutsch
Eine Gruppe Hippies mit ausgeprägtem Hang zum Nudismus, drei verschwundene Personen aus derselben Familie, eine Leiche und ein paar herrenlose Fingerspitzen sorgen für Aufregung auf dem Gendarmerieposten in Tratschen. Es gibt keine Zeugen und die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Ausgerechnet zu dieser Zeit betoniert der Nachbar eines Opfers ein neues Garagenfundament. Bezirksinspektor Strobel entdeckt erste Ungereimtheiten und die Lösung des Falles rückt am Ende doch noch in greifbare Nähe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oskar Feifar
Fingerspitzengefühl
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Sarah Harnisch / photocase.com
ISBN 978-3-8392-4336-7
Widmung
Für meinen allerbesten guten Freund Christian, genannt Ressi, und seine Familie. Passt auf euch auf!!!
Kapitel 1
Die echten, oder wenn du so willst, die originalen Hippies haben ihre Bewegung 1967 symbolisch begraben. So richtig mit Sarg und so. Es störte sie nämlich, dass so viele Menschen ihre Idee geklaut, sie abgewandelt und wie eine Seuche über den Erdball verbreitet haben. Ergo trugen sie sich selbst zu Grabe. Die nicht ganz so originalen Blumenkinder setzten indes noch viele Jahre ihren Siegeszug um die Welt fort und drangen dabei in ziemlich entlegene Winkel vor, in denen man oft nichts mit ihnen und ihrer Art zu leben anzufangen wusste. Bis zu jenem denkwürdigen Tag Anfang Juli 1972, an dem ein mit Blumen bemalter VW-Bus vor dem Haus der Pfeifer Resi anhielt und zwei Vertreter dieser Subkultur ausspuckte, war die Hippiebewegung auch in Tratschen weitgehend unbeachtet geblieben. Ich meine, die Leute hatten natürlich schon etwas von den Blumenkindern gehört. Keine Frage. Aber so wirklich hatte sich keiner für sie interessiert. Auch dann noch nicht, als die Pfeifer Resi herumerzählte, dass es ihr gelungen war, ihr Elternhaus an ganz entzückende junge Leute zu vermieten. Richtig glücklich war die alte Dame darüber. Das konntest du schon daran erkennen, dass sie das Wort ›entzückend‹ sicher fünfmal wiederholte und dabei extrem betonte. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, dass bald ein entzückendes junges Paar in den alten Pfeifer-Hof einziehen würde, im ganzen Ort und die Bewohner waren äußerst gespannt. Lange mussten sie nicht warten. Schon zwei Tage später kam der Bus wieder. Mit dem entzückenden Pärchen und weiteren acht mindestens genauso entzückenden Menschen, die sich nach und nach aus der Enge des Fahrzeuges quälten. Genau vor dem Kaufhaus Hörmann. Und was glaubst du, wie den Tratschweibern da die Worte im Hals stecken geblieben sind, als sie die sieben Frauen in ihren Blumenkleidern und die fünf Männer in den weiten, ausgefransten Jeans und den Leinenhemden sahen. Allesamt mit langen Haaren auf dem Kopf und Jesuslatschen an den Füßen. Auf dem Dach des Busses stapelte sich die dürftige Habe der seltsamen Gruppe. Nach einem kurzen Palaver ging der Fahrer ins Kaufhaus. Ihrer Natur entsprechend, beobachteten ihn die einheimischen Frauen dabei misstrauisch. Seinen freundlichen Gruß erwiderten sie allerdings nicht. Das heißt, mit Ausnahme der alten Hörmann. Die war wenigstens noch so viel Geschäftsfrau, dass sie ein »Grüß Gott« murmelte. Schließlich konnte man ja nie wissen, ob der Kerl nicht doch etwas kaufen würde. Vor Freundlichkeit überschlagen hat sie sich dann aber nicht unbedingt, als sie spitzkriegte, dass der etwas zerfleddert aussehende Bursche nichts kaufen, sondern nur nach dem Weg zum Pfeifer-Hof fragen wollte. Den anwesenden Kundinnen war anzusehen, dass sie alle sehr froh waren, dass der Hof etwas außerhalb des Ortes lag. Kaum war der Bursche wieder draußen, ging das Maulzerreißen los. Dass es wohl nicht wahr sein könne, dass die Resi ihr Haus an so ein Gesindel vermiete, dass die alle so aussähen, als hätten sie Flöhe und Wanzen, dass es mit diesen Leuten sicher nur Probleme geben würde und es mit der Ruhe im Ort jetzt sicher vorbei sei. So einen Quatsch redeten sie daher. Die tratschenden Weiber stachelten sich untereinander derartig auf und versetzten sich mit ihren Prophezeiungen, was die schlimme Zukunft mit den neuen Ortsbewohnern anging, gegenseitig derart in Furcht und Unruhe, dass jeder Verhaltensforscher seine helle Freude an ihnen gehabt hätte. Von außen betrachtet, sah die Szene wirklich witzig aus. Denn sieben ungläubig starrende Frauengesichter in der Auslage eines Kaufhauses sah man auch nicht jeden Tag. Schon gar nicht neben einem Bild der Milka-Kuh. Ein paar Stunden später wusste das ganze Dorf, dass die Resi an sehr zweifelhafte Menschen vermietet hatte.
Auf dem Gendarmerieposten bekamen der Strobel und seine Mannen von alledem vorerst nichts mit. Die Herren waren nämlich mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Ein Urlaubsplan musste erstellt werden. Ich meine, immerhin war Sommer und der Plan hätte schon vor zwei Wochen fertig sein sollen. Es war also allerhöchste Zeit, wenigstens einmal darüber zu reden. Irgendwie wurden sie sich aber nicht darüber einig, wer wann und wie lange Urlaub machen sollte. Aber nicht, weil sie alle zur gleichen Zeit gehen wollten, sondern weil jeder meinte, dass es ihm wurscht sei. Was soll ich dir sagen? Es gibt fast nichts Schlimmeres als eine Diskussion unter Leuten, denen das Thema wurscht ist. Wenn keiner anfängt, Vorschläge zu machen, kommt man in so einem Gespräch nicht recht weiter. Der Strobel, in seiner Eigenschaft als gutmütiger und fast schon zu demokratischer Postenkommandant, wollte natürlich keinem seiner Mitarbeiter vorschreiben, wann er Urlaub zu machen hatte, und meinte deshalb, die beiden sollten sich untereinander einigen. So ist es halt gekommen, dass nach über einer Stunde Urlaubsplanung noch immer nichts im Plan eingetragen war. Eine Tatsache, die dem Strobel gehörig auf die Nerven ging. Er meinte, dass es für zwei Leute so schwierig nicht sein könne, sich da einig zu werden. Ganz unrecht hatte er damit nicht. Der Berti sah das allerdings ein bisschen anders und stellte fest, der Strobel könne genauso gut als Erster einen Termin eintragen. Geändert hat das aber nichts. Und weil der Pfaffi halt einmal der Jüngste war und es sich mit seinen Kollegen nicht ganz verderben wollte, gab er irgendwann nach und sagte, dass er in der letzten Juli- und der ersten Augustwoche daheimbleiben wolle. Und wenn du jetzt glaubst, die Diskussion war damit beendet, täuschst du dich gewaltig. Das war nämlich ein Termin, der dem Berti auf einmal gar nicht mehr wurscht war. Das erboste wiederum den Strobel. Er schmiss den Stift auf den Tisch und verkündete, dass er sich langsam wie im Kindergarten vorkomme. Noch dazu hatte der Berti offenbar keinen wirklichen Grund, gegen den Termin vom Pfaffi zu sein. Zumindest konnte er keinen nennen. Da machte der Strobel von seiner Chefposition Gebrauch und zog sich geschickt aus der Affäre. Er kündigte nämlich an, zum Wenger zu gehen und dort eine Kleinigkeit zu essen. Bevor er die Tür von außen schloss, stellte er noch fest, dass sich die beiden Herren in seiner Abwesenheit einig werden sollten, weil er den Plan sonst ohne Eintragung zum Bezirkskommando schicken würde. Mit diesen Worten setzte er seine Mütze auf und verschwand. Der Berti und der Pfaffi kamen auf die glorreiche Idee, die Urlaubssache auszuknobeln. Schere, Stein, Papier. Über eine Stunde lang. Du kannst dir jetzt wahrscheinlich schon denken, dass die Beamten am Gendarmerieposten in Tratschen nicht sehr ausgelastet waren. Hätten sie nämlich etwas zu tun gehabt, wäre ihnen so ein Blödsinn sicher nicht eingefallen. Aber zur Verteidigung der Gendarmen muss gesagt werden, dass es nicht ihre Schuld war, dass sich nichts Außergewöhnliches ereignete. Das heißt, fast nichts. Ein paar Kleinigkeiten passierten freilich schon. Anrufe vom Haberl oder seinem Intimfeind, dem Rollinger, die sich immer wieder wegen irgendwelcher Blödheiten in die Haare bekamen. Die eine oder andere Beschwerde, weil jemand am Sonntag Rasen mähte, was immerhin laut der von der Gemeinde erlassenen Rasenmäherverordnung verboten war. Streitigkeiten zwischen Besoffenen, da und dort eine Rauferei, hin und wieder ein Unfall und so was alles. Alltagsgeschäft eben. Das haben die Gesetzeshüter natürlich immer prompt und ordentlich erledigt. Gar keine Frage. Quasi immer Gewehr bei Fuß, die Burschen. Was die Vergangenheit betraf, war alles schon so gut wie vergessen. Der Fellner Fritz, die Wenger Traude, der Brauneis Thomas, der abgebrannte Hexenwinkel. Alles so gut wie vergessen. Und der Pfaffi war mittlerweile so weit, dass er alleine Dienst machen konnte. Das war eine deutliche Verbesserung, weil so jeder der Beamten mehr Freizeit hatte. Das kam dem Berti sehr entgegen. Dem Strobel nützte es weniger, weil der unter der Woche sowieso fast immer da war. Von so kleinen Ungereimtheiten wie Urlaubsplanung einmal abgesehen, vertrugen sich die Gendarmen bestens. Aber auch dieses Thema war letztendlich nach unzähligen Knobelrunden vom Tisch. Der Pfaffi durchschaute sein Gegenüber irgendwann und der Berti, ganz der gute Verlierer, nahm seine Niederlage ohne ein weiteres Wort zur Kenntnis und trug sich die zweite und dritte Juliwoche ein.
Kapitel 2
Währenddessen saß der Strobel ganz entspannt beim Wenger Sepp im Gastgarten und las Zeitung. Der Garten war in diesem Jahr zum ersten Mal geöffnet und die Leute nahmen diese Errungenschaft dankbar an. Mit den knorrigen Kastanienbäumen, die seit ewigen Zeiten hinter dem Wirtshaus standen, den urigen Holzbänken und Tischen und dem Kiesboden wirkte der Garten wirklich gemütlich und lud zum Verweilen ein. Vor allem, weil er schön schattig und damit auch kühl war. Gerade an den Hundstagen im Hochsommer schadete ein solches Refugium nicht. Trotzdem der Strobel ein paar Monate zuvor die Tochter vom Sepp ins Gefängnis gebracht hatte, ging er immer noch regelmäßig in das Wirtshaus, um seine Würsteln mit Saft zu essen. Wenn es um sein leibliches Wohl ging, hatte der Postenkommandant überhaupt keinen Genierer. Und dass der Wenger den besten Gulaschsaft von ganz Tratschen und Umgebung machte, war für den Strobel eine unbestreitbare Tatsache. An diesem Saft gab es nichts auszusetzen. Nicht das Geringste. Außerdem war der Wenger Sepp wegen der Sache nicht sauer auf den Postenkommandanten. Weil, erstens hatte der nur seine Arbeit gemacht und zweitens war es der Sepp selber, der dem Strobel alles über die Machenschaften seiner Tochter erzählt hatte. Von daher also kein Grund für böses Blut. Ich meine, Freunde sind die beiden deswegen freilich auch keine geworden. Weil sie das aber vorher auch nicht waren und seine Lieblingsspeise deswegen nicht schlechter schmeckte, war das für den Strobel nicht weiter tragisch. Wie der Wenger über diesen Punkt dachte, weiß man nicht. Jedenfalls saß der Strobel im Schatten von einem dieser Kastanienbäume, las Zeitung und verspeiste dabei genüsslich seine Würsteln. Ein Moment, in dem er keinesfalls gestört werden wollte. Ein Umstand, der dem Fürnkranz Josef allerdings nicht bekannt gewesen sein dürfte. Zumindest gab es keine andere Erklärung dafür, dass der, als er den Postenkommandanten erblickte, sofort zielstrebig auf dessen Tisch zusteuerte und sich, ohne lange zu fragen, zu ihm setzte. Irritiert sah der Strobel von seiner Zeitung auf und fragte sich insgeheim, wieso sich der Mann in einem leeren Gastgarten ausgerechnet an seinen Tisch setzen musste. Laut gesagt hat er das aber nicht. So unhöflich wollte er zum Bürgermeister nicht sein. Also grüßte er ihn knapp und vertiefte sich wieder in seine Zeitung. Der Fürnkranz war allerdings nicht umsonst als besonders leutseliger Typ bekannt. Das kam daher, weil er gerne und vor allem viel redete. Hilfsbereit, freundlich und immer mit einem offenen Ohr für seine Bürger. So war der Fürnkranz Josef Zeit seines Lebens. Normalerweise störte es den Strobel nicht, wenn ihn der Herr Bürgermeister in ein Gespräch verwickelte, auf das er gut und gerne hätte verzichten können. Aber jetzt, in seinem Moment der Ruhe, den er sich hier gönnen wollte, störte es ihn schon. Blöd nur, dass er zu höflich war, seinem Gegenüber das zu sagen. Von daher blieb ihm nichts anderes übrig, als so zu tun, als würde er dem sinnlosen Geplapper wirklich zuhören. In Wirklichkeit hatte er seine Ohren auf Durchzug gestellt. Bis zu dem Augenblick, in dem der Fürnkranz meinte, dass er ihn um einen kleinen Gefallen bitten wolle. Da ist der Strobel dann doch aufmerksam geworden. Weil, aus Erfahrung wusste er, dass es gefährlich sein konnte, wenn einem jemand einen ›kleinen Gefallen‹ abverlangte. Oft stellte sich nämlich heraus, dass dieser Gefallen so klein gar nicht war. Wenn man da nicht genau zuhört, kann man ganz schön einfahren bei der Gefallentunsache. Dieser Fall stellte sich aber als halb so schlimm heraus. Der Bürgermeister erzählte dem Strobel nämlich, dass die Jocha Elisabeth, die alle im Ort nur ›die Jocha Mutter‹ nannten, in zwei Tagen ihren hundertsten Geburtstag feiern würde, und er, zusammen mit zweien seiner Gemeinderäte, zu ihr fahren wolle, um ihr im Namen der Gemeinde zu gratulieren und einen großen Blumenstrauß zu überreichen. Weil, so meinte der Fürnkranz, so ein hundertster Geburtstag sollte schon gebührend beachtet werden. Da gab ihm der Strobel zwar recht, blieb aber trotzdem auf der Hut. Schließlich wusste er immer noch nicht, was das alles mit ihm zu tun hatte. Und siehst du, diesmal war die Vorsicht vom Strobel unbegründet. Weil, der Fürnkranz verlangte nichts Unmögliches von ihm, sondern fragte ihn nur, ob er vielleicht seine Ausgehuniform anziehen und mitgehen könne, um der Sache ein bisschen mehr Glanz zu verleihen. Ja, wirklich, so drückte sich der Fürnkranz aus. Der Strobel solle mitgehen, um der Sache mehr Glanz zu verleihen. Also ich finde, dass das ein nettes Kompliment war. Man könnte dem Herrn Bürgermeister allerdings auch unterstellen, dass er dem Postenkommandanten einfach nur Zucker in den Hintern blies, um ihm ein Nein schwerer zu machen. Aber wie dem auch sei. Noch bevor der Strobel eine Antwort geben konnte, informierte ihn der Fürnkranz darüber, dass auch ein Fotograf vom Bezirksanzeiger kommen würde, um ein paar Bilder zu schießen, die dann in der nächsten Ausgabe erscheinen sollten. Dann drosch er noch so Phrasen wie: ›Ehre, wem Ehre gebührt‹, ›Man muss die Feste feiern, wie sie fallen‹ und ähnlichen Mist. Das hätte er sich aber auch sparen können, weil der Strobel sowieso schon wusste, dass er um die Geschichte nicht drum herumkommen würde. Und das wollte er auch gar nicht. Für die Jocha Mutter machte er das nämlich gerne. Ich meine, er kannte ihre Lebensgeschichte vom Hörensagen und wusste deshalb, dass es die Frau immer sehr schwer gehabt hatte. Von daher war er überzeugt, dass sie sich eine kleine Ehrung zu ihrem Hundertsten redlich verdient hatte. Auch wenn es aus seiner Sicht vielleicht ein bisschen spät war, um von der Elisabeth Notiz zu nehmen. Andererseits, so überlegte er sich, war spät immer noch besser als gar nicht. Deshalb sagte er sein Kommen für Mittwoch, 10.00 Uhr Vormittag, natürlich zu. Sehr zur Freude vom Bürgermeister, der ihn daraufhin auf einen Kaffee einlud. Das heißt, er wollte eigentlich lieber ein Bier mit ihm trinken. Aber das lehnte der Strobel angesichts der frühen Stunde und der Tatsache, dass er im Dienst war, entschieden ab. Deswegen halt Kaffee. Schwarz ohne Zucker. So wie er ihn mochte. Allerdings zu einem hohen Preis. Weil, der Herr Bürgermeister hat geredet und geredet und geredet. Wie der sprichwörtliche Ölmann. Nichts von dem, was er von sich gab, war für den Gendarmen in irgendeiner Form interessant. Von Minute zu Minute fiel es dem Strobel schwerer, den konzentrierten Zuhörer zu mimen. Krampfhaft überlegte er, mit welcher Ausrede er sich aus dem Staub machen konnte. Zu seinem Glück brauchte er dann aber keine, weil der Fürnkranz selbst draufkam, dass er noch zu einem wichtigen Termin musste, und sich verabschiedete. Erleichtert blieb der Strobel noch eine Weile sitzen, um die Ruhe auszukosten, bevor er zurück zur Dienststelle ging. Die Sonne tat ihm gut und erhellte seine Laune. Er fühlte sich so richtig wohl und genoss die Wärme, als er die Hauptstraße entlangging. Um diese Jahreszeit war der Ort fast schon hübsch. Kaum ein Haus, vor dessen Fenstern keine üppig bepflanzten Blumenkästen angebracht waren. In diesem Jahr hatten die Ortsbildverschönerer offensichtlich die Farben Rot und Weiß auserkoren und bestimmt, wer welche Farbe verwenden musste. Rote Blumenkästen, weiße Blumenkästen. Von einem Haus zum nächsten. Immer schön abwechselnd. Das gefiel sogar dem Strobel gut, dem die Blumenkästen normalerweise nicht einmal auffielen. Seine Laune war für einen Montag überdurchschnittlich gut und er pfiff ein Liedchen. Am Hauptplatz angekommen, blieb er stehen, bewunderte die Blumenbeete, die der Sokol, seines Zeichens Gemeindegärtner, angelegt hatte, und beobachtete eine Gruppe von Kindern, die wie die Wilden auf ihren Fahrrädern durch die Gegend bretterten und dabei fröhlich lachten. Da und dort waren Frauen in den Vorgärten mit irgendwelchen Gartenarbeiten beschäftigt oder kehrten den Staub vor den Türen ihrer Häuser weg. Aber nicht unter den Teppich. Da war nur Platz für die Geheimnisse. Die Ruhe, die Blumen und die spielenden Kinder luden wirklich zum Verweilen ein. Man könnte auch sagen, dass der Ort sein wahres Gesicht in diesem Jahr hinter einer besonders hübschen Maske versteckte. Aber so sah der Strobel das natürlich nicht. Der freute sich einfach nur über das schöne Wetter. Genau wie die Kinder. Von daher stand ihm der Sinn nicht wirklich nach Arbeit und er ließ sich auf halbem Weg auf einer Bank nieder, um die Stimmung noch ein bisschen in sich aufnehmen zu können und über das vergangene Wochenende nachzudenken. Insgesamt gesehen, hatten er und seine Frau Doktor nämlich zwei sehr schöne Tage miteinander verbracht. Am Samstag waren sie mit dem Schiff von Korneuburg aus in die Wachau gefahren, hatten dort übernachtet und waren am Sonntag zurückgefahren. Das hatte dem Strobel unheimlich gut gefallen. Zumindest bis zu dem Moment, als seine Herzdame anfing, über das Zusammenziehen zu reden. Da hatte es ihm so ein kleines bisschen die Sprache verschlagen. Ich meine, nicht, dass du jetzt denkst, der Strobel hätte das überhaupt nicht gewollt oder so. Das ist nämlich nicht ganz richtig. Es kam nur so überraschend. Außerdem war er sehr zufrieden mit ihrer Beziehung und hatte bis dahin keine Gedanken an eine Veränderung verschwendet. Schon gar nicht an eine so gravierende. Aus seiner Sicht war alles bestens. Während der Woche Tratschen. Am Wochenende Hollabrunn. Da sah er keinen Fehler. Natürlich war ihm bewusst, dass er seine Flamme dann jeden Tag sehen würde, und das konnte er sich auch recht gut vorstellen, aber andererseits war er halt auch ein sehr bequemer Mensch. Soll heißen, dass ihm die Vorstellung, jeden Tag mindestens eine Stunde im Auto zu sitzen und zwischen Hollabrunn und Tratschen zu pendeln, nichts herausriss. Von zwei Stunden im verhassten Bus erst gar nicht zu reden. Jetzt brauchte er zu Fuß maximal zehn Minuten bis zur Dienststelle. Von daher hätte Umziehen eine Verschlechterung bedeutet. Umgekehrt hätte die Frau Doktor, wäre sie nach Tratschen gezogen, jeden Tag hin und her fahren müssen. Er selber hätte sich die Fahrerei zwar erspart, aber viel Sinn sah er auch in dieser Variante nicht. Ob die Frau Doktor überhaupt nach Tratschen hätte ziehen wollen, hatte er sie allerdings in dem Gespräch gar nicht gefragt. Obwohl ›Gespräch‹ vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck war. Man könnte eher von einem Monolog der Frau Doktor reden. Der Strobel hatte sich nämlich von seiner wortkargen Seite gezeigt. Da wirst du dich sicher nicht wundern, dass es zu keinem nennenswerten Ergebnis gekommen ist. Immerhin hatte er zugestimmt, darüber nachdenken zu wollen. Und sogar das hatte er nicht mit Worten gesagt, sondern nur mit dem Kopf genickt. So ist es halt gekommen, dass er jetzt auf seiner Bank hockte und versuchte, sich das Zusammenleben mit seiner Holden vorzustellen. Freilich war die Bequemlichkeit nicht der einzige Grund für seine Unsicherheit. Viel mehr Sorgen machte ihm die Frage, ob sie sich unter einem gemeinsamen Dach auf Dauer genauso gut vertragen würden wie jetzt. Weil, so ein bisschen ein Sturkopf war die Frau Doktor schon und kratzbürstig konnte sie auch werden, wenn ihr was nicht passte. Das darfst du jetzt aber nicht falsch verstehen und glauben, dass er die Frau vielleicht nicht genug mochte oder so. Ganz im Gegenteil. Voll vernarrt war er in sie. Aber weil halt mit dem Alter auch eine gewisse Reife kommt, waren solche Überlegungen aus seiner Sicht durchaus legitim. Schönes Wetter hin, Bank her. Zu einem brauchbaren Ergebnis kam er nicht. Nicht einmal ansatzweise. Schließlich hatte er ja nur ein paar Gedanken hin und her gewälzt. Das hättest du bestenfalls als Hirnwichserei bezeichnen können. Herausgekommen ist dabei nur, dass er am Mittwochabend unbedingt mit dem Pfarrer Römer über dieses Thema reden wollte. Weil, Hochwürden hatte immer gute Ratschläge auf Lager und würde auch in diesem Fall wissen, was zu tun war. Zumindest hoffte der Strobel das inständig. Kurz überlegte er sich, gleich ins Pfarrhaus zu gehen, verwarf den Gedanken aber wieder und hoffte, dass er das Problem bis zum Mittwoch eventuell doch selber würde lösen können. Schon lustig, dass sich so ein gestandener Mann wie der Strobel wegen so etwas so blöd anstellte.
Kapitel 3
Um 19.00 Uhr haben sich der Berti und der Pfaffi nach einem überaus ereignislosen Tag verabschiedet. Der Strobel musste auf der Dienststelle bleiben, weil er mit dem Nachtdienst dran war. Jetzt wunderst du dich vielleicht, wieso er Nachtdienst hatte, wenn er doch am Tag auch schon da war. Aber das ist schnell erklärt. Ein- oder zweimal im Monat machte jeder von den dreien vierundzwanzig Stunden hintereinander Dienst. Das hört sich aber viel schlimmer an, als es tatsächlich war. Im Normalfall passierte in der Nacht nämlich nichts und ein Klappbett gab es auch. Heutzutage geht es bei der Polizei nicht mehr so beschaulich zu. Viele von den kleineren Dienststellen auf dem Land sind zugesperrt worden. Auch die Dienststelle in Tratschen. Natürlich gibt es heute noch Gebiete, in denen kaum etwas passiert, aber so ruhig wie damals ist es nirgends mehr. Einbrüche, Autodiebstähle, Raubüberfälle, Taschendiebstähle, Gewaltdelikte, große und kleine Betrügereien, Unmengen an Vergehen im Straßenverkehr, Unfälle und so weiter. Alles ist viel mehr geworden. Überhaupt in und um die großen Städte. Da geht es ganz schön wild zu. Trotzdem leben wir immer noch in einem der sichersten Länder Europas. So gesehen hatten der Strobel und seine Männer unheimliches Glück, dass sie in jener Zeit Dienst machten. Auch, wenn ihnen das natürlich nicht bewusst war. Sie stöhnten auch damals schon, weil sie immer so viel zu tun hatten. Im Vergleich zu heute lebten sie trotzdem im Schlaraffenland. Schon alleine deshalb, weil ein Gendarm damals noch eine richtige Respektsperson war. Die meisten Leute hätten sich nicht getraut, einen der Gesetzeshüter blöd anzureden oder gar anzuspucken, wie das heute fast schon normal ist. Das muss auch einmal gesagt werden. Auch hatten die Menschen nicht so ein verzerrtes Bild von der Polizei oder Gendarmeriearbeit. Heutzutage werden im Fernsehen unheimlich viele Krimiserien gezeigt und viele Zuseher glauben ernsthaft, dass das real ist, was sie da zu sehen bekommen. Angefangen von wurstsemmelvernichtenden Schäferhunden, die außer Briefe schreiben alles können, über Spurensicherer, die am Tatort einen Faden finden und aus dem Stehgreif ein drei Minuten langes Referat über die Zusammensetzung und den Verwendungszweck halten, bis hin zu ermittelnden Mentalisten und Lügenspezialisten. Nicht zu vergessen die Gerichtsmediziner, die einfach losziehen, um die Mörder selber zu überführen. Es gibt nichts, was du in der Fernsehlandschaft nicht findest. Aber am besten sind die Serien, in denen sich der Held wilde Schusswechsel mit den bösen Buben liefert und gleich danach irgendwo gemütlich Kaffee trinkt, ohne auch nur eine Zeile zu schreiben. Das ist genauso real wie Autobahnpolizisten, die in jeder Serie mindestens einen sündhaft teuren Dienstwagen in einen verkohlten Haufen Blech verwandeln und als Belohnung dafür schon eine Stunde später ein noch tolleres Auto kriegen. Man mag diese Serien unterhaltsam finden oder auch nicht, aber mit der Wirklichkeit haben die überhaupt nichts zu tun. Das hat auch die Fernsehindustrie erkannt und Formate erdacht, in denen echte Polizisten bei ihrer täglichen Arbeit gefilmt werden. Reality TV nennt sich das auf Neudeutsch. Aber das ist bestenfalls ein Blick durchs Schlüsselloch. Mehr nicht. Wer will schon Ermittler sehen, die einen Großteil der Zeit am Schreibtisch verbringen, um irgendwelche Berichte zu tippen oder Statistiken zu befüllen? Genau, kein Mensch! Dann schon lieber explodierende Autos und Schusswechsel in der überfüllten U-Bahn. Das wollen die Leute sehen. Langweilige Jobs haben sie schließlich selber. Wie dem auch sei. Ich will mich bei dem Thema gar nicht länger aufhalten. Weil, mit dem Strobel oder dieser Geschichte hat das im Grunde nichts zu tun. Also, der Strobel hat jedenfalls an diesem Montag Nachtdienst gehabt. Und wenn du jetzt denkst, dass da sicher was passiert ist, muss ich dich leider enttäuschen. Außer dass er auf dem Klappbett schlecht geschlafen hat, ist gar nichts passiert. Um 07.00 Uhr ist der Berti gekommen und der Strobel ist zum Wenger frühstücken gegangen. Danach marschierte er direkt nach Hause, hüpfte unter die Dusche und machte sich bis zur Unkenntlichkeit schön. Paradeuniform, weiße Handschuhe, auf Hochglanz polierte Schuhe. Das volle Programm. Alles für die Jocha Mutter. Na gut, vielleicht auch, weil er gewusst hat, dass ein Fotograf vom Bezirksanzeiger kommen würde. Ein bisschen eitel war der Strobel nämlich schon und wollte in der Zeitung gut ausschauen. Pünktlich ist er schließlich auf dem Gemeindeamt gewesen. Der Bürgermeister wartete dort zusammen mit seinen Gemeinderäten, dem Fotografen und einem überdimensionierten Blumenstrauß in der Hand schon auf ihn. Mit dem Auto machte sich die Gruppe schließlich auf den Weg zum Hof von der Jocha Elisabeth. Dort angekommen, fiel dem Strobel sofort auf, wie desolat das Haus war. Die Fassade abgebröckelt, Löcher im Dach, kaputte Fenster und ein mit Unkraut überwucherter Vorgarten. Ich meine, natürlich konntest du da der Frau keine Vorwürfe machen. Weil, in ihrem Alter hat sie das unmöglich bewältigen können und Geld hatte sie auch keines. Bei dem Anblick dachte sich der Strobel, dass es wesentlich gescheiter gewesen wäre, die Gemeinde hätte einmal ein paar Arbeiter vorbeigeschickt, statt der Elisabeth einen Riesenstrauß zu schenken. Gesagt hat er das freilich nicht. Natürlich fiel der traurige Zustand des Anwesens nicht nur ihm auf. Alle haben es gesehen. Aber keiner kommentierte das irgendwie. Der Bürgermeister streifte sich seine Anzugjacke glatt und ging auf die Eingangstüre zu. Der Rest latschte im Gänsemarsch hinter ihm her. Auf sein Klopfen reagierte die Elisabeth allerdings nicht und die Männer gelangten zur Ansicht, dass sie sicher sehr schlecht hörte und sie einfach hineingehen sollten. Gesagt, getan. Der Fürnkranz voran, alle anderen brav hinterher. Schon im Vorraum ist allen die abgestandene Luft aufgefallen. Der Fürnkranz schlug deswegen vor, die Tür ein Stück offen zu lassen, damit frische Luft ins Haus konnte. Dann begann er, nach der Elisabeth zu rufen. Aber sie rührte sich nicht. Also fingen die Herren an, nach ihr zu suchen. Im Schlafzimmer wurde der Strobel schließlich fündig. Die Jocha Mutter lag im Bett und man hätte meinen können, dass sie schlief. Wenn da der bestialische Gestank und die vielen Fliegen nicht gewesen wären. Überall im Raum hörte der Strobel das Summen von den Biestern. Kaum eine Stelle, wo sie nicht saßen. Auf den Möbeln, an den Wänden, an der Decke, den Fenstern und auf dem Gesicht von der Elisabeth. Wahrlich kein schöner Anblick. Das kannst du mir ruhig glauben. Um etwas mehr Licht in den Raum zu lassen, ging er zum Fenster und zog die Vorhänge zur Seite Und siehst du, mit mehr Tageslicht wirkte die Szenerie gleich gar nicht mehr so unheimlich. Die Fliegen fanden die plötzliche Helligkeit anscheinend nicht so toll und flogen wild durcheinander. Der Strobel holte sein Taschentuch hervor, hielt es sich über Mund und Nase und ging zum Bett. Der Anblick, der sich ihm da bot, erschreckte ihn furchtbar. Nicht, weil er jetzt sicher sein konnte, dass die Frau tot war, sondern weil er aus der Nähe erkannte, dass sie schon mumifiziert war. Und weil sich der Strobel in den letzten beiden Jahren noch immer nicht an den Anblick von grausigen Leichen gewöhnt hatte, wurde ihm wieder einmal schlecht. Er rief nach den anderen Männern und verließ dann rasch das Zimmer und auch das Haus. Im Hof kamen alle zusammen und ein sehr blasser Strobel berichtete, dass die Geburtstagsfeier wohl doch nicht stattfinden könne, weil die Elisabeth offensichtlich schon seit längerer Zeit mausetot war. Da haben die Männer fast ein bisschen bestürzt dreingeschaut. Aber nicht, weil sie so arg um die Elisabeth getrauert haben. Nein. Der Strobel hatte viel eher das Gefühl, dass der Bürgermeister und seine Gemeinderäte enttäuscht waren, weil sie jetzt nicht in die Bezirkszeitung kommen würden. Ganz anders der Fotograf. Ich meine, der hatte die Jocha Mutter zu Lebzeiten nicht gekannt. Von daher berührte ihn ihr Tod auch nicht wirklich. Er wollte unbedingt ins Haus zurück und Fotos von der Leiche machen. Ich glaube, heutzutage denkt sich keiner mehr was dabei, wenn ein Pressefotograf alles knipst, was ihm vor die Linse kommt. Großaufnahmen von Unfall- oder Mordopfern, Bilder von Leichenbergen auf Schlachtfeldern oder Ähnliches sind für uns völlig normal geworden. Kaum jemand lässt sich davon noch den Appetit verderben. Die Neugier ist stärker als Ekel oder gar Scham. Das alles wird gezeigt, weil die Leute es sehen wollen. Zumindest berufen sich die Medien darauf, dass die Zuschauer genau das sehen wollen. Vielleicht ist das auch so. Aber ich persönlich glaube, dass diese makabere Sensationsgier immer schlimmer geworden ist, seit man angefangen hat, derartige Bilder zu zeigen. Die Menschen in den Städten und Dörfern haben niemals verlangt, solche Grausamkeiten ins Wohnzimmer geliefert zu bekommen. Diese Lieferungen erfolgten unaufgefordert. Frei Haus quasi. Und wenn du genau aufpasst, wirst du feststellen, dass ständig dafür gesorgt wird, dass wir immer mehr abstumpfen und uns immer schlimmere Sachen anschauen. Sei’s drum. Damals war das jedenfalls noch nicht ganz so arg. Von daher untersagte der Strobel dem Fotografen, noch einmal in das Haus zu gehen. Und als der Mann protestierte, kam der Strobel auf die sensationelle Idee, ihm einzureden, dass man vorerst von einem möglichen Tatort ausgehen müsse, weil man ja noch nicht wissen könne, ob die Frau eines natürlichen Todes gestorben sei. Falls sie umgebracht worden sei, so hat der Strobel dem Mann gesagt, könne es sein, dass er Spuren vernichte, wenn er noch einmal hineingehe. Und siehst du, das hat der Typ ohne weiteres Murren zur Kenntnis genommen. Für den Strobel war so eine kleine Lüge immer noch besser, als mit dem Fotografen zu streiten. Das hätte er sicher anders gesehen, wenn er in dem Moment schon gewusst hätte, was für Folgen diese kleine Lüge noch haben würde. Hat er aber nicht. Nach einer Weile stieg die Delegation wieder in die Fahrzeuge und der Strobel ersuchte den Bürgermeister, doch bitte beim Gendarmerieposten vorbeizufahren und ihn dort aussteigen zu lassen.
Kapitel 4
Manche Ereignisse bewegen die Menschen. Manche nicht. Der Tod der Jocha Mutter berührte die meisten Tratschener nicht. Man könnte auch sagen, es war ihnen egal. Natürlich ist beim Hörmann kurz darüber geredet worden, aber eben nur kurz.
»Hast du schon gehört, die alte Jocha hat den Löffel abgegeben.«
So in der Art. Kein Wort des Bedauerns, keine Anteilnahme. Jetzt kannst du natürlich sagen, dass der Tod zum Leben dazugehört und es ganz normal ist, dass alte Menschen irgendwann sterben. Und natürlich hast du damit vollkommen recht. Alte Menschen sterben. Gar keine Frage. Das ist mir klar und dem Strobel war das damals auch klar. Trotzdem hat er jetzt mit dieser Tatsache gehadert. Aber nicht, weil die Elisabeth gestorben ist, sondern wegen dem Wie. Einsam und völlig unbemerkt ist sie gegangen und dann einige Monate in ihrem Bett gelegen. Zumindest meinte der Arzt, dass sie schon seit mindestens zwei Monaten da gelegen hatte. Stell dir das einmal vor. Zwei Monate lang hat keiner der Dorfbewohner bemerkt, dass die Jocha Mutter fehlt. Dabei war die buckelige Alte mit ihrem Stock und dem Glasauge nicht gerade eine unauffällige Erscheinung. Ich weiß, man soll über Tote nicht schlecht reden, und ich meine das jetzt auch gar nicht böse, aber die Elisabeth hätte vom Äußeren her locker jeder Märchenhexe Konkurrenz machen können. Von daher hätte es eigentlich jemandem auffallen müssen, dass sie von einem Tag auf den anderen keine Spaziergänge mehr durch den Ort machte. Niemand hatte sie vermisst. Der Hörmann, wo die Elisabeth seit Jahrzehnten ihre Milch und ihr Brot gekauft hatte, nicht, seine anderen Kunden ebenso wenig, keiner von den Leuten, an deren Häusern sie jeden Tag vorbeigekommen ist, der Pfarrer, Römer, nicht und was den Strobel am meisten traf, auch die Gendarmen nicht, denen sie regelmäßig begegnet war. Ja, der Strobel machte sich Vorwürfe, weil er nie auf die Idee gekommen war, einmal bei der Elisabeth vorbeizufahren, um zu schauen, ob es ihr gut ging. Ich meine, nachträglich ist man bekanntlich immer klüger, und von seiner Reue hatte die Elisabeth jetzt nichts mehr, weil sie gestorben war. Aber trotzdem hatte der Mann natürlich recht. So ganz alleine sollte ein Mensch nicht sterben müssen. Auch dann nicht, wenn er selber keine Familie hat. Außerdem musst du dich da ja auch fragen, was mit den Leuten im Dorf nicht stimmte, weil die die Elisabeth so gekonnt ignoriert haben. Heutzutage passiert so etwas freilich auch. Sogar in den Städten, wo die Menschen Tür an Tür wohnen. Da fällt es oft noch viel länger keinem auf, dass der Nachbar sich nicht rührt. Wenn es nicht gerade aus der Wohnung heraus stinkt oder der Briefkasten derart überquillt, dass es störend wird, hast du es da als Leiche oft viel ruhiger als auf dem Friedhof, weil nicht so viele Besucher kommen, die über deinem Schädel herumlatschen. Da sind manche schon so lange gelegen, dass nur noch ihr Skelett übrig geblieben ist. Unglaublich! In diesen Fällen schiebt man das gerne auf die Anonymität der Großstadt. Aber in Tratschen hat es diese Anonymität nicht gegeben. Die Leute steckten ihre Nasen mehr in die Angelegenheiten anderer als in die eigenen. Neugier, Klatsch und Tratsch waren an der Tagesordnung und einer kannte den anderen. In einem so kleinen Ort war gar kein Platz für Anonymität. Versuch einmal, dich in so einem Kaff zu verstecken, wenn du deine Ruhe haben willst. Das schaffst du fast nicht. Trotzdem hatte die Elisabeth ganze zwei Monate warten müssen, bis sie gefunden wurde. Kein Paradebeispiel dafür, wie wir miteinander umgehen sollen. Obwohl, ganz so hart darf man dann auch wieder nicht mit den Menschen ins Gericht gehen. Zumindest nicht mit allen. Vielleicht ist es dir ja auch schon einmal passiert, dass dir aufgefallen ist, dass du jemanden schon länger nicht gesehen und dir überlegt hast, diese Person anzurufen, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Aber dann hast du einfach nicht mehr daran gedacht, weil du mit deinem eigenen Leben so beschäftigt warst, und irgendwann hast du es ganz vergessen oder erfolgreich verdrängt. Den Anruf und die Person. Einfach so. Aus den Augen, aus dem Sinn, wie das Sprichwort sagt. Aber wie dem auch sei. Viele hat es in Tratschen jedenfalls nicht gegeben, die so wie der Strobel gedacht und sich bei der Nase genommen haben. Wahrscheinlich war es sein schlechtes Gewissen, das ihn dazu brachte, sich selbst um die Sache zu kümmern. Weil, das hätte er an seinem freien Tag natürlich nicht machen müssen. Obwohl er das dem Berti überlassen und nach Hause hätte gehen können, wartete er, bis die Elisabeth abgeholt wurde. Am frühen Nachmittag kam dann die Haslauer Marion auf die Dienststelle und meldete, dass ihr Chef seit gestern nicht zu Hause gewesen sei und sie sich deswegen Sorgen mache. Dazu musst du wissen, dass die Marion beim Bremer Ferdinand als Haushälterin arbeitete. Der Bremer gehörte zu den reichen Leuten in der Gegend und wohnte drüben, im 15 km entfernten Mariendörfl. Das war ein winzig kleiner Ort, in dem insgesamt nur knapp 100 Leute gelebt haben. Lauter ›Großkopferte‹, wie man sie in der Gegend bezeichnete. Weil, im Mariendörfl residierten nur besonders wohlhabende Angehörige der Lokalprominenz. Und der Bremer Ferdinand gehörte da dazu. Er war nicht nur Besitzer einer riesigen Speditionsfirma, die ihren Hauptsitz in Wien hatte, sondern war auch politisch sehr aktiv. Soll heißen, er saß im Bundesrat. Daneben betrieb er noch einen Lebensmittelgroßhandel. Von daher hatte der Mann Geld wie Mist. Und das zeigte er auch gerne. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Immer musste alles besser und größer sein als bei den Nachbarn. Auch sein Haus. Jetzt musst du aber wissen, dass es im Mariendörfl keine kleinen Häuser gab, weil alle, die dort wohnten, unter dem Schlossbausyndrom gelitten haben. Nur große und luxuriöse Villen gab es da und die größte gehörte dem Bremer. Damit alleine begnügte sich der Mensch aber nicht. Nein. Er hatte seine Hütte auch noch auf einen Hügel bauen lassen, um auf die anderen Einwohner hinunterschauen zu können. Weil, das tat er gerne, der Bremer. Auf andere hinunterschauen. Von daher mochte ihn kaum jemand. Teils aus Neid und teils, weil ihn viele für ein Arschloch gehalten haben. Böse Zungen behaupteten, dass ihn nicht einmal seine drei Kinder mochten, die aus seinen zwei Ehen hervorgegangen waren. Noch bösere Zungen behaupteten, dass er seine beiden Ehefrauen mit seiner Gemeinheit in den Tod getrieben hatte. Letzteres war allerdings ein unhaltbares Gerücht, weil die beiden Frauen eines natürlichen Todes gestorben sind. Seine erste Frau, die Helena, an einem Herzinfarkt und die Hannelore, seine zweite, an Krebs. Danach hatte der Bremer das mit dem Heiraten bleiben lassen und lieber alleine gelebt. Das heißt, nicht wirklich alleine. Weil, alle seine Kinder waren nicht weit weg. Für die hatte der Bremer einfach noch drei Häuser bauen lassen. Aber nicht im Mariendörfl. Weil, dort hatte es keinen Platz mehr gegeben. Wirklich, so blöd sich das auch anhört. Es gab dort keine Baugründe mehr. Deswegen ließ er die Häuser in einem Nachbarort, nämlich in Neus, bauen. Schön nah beieinander. Wie es sich für eine so gut situierte Vorzeigefamilie halt gehört. Nur, dass die Bremers keine Vorzeigefamilie waren. Das war deshalb so, weil sich die Geschwister nicht sonderlich lieb hatten. Warum das so gewesen ist, war ein Familiengeheimnis. Wie sie zu ihrem Vater standen, wusste offiziell auch niemand. Hemmungslose Liebe unterstellte ihnen da aber auch keiner. Genommen haben sie aber alles, was ihnen ihr Vater gab. Häuser, Autos, Geld und so. Ob er ihnen auch Liebe gab, weiß man nicht. Wahrscheinlich aber nicht. Sonst wären seine Sprösslinge vermutlich nicht so seltsam gewesen. Aber wie dem auch sei. Jedenfalls war die Haslauer Marion seit über zwanzig Jahren die Haushälterin vom Bremer und sorgte für sein leibliches Wohl. Dankbarkeit erntete sie dafür aber keine. Im Gegenteil, der Bremer kommandierte sie herum wie eine Leibeigene und wenn ihm gerade danach war, beschimpfte er sie aufs Gröbste. Besonders gut bezahlt hat er sie auch nicht. Trotzdem beschwerte sich die Marion kaum und machte immer brav ihre Arbeit. Viele ihrer Bekannten wunderten sich, wie sie das so lange ausgehalten hatte. Jetzt stand sie vor dem Schreibtisch vom Strobel und schaute besorgt drein, als sie erzählte, dass der Bremer gestern, so gegen 18.00 Uhr, mit dem Auto weggefahren und bis jetzt nicht zurückgekommen sei. Sie meinte, dass er öfter einmal über Nacht wegbliebe, aber normalerweise immer spätestens am nächsten Tag zur Mittagszeit wiederkomme. Weil, ein Kind von Traurigkeit war er nicht gerade, der Ferdinand. Der ließ es oft ganz schön krachen und kam mit einem mugel Rausch im Gesicht nach Hause. Der Strobel hörte sich alles an und erklärte der Frau dann, dass er im Moment nicht viel mehr machen konnte, als zu den Kindern vom Bremer zu fahren und zu schauen, ob er vielleicht dort war. Damit war die Marion für den Anfang zufrieden und zog ab. Der Strobel fuhr aber nicht gleich los, sondern beendete zuerst seine Arbeit. Einen ›Vorfallenheitsbericht‹ musste er schreiben. Ich meine, gib dir einmal dieses Wort. Als Normalsterblicher musst du dir da an den Kopf greifen und dich fragen, wer sich das ausgedacht hat. ›Vorfallenheitsbericht‹. Das findest du im Duden nicht. Weil, so ein Wort existiert überhaupt nicht. Nur bei der Exekutive. ›Amtsdeutsch‹ nennt sich diese Art der Sprache, in der es einen ›Vorfallenheitsbericht‹ gibt. Wie sich das schon anhört. Und wenn du jetzt denkst, dass die damals komische Wörter verwendet haben bei der Gendarmerie, dann muss ich dir sagen, dass dieses Wort immer noch verwendet wird. Keine Ahnung, warum, und auch keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Auf jeden Fall hat der Strobel ein paar Zeilen über die ›Auffindung einer Leiche‹ verfasst. Wieder so ein Unwort aus dem Amtsdeutschen. ›Auffindung‹. Sei’s drum. Bevor er sich aber auf den Weg nach Neus machte, ging er noch heim, um sich umzuziehen. Weil, in seiner Paradeuniform mit den weißen Handschuhen wollte er nicht herumlaufen. Als er die Haustüre aufsperren wollte, entdeckte er auf seiner Fußmatte die Hinterlassenschaft einer Katze. Nicht zum ersten Mal. Nein. Seit mehreren Wochen schien es eine der Katzen im Ort besonders erleichternd zu finden, ihm vor die Tür zu scheißen. Bisher hatte er das Vieh aber nie erwischt und wusste deshalb nicht einmal, wie es aussah. Er hatte sich aber bereits nach ein paar Tagen fest vorgenommen, diesem Flohbeutel den Hals umzudrehen. Wie dem auch sei. In diesem Moment hatte der Strobel weder Zeit noch Lust, die Bescherung wegzuräumen. Das, so dachte er, konnte er genauso gut erledigen, sobald er aus Neus zurück war. Er öffnete die Eingangstür, stieg über das Häufchen und verschwand im Inneren des Hauses. Noch nicht einmal eine halbe Stunde später trat er schon wieder heraus. Frisch geduscht, umgezogen und bereit, seinen Aufgaben nachzukommen. Schön gemütlich fuhr er dann in Richtung Neus und dachte dabei über die Zusammenziehsache nach. Das heißt, er versuchte sich vorzustellen, wie das sein könnte. Und in seiner Fantasie kam ihm das gar nicht so verkehrt vor. Im Gegenteil. Er konnte es sich in dem Moment wirklich gut vorstellen. Gemeinsam zu Bett gehen, gemeinsam aufwachen, gemeinsam frühstücken, gemeinsames Mittag- und Abendessen, gemeinsam weggehen. Mitten in all das Gemeinsame platzte seine innere Stimme mit der Frage, ob das nicht ein bisschen viel Gemeinsames sein könnte. Und das, so ist es dem Strobel vorgekommen, war eine gute Frage. Wie viel Gemeinsamkeit braucht der Mensch? Oder anders gefragt, wie viel Gemeinsamkeit will der Mensch? Weil, immerhin birgt das Zusammenleben ja auch Risiken. Es beinhaltet Regeln und Kompromisse. Und zwar jeden Tag und nicht nur an den Wochenenden. Die Frage aller Fragen war also, ob er das wirklich haben wollte. In seinem Haus konnte er den Badezimmerspiegel vollspritzen, so viel es ihm Spaß machte. Bei der Frau Doktor musste er darauf achten, ihn zu reinigen, bevor er aus dem Bad ging. Unter der Woche war es völlig egal, wann er nach Hause kam, wann er seine Wäsche wusch, wann er schlafen ging, was er sich im Fernsehen ansah oder wie oft er Würsteln mit Saft aß. Würde das so bleiben? Wohl kaum! War er selber dazu bereit, sein Leben umzustellen? Und siehst du, genau das wusste er nicht. Weil, auf der einen Seite war es schon eine sehr schöne Vorstellung, mit der Frau Doktor unter einem Dach zu leben. Aber auf der anderen Seite war die völlige Unabhängigkeit, die er unter der Woche genoss, auch eine wunderbare Sache. Und du darfst nicht vergessen, dass sich die beiden Turteltäubchen damit gegenseitig die Möglichkeit gaben, einander zu vermissen. Weil, irgendwie glaube ich, dass dieses ›sich Vermissen‹ eine unheimlich wichtige Sache ist. Sich jeden Tag zu sehen, ist vielleicht gar nicht so gut. Wegen dem Alltag und der Gewohnheit, meine ich. Da ist Vermissen sicher viel besser. Weil, dann freut man sich viel mehr über die gemeinsame Zeit. Das hat sich auch der Strobel überlegt. Zwar führten all seine Gedankengänge zu nichts, aber dafür verging die Zeit viel schneller und der Strobel war in null Komma nichts in Neus. Zuerst fuhr er zur Anneliese, der ältesten Tochter vom Bremer, die aus dessen erster Ehe stammte. Sie wohnte an der südlichsten Ecke und somit gleich bei der Ortseinfahrt. Für eine alleinstehende Frau lebte sie in einem ziemlich großen Haus. Der Strobel schätzte, dass da locker eine Familie mit vier Kindern Platz gehabt hätte. Vielleicht, so dachte er, hatte sich ihr Vater genau das von ihr erwartet, als er ihr das Haus bauen ließ. Eine große Familie mit vielen Enkelkindern. Möglicherweise hatte er aber auch nur viel zu viel Geld. Aber egal. Jedenfalls sah sich der Postenkommandant das Haus noch ein bisschen näher an, bevor er letztendlich läutete. Einmal, zweimal, dreimal. Nichts geschah. Gerade als er aufgeben und zu seinem Auto zurückgehen wollte, öffnete sich im ersten Stock ein Fenster und ein Frauenkopf kam zum Vorschein. Mit streng hochgesteckten Haaren und einem noch strengeren Blick. Sie grüßte nicht, sondern stellte in ziemlich unfreundlichem Ton eine einzige Frage:
»Was wollen Sie?«
Der Strobel ließ sich von ihrer Unhöflichkeit nicht anstecken, sondern grüßte sie höflich und erklärte ihr sein Anliegen. Und siehst du, da hat er gleich wieder was lernen müssen. Weil, die Frau ließ ihn nicht einmal zur Tür hinein, sondern redete vom Fenster aus mit ihm. Kurz und knapp erklärte sie, dass sie keine Ahnung habe, wo ihr feiner Herr Vater abgeblieben sein könnte, und sie äußerte die Vermutung, dass er sich sicher wieder mit einer seiner Huren herumtrieb. Ja wirklich, genauso sagte sie das. Der Strobel konnte sich das allerdings nur schwer vorstellen, weil der Bremer immerhin schon fast 70 Jahre alt war. Allerdings schützt Alter bekanntlich vor Torheit nicht. Von daher hätte der Strobel das Thema mit den Huren gerne noch ein wenig vertieft. Aber noch bevor er genauer nachfragen konnte, beendete die Anneliese das Gespräch auch schon und meinte, dass sie noch genügend andere Dinge zu tun hätte. Sprach’s, knallte das Fenster zu und weg war sie. Einer der wenigen Momente, in denen sich der Gendarm dachte, dass es nicht unbedingt ein Segen sein musste, Kinder zu haben. Nachdenklich ging er zu seinem Wagen zurück. Der Nächste auf der Liste war der Karl Bremer. Auch er kam während der ersten Ehe seines Vaters zur Welt. Und, du wirst es dir vielleicht schon gedacht haben, er war auch nicht freundlicher als seine Schwester. Nur, dass er, statt das Wort ›Hure‹ zu verwenden, ›Weiber‹ gesagt hat. Sonderlich besorgt wirkte aber auch er nicht. Und reingelassen hat er den Strobel auch nicht. Wieder zog der Ordnungshüter ab, ohne weitere Informationen über den alten Bremer bekommen zu haben. Und wieder fragte er sich, was der Mann wohl falsch gemacht haben mochte, dass es seinen Kindern so herzlich wurscht war, was mit ihm passierte. Kurz darauf parkte er vor dem Haus vom Markus. Im Gegensatz zu seinen beiden Geschwistern war der richtig freundlich zu dem Gendarmen und bot ihm sogar einen Kaffee an. Ihm konnte der Strobel deutlich ansehen, dass er sich schon ein bisschen Sorgen um seinen Vater machte. Überhaupt war der Bursche ganz anders als der Karl und die Anneliese. Vielleicht, weil er nicht das leibliche Kind vom Ferdinand und der Hannelore war. Den Markus hatten die zwei nämlich adoptiert. Aus dem Kinderheim hatten sie ihn geholt. Dazu kam es, weil die Hannelore sich nichts sehnlicher gewünscht hatte als ein drittes Kind, selbst aber keine mehr bekommen konnte. Ich glaube, zu der Zeit war sie schon krank. Genau weiß ich das aber nicht. Sicher ist, dass sie ihren Mann dazu gedrängt hatte, ein Kind zu adoptieren, und ihre Wahl damals auf den Markus fiel. So gesehen also nicht verwunderlich, dass der Strobel das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, nicht bestätigt sah. Weil, im Gegensatz zum Markus, der einen wirklich sympathischen Eindruck machte, waren seine Geschwister eher so wie ihr Vater. Arrogante Arschlöcher. Ich gebe schon zu, dass der Strobel da ein bisschen zu hart war in seinem Urteil. Aber die echten Bremer Kinder waren einfach zu unfreundlich gewesen, um es anders formulieren zu wollen. Dass der Postenkommandant kein perfekter Mensch war, weißt du ja schon. Von daher denke ich, man kann ihm diesen Ausrutscher ruhig verzeihen. Weil, laut gesagt hat er es sowieso nicht. Nur gedacht. Wie dem auch sei. Der Markus bemühte sich jedenfalls sehr und nannte dem Strobel ein paar Orte und Lokale, die sein Vater gerne besuchte. Soweit er das halt wusste. Weil, natürlich war ihm sein Vater nicht nachgelaufen und hatte ihm aufs Auge gedrückt, wo er üblicherweise hinging. Der Bremer redete nämlich mit keinem seiner Kinder übertrieben viel. Mit den leiblichen nicht und mit dem Markus auch nicht. Funkstille quasi. Warum das so war, konnte ihm der Markus allerdings nicht erklären. Und um ganz ehrlich zu sein, es interessierte den Gendarmen auch gar nicht wirklich. Nach der Unterhaltung mit dem Markus fuhr er ins Mariendörfl, um zu schauen, ob der Bremer in der Zwischenzeit aufgetaucht war. Ausschließen konnte er es jedenfalls nicht, dass der Alte nach einer längeren Sauftour wieder daheim war und friedlich in seinem Bett schlief.
Kapitel 5
Dass das Mariendörfl ein ganz besonderes Fleckchen Erde war, konntest du schon beim Abbiegen auf die schmale Straße sehen, die in den Ort hineinführte. Die war als Sackgasse gekennzeichnet. Und wie viele Orte kennst du, durch die man nicht durchfahren kann, weil es einfach nirgends mehr hingeht? Da kannst du auch in der heutigen verkehrsintensiven Zeit noch von einer echten Ruhelage reden. Außer den Leuten, die dort gewohnt haben und ihren Besuchern, fuhr kein Mensch auf dieser Straße. Wozu auch? Oder besser gefragt: Wohin auch?
Halbkreisförmig angelegt und mit sehr viel Grün in und um den Ort, wirkte das Mariendörfl fast schon ein bisschen paradiesisch. Gar keine Frage. Hinter den letzten Häusern war ein kleines Waldstück. Als natürliche Grenze quasi. Und was die Häuser angegangen ist, hast du damals sicher so schnell nirgends mehr Prachtbauten auf einem so kleinen Fleck gesehen wie dort. Das war so beeindruckend, dass der Strobel auf einer kleinen Hügelkuppe anhielt und fasziniert hinunterschaute. Nicht ein Haus, das keinen Pool hatte. Gepflegt, ruhig und gigantisch. Diese Begriffe gingen dem Strobel durch den Kopf. Noch gigantischer war aber das Anwesen vom Bremer, mit dem der Strobel fast auf Augenhöhe war. Das war ein halbes Schloss. Diesen Eindruck riefen sicher die Fensterläden und die kaisergelbe Fassade hervor. Ich meine, der Strobel sah sich das zwar voller Ehrfurcht an, beschloss gleichzeitig aber auch, dass er so etwas zum Glücklichsein nicht brauchte. Er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand so viel Geld in Wohnraum stecken wollte, den er gar nicht brauchte, nur um den Nachbarn zu zeigen, dass er noch mehr Geld investieren konnte als sie. Das kam dem Gesetzeshüter ziemlich blöd vor. Schön fand er es trotzdem. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Bis heute treten nämlich viele Reiche immer wieder den Beweis an, dass hässliche Dinge ein Vermögen kosten können. So ist das ja nicht. Weil, natürlich kann Geld guten Geschmack nicht ersetzen. Und kaufen kannst du den auch nicht. Entweder du hast einen guten Geschmack oder du suchst dir jemanden, der ihn hat. Ansonsten kannst du machen, was du willst, und es wird immer Mist dabei rauskommen. Ich persönlich glaube ja, dass die Geschmacklosen unter den Reichen den Spruch in die Welt gesetzt haben, dass man über Geschmack nicht streiten kann. Ich kann mich aber auch irren. Wichtig ist das sowieso nicht.
Als der Strobel dann beim Haus ankam, bot sich ihm neuerlich ein toller Anblick. Weil, genau vor dem Eingang war ein großer, kreisrunder Platz mit einem Springbrunnen in der Mitte. Genau wie bei einem Schloss halt. Weil er nicht wusste, wo er parken sollte, blieb er direkt vor dem Eingang stehen. Kaum stieg er aus dem Auto, ging auch schon die Türe auf und die Marion kam heraus. Als der Strobel sie fragte, ob der Bremer schon wieder da sei, schüttelte sie enttäuscht den Kopf und versprach, sofort anzurufen, falls ihr Chef nach Hause kommen sollte. Und weil es zu diesem Thema vorerst nicht mehr zu sagen gab, machte sich der Gendarm gleich wieder auf den Rückweg. Allerdings nicht, ohne der Marion zu sagen, dass sie sich keine Sorgen machen solle, weil ihr Chef sicher bald wieder da sein würde. Die Marion sah aber nicht so aus, als hätten sie die Worte vom Postenkommandanten in irgendeiner Form überzeugt.