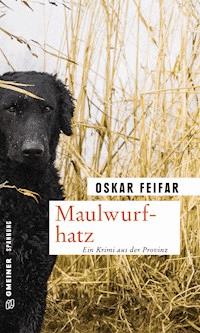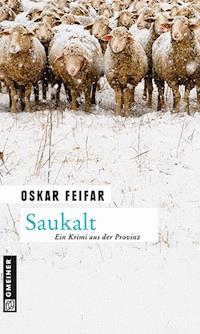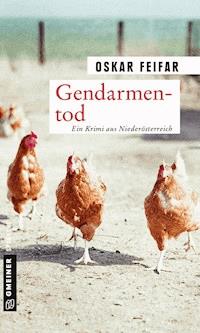Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Postenkommandant Poldi Strobel
- Sprache: Deutsch
150 Jahre Tratschen. Das muss gefeiert werden! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wie bestellt kommt ein Wanderzirkus in den Ort. Alles scheint perfekt, bis ein Unwetter losbricht und alles gehörig durcheinanderwürfelt. Ein toter Zirkusdirektor, dessen Leiche verschwindet, mehrere Kleinwüchsige, die behaupten den Mann ermordet zu haben, eine Gruppe verschwundener Kinder und ein entlaufener Löwe verlangen Bezirksinspektor Strobel einiges ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oskar Feifar
Zwergenaufstand
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © suze / photocase.de
ISBN 978-3-8392-4614-6
1. Kapitel
Gewitter reinigen die Luft, sagt man. Überhaupt nach diesen schwülen Sommertagen, an denen dich die feuchte Hitze quält und die Gelsen sich während deiner durchwachten und verschwitzten Nächte einen Spaß daraus machen, dich an so vielen Körperstellen wie irgendwie möglich zu stechen und diese kleinen juckenden Beulen zu hinterlassen, die immer schlimmer jucken, je mehr du an ihnen herumkratzt, und die dich um den Schlaf bringen. Tage, durch die du dich in Zeitlupe schleppst, inständig auf eine Abkühlung hoffend. Sei sie auch noch so klein. Und in unseren Breiten brauchst du nur lange genug zu warten. Weil nach einer Anzahl von solch schwülen Tagen kommt sicher irgendwann ein Gewitter daher, das die Gelsen kurzfristig vertreibt oder zumindest dazu bringt, sich in deinem Schlafzimmer zu verschanzen, bis der Regen vorbei ist und die Luft um das eine oder andere Grad abkühlt. Das hat alles seine Ordnung. Keine Frage. Nur manchmal schlägt auch so ein heiß ersehntes Gewitter ein kleines bisschen über die Stränge und vermiest dir die Freude mit so viel Regen, dass der Boden ihn nicht schnell genug aufnehmen kann und sich das Wasser auf den Feldern und Straßen rasch zu richtigen Sturzbächen sammelt, die unzählige Keller überfluten, zu Erdrutschen führen und schließlich kleine, harmlose Bäche zum Überlaufen bringen. Begleitet von stürmischen Winden, denen so manches Dach nicht standhält, und die Bäume fällen, als wären sie Streichhölzer. Zugegeben, Unwetter dieser Art gibt es bei uns nicht sehr oft, aber hin und wieder eben doch. In Tratschen ging im August 1973 ein Sommergewitter nieder, das in die Dorfgeschichte eingegangen ist. Zum einen, weil Hagelstürme, monsunartiger Regen und orkanartige Windböen so viele Schäden anrichteten, dass es Monate dauerte, bis auch die letzten Spuren beseitigt waren. Und zum anderen, weil die reißenden Sturzbäche nicht nur Dinge wegschwemmten, sondern auch welche ans Licht brachten, an die später niemand so recht erinnert werden wollte. Es waren schwarze Tage für die Feuerwehr, die gar nicht damit fertig wurde irgendwelche Keller auszupumpen, Bäume aus Stromleitungen zu entfernen, Hausdächer zu sichern und was weiß ich noch alles. Für die Gendarmeriebeamten, die natürlich auch nicht gewusst haben, wo sie zuerst hinfahren sollen, für so manchen Ortsbewohner, der sein Hab und Gut verlor und für die Dorfmusikkappelle, deren Vorzeigemusiker im allgemeinen Chaos abhandenkam. So viel gereinigte Luft wie danach über dem Ort lag, hatte auch keiner gebraucht. Aber schön der Reihe nach.
2. Kapitel
Vor dem großen Regen war alles in bester Ordnung. Mit Ausnahme der Kinder, die sich ihre Zeit beim nahe gelegenen Mühlbach vertrieben, wo sie herumtollten und sich Abkühlung verschafften, freute sich niemand so recht über die brütende Hitze, die über dem Ort lag. Fast 39 Grad. So viel wie schon seit Jahren nicht mehr. Jeder, der es sich erlauben konnte, verkroch sich irgendwo im Schatten. So auch der Strobel Poldi. Der hatte sich beim Hörmann einen kleinen Standventilator besorgt, den er so nah wie möglich an seinem Schreibtisch platzierte, und er vermied es tunlichst, vor die Tür zu gehen. Genau genommen vermied er es sogar, sich in irgendeiner Form zu bewegen. Das Hemd bis zum Bauchnabel geöffnet, die Füße auf dem Schreibtisch und das Gesicht im Luftstrom des Ventilators saß er in der Kanzlei und schwitze. Ihm gegenüber lümmelte der Schulz Bertram in seinem Schreibtischsessel und schnarchte leise vor sich hin. Ein Bild, das von Ruhe und Frieden zeugte. Obwohl alle Rollos heruntergelassen und auch noch die Vorhänge zugezogen waren, hatten sich die Räume der Dienststelle seit dem Morgen unglaublich aufgeheizt. Wie jeden Tag in den letzten Wochen. Erst in der Nacht kühlte es draußen soweit ab, dass man die Fenster öffnen und frische Luft hereinlassen konnte. Aber da waren die Gendarmen meistens nicht mehr im Büro. Diese brütende Hitze war so lähmend, dass schon seit zwei Tagen kein einziger Anruf eingegangen war. Ich meine, stell dir das einmal vor. Damals ist tatsächlich zwei Tage lang gar nichts passiert. Kaum zu glauben, aber wahr. Für die beiden Gendarmen war es schon zu glauben, weil das damals öfter im Jahr vorgekommen ist. In so kleinen Dörfern konnte es schließlich nicht immer nur Mord und Totschlag geben. Und der Alltag war halt ruhig. Nicht so wie heutzutage, wo dauernd irgendwo was passieren muss. Sogar auf dem Land. Nein, da war Tratschen damals trotz allem anders. Eine Insel der Seligen quasi. Einzig die Vorbereitungen für das große Dorffest, das in einer Woche stattfinden sollte, sorgten ab und zu für ein kleines bisschen Hektik. Immerhin war es nicht irgendein Fest. 150 Jahre Tratschen wollten gebührend gefeiert werden. Ein Ereignis, das natürlich entsprechend vorbereitet werden musste. Vor allem die Mitglieder des Ortsbildverschönerungsvereines hatten alle Hände voll zu tun. Denn in ihren Händen lag die Organisation des Festes. Und wer noch nie ein so großes Fest organisiert hat, der weiß auch gar nicht, wie viel Arbeit da dahintersteckt. Zelt, Getränke, Speisen, Musik, Blumenschmuck, Fahnen und Wimpel, Transparente, Gästelisten, Teller, Gläser, Geschirr und, und, und. Das alles musste organisiert werden. Von daher ist es hinter so mancher Haustür nicht ganz so entspannt und locker zugegangen wie auf dem Gendarmerieposten.
3. Kapitel
So übten die Burschen von der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel schon seit zwei Wochen fast täglich erfolglos das Exerzieren. Die Sache mit dem Gleichschritt hat überhaupt nicht funktioniert. Da konnte der Konrad Christian so laut kommandieren, wie er wollte. Das hatte mit Formation nicht viel zu tun, was die Jungs da vorführten. Eher so etwas wie ein chaotischer Sauhaufen sind sie gewesen. Aber so sehr der Christian auch gemeckert hat, es hat nicht geholfen. Zur Verteidigung seiner Männer muss allerdings gesagt werden, dass es nicht immer die Marschierer sein müssen, die Mist bauen. Manchmal sind es auch die Kommandanten. Weil das Kommandieren will auch gelernt sein. Bis drei zählen zu können und eine laute Stimme zu haben, reicht da bei Gott nicht aus. Während also der Konrad Christian mit den Talenten seiner Truppe haderte, murrten die hinter vorgehaltener Hand über seine Fähigkeiten als Kommandeur. Offen zu sagen traute sich aber keiner was. Ergo natürlich weiterhin jeden Abend Übungen und kein Fortschritt. Kurz vor seinem Urlaub hatte der Pfaffi seine Hilfe angeboten. Der war immerhin einmal Zugsführer beim Bundesheer und von daher mit dem Kommandieren halbwegs vertraut. Natürlich hatte er gesehen, dass es nicht nur an der Truppe lag. Aber mit seinem Hilfsangebot hat er sich an die sture Seite vom Konrad gewendet. Und die wollte gar nicht einsehen, dass er selber vielleicht auch nicht ganz so perfekt war, wie er dachte, und er ist dem Pfaffi mit dem Arsch ins Gesicht gefahren, wie man so sagt. So gesehen also kein Wunder, dass der Bursche sich ziemlich beleidigt zurückgezogen und den Konrad mit seinen Problemen allein gelassen hat. Er hatte ohnehin schon genug damit zu tun, der Dorfmusikkapelle den Gleichschritt zu lernen. Warum nicht alle zusammen geübt haben, darfst du mich nicht fragen. Wahrscheinlich wäre das zu einfach gewesen. Vielleicht ist es aber auch daran gelegen, dass die Herrschaften von der Kapelle nicht gerade Profimusiker waren und sich mancher Bürger von Tratschen einen Gehörschaden gewünscht hat, wenn er sie üben hörte. Zumindest haben böse Zungen im Ort derartiges behauptet. Ganz so schlimm war es nämlich gar nicht. Vor allem nicht, seit der Zechmeister Peter dabei war. Trotz seiner erst 13 Lenze war das Peterle, wie der Junge im Ort genannt wurde, mit seinem Euphonium so etwas wie der Star der Truppe. Dazu musst du aber wissen, dass der Bub ansonsten nicht sehr viel Glück im Leben gehabt hat, weil er ein bisschen ein Tschapperl gewesen ist, wenn du verstehst, was ich meine. Man könnte auch sagen, er ist in der geistigen Entwicklung zurückgeblieben. Ein Depp quasi. Das hat im Ort, mit Ausnahme der Kinder, allerdings keiner so gesagt. Aber Kinder sind eben bekanntlich grausam. Für die Erwachsenen war er ein Tschapperl. Und zwar ein liebenswertes. Der Peter war nämlich eine ausgesprochene Frohnatur. Kaum jemals hat man ihn traurig gesehen. Mit seinem Blondschopf, den strahlendblauen Augen und seinem fröhlichen Lachen ist er immer positiv aufgefallen. Trotzdem war er für seine alleinerziehende Mutter eine ganz schöne Belastung. Weil bei aller Fröhlichkeit war der Bub auf dem Stand eines maximal Fünfjährigen und hat ganz schön viel Aufmerksamkeit gebraucht. Schon allein deshalb, weil er nicht wirklich imstande war, seine Wünsche und Bedürfnisse in einer allgemein verständlichen Sprache zu formulieren. Soll heißen, dass die Worte, die der Peter so von sich gegeben hat, eher merkwürdig klangen und es schon eines geübten Ohres bedurfte, ihn zu verstehen. Da hat es dann schon manchmal vorkommen können, dass er ein bisschen grantig geworden ist, wenn man ihn nicht gleich verstanden hat. Zum Glück war das Ganze nicht ganz so tragisch, weil er nicht besonders viel redete. Da gab es wesentlich wichtigere Dinge im Leben vom Peterle. Wie zum Beispiel seine Leidenschaft für das Radfahren. Der Peter liebte es, so schnell wie nur irgendwie möglich, kreuz und quer durch den Ort zu radeln. Besonders in der Dunkelheit. Da lieferte sich das Peterle nämlich unglaubliche Wettrennen mit seinem Schatten. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob du Rad fährst und ob es dir dabei schon einmal aufgefallen ist, dass dich dein Schatten überholt, wenn du im Dunkeln an einer Laterne vorbeifährst. Dem Peter ist es aufgefallen. Zwar hat er nicht kapiert, warum das so war, aber das war ihm ziemlich sicher auch völlig wurscht. Genauso wie es ihm wurscht war, dass er diese Rennen nie gewonnen hat. Bei jeder Laterne hat er vor Vergnügen gequietscht und gelacht, wenn ihn sein Schatten überholt hat. Richtig glücklich hat ihn das gemacht. Seine Mutter freute das auch. Auf diese Weise war es ihr möglich, sich wenigsten ein paar Stunden am Tag etwas anderem widmen. Weil natürlich konnte sie nicht davon leben, nur auf ihren Sohn aufzupassen. Eine richtige Arbeit anzunehmen, ging auch nicht, weil sie ja immer daheim sein musste. Für den Kindergarten war der Peter nämlich zu groß und für die Schule, so hart das jetzt auch klingen mag, war er schlicht und ergreifend zu dumm. Von daher ist der Karoline nichts anderes übrig geblieben, als sich eine Arbeit zu suchen, die sie von zuhause aus erledigen konnte. Wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, war die Auswahl da nicht gar so groß. Das Thema Heimarbeit war nämlich damals noch keines. Soll heißen, dass es so etwas im Grunde nicht gegeben hat. Nicht so wie heute, wo manche Leute nicht einmal mehr regelmäßig ins Büro gehen müssen, weil sie ihre Sachen daheim erledigen können. Am Computer. Oder dir irgendeine Firma unzählige Schachteln mit den Bestandteilen von Kugelschreibern schickt, die du dann für einen Hungerlohn zusammenbauen darfst. Damals konnte sich derartiges niemand vorstellen. Wahrscheinlich deshalb nicht, weil so ein Computer damals noch ein ganzes Zimmer gefüllt hätte. Heute sind die Dinger viel kleiner, dafür aber so leistungsstark, dass jeder von daheim eine Rakete starten könnte. Jetzt fragst du dich vielleicht, was die Karoline damals gearbeitet hat. Ganz einfach. Alles, was so gebraucht wurde. Sie hat Wäsche gewaschen und gebügelt, Torten und Kekse für Veranstaltungen, wie Hochzeiten, Geburtstage, Taufen und so weiter, gebacken, für den Pfarrer Römer gekocht und auf die Kinder der Nachbarn aufgepasst. Alles Dinge, die genau genommen ein jeder hätte selber machen können. Aber was die Karoline angegangen ist, haben die Tratschener zur Abwechslung bewiesen, dass sie tatsächlich auch eine soziale Ader hatten und ihr auf diese Weise ein bescheidenes Einkommen beschert. Ehrlich gesagt glaube ich, dass da bei manchen in Wirklichkeit viel Bequemlichkeit im Spiel gewesen ist. Andere haben vielleicht eine Möglichkeit gesehen, ihr Moralkonto ein bisschen auszugleichen. Ich meine, es kann schon sein, dass sich der eine oder andere gedacht hat, dass der liebe Gott über manche Bosheit hinwegsehen würde, wenn man die Karoline ein bisschen unterstützte. Das Haus, in dem sie mit dem Peter gewohnt hat, gehörte der Gemeinde. Und weil der Herr Bürgermeister ein Menschenfreund war und Mitleid mit der Karoline hatte, brauchte sie keine Miete zu bezahlen. Ja sogar Wasser und Strom wurden aus der Gemeindekasse bezahlt. Große Sprünge konnte die Frau trotzdem nicht machen, aber es reichte zum Leben. Wo der Vater vom Peter abgeblieben war, wusste niemand so genau. Auch die Karoline nicht. Naturgemäß wusste sie im Gegensatz zu den übrigen Ortsbewohnern zwar, wer der Vater war, aber das hatte sie aus Rücksicht auf ihren Ruf nie jemandem erzählt. Das Peterle war nämlich das Ergebnis einer lauen Sommernacht im Wohnwagen eines Zirkusakrobaten. Ein Trapezkünstler, oder so. Abgesehen von der Tatsache, dass der Mann gar nicht wusste, dass er einen Sohn hatte, wusste die Karoline nicht, wo sie ihn hätte finden sollen, um es ihm zu sagen. Was hätte es ihr auch gebracht? Geld wäre wohl kaum zu holen gewesen, weil diese Zirkusgeschichte eine ziemlich brotlose Kunst gewesen ist. Aber wie dem auch sei. Überhaupt hatte die Karoline familientechnisch nicht besonders viel Glück gehabt im Leben. Sie hatte keine Geschwister und ihre Eltern waren verstorben. Zu erben hatte es allerdings nichts gegeben. Das heißt, fast nichts. Denn eines hatte ihr Vater ihr schon vermacht. Ein Blechblasinstrument nämlich, von dem die Karoline nicht einmal wusste, wie dieses Ding hieß. Geschweige denn, was genau sie damit machen sollte. Weil es aber die einzige Erinnerung an ihren Vater war, verkaufte sie es nicht, sondern behielt es. Vielleicht war da so etwas wie Vorsehung im Spiel. Denn lange Jahre nach dem Tod ihres Vaters kam bei ihrem Sohn, mehr zufällig, ein schier unglaubliches Talent zum Vorschein. Obwohl Talent sicher nicht der richtige Ausdruck ist. Es war vielmehr eine Gabe, ein Gottesgeschenk oder, wenn dir das lieber ist, ausgleichende Gerechtigkeit, was der Peter da konnte. Jetzt willst du wahrscheinlich auch wissen, was da mit dem Peterle gewesen ist. Also hör zu.
4. Kapitel
Die Sache hat ganz harmlos angefangen. Eines Tages hatte die Karoline wieder einmal einen Berg fremder Wäsche zu bügeln und von daher nicht genügend Zeit, um sich um den Peter zu kümmern. Blöderweise regnete es und der Bub konnte nicht hinaus. Vor lauter Langeweile fing er an, im Haus herumzustöbern und stolperte dabei auch über den Instrumentenkoffer seines Großvaters und öffnete ihn. Voller Faszination begann er, mit dem Ding zu hantieren. Natürlich hatte der Bub nicht die geringste Ahnung, was er da in der Hand hielt, aber es glänzte so herrlich, dass er sich, wenn auch nur verzerrt, darin spiegeln konnte. Sein eigenes Gesicht brachte ihn dazu, laut zu lachen und immer wildere Grimassen zu schneiden. Außerdem hatte dieses Ding viele bewegliche Teile, die ihn mindestens genauso faszinierten. Freilich entdeckte er auch bald das Mundstück. Aber seine ersten Versuche, dem Instrument einen Ton zu entlocken, blieben erfolglos. Froh, neben dem Radfahren und seinen über alles geliebten Rittermärchen etwas gefunden zu haben, dass dem Peterle richtig Freude bereitete und mit dem er sich stundenlang beschäftigen konnte, überließ ihm die Karoline das für sie ohnehin sinnlose Drum. Allerdings nicht, ohne ihm spielerisch zu zeigen, wie er darauf ein paar Töne erzeugen konnte. Und ob du es glaubst oder nicht, damit war der Knirps dann wochenlang beschäftigt. Als dann einmal der Doktor Lasser vorbeikam, um seine Wäsche abzuholen, sah er, wie sich das Peterle mit dem für ihn zu großen Instrument abmühte und ging zu ihm. In seiner Kindheit hatte der Arzt selbst auf Drängen seiner Eltern ein Blasinstrument lernen müssen und konnte deswegen ein bisschen was spielen. Keine Glanztaten, aber immerhin ein paar nette kleine Melodien. Ganz nebenbei erklärte er im Tonfall des Gelehrten, dass es sich bei dem Instrument um ein Euphonium handelte. Eine Information, die für den Peter gelinde gesagt wertlos und für die Karoline absolut uninteressant war. Zwar versuchte der Peter, das Wort brav nachzusprechen, aber wirklich zu verstehen war es aus seinem Munde nicht. Das hat den Arzt aber gar nicht so arg gestört. Er nahm sich schließlich zwei Stunden Zeit um dem Jungen mehr schlecht als recht ein paar Liedchen vorzuspielen, und der Peter hörte ganz aufmerksam zu, bohrte dabei genussvoll in der Nase und rollte mit seinen blauen Augen. Aber nicht nur das. Nein. Er beobachtete auch ganz genau, was der Doktor mit seinen Fingern machte und wie er seinen Mund formte. In den nächsten Tagen begann für die Karoline und ihre Nachbarn eine Zeit des Leidens. Dank dem Doktor Lasser hatte der Peter nämlich endlich kapiert, wie er mit dem Ding umgehen musste, um ihm ein paar, wenn auch recht klägliche Töne zu entlocken und das wollte er natürlich auch zeigen. Aber diese Phase dauerte nicht allzu lange. Weil schon kurz darauf geschah das, was die Erzkatholischen im Ort als Gabe Gottes und ein echtes Wunder bezeichneten. Das Peterle spielte nämlich auf einmal die erste richtige Melodie. Und zwar ein Lied, das gerade im Radio lief, als er wieder einmal Nervensäge spielte. Das Peterle hörte erst auf mit seiner Dudelei, lauschte den Klängen aus dem Gerät und begann schließlich, das Lied nachzuspielen. Natürlich nicht perfekt. Wie auch? Aber doch so, dass die über alle Maßen erstaunte Karoline es eindeutig erkennen konnte. Sie traute kaum ihren Augen und ihren Ohren schon gar nicht. War das wirklich ihr Peterle, das da auf einmal so schön spielte? Und weil kein anderer mit einem Blasinstrument im Haus war, musste sie zur Kenntnis nehmen, dass es tatsächlich ihr Sohn war, der da von jetzt auf gleich musizierte. Zuerst wollte die Frau lieber keinem was davon erzählen, aber nach und nach haben natürlich immer mehr Leute mitbekommen, dass da auf einmal viel schönere Töne aus dem Haus gedrungen sind. Und was soll ich dir sagen? Schon nach relativ kurzer Zeit waren die Töne so schön, dass immer wieder jemand vor dem Haus stehen geblieben ist, um zu lauschen. Die Kundschaft von der Karoline ist auch immer wieder länger geblieben, um dem Spiel des Burschen zuzuhören. Der Peter selbst war während der Spielerei voll in seinem Element. Besonders gut gefiel ihm die Aufmerksamkeit, die ihm plötzlich entgegengebracht wurde. Er war zwar auch vor diesem Wunder schon gut behandelt worden, aber jetzt war das noch einmal etwas ganz anderes. Jetzt wurde er nicht mehr nur am Rande wahrgenommen, sondern erntete die volle Aufmerksamkeit aller. Was auch immer in dem Jungen vorgegangen sein mag, es beflügelte ihn, immer weiter zu üben. Und wer Talent hat und brav übt, kann irgendwann auch was. Und das Peterle konnte schon sehr bald sehr viel. Gar keine Frage. So ist es halt gekommen, dass der Peter sein Instrument nicht mehr aus den Augen gelassen hat. Wenn er nicht spielte, verstaute er das Euphonium brav im Koffer, den er auf Schritt und Tritt mitnahm. Ja sogar mit ins Bett hat er das Ding genommen. Nur die Sache mit dem Fahrradfahren war für ihn ein bisschen blöd. Da konnte er den Koffer nämlich nicht mitnehmen. Halten war nicht möglich und für den Gepäckträger war er zu groß. Aber auch dafür hat sich rasch eine Lösung gefunden. Weil der alte Seltenhammer, der ein pensionierter Schuster war, sich des Problems annahm und zwei Lederriemen an dem Koffer befestigte, damit der Peter ihn wie einen Rucksack auf dem Rücken tragen konnte. Na, was glaubst du, wie der Junge da gestrahlt hat, als er wieder mit seinem Schatten um die Wette fahren konnte. Und die Karoline hat freilich auch gestrahlt, weil ihr Bub so offensichtlich glücklich war. Ganz aus dem Häuschen ist er dann gewesen, als der Kreuzbichler Sepp, seines Zeichens Kapellmeister der Dorfmusik, bei seiner Mutter vorsprach und sich erkundigte, ob sie wohl einverstanden wäre, den Buben hin und wieder in der Kapelle mitspielen zu lassen. Weil, so hat der Kreuzbichler gemeint, sich ein Euphonium im Gesamtgefüge der Kapelle sicher ganz toll machen würde. Da war die Karoline am Anfang ein bisschen skeptisch. Würde der Peter wirklich in der Dorfkapelle mitspielen können? Das war ja gleich noch mal etwas ganz anderes, als daheim ein Solo nach dem anderen zu spielen. Der Kreuzbichler Sepp hat das sehr pragmatisch gesehen und gemeint, dass, wenn man es nicht probiert, man es nie wirklich wissen wird. Da mag sich ein jeder denken was er mag, aber ganz von der Hand zu weisen war diese Logik nicht. Das hat auch die Karoline eingesehen und ihr Einverständnis gegeben. Schon bei der ersten Probe stellte sich heraus, dass das Peterle noch viel musikalischer war, als alle gedacht hatten. Er hatte nämlich überhaupt keine Schwierigkeiten damit, ein Lied nach dem anderen zu lernen und auch nicht mit seinem Einsatz. Nur mit dem Ruhigsitzen hat es längere Zeit nicht ganz so gut geklappt, weil der Bub Hummeln im Hintern gehabt hat, wie man gemeinhin so sagt. Aber gespielt hat er einfach nur wunderbar. So wunderbar nämlich, dass er noch im selben Jahr beim Weihnachtsblasen auf dem Dorffriedhof mitmachen durfte. Das war sein allererster Auftritt vor einem großen Publikum. In ein Engelskostüm gesteckt, mit Flügeln auf dem Rücken und einem goldenen Heiligenschein auf dem Kopf hat das Peterle so gefühlvoll Stille Nacht gespielt, dass vielen der Zuhörer nur so die Tränen runtergelaufen sind. So gerührt waren sie beim Anblick des kleinen Peter, der mit dem großen Instrument in der Hand so klein und zerbrechlich ausgesehen und all sein Herzblut in sein Spiel gelegt hat. Schöner, da waren sich nachher alle einig, hatte die Kapelle die Weihnachtslieder noch nie gespielt. Von da an ist das Peterle, sehr zu seiner Freude, fixer Bestandteil der Kapelle gewesen. Aber das ist eben vor dem großen Regen passiert und bevor sich alles so dramatisch geändert hat.
5. Kapitel
Für den Pfarrer Römer waren die Wochen vor dem großen Fest auch eine aufregende Zeit. Aber nicht, weil er Ärger mit seinen Schäfchen gehabt hätte, oder so. Nein, überhaupt nicht. Es war nur so, dass er bei dem Fest eine Messe lesen sollte. Und weil auch er die Meinung vertreten hat, dass eine 150-Jahr-Feier nicht irgendein larifari Ereignis war, wollte er selbstverständlich eine ganz besonders schöne und gehaltvolle Predigt vorbereiten. Jetzt sollte man meinen, dass das für jemanden, der für seine tollen Predigten bekannt war, keine besonders große Aufgabe gewesen ist. Aber weit gefehlt. Weil etwas zu übertreffen, was immer schon hervorragend war, war keine leichte Übung. Das hat schon bei der Wahl des Themas angefangen. Immerhin hat der Römer jeden Sonntag gepredigt und hatte in der Vergangenheit von daher natürlich schon über so ziemlich jede menschliche Schwäche, jedes göttliche Gebot und was weiß ich noch alles geredet. Die Geschichte des Ortes, also dieses ganze historische Zeugs, würde sowieso der Bürgermeister in seiner Rede aufarbeiten. Das konnte er getrost vernachlässigen. Eine moralische Rückschau ist dem Römer nicht besonders klug vorgekommen, weil er gemeint hat, die Dorfbewohner an die tragischen Ereignisse der letzten Jahre zu erinnern, könnte sich eventuell negativ auf die Stimmung auswirken. Damit hatte er sicher nicht ganz unrecht. Gerade während seiner Amtszeit hatten sich die Ortsbewohner, moralisch betrachtet, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das musste man grundsätzlich schon sagen. Aber halt nicht am Jubeltag. Da musste was anderes her. Eher mehr was Heiteres, verstehst du? Jetzt stehen in der Bibel aber nicht gar so viele lustige Sachen. Ergo ist dieses Buch für den Römer als Quelle der Inspiration ausgeschieden. Die vielen Kleinigkeiten, die im Ort so passiert sind, haben auch nicht genügend Stoff für eine längere Predigt hergegeben. Ich meine, versetz dich doch bitte einmal in die Lage von dem Gottesmann. Wirklich gute Erfahrungen hatte er bis dahin mit seinen Schäfchen, die in der Mehrzahl eine Schar von scheinheiligen Pharisäern waren, ja nicht gemacht. Was also wäre geeignet gewesen, lobend erwähnt zu werden? Die Tratscherei? Die Streiterei? Die ständigen Intrigen? Oder vielleicht gar die Ignoranz der Menschen? Alles in allem wohl kaum Themen, um ein positives Stimmungsbild bei den Zuhörern zu erzeugen. Lügen waren für Hochwürden aufgrund seiner Stellung natürlich nicht drin. Gar keine Frage. Nicht einen Gedanken hat der Römer daran verschwendet. Ich meine, wo kämen wir denn da hin, wenn sogar der Herr Pfarrer ein Lügner wäre? Unvorstellbar so etwas! Na gut, heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so undenkbar, aber damals schon. Früher ist so ein Priester oft gar nicht in die Situation gekommen, lügen zu müssen. Noch nicht einmal hinter vorgehaltener Hand ist über Geschehnisse getuschelt worden, die dir heutzutage in den Nachrichten aufs Auge gedrückt werden, ob du es wissen willst oder nicht. Damals hätte zum Beispiel kein Mensch erfahren, wie sich die Mönche in so mancher Abtei ihre Freizeit miteinander vertrieben haben. Vom Pornoschauen im Internet brauchen wir da gar nicht erst reden, weil es das Internet damals ja noch gar nicht gegeben hat. Vielleicht waren aber auch die Ministranten in dieser Zeit einfach nur härter im Nehmen und haben sich deshalb erst gar nicht beschwert. Wer weiß? Spielt aber im Hinblick auf das Dilemma vom Römer sowieso keine Rolle. Weil erstens hat der, von seinen gelegentlichen Frauengeschichten einmal abgesehen, mit solchen Verfehlungen nichts am Hut gehabt. Und zweitens hätten sich diese Dinge auch nicht für seine Predigt geeignet. Zu seinem Glück hatte der Gottesmann aber noch genügend Zeit, um sich den Kopf über die richtigen Worte zu zerbrechen. Er nahm sich auf jeden Fall ganz fest vor, intensiv für eine göttliche Eingebung zu beten. Schaden konnte das schließlich nicht.
6. Kapitel
Als Hauptredner war selbstverständlich der Herr Bürgermeister vorgesehen. Dem ist es derweil auch nicht viel besser ergangen als dem Kirchenhirten. Seit Tagen war der Fürnkranz Josef damit beschäftigt, seine Rede zu schreiben. Und stell dir vor, er hatte noch nicht mehr als eine halbe Seite geschafft. Hättest du ihn damals gefragt, dann hätte er dir wahrscheinlich versichert, dass es eine sehr gute halbe Seite gewesen sei. Das mag durchaus auch so gewesen sein. Aber gereicht haben die paar Zeilen freilich nicht. Natürlich hat der Fürnkranz das selber auch gewusst. Er war ja schließlich kein Depp. Aber ändern konnte er es halt auch nicht. Schon die wenigen Worte, die bisher auf dem Blatt standen, hatte er sich mühsam abringen müssen. Trotzdem, oder vielleicht gerade weil er sich so bemüht hatte, klang seine Rede ein kleines bisschen hölzern. Zumindest ist ihm das in den Momenten, in denen er ehrlich zu sich selbst war, so vorgekommen. Dabei war er immer noch bei der Einleitung. Sein einziger Vorteil gegenüber dem Römer war, dass er sich nicht so viele Gedanken über das Thema machen musste. Die Entwicklung des Ortes bot genügend Daten und Fakten, um zumindest ein tödlich langweiliges Geschichtsreferat zu halten. Viel mehr Themen wollte der Fürnkranz auch gar nicht verarbeiten. Weil was das Menschliche angegangen ist, hat er sich da viel lieber auf den Pfarrer Römer verlassen. Für das Menschliche und all das moralische Zeugs und für den Frieden mit Gott war der Kirchenhirte ganz allein zuständig. Fand zumindest der Herr Bürgermeister. Von daher kannst du schon erkennen, dass die beiden Herren so etwas wie eine stillschweigende Arbeitsaufteilung hatten. Weil miteinander geredet hatten sie noch nicht. In dem Fall war das aber völlig egal, weil sowieso nichts anderes rausgekommen wäre. Wie dem auch sei. Jedenfalls hatte das Dorfoberhaupt auch so seine Probleme mit dem Verfassen einer Rede und beschloss, sich Hilfe zu holen. Und weil er nicht so recht wusste, wer im Ort dieser Anforderung gewachsen sein könnte, und ihm beim besten Willen niemand anderer eingefallen ist, hat er den Postenkommandanten angerufen und zu sich ins Büro gebeten. Fragen, so dachte sich der Fürnkranz, konnte ja nicht schaden. Insgesamt gesehen war das wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Woher hätte der Herr Bürgermeister auch wissen sollen, dass der Ordnungshüter intensiv damit beschäftigt war, der Hitze des Tages aus dem Weg zu gehen und von daher nicht die geringste Lust verspürte, zur Gemeinde zu latschen, um dort an einer Rede zu basteln, die er gar nicht halten würde. Hingegangen ist er, um des lieben Friedens willen, natürlich trotzdem. Mit einem so grantigen Gesichtsausdruck, dass die Leute, die ihm begegneten, die Straßenseite gewechselt haben. Grund für seine üble Laune war einerseits, dass er nicht verstehen konnte, wieso jemand, der freiwillig in der Politik tätig war und deswegen dauernd irgendwelche Ansprachen halten musste, nicht wusste, was er bei einer vergleichsweise harmlosen Veranstaltung wie dem Dorffest sagen sollte. Andererseits hatte er über die Sache nachgedacht und erkannt, dass er selbst auch keine guten Ideen für eine Rede hatte. Eine Tatsache, die sicher Stress bedeutete. Dem Strobel reichte es nämlich schon ganz und gar, dass ihm der Major Schuch ständig damit in den Ohren lag, dass man dringend ein Verkehrskonzept erstellen müsse, weil das Fest immerhin ein ganzes Wochenende dauere und der Ort somit zumindest zwei Tage lang nicht passierbar sein würde. Den Einwand vom Strobel, dass man wegen den drei oder vier Autofahrern, die normalerweise an so einem Wochenende durch Tratschen fahren wollten, keinen großen Wirbel zu machen brauche, ließ der Offizier nicht gelten. Er blieb stur und bestand auf ein schriftliches Konzept. Jetzt wusste der Strobel aber nicht so ganz genau, wie so ein Konzept ausschauen musste, oder was genau da drinnen stehen sollte, und hatte von daher noch keine Zeile geschrieben. Noch nicht einmal eine Überschrift hatte er zustande gebracht. Und ausgerechnet in einer solchen Notsituation kam der Bürgermeister mit seiner Rede daher. Das schrie geradezu nach Überforderung. Also nur logisch, dass der Ordnungshüter auf seinem Marsch zur Gemeinde von einem Strahlemann weit entfernt gewesen ist. Eher wie eine Zwiderwurzen hat er ausgeschaut. Daran hat diesmal auch das Peterle nichts ändern können, als es in seiner selbst gebastelten Ritterrüstung, die aus einem bunt bemalten Pappschild, einem mindestens genauso farbenfrohen Brustpanzer aus Pappe, einem alten, ledernen Pilotenhelm samt Schutzbrille und einem Holzschwert bestand, auf dem Fahrrad an ihm vorbei sauste und »Hüh-ha, hüh-ha« rief, als gelte es, ein Pferd anzutreiben. Normalerweise fand der Strobel das sehr lustig und beobachtete den Jungen bei seinem Spiel. Aber diesmal nahm er ihn kaum wahr. So einen Zorn hat er gehabt. Dass er nicht mitgekriegt hat, dass der Zirkus in die Stadt gerollt ist, lag aber nicht an seinem Zorn, sondern schlicht an der Tatsache, dass er am falschen Ende des Ortes war, als die Wagen kamen.
7. Kapitel
Im Gegensatz zum Strobel haben die Leute am anderen Ortsende den Zirkus sehr wohl kommen sehen und es hat deshalb gar nicht lange gedauert, bis etliche Ortsbewohner auf der Straße waren, um den Zug der Zirkuswagen zu bestaunen und zu begrüßen. Lachend winkten sie den vorbeifahrenden Artisten und den neben den Wagen laufenden Clowns zu. Vom Kleinkind bis zur Urgroßmutter waren alle dabei. Irgendwie ist der Mensch für den Zirkus halt nie wirklich zu alt. Die bunten Kostüme, die exotischen Tiere und die nach außen hin immer fröhlichen Menschen vermittelten auf den ersten Blick den Eindruck einer völlig sorglosen Welt mit jeder Menge Raum für die persönliche Freiheit. Bei genauer Betrachtung stellte sich allerdings schnell heraus, dass das nicht ganz der Realität entsprach. Mit grenzenloser Freiheit und leben auf rosaroten Wolken hatte so ein Zirkus nämlich gar nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Normalerweise war der Tagesablauf von Disziplin und festen Abläufen geprägt, die kaum Platz für Freiheit ließen. Genau wie heutzutage auch, musste so ein Zirkus damals ganz schön ums Überleben kämpfen. Immerhin war da ein Haufen hungriger Mäuler, die von den Eintrittsgeldern gestopft werden wollten. Außerdem glaube ich persönlich, dass es nicht jedem gegeben ist, ein Leben auf ständiger Wanderschaft zu führen. Zu Heimweh darfst du jedenfalls nicht neigen, wenn du dich für so ein Leben entscheidest. Aber wie dem auch sei. Jedenfalls ist an diesem Tag ein Wanderzirkus nach Tratschen gekommen und die Leute haben einen Platz gesucht, an dem sie ihre Wagen ab und ihr Zelt aufstellen konnten. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, dass das eine Sache gewesen ist, die für Aufregung unter den Dörflern gesorgt hat. Aber nicht nur vor lauter Freude. Die Zirkusgeschichte hat nämlich einmal mehr dafür gesorgt, dass sich zwei Lager gebildet haben. Eines, das der Meinung war, dass man diesen Zirkus so kurz vor dem Jubiläumsfest nicht wirklich im Ort brauchen konnte, und ein anderes, das sich dafür aussprach, den Zirkus, falls möglich, in das Fest einzubinden. Einig waren sich beide Seiten lediglich darüber, dass es ein Platzproblem gab. Weil auf dem Hauptplatz konnte man so ein Riesenzelt schlecht aufstellen. Auch der Fußballplatz war da keine Alternative. Dort sollten nämlich eine Bühne für die Dorfmusik, die Fahrgeschäfte und die Schaustellerbuden aufgebaut werden. Von daher also auch kein Platz für Akrobatik. Auf einer Wiese außerhalb des Ortes passte es einigen der Verantwortlichen auch nicht, weil sie befürchteten, eine Konkurrenz zu ihrem eignen Fest zu schaffen. In dem ganzen Hin und Her bewahrten die Zirkusleute ihre Ruhe und beschlossen erst einmal, ihr Lager in der Nähe des Dorfes aufzuschlagen und dort zu warten, bis eine endgültige Entscheidung fiel. Wahrscheinlich kannten sie derartige Diskussionen schon zur Genüge und wussten, dass sie mit wütenden Protesten nichts erreichen würden. Also setzten sie auf Geduld und sollten damit Recht behalten. Weil die lange Geschichte kurz erzählt, ist, dass die Sache am nächsten Tag schon ganz anders ausgeschaut hat. Da hat nämlich der Herr Graf höchstpersönlich die Situation gerettet, indem er einfach den Garten seines Schlosses für die Zirkusleute zur Verfügung stellte. Jetzt fragst du dich vielleicht, von welchem Grafen ich da eigentlich rede, weil du bis jetzt noch nie etwas von dem Mann gehört hast. Das ist eine berechtigte Frage, wie ich zugeben muss. Aber bis jetzt hat es keinen Grund gegeben, etwas über den Mann zu erzählen. So einfach ist das. Obwohl er gar nicht einmal so unwichtig gewesen ist, der Herr Graf. Weil abgesehen davon, dass ein großer Teil der Felder rund um Tratschen zu seinem Besitz zählten, gehörte ihm auch das Schloss, das, umgeben von einer Mauer aus roten Ziegeln, nahe dem Ortszentrum auf einem Hügel stand. Na ja, vielleicht ist Hügel ein bisschen übertrieben. Sagen wir, es war eher eine leichte Wölbung im Erdboden. Aber so wichtig ist das ja auch wieder nicht. Weil schön anzuschauen war das Schloss in jedem Fall. Zumindest die Teile, die von der Straße aus zu sehen waren. Hinter den Kulissen hat das etwas anders ausgeschaut. Da hat man deutlich erkennen können, dass die Monarchie vorbei war und ehemals Adelige schon einmal bessere Zeiten gehabt hatten. Weil genau genommen war der Graf ja kein Graf mehr. Zumindest hat er sich nicht mehr so nennen dürfen. Das Tragen von Adelstiteln ist in Österreich nämlich schon im Jahr 1919 abgeschafft worden. Trotzdem hätte man damals noch denken können, der Herr Graf war immer noch so etwas wie der Lehensherr in Tratschen. So untertänig haben sich nämlich viele der Ortsbewohner verhalten. Überhaupt die Älteren, die von ihren Großeltern und Eltern noch gewusst haben, dass man dem Grafen mit großem Respekt begegnen und ihm dankbar sein musste für alles, was er für den Ort so getan hatte. Was auch immer das im Einzelnen gewesen sein mag. Diesmal hat er eben dafür gesorgt, dass der Zirkus dableiben konnte. Aber nicht, dass du jetzt glaubst, der Herr Graf ist so ein Gutmensch gewesen und hat das für die Leute im Ort gemacht. Überhaupt nicht. Für seine eigenen Kinder hat er das gemacht. Weil die beiden verwöhnten Fratzen so ein irrsinniges Theater gemacht haben, als es geheißen hat, dass der Zirkus nicht bleiben könne. Die Tatsache, dass die Sprösslinge so offensichtlich unglücklich gewesen sind, hat natürlich dann die Frau Gräfin auf den Plan gerufen, die wiederum ihrem Mann allein mit ihren vorwurfsvollen Blicken nahegelegt hat, etwas zu unternehmen. Und weil der Herr Graf genau wusste, was seine Alte für eine furchtbare Zicke sein konnte, hat er eben was gemacht. Nicht aus Liebe zur Familie, sondern aus reiner Notwehr. Die Motive seiner Frau Gemahlin sind nicht viel edler gewesen. Da war auch nichts mit extremer Mutterliebe. Überhaupt nicht. Der Frau Gräfin ist es nur darum gegangen, die quengelnden Bälger ruhigzustellen. Ich meine, heutzutage stellen Eltern die kleinen Quälgeister mit Fernsehen, Computerspielen oder Smartphones ruhig. Oder sie geben ihnen sobald sie aus der Volksschule draußen sind so viel Taschengeld, dass sie ins Kaffeehaus gehen können. Hauptsache kein Lärm in der geheiligten Freizeit. Wenn du jetzt sagst, das machen nicht alle Eltern so, muss ich dir zustimmen. Gott sei Dank nicht! Aber leider sind es immer noch viel zu viele, die getrieben von ihren Interessen, die ihrer Kinder nicht ganz so ernst nehmen. Genaugenommen tut weder das noch das Familienleben vom Grafen hier etwas zur Sache. Weil für die Geschichte ist nur wichtig, dass der Zirkus in Tratschen geblieben ist. Aber eins nach dem anderen. Lass mich zuerst zum Strobel und dem Bürgermeister zurückkommen.
8. Kapitel
Alles deutete also auf ein wunderbares Fest mit vielen Attraktionen hin. Natürlich ganz zur Zufriedenheit des Bürgermeisters. Abgesehen von seiner eigenen Rede waren die Vorbereitungen in vollem Gange und kamen gut voran. Und während also der Zirkus unter dem Applaus der Bewohner in den Ort kam, saß der Strobel im Büro des Ortsvorstehers und diskutierte über mögliche Inhalte der Ansprache. Und wie das halt oft so ist, war dem Bürgermeister so schnell nichts recht. Da hat sich der Strobel glatt auf die Zunge beißen müssen, um nichts Falsches zu sagen. Zumindest nicht laut. Sein imaginärer Bart hat sich nämlich einiges anhören müssen. Kein Wunder. Weil genau genommen war es schon ganz schön unverschämt vom Fürnkranz alles schlecht zu machen, was der Strobel vorgeschlagen hat. Immerhin hatte er selbst keine besseren Ideen auf Lager. Sonst hätte er den Gendarmen ja nicht gebraucht. Dauernd blöd daherreden und selbst keine einzige Idee zu haben, kommt selten gut. Da muss man den Strobel schon verstehen. Rausgekommen ist zwei Stunden lang gar nichts. Dann hat der Strobel die dauernden Sprüche vom Fürnkranz endgültig satt gehabt und ihm gesagt, dass er die Rede lieber daheim fertig machen wolle, weil er da einfach mehr Ruhe habe. Und siehe da, der Bürgermeister hat den Ernst der Lage gleich erkannt und diese Entscheidung vorerst nicht kommentiert. Eine weise Haltung. Zumindest für diesen Augenblick. Gekommen ist es wegen dieser Zirkuszeltsache sowieso anders. Die viele Streiterei unter den Ortsbewohnern kostete den Strobel nämlich jede Menge Zeit. Von ihm aus hätte also der Graf seine Entscheidung schon viel früher bekannt geben können. Hat er aber halt nicht getan. Sei’s drum. Weitere zwei Tage später hat sowieso kein Hahn mehr nach den ganzen Diskussionen gekräht. Einzig ein paar von den abergläubischen Leuten haben großes Unheil vorhergesehen, weil sie der Meinung waren, dass mit dem Zirkus auch das Böse nach Tratschen gekommen war. Nämlich in der Gestalt der Zwerge, die sich mit ihren dicklichen Ärmchen und Beinchen und ihren hinterhältig dreinschauenden Äugelein als Clowns getarnt ins Dorf geschlichen hatten, um Unheil zu verbreiten. Sie, da waren sich die Abergläubischen sicher, waren an all dem schuld, was später passiert ist. Sogar am großen Regen. Gesagt haben sie das freilich erst, nachdem das alles schon passiert war. Keine Ahnung, warum die Hellseher unter uns immer erst nach der Katastrophe kommen, um uns mit erhobenem Zeigefinger wissen zu lassen, dass sie es immer schon gewusst und dazu noch kommen gesehen haben, dass so etwas einmal passieren würde. Das ist heutzutage noch immer nicht anders als damals. Dieser Montag ging in Tratschen jedenfalls relativ hektisch zu Ende und der Strobel wünschte sich fast, er hätte sich, genau wie der Pfaffi, in dieser Woche Urlaub genommen. Und das, obwohl er noch nicht einmal wusste, was der Rest der Woche alles bringen würde.