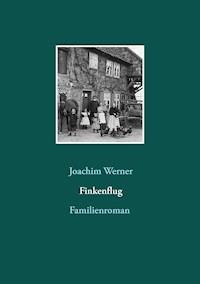
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Viktoria Fink wird am 14. August 1886 als fünftes von acht Kindern der Wirtsleute, Viktoria und Theodor Fink, im schwäbischen Dorf Glöttweng geboren. Auf der Suche nach der eigenen Identität müssen Viktoria und ihre Geschwister mit den widersprüchlich erscheinenden Aussagen und Verhaltensweisen ihrer Familie sowie den kriminellen Ereignissen in ihrem Dorf umgehen lernen. Viktoria wird geprägt von wiederholten Bindungsverlusten, einer für sie unübersichtlichen Familienstruktur und der wilhelminischen Zeit, in der die Erziehung ihre eigenen Gesetze hat. Die Figuren dieses Familienromans haben historische Ausgangspersonen, deren Handlungen und Charaktere jedoch vom Autor frei gestaltet wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch
Diese Familiengeschichte entstand überwiegend aus den Erzählungen meines Großvaters, der, ich möchte es gelinde ausdrücken, zu Ausschmückungen seiner eigenen Erinnerungen neigte, welche wiederum wesentlichen Einfluss auf meine eigene Phantasie hatten.
Viele Menschen neigen zu Übertreibungen, damit ihnen zugehört wird und sie das Interesse eines Zuhörers immer wieder neu beleben können. Mein Großvater war so ein Mensch. Ich verzeihe ihm dies, weil seine Erzählungen, so übertrieben sie auch sein mochten, mich diesem eigensinnigen Mann näher gebracht haben und seine Mär noch Jahre später leise in meinen Ohren zu klingen vermag.
Ich wiederum neige manchmal, wie mein Vorfahre auch, zu Beiwerken, die mir von meinen Lesern, so hoffe ich, freundlichst verziehen werden mögen. Manche werden beim Lesen vielleicht eine Mär erkennen. Bei ihnen bitte ich höflichst um Nachsicht, denn sie dürfen gerne zweifeln und ich freue mich sogar darüber, denn der Zweifel ist bekanntlich der erste Schritt zur Erkenntnis. Sollten sich meine Leserinnen und Leser jedoch in dieser Geschichte wiederfinden, freut es mich natürlich umso mehr.
Die Figuren dieses Romans sind frei gestaltet. Für einige von ihnen gibt es historische Ausgangspersonen, doch ihre Handlungen und Charakterzüge sind vom Autor frei erfunden.
Der Autor
Joachim Werner wurde 1963 im Dorf Wulksfelde, jetzt Tangstedt, in Schleswig-Holstein geboren. Aufgewachsen mit drei Geschwistern interessierte er sich bereits früh für Geschwisterkonstellationen und ihre vermeintlichen Auswirkungen auf die eigene Persönlichkeit. Er arbeitet als sozialpädagogische Fachkraft in der Integrationsgruppe einer Kindertagestätte.
Für Kirsten, Katrin und Julia
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Sonnabend, 14. August 1886
Sonntag, 15. August 1886
Montag, 16. August 1886
Kapitel 2
Taufe am Sonntag, 14. November 1886
Kapitel 3
Donnerstag, 17. Februar 1887
Kapitel 4
10. April 1887, Ostersonntag
Kapitel 5
Freitag, 02. Mai 1890
Kapitel 6
Samstagvormittag, 03. Mai 1890
Mittag
Abend
Kurz nach Sonnenuntergang
Sonntag, 04. Mai, kurz nach Mitternacht
Vor dem Morgengrauen
Morgengrauen
Vormittag
Mittag
Nach dem Mittagessen
Später Nachmittag
Abend
Kapitel 7
Montag, 29. September 1890, früher Morgen
Später Vormittag
Später Nachmittag
Abends
Kapitel 8
Freitag, 03. Oktober 1890
Kapitel 9
Donnerstag, 09. Oktober 1890 in Burgau
Kapitel 10
Freitag, 10. Oktober 1890
Kapitel 11
Montag, 13. Oktober 1890 in Berlin
Kapitel 12
Donnerstag, 16. Oktober 1890
Kapitel 13
Dienstag, 21. Oktober 1890
Kapitel 14
Samstagabend, 20. Dezember 1890
Sonntag, 21. Dezember 1890
Mittwoch, 24. Dezember 1890
Kapitel 15
Donnerstag, 21. April 1892
Freitag, 22. April 1892
Samstag, 23. April 1892
Kapitel 16
Unterknöringen am Dienstag, den 01. August 1893
Kapitel 17
Der März 1894 in Glöttweng
Freitagabend, 16. März 1894
Kapitel 18
Samstag, 17. März 1894
Sonntag, 18. März 1894
Samstag, 24. März 1894
Kapitel 19
Montag, 07. Mai 1894
Kapitel 20
Donnerstag, 24. Mai 1894 (Fronleichnam)
Kapitel 21
Donnerstag, 18. Oktober 1894
Die Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 1894
Freitag, 19. Oktober 1894
Kapitel 22
Freitag, 15. März 1895
Montag, 18. März 1895
Kapitel 23
Freitag, 19. April 1895
Kapitel 24
Montagvormittag, 10. Juni 1895
Nachmittag
Kapitel 25
Samstag, 17. August 1895
Kapitel 26
Sonntag, 12. Januar 1896
Montag, 13. Januar 1896
Kapitel 27
Freitag, 12. Juni 1896
Sonntagnachmittag, 21. Juni 1896
Sonntagabend
Montag, 22. Juni 1896
Kapitel 28
Sonntag, 10. Januar 1897
Mittwoch, 13. Januar 1897
Namensregister
Glöttweng im Schwäbischen
Kapitel 1
Sonnabend, 14. August 1886
‚Es soll endlich heraus‘, dachte Viktoria, während sie einen befreienden Schrei ausstieß, nachdem eine der schier unendlichen Wehen erneut keinen Erfolg brachte. Sie schaute sich im stickigen, warmen Raum um. Ihr müder Blick blieb an der schmucklosen Wand haften. Die Maserung der grob behauenen Bretter schimmerte durch die aufgetragene schmutzige, dünne Kalkschicht.
„Warum öffnest du das Fenster nicht?“, fragte sie Anne, die Hebamme, die sich ihre blutverschmierten Hände an einem Tuch abrieb.
„Der Wirt möchte es so“, antwortete Viktoria mit gequält klingender Stimme, der jedoch deutlich zu entnehmen war, dass sie keinen Widerspruch duldete.
Während der letzten Geburt vor nunmehr zwei Jahren kamen Viktoria allerhand Winde aus dem Darm. Das Fenster stand damals offen und die Nachbarsbrut, angelockt vom Wehgeschrei, hockte darunter und kicherte leise. Sie erzählten es ihren Eltern, die abends in der Wirtschaft so manche Spöttelei mit Blick in Richtung des Wirts abgaben.
Viktoria schmunzelte in sich hinein, als sie sich daran erinnerte. Wie eine halbe Ewigkeit kam es ihr vor, dass Theodor auf die Welt kam. Die Geburt hatte damals nicht so lange gedauert, erinnerte sie sich. Ihre Brust hob und senkte sich jetzt schnell, während sie lautlos lachen musste. Sie rechnete damals schon mit dem nächsten Wind aus ihrem Darm, als mit einer erleichternd kurzen Wehe Theodors Köpfchen aus dem geweiteten Geburtskanal schlüpfte. Danach ging alles ganz schnell, erinnerte sie sich an die Zeit zurück, als sie eine erneute, diesmal wahnsinnig schmerzhafte Wehe in das Hier und Jetzt zurückkatapultierte.
„Es wird gleich kommen“, sagte Anne laut und mit Mut machendem Lächeln im Gesicht.
Viktoria bemerkte Annes Lächeln nicht. Sie war mit ihren Gedanken bei ihren Schmerzen, bei ihrem Sohn Theodor und ihren anderen Kindern. Erst jetzt kam ihr die humorvolle Erkenntnis, dass bisher alle ihre vier Kinder zur Erntezeit des Kohls geboren wurden. Aus Kostengründen stand oft Kohl auf dem Speiseplan und Viktoria erkannte augenblicklich, dass dies einen wehenden Einfluss auf die Geburtsverläufe gehabt hatte. Erneut hob und senkte sich Viktorias Brustkorb, was von ihrem glucksenden Gelächter begleitet wurde.
„Jetzt bist närrisch geworden, oder was?“, fragte Anne ein wenig unsicher. „Dreh mir bloß nicht durch auf der letzten Strecke.“
Kaum hatte die Hebamme ihre letzten Worte gesprochen, setzte erneut eine Wehe ein und mit einem erleichterten Schrei schob sich das Köpfchen des Säuglings hinaus in diese Welt. Mit gekonntem Griff half Anne dem Säugling auf dem letzten Stück seines kurzen, anstrengenden Weges und legte es behutsam auf die Brust der Mutter, wo es alsbald leise zu greinen anfing.
„Ist es ein Mädchen?“, fragte Viktoria mit erschöpfter Stimme.
„Ja, es ist wieder ein Mädchen und, wie es scheint, recht gesund.“
„Es soll meinen Namen tragen“, sagte Viktoria lächelnd. Sie schaute ihr drittes Mädchen liebevoll an. „Viktoria“, flüsterte die Mutter den Namen ihres Babys.
Beim ersten Kind hatte sich ihr Mann Theodor durchgesetzt und bestand bei der Namensgebung auf den Namen seiner Mutter, Genoveva. Die Mutter verstarb, als Theodor elf Jahre alt war. Er liebte sie sehr und seine Augen wurden jedes Mal feucht, wenn er von ihr sprach. Dies erlaubte er sich allerdings nur vor Viktoria. Im Dorf konnte er sich Sentimentalitäten nicht erlauben und gab sich als unnachgiebiger, auf Anstand pochender Wirt, der die Ärmel hochkrempelte, wenn ein unangenehm auffallender Gast vor die Tür gesetzt werden musste; natürlich nur, wenn alles Reden versagt hatte und es keinen anderen Ausweg mehr gab. Abends in der Kammer war Theodor stets liebevoll zu seiner Frau und sie genoss das wenige traute Beisammensein mit ihm. Er konnte sehr verständnisvoll sein, nicht so grob, wie es bei anderen Eheleuten in Glöttweng zuging. Es wurde nicht offen über Grobheiten in der Ehe gesprochen, Viktoria konnte sich jedoch aus dem Verhalten und den Anmerkungen der zumeist männlichen Gäste in der Schankstube einiges zusammenreimen.
Immer wieder schaffte sie es, seine Nachgiebigkeit ihr gegenüber auszunutzen. Erst vor zwei Wochen durfte sie sich schönes festes Tuch vom fahrenden Händler, einem Juden namens Samuel Kindig, aussuchen. Zwar knurrte Theodor zunächst, aber als Viktoria ihm erklärte, sie wolle doch nach der Geburt schön für ihn sein und sich aus dem Stoff ein Kleid nähen, schaute er zunächst den verschmitzt dreinblickenden Juden, dann seine hochschwangere Frau an und sagte ruhig lächelnd: „Gut, du sollst den Stoff haben, aber nur, wenn der Herr Samuel Kindig im nächsten Herbst ohne schönen Stoff bei uns aufkreuzt.“
Ja, der Wirt gönnte seiner Viktoria sein letztes Hemd. Bei der Namensgebung seiner Kinder ließ er Viktoria bisher jedoch keine Entscheidungen treffen und so bekam ihr zweites Kind den Namen seiner Großmutter, Anna. Danach erblickten Georg, benannt nach seinem Großvater, und Theodor, benannt nach ihm selbst, das Licht der Welt.
„Immer schön in bewährter Tradition der Familie Fink, denn die Dörfler sollen wissen, wer hier der Herr im Hause ist“, pflegte er mit einem Lächeln zu sagen und hoffte nicht unbedingt auf Viktorias Verständnis, jedoch darauf, dass der Haussegen deshalb nicht schief hing. „Beim dritten Mädchen darfst du entscheiden“, sagte Theodor nach der Geburt von Genoveva. Aus unerfindlichen Gründen hatte er die naive Hoffnung, dass ihm nach Genoveva nur noch Söhne geboren werden würden. In diesem Zusammenhang erwähnte der Wirt oft den armen, bedauernswerten Bauern Salger, wie er ihn gespielt mitleidig nannte, denn dieser hatte bereits drei Töchter. Der Wirt erwähnte den Bauern meistens nur in diesem Zusammenhang, obwohl er ihn vielmehr aufgrund seines ungehobelten Verhaltens ablehnte.
„Da hat der Theodor nicht mit gerechnet, dass mir nach der Genoveva, der Anna, dem Georg und dem Theodor noch ein Mädchen beschieden sein würde. Ich bin so glücklich und so müde“, sagte Viktoria.
„Erst die Kleine anlegen, danach können Sie sich ausruhen“, antwortete Anne, während sie grob sauber machte. Anschließend wischte sie sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn und ging mit ausladenden Hüftbewegungen zur Tür.
„Herr Wirt! Sie können kommen und ihr Werk bestaunen“, rief Anne die Stiege hinunter, ohne sich ein Lächeln verkneifen zu können, weil sich der Herr des Hauses mit seinem Geschlecht wieder in der Minderheit befand.
Sonntag, 15. August 1886
„Josefa, ich weiß nicht, was ich ohne dich täte. Ich bin dir so dankbar.“
„Ist schon recht. Ich hab die Brust voller Milch und bin froh, dass die Dinger zu etwas nütze sind“, antwortete Josefa mit gesenktem Blick auf ihre großen mit Muttermilch gefüllten Brüste. Sie dachte an ihr viertes Kind, das vor vier Tagen die Nottaufe erhalten hatte und genau wie ihr erstes und drittes an einem unerklärlichen Fieber gestorben war. Ihr zweites Kind, das von allen nur „die kleine Josefa“ gerufen wurde, war jetzt zehn Jahre alt und erfreute sich bester Gesundheit. ‚Sie scheint die Kraft ihres Vaters Georg Fink geerbt zu haben‘, dachte Josefa und schweifte gedanklich in die Vergangenheit.
Georg war einer der zwei Brüder von Theodor und verließ für zwei Jahre seinen Heimatort Glöttweng, um in Augsburg das Handwerk des Schmiedens zu erlernen. Sein Vater hatte ihn darauf gebracht, denn die Wirtsstube würde, wie er sagte, nicht alle drei Söhne ernähren können.
So kam es, dass Georg sich eines schönen Septembertages im Jahre 1860 auf dem Kutschbock des Juden Kindig wiederfand und mit schwerem Herzen in eine ihm unbekannte Stadt fuhr. Der Jude bemerkte seine Traurigkeit, aber er wollte es seinem Begleiter nicht noch schwerer machen und schwieg. Er sagte auch nichts, als einige hundert Schritte hinter dem Dorfausgang Josefa, halb versteckt hinter einem Baum, stand und zaghaft die Hand zu einem Abschiedsgruß hob.
Georg und Josefa hatten niemandem etwas von ihrer Liebe erzählt und sich im Geheimen getroffen. Ihre Beziehung fing an, als Georg im Auftrag seines Vaters, Franz Josef Fink, die von ihm bestellten sieben Bierkrüge von Josefas Vater, dem Töpfer Mändle, abholen sollte. Georg klopfte mit seinen großen Fäusten gegen die Tür des Töpfers und nahm sich vor, sich nichts von seiner Unsicherheit anmerken zu lassen, die ihn gegenüber erwachsenen Männern oft überkam. Er wollte gerade ein zweites Mal klopfen, als sich die Tür zaghaft öffnete. Statt des Töpfers stand Josefa, die Tochter des Hauses, vor ihm.
„Ja … ähm … ich wollte …“, begann Georg. Es hatte ihm nichts genützt, dass er sich die Worte vorher zurechtgelegt hatte, da nun gänzlich unerwartet statt des Töpfers seine Tochter vor ihm stand.
„Brauchst wegen der Krüge nicht so zu stammeln. Du willst bestimmt einen Krug abholen, habe ich recht?“ Josefa war über ein Jahr älter als Georg, was in ihrem Alter nicht unbedeutend war, zumal Mädchen in ihrer Entwicklung den Buben oft voraus sind. Diesen Vorteil machte sich Josefa zu Nutze und fuhr Georg keck über den Mund.
„Nicht einen. Mein Vater hat …“, begann Georg zu sprechen, wurde jedoch schnell wieder unterbrochen.
„Ich weiß, wie viele Krüge ihr bestellt habt, aber es wäre doch schade, wenn ich dir alle auf einmal gebe.“
„Aber wieso?“ Georg schaute Josefa fragend an.
„Nun ja, wenn du jetzt alle Krüge auf einmal von mir bekommst, hätten wir für heute nur ein einziges gemeinsames Zusammentreffen. Willst du das?“ Josefa hoffte inständig, dass Georg auf ihr Vorhaben einging. Sie wusste, dass Georg schüchtern war und von sich aus keine Anstalten machen würde, um auf sie zuzugehen. Jetzt war es an ihm, auf ihren Annäherungsversuch einzugehen.
„Ich … würde schon … – Gerne!“, stammelte Georg.
„Also gut!“, sagte Josefa schnell, bevor Georg es sich anders überlegen konnte. „Nach jedem Krug, den du von mir erhältst, gehst du von dannen und klopfst später erneut an die Tür und fragst höflich nach dem nächsten. – So haben wir beide mehr davon.“ Josefa nickte Georg aufmunternd zu.
So kam es, dass Georg mit jedem Klopfen ein wenig mehr die Scheu verlor. Als er schließlich nach dem siebenten und letzten Krug verlangte, nahm er seinen ganzen Mut zusammen. „Sieben Mal habe ich meine Scheu überwunden und bin ich zu dir gekommen“, begann Georg schüchtern, um anschließend fordernd weiterzusprechen. „Die nächsten sieben Sonntage schleiche ich mich weg von den Kirchgängern und dann musst du dich überwinden, denn ich werde an der Glöttquelle auf dich warten.“
Es sollte nicht bei sieben Treffen bleiben. Jede Möglichkeit nutzend, trafen sie sich an der Quelle und kamen sich zaghaft näher, vertrauten sich Geheimnisse und Wünsche an. Erst kurz vor seiner Abreise küssten sie sich zärtlich und gaben sich das Versprechen, einander treu zu sein bis zu seiner Rückkehr aus Augsburg. Es war der schönste Sommer ihres Lebens; so zart wie die Blüten eines Vergissmeinnichts und so verheißungsvoll wie der volle Mond einer wolkenlosen Nacht.
„Gib mir die Kleine“, sagte Josefa, die wieder in die Gegenwart zurückgekehrt war.
Viktoria legte ihre Tochter der sitzenden Schwägerin an die Brust. Die kleine Viktoria fand schnell die Warze und begann umgehend stark zu saugen. Sacht legte Viktoria ihre Hand auf Josefas Schulter und küsste ihr sanft auf das Haar.
Josefa lächelte ein kurzes gequält wirkendes Lächeln. „Ich bin froh, dass es dich gibt. Du bist mir ein Trost in meinen schwersten Stunden.“
Für einen Augenblick war es still im Raum. Durch das geöffnete Fenster hörten sie das Gezwitscher einiger Singvögel, ansonsten durchbrach die Stille nur das zufriedene Saugen des Säuglings. Im Raum war die stickige Luft des Vortages der sommerlichen Frische eines Augustmorgens gewichen. Viktoria atmete tief durch und begann ihrer Schwägerin ihre Gedanken mitzuteilen.
„Wie wäre es für dich und deine kleine Josefa, wenn du eine Zeit lang hier bei uns wohnst?“, fragte Viktoria. „Natürlich nur, bis mein Baby nicht mehr gestillt werden muss. Ich wüsste derzeit nicht, was ich ohne euch täte. Meine Kinder sind noch so klein. Deine Josefa hütet die Kinder, du gibst meinem Kind Milch, weil meine bestimmt nicht ausreichen wird und mein Theodor erwartet, dass ich ihm in der Wirtsstube zur Hand gehe. Vielleicht ist es auch gut für dich und Josefa, wenn ihr hier ein wenig Ablenkung und Trost habt. Georg kommt dann einfach zum Essen herüber.“
Die Stille kehrte in den Raum zurück. Josefa dachte daran, wie es wäre, eine geraume Zeit hier zu wohnen. Hier war alles so voller Leben. Die Wirtsstube mit den vielen Gästen und die Kinder bedeuteten zwar viel Arbeit, aber auch Ablenkung von der Trauer ihres Hauses. Und hier gab es immer satt zu essen.
„Ich muss das mit Georg besprechen. Er lässt sich seine Trauer über den Verlust unserer Kinder zwar nicht anmerken, aber stumpf ist er weiß Gott auch nicht. Den Hammer drischt er seit geraumer Zeit so grimmig auf das Schmiedeeisen, dass einem dabei angst und bange werden könnte. Früher war er so voller Hoffnung, behandelte das Eisen mit einer Liebe, die mich schon fast eifersüchtig machte. Als er sich gestern unbeobachtet fühlte, sah ich ihn über dem Blasebalg gebeugt weinen. Mir zerriss es fast das Herz, aber ich hatte keine tröstenden Worte für ihn.“ Eine Träne lief über Josefas Wange.
Montag, 16. August 1886
„Grüß Gott, Georg! Wir müssen reden.“ Theodor stand angelehnt im Türrahmen zur Schmiedewerkstatt. Er ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Die Werkstatt wirkte auf ihn zu klein und das Mobiliar in ihr sehr spärlich. Den schmiedeeisernen Fenstern fehlte an einigen Stellen das Glas. ‚Bevor die kalte Jahreszeit anfängt, muss hier dringend Abhilfe geschaffen werden‘, dachte der Wirt. Das Werkzeug lag ordentlich sortiert am rechten Platz und machte einen gut instand gehaltenen Eindruck. Theodor verstand nicht viel vom Schmieden. Aber es war offensichtlich, dass vieles, was ein Schmied an Werkzeug benötigt hätte, fehlte.
Nach der Lehre bekam Georg ein wenig Werkzeug von seinem Lehrherrn, dem Augsburger Schmiedemeister Alois Schlickengruber, mit auf den Weg. Bevor Georg jedoch in seinen Heimatort zurückkehren konnte, ging er auf die Walz. Er kam in Städte wie München, Bamberg und streifte auf dem Weg nach Zürich auch Ulm. In Ulm war er versucht, einen Abstecher nach dem nahe gelegenen Glöttweng zu machen, um seine geliebte Josefa und seine Familie zu sehen. Es entsprach jedoch nicht den Regeln der Walz, seinen Heimatort zu besuchen. Er wollte Meister werden und in Glöttweng etwas ganz Eigenes aufbauen. Sein Vater hatte ihm ein Stück Land versprochen, worauf er eine eigene Schmiedewerkstatt errichten wollte. Das auf der Walz Ersparte sollte für den Neubeginn in Glöttweng sein. Geld vom Vater wollte Georg möglichst nicht annehmen müssen. Er hatte seinen Stolz und wollte allen beweisen, dass er es schaffen würde. Außerdem sollte Josefa seine Frau werden und es immer gut bei ihm haben.
„Ach, du bist es. Ich habe dich nicht kommen hören. Ich mach dieses gute Stück noch fertig.“ Georg klopfte ein gebogenes Stück Eisen mit dem Hammer ab, ließ es anschließend laut zischend in einen Bottich mit kaltem Wasser sinken, zog es wieder heraus und legte es samt Greifzange auf den Tisch neben der Feuerstelle ab. Mit einem kräftigen Ruck zog er seine Lederhandschuhe von den Händen und wischte sich abschließend mit einem fleckigen Lappen den Schweiß von Stirn und Armen. Mit wachsamen Augen schaute Georg seinen Bruder an.
„Hast du mit Josefa gesprochen, Georg?“, fragte Theodor ungewohnt ruhig.
„Ja, habe ich.“
„Und, was sagst du zu unserem Vorschlag?“
Eine unangenehme Pause machte sich breit.
„Ich weiß, dass du ungern Unterstützung annimmst, Georg. Aber sieh doch, wir machen uns Sorgen um Josefa. Sie braucht jetzt Menschen um sich und eine Aufgabe, die sie ablenkt. Es soll auch alles nicht umsonst sein. Sie wird für ihre Mühe gerecht entlohnt und wir haben sie und deine Tochter gerne bei uns. Es soll doch nur für kurze Zeit sein und …“ Der Wirt hielt einen kurzen Augenblick inne. „… wenn du magst, kannst auch du jederzeit bei uns sein. Tag und Nacht.“
Georg hatte die Gedankenpause in Theodors Satz bemerkt. Er wusste, dass Viktoria und Theodor es gut meinten mit ihrem Vorschlag und auch mit ihm. Es fiel ihm jedoch schwer, über seinen Schatten zu springen. Er hatte sich vorgenommen, alles im Leben selbst zu schaffen, ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Das Schlimmste für ihn war, dass er zum Bittsteller werden würde. Gerade seinen Brüdern wollte er es beweisen, weil sie es zu Ansehen gebracht hatten. Theodor mit seiner Speise- und Schankwirtschaft, die direkt an der gut befahrenen Überlandstraße zwischen Ulm und Augsburg lag, hatte es geschafft. Viele Fuhrwerker machten hier Halt, kehrten bei Theodor ein und ließen so manchen Gulden auf der Zeche erscheinen. Auch Joseph, der älteste der drei Brüder, hatte einen Gasthof, allerdings im benachbarten Hafenhofen.
Es wäre Georg sicherlich leichter gefallen auf Theodors Vorschläge einzugehen, wenn er nicht der ältere Bruder gewesen wäre. So stand er verlegen da und wusste nichts zu sagen.
„Du möchtest doch auch nicht, dass Josefa vor die Hunde geht.“ Theodor behielt seinen ruhigen Ton bei, verstärkte jedoch den Nachdruck in seiner Stimme.
Insgeheim wusste auch Georg, dass dies der richtige Weg war. Er machte sich Sorgen um seine Frau und wusste in dieser Situation keinen anderen Ausweg. „Aber nicht für lange und auch nur, weil Viktoria und du so darauf drängt“, willigte er barsch ein. „Wenn die Situation es zulässt, kommt meine Frau heim. Nur dass du’s weißt.“ Ein Gefühl der Erleichterung setzte bei Georg ein. Vielleicht würde nun doch noch alles gut werden.
Theodor ging auf seinen Bruder zu, legte ihm eine Hand auf die Schulter, zeigte mit der anderen auf Georgs Arbeitsstück und fragte: „Woran arbeitest du gerade?“
„Das ist für den Bauern Kroitsch. Ein Teil seines Spanngeschirrs ist gebrochen. Er braucht es dringend. Er will morgen Heu einfahren.“
Georg ging wieder seiner Arbeit nach. Tief in seinem Herzen freute er sich, dass er sich in der Not auf seine Brüder verlassen konnte.
„Na, dann will ich mal. Servus, mach’s gut, Bruder“, sagte der Wirt.
Kapitel 2
Taufe am Sonntag, 14. November 1886
Die gesamte Familie Fink hatte sich an diesem Morgen in der Pfarrei St. Oswald in Glöttweng versammelt, um der Taufe von Viktoria beizuwohnen. Die Kirche lag am Ortsrand und hatte einen schönen weißen Turm vor einem kleinen, gedrungen wirkendem Schiff. Es bedurfte keiner zusätzlichen Stützpfeiler, um das Dach zu halten. So hatte jeder einen guten Blick auf den Taufstein. Die Gemeindemitglieder saßen auf den Holzbänken und schauten zum Taufstein hinüber. Dort sahen sie den Vater des Taufkindes, neben ihm die Mutter, daneben Pfarrer Gumpeller, neben dem Geistlichen Josefa, die als Patin den Täufling auf ihrem Arm trug, und Joseph, der auch Taufpate war und hinter dem Taufbecken stand. Mit einer leichten Neigung des Kopfes deutete der Pfarrer Josefa an, dass sie nun das Kind über das Taufbecken halten sollte, anschließend schöpfte er ein wenig geweihtes Wasser über den Kopf des Täuflings.
„… und ich taufe dich hiermit, auf das Geheiß unseres Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters …“, sprach der Pfarrer und konnte von dem Moment an, als das nasskalte Element Berührung mit Viktorias Kopfhaut aufnahm, nur noch mit lautstarker Stimme sein Gebet gegen das heftige Gebrüll des Täuflings aufsagen.
„Mir scheint, die Kleine hält auch den Pfaffen ordentlich auf Trab“, sprach der alte Wagner, der in der ersten Reihe saß, flüsternd zu seinem Sitznachbarn. Den Spott in seiner Stimme wusste sein Sitznachbar zu deuten, denn aus seiner Abneigung gegen die katholische Kirche machte der Alte im Allgemeinen keinen Hehl. Seine politische Meinung kannte in Glöttweng auch jeder. Der Kaiser hatte, zusammen mit seinem Kanzler, das Bayerische Königreich dem Deutschen Reich zugeführt. Dies stieß hier in Glöttweng scheinbar nur bei dem alten Wagner auf unkritische Zustimmung, denn er ließ keine Gelegenheit aus, den Kaiser zu loben, und trug derzeit als Einziger seinen Bart nach Manier des Staatsoberhauptes. An der Oberlippe war sein Bart schmal und an den Wangen buschig abstehend. Dazu schaute der Alte aus zwei tiefliegenden, aufmerksamen Augen, die von ausgeprägten Tränensäcken und buschigen Augenbrauen umrahmt wurden.
„Kannst du nicht wenigstens heute Ruhe geben?“, flüsterte sein Sohn Karl energisch zurück.
„Geh mir ab mit den Pfaffen. Überall wollen die mitmischen und zeigen mit dem Zeigefinger auf ihre sündigen Schafe.“
Karl wusste, worauf sein Vater anspielte. „Du hast der Vreni … na, du weißt schon“, flüsterte Karl.
„Der Pfaffe hat in seiner Predigt darauf angespielt …“, sagte der alte Wagner in mokierendem Ton, „… obwohl ihn das nicht das Geringste angeht. Er findet es sogar verdächtig, dass ich nichts zu beichten habe.“
„Vater, lass jetzt gut sein.“
Die Orgel begann laut zu tönen und unterbrach das Gespräch der beiden. Wie eine Mahnung an den Alten stimmten die Familie Fink und viele der versammelten Gemeindemitglieder zur dritten Strophe des Liedes „Ach bleib mit deiner Gnade“ an und sangen voller Inbrunst.
„Ach bleib mit deinem Glanze
bei uns, du wertes Licht;
deine Wahrheit uns umschanze,
damit wir irren nicht.“1
Während des Liedes schaute der Pfarrer immer wieder mahnend zum alten Wagner hinüber. Dem Angeschauten war bewusst, dass der Geistliche in ihm ein unfrommes Schäflein sah.
„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“
Das Wirtshaus hatte eine prächtige, weiß gestrichene Eingangstür. Die geschliffenen Ornamente der Glasscheiben zeigten hübsche Blumenmuster und wurden von grünlackierten Holzleisten umrahmt. Durch das Glas schimmerte matt ein Schild auf dem „geschlossene Gesellschaft“ stand. Die gedämpfte Musik eines Akkordeons und von Lachen unterbrochenes Stimmengewirr drang zur Straße hinaus. Die Straße im Ort bestand aus Kopfsteinpflaster. An ihrem Rand standen zumeist kleine Häuser, deren Anzahl übersichtlich war und auf bescheiden lebende Bewohner schließen ließ. Verließ man den Ort, ging die Straße in einen festen Sandweg über und verlor sich in den weiten Wäldern des sogenannten Holzwinkels.
Die Tür des Wirtshauses öffnete sich und man hörte die lauten Stimmen der Gäste hinaus ins Freie tönen. Theodor und Joseph traten ein wenig wankend die zwei Stufen vor dem Eingang hinunter, während die Tür hinter ihnen wieder ins Schloss fiel. Es war jetzt still auf der Straße. Die untergehende Sonne brach das Licht zwischen den fast blattlosen Linden vor dem Haus und ließ die Umgebung in rotgoldenem Glanze erscheinen. Auch die Gesichter der beiden Männer bekamen etwas von dem Glanz ab, der sie in ihrem Sonntagsstaat vornehm aussehen ließ.
„Du, dein Schwiegervater ist mir ja ein Schwerenöter. Sage einmal, was ist wahr an der Geschichte mit der Vreni?“ Joseph konnte seine Neugierde nicht verbergen. „Du weißt, bei mir drüben in Hafenhofen wird allerlei erzählt. Und jeder erzählt etwas anderes.“
„Der alte Wagner erzählt doch niemanden etwas, auch uns nicht. Und die Vreni schweigt sich auch aus. Alles, was ich weiß, und das kann jeder mittlerweile sehen, ist, dass die Vreni schwanger ist“, antwortete Theodor, der von der Angelegenheit sichtlich genervt war, da an den Tischen seiner Wirtschaft über das Thema ausgiebig getratscht wurde. Zunächst, aus Rücksicht vor dem Wirt, leise und hinter vorgehaltener Hand, aber seit Neuestem unverhohlen.
„Aber ohne Grund kann doch niemand behaupten, dass der alte Wagner der Vater des Kindes ist“, drängelte Joseph weiter. „Dass er jedem schönen Rock hinterherschaut, ist bekannt. Und er soll ja auch nicht immer treu gewesen sein in seiner Ehe mit Viktorias Mutter. Gott möge sich ihrer Seele annehmen.“ Joseph bekreuzigte sich während seines frommen Wunsches und schaute Theodor mit einem aufmunternden Lächeln an.
„Na gut, er wurde mehrmals bei Bauer Salger auf dem Hof gesehen, half gerne beim Zusammentreiben und Melken der Kühe mit, eine Aufgabe, die Vreni innehatte. Zunächst fand sie es ganz und gar nicht gut und sprach mit dem Salger darüber. Der fand nichts dabei, sprach meinen Schwiegervater darauf an und ließ sich von dem Alten mit der Erklärung abspeisen, dass er Zeit habe und ihm nur einen Freundschaftsdienst erweisen wollte. Von da an ging er fast täglich zum Melken und mit der Zeit wurde Vreni freundlicher zum Alten. Sie staunte über sein Wissen und fühlte sich geehrt, dass er, als ehemaliger Schulmeister von Landensberg, ausgerechnet eine Magd wie sie ernst nahm“, sagte Theodor mit wissendem Lächeln. „Später war sie anscheinend seinen Komplimenten erlegen und in einem der Frühlingsmonate muss es dann passiert sein.“
„Und ging es im Sommer weiter mit den beiden?“, wollte Joseph wissen.
„Plötzlich, es muss so Mitte Mai gewesen sein, wollte der Alte nicht mehr zum Melken. Ich habe ein wenig gespöttelt und ihn gefragt, ob er der Magd nicht mehr zur Hand gehen mag“, lachte Theodor über seine ehemals, wie er es empfand, gut platzierten Worte.
Auch Joseph lachte. „Also ist etwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Beide waren danach besonnen genug, um zu wissen, dass es einmalig bleiben musste. Sie gingen wieder ihrer Wege und keiner der beiden rechnete mit dem Volltreffer“, schlussfolgerte er.
Nun war es Theodor, der sich ein Lächeln nicht verkneifen konnte. „Seit dem Volltreffer ist der Alte wieder den ganzen Tag hier bei uns im Wirtshaus. Er war zunächst etwas grimmig, was sich mit fortschreitendem Abstand vom Melkabenteuer aber legte. Seit Vreni jedoch offensichtlich etwas unter ihrem Herzen trägt, grübelt er viel und ist beizeiten grantig.“
„Nun muss er sicherlich viel darüber nachdenken, wie es weitergeht mit seinen Vaterfreuden.“ Joseph war mit dem Ergebnis der Unterredung mit seinem jüngsten Bruder sichtlich zufrieden.
„Und nun lass gut sein. Wir feiern heute die Taufe meines fünften Kindes. Gehen wir hinein“, schlug Theodor vor.
„Es wird auch langsam kalt hier draußen.“ Joseph behielt gerne das letzte Wort und rieb sich, nicht nur wegen der abendlichen Kälte, die Hände.
Drinnen in der Wirtsstube war die Luft rauchgeschwängert. Die Männer der Familie Fink gingen dem Tabakgenuss gelegentlich nach und stopften an diesem geselligen Nachmittag manche Pfeife mehr als sonst. Tische wurden zu einer Tafel zusammengestellt, so dass alle Platz an ihr fanden. Die Tafel begann am Fenster in einer Ecke des Raumes und endete in der Raummitte. An der Stirnseite, direkt am Fenster, saß der alte Wagner und unterhielt sich mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn, die direkt vor ihm saßen. Das heftige Gestikulieren der beiden Männer ließ, trotz der leisen Stimmen, auf ein unangenehmes Gesprächsthema schließen.
Neben Viktoria hatte Josefa ihren Platz gefunden und ihr gegenüber saß Georg. Neben Georg hatte Joseph Platz genommen. Ihm zur Seite saß seine Frau Theresa breitbeinig auf dem Stuhl. Sie hatte sich ein wenig von ihrem Mann abgewendet und blickte auf die freie Fläche des Saales. Ihr langer Rock fiel elegant in Falten hinunter, so dass der Saum auf dem Fußboden lag. Zwischen den Händen hielt sie ihr Akkordeon, welches sie im Takt wankend zusammen und wieder auseinander zog. Sie spielte ein fröhliches schwäbisches Volkslied.
Die Kinder der Familie reichten sich die Hände, tanzten im Kreise und gaben sich ganz ihrer Unbeschwertheit hin. Als Zehnjährige überragte die „kleine Josefa“ mit ihrer Körpergröße die ansonsten zwei- bis sechsjährige Kinderschar deutlich.
„Ich bin ein Musikante und komm aus Schwabenland …“, sang Theresa gerade, als sich der alte Wagner vom Stuhl erhob und seine rechte Hand donnernd auf den Tisch krachen ließ. Für eine kurze Zeit herrschte Stille und ungläubiges Staunen. Theresa wendete sich dem unerwarteten Geschehen zu und hörte, wie der Alte leise, mit vor Aufregung vibrierenden Lippen, zu sprechen begann.
„Schließlich habe auch ich meinen Anteil an diesem Haus; vergiss das bitte nicht“, sprach der Alte, nickte seinem Schwiegersohn mit unmissverständlicher Entschlossenheit zu und ließ sich mit einer Geste der Beschwichtigung, die er an die Anwesenden gerichtet hatte, wieder auf seinen Stuhl sinken.
Jeder der Anwesenden wusste, dass der Schulmeister viel Geld in den Erwerb der Gastwirtschaft gesteckt hatte und dafür Wohnrecht auf Lebenszeit mit freier Kost und Logis bekam. Warum der Alte gerade jetzt daran erinnerte, blieb für die Unbeteiligten zunächst ein Rätsel.
Theresa war an das Leben in einer Wirtschaft gewöhnt und musste oft als Schlichterin vieler Streithähne herhalten. In unangenehmen Situationen konnte sie die Stimmung oft vom Tiefpunkt zumindest wieder in die Normalität bringen. So gewann sie auch jetzt schnell ihre Fassung wieder und spielte zur Aufmunterung das passende Lied vom armen Dorfschulmeisterlein.
„In einem Dorf im Schwabenland
da lebt, uns allen wohlbekannt,
da wohnt in einem Häuschen klein
das arme Dorfschulmeisterlein …“2
Der Alte lächelte Theresa freundlich zu. Er mochte sie sehr. Sie war immer guter Dinge, war nicht auf den Mund gefallen „und kann schaffen wie ein Brunnenreiniger“, wie er anerkennend über Theresa sagte.
Theresa lächelte zurück und beobachtete Augenblicke später, wie Viktoria ihrem Vater einen Kuss auf die Wange gab, Theodor bei der Hand nahm und ihn zur Tanzfläche zog. Sie legte ihre Hände auf seine Schultern und gab auch ihm einen Kuss. Nun begannen sie im Takt der Akkordeonmusik zu tanzen. Viele Gäste fingen bald zu klatschen an und begaben sich auch auf die Tanzfläche. Allein Viktoria, der kleine Täufling, bekam von alledem nichts mit. Sie schlief seit dem Kirchgang selig in ihrer Wiege und würde erst aufwachen, wenn es Zeit zum Stillen wäre. Josefas Geruch war ihr bereits sehr vertraut.
Ein Mann saß am nächsten Morgen am Frühstückstisch und kaute genüsslich an einem Stück Brot, während er nebenbei die Schale von seinem Frühstücksei pulte. Er liebte die Stunde nach dem ersten Hahnenschrei, wenn die Dämmerung den Tag ankündigte und die Menschen sich einer müden Langsamkeit hingaben. Das Haus des Theodor Fink mochte er sehr, weil in ihm eine Sauberkeit herrschte, die er in anderen Gasthäusern selten vorfand. Gleich nach dem Aufstehen stand neben einer Porzellanschüssel ein Krug mit kühlem Wasser bereit, um ihm die Morgenwäsche angenehm zu machen. Wenn er sich mit den bereitliegenden, frischen Leinen abgetrocknet hatte, ging er die Treppe hinunter, schnurstracks zur Hintertür hinaus und über den Hof zum „heimlichen Örtchen“. Nach der Erleichterung kehrte er sehr entspannt in das Haus zurück und begab sich direkt in den Speiseraum an den gedeckten Tisch.
„Herr Wirt, Ihr Frühstück macht dem Vergleich mit dem Paradies wieder alle Ehre. Herrlich!“
„Freut mich, dass es Ihnen schmeckt, Meister Oswald“, antwortete Theodor, der gerade Gläser und Krüge in den Thekenschrank sortierte. „Aber ehre, wem Ehre gebührt, das Frühstück hat heute meine liebe Gattin hergerichtet.“
„Oh, Ihre Gattin habe ich noch gar nicht gesehen“, stellte Meister Oswald fest. „Sie ist gerade bei den Kindern“, sagte Theodor, der seine Arbeit unterbrach und zum Tisch des Gastes hinüberging. Mit einem freundlich zugewandten Gespräch pflegte Theodor seine besonderen Beziehungen zu den Stammgästen des „Adler“.
„Als ich gestern gerade noch rechtzeitig vor dem Dunkelwerden hier ankam, neigte sich die Feier ihrem Ende entgegen. Ich hoffe, Ihnen durch mein Erscheinen nicht zu viele Unannehmlichkeiten gemacht zu haben“, sagte Johannes Oswald und meinte es ehrlich.
„Nein, keine Sorge. Ich freue mich über jeden Gast. In der dunklen Jahreszeit haben wir weniger auswärtige Gäste als sonst. Sie scheuen das Wetter, weil die Wege vom Regen durchweicht sind und jederzeit mit Schnee gerechnet werden muss.“ Der Wirt überlegte einen kurzen Augenblick, bevor er weitersprach. „Was treibt euch um diese Jahreszeit auf die Straße?“
„Das Geschäft. Ich brauchte Farbpulver. Sie wissen vielleicht, dass ich eine Glasbläserei in Ulm habe. Die Kunden verlangen heutzutage immer mehr nach farbigem Glas. Die besten Pulver bekomme ich in München, denn die Händler dort beziehen die Farben aus Venedig und …“ Meister Oswald überlegte, ob er die Handelswege der von ihm benutzten Farben erklären sollte, entschied sich aber, einer Eingebung folgend, dagegen. „Nun ja, wie dem auch sei, jetzt auf dem Rückweg kehre ich gerne hier ein, denn die Herbergen der Großstadt sind mir zu hektisch und zum Teil auch zu schmuddelig“, sagte der alte Glasbläsermeister und legte seine Nase rümpfend in Falten.
So ging es vielen Kunden vom Wirt. Das Wirtshaus „Zum Adler“ war bei den reisenden Händlern mittlerweile für seine Gastfreundlichkeit und Sauberkeit bekannt.
„Sie reisen diesmal nicht allein“, stellte der Wirt fest.
„Diesmal reise ich mit meiner Tochter, sie ist eine Langschläferin“, stellte Meister Oswald fest und vergewisserte sich mit einem Blick auf seine Armbanduhr, ob seine Aussage wirklich zutraf. „Acht Uhr!“ Oswald tat erschrocken. „Herr Wirt …“, er hob mahnend den Zeigefinger seiner rechten Hand, „… Ihre Betten sind einfach zu bequem.“
„Wie man sich bettet, so liegt man.“
„Sie liegt mir eigentlich schon zu lange. Ich meine allein, wenn Sie verstehen?“
Theodor tat so, als verstünde er die Anspielung nicht, und schaute sein Gegenüber hilfesuchend an.
„Also …“, hob Meister Oswald erneut an, nur diesmal leiser und um sich blickend, ob niemand von den weiteren Gästen lauschte, „… meine Tochter, die Kreszenz, ist mittlerweile über 23 Jahre alt und kein Kerl guckt sie an. Ich habe sie mitgenommen, weil ich keine Gelegenheit auslassen möchte. Vielleicht interessiert sich ja doch noch eine gute Partie für sie.“
„Verstehe ich nicht“, sagte der Wirt erstaunt. „Das Mädel sieht doch anständig aus.“
„Haben Sie sie schon sprechen gehört?“
„Wenn ich es mir recht überlege, nein.“
„Sie kriegt zunächst keinen Ton heraus, müht sich redlich und stottert dann ein oder zwei Wörter über ihre Lippen.“
Der Wirt war verblüfft. Es war ihm noch nicht aufgefallen, dass die junge Frau keine flüssige Sprache benutzte. Allmählich wurde ihm jedoch klar, warum sie sich bei jedem Gespräch hinter ihrem Vater zu verstecken schien, und einen Gruß erwiderte sie stets nur mit einem freundlichen Nicken.
Noch bevor der Wirt seine Verwunderung überwunden hatte, öffnete sich die Tür und Kreszenz trat ein. Eilenden Schrittes ging sie an den Tisch ihres Vaters und setzte sich auf den freien Stuhl.
„Kreszenz, willst du den Wirt nicht grüßen?“, mahnte der Vater seine Tochter.
„Lassen Sie es gut sein“, sagte der Wirt eilig. „Ich bin froh, dass ein schönes Gesicht auch ohne Sprache meinen Gastraum erhellt.“ Der Wirt lächelte Kreszenz freundlich an, machte auf dem Absatz kehrt und verließ den Raum durch die Schwenktür zum Flur. Nun stand er überlegend da. Seine Arbeit hinter der Theke hatte er vollkommen vergessen. Als würde er den Flur nicht kennen, schaute er sich in ihm um. Der Durchgang links war der Zugang zur Küche. Von seinem Standort aus konnte der Wirt die von der Küche abgehende Tür zur Abstellkammer sehen. Sie war stets verschlossen und den Schlüssel dazu hatte nur der Wirt. Unbewusst fühlte er nach dem Schlüssel in seiner Hosentasche.
Geradedurch befand sich das Wohnzimmer mit Alkoven für die Eltern und den kleinsten Kindern. Daneben bewohnte der alte Wagner ein bescheidenes Zimmer mit Schlafstatt. Rechter Hand befand sich ein Zimmer, der dem Nachwuchs des Hauses zugedacht war. Hier hatten zurzeit nur Genoveva, Anna und der kleine Georg ein Bettchen stehen, denn „sie brunzen nicht mehr in die Büx“, wie der Hausherr anerkennend zu sagen pflegte. Neben der Tür zum Zimmer der Kinder führte eine knarzende Holztreppe in die oberen Räume. Dort gab es einige mit Bett, Stuhl und Tisch eingerichtete Kammern für die Übernachtungsgäste. Die größte der Kammern bewohnte derzeit Josefa mit ihrer Tochter, der kleinen Josefa.
Theodor schaute konsterniert die Treppe hinauf. Er wusste, dass seine Frau dort oben war und er spürte das Verlangen, sie zu umarmen. Die Situation im Speise- und Schankraum hatte ihm zugesetzt. Etwas hatte ihn zutiefst berührt. Als Wirt und Oberhaupt einer großen Familie brauchte er seine Sprache immerzu. Ohne darüber nachzudenken, gab er Anweisungen, musste sich bei unangenehm auftretenden Gästen durchsetzen, war Schlichter in Familienangelegenheiten und Erzieher seiner Kinder. Abends, wenn der Tag Abschied nahm und er mit Viktoria im Bett lag, flüsterten sie einander zärtlich Kosenamen zu. All das wäre hinfällig ohne Sprache. Ihm wurde bewusst, dass all dies nicht selbstverständlich war. Er fragte sich, ob er manches zu selbstverständlich nahm und seinen Lieben zu viel abverlangte. Ein erstes Gefühl von Verunsicherung fing in ihm an zu keimen.
Derweil saß Josefa in der von ihr vorübergehend bewohnten Kammer auf einem Stuhl. In ihrem Arm hielt sie Viktoria, die seelenruhig und mit geschlossenen Augen an ihrer Brust saugte.
„Sie hat wieder einen großen Appetit“, sagte Josefa zu ihrer Schwägerin, ohne aufzuschauen.
Viktoria stand neben ihr und trug Theodor, ihr viertes Kind, auf dem Arm und drückte ihn zärtlich an sich. Der Kleine fühlte sich sichtlich wohl auf ihrem Arm. Er schmiegte sein Gesicht an den Hals seiner Mutter. Viktoria lächelte zu ihm hinunter und schaute anschließend nachdenklich auf Josefa, die ihre Rolle als Amme hingebungsvoll ausfüllte. Die Situation fühlte sich für Viktoria nicht stimmig an, denn liebend gerne würde sie jetzt ihr Kind stillen. Aber wie sollte sie, ihr Milchfluss versiegte schon wenige Tage nach der Entbindung. Tief in ihrem Herzen wusste Viktoria, dass dies noch von Bedeutung sein würde.
„Warum war eigentlich dein Vater gestern so aufgebracht“, unterbrach Josefa Viktorias Gedanken.
Erleichtert, von ihren unbehaglichen Gefühlen abgelenkt zu werden, war Viktoria schnell bereit, sich einem anderen Gedanken zuzuwenden, obwohl auch dieser nicht ohne Belastung für sie war. Sie überlegte kurz, ob sie vom Anliegen ihres Vaters erzählen sollte, entschloss sich jedoch schnell dafür, denn irgendwann würde sie diesem Gespräch nicht mehr ausweichen können.
„Wenn die Vreni das Kind bekommt, möchte mein Vater es versorgt wissen.“
„Ist es denn von ihm?“, fragte Josefa ungläubig.
„Dazu schweigt er sich aus.“
„Und was meint er mit versorgt wissen?“
„Ich weiß es nicht so genau. Er kriegt es fertig und gibt Vreni samt Bastard Obdach in unserem Haus.“
„Hat er das gesagt?“, hakte Josefa nach.
„Nicht direkt, aber er sagte, wir sollen damit rechnen, dass er in Zukunft mehr Platz braucht.“
„Das kann er doch nicht verlangen.“ Josefa fragte sich, was es wohl für sie und ihre Tochter bedeuten würde. Sie fühlten sich sehr wohl und geborgen in diesem Haus. Ihr eigenes Haus war bei weitem nicht so wohnlich. In den drei Zimmern ihrer feuchten Behausung fehlte es noch immer an Möbeln und Hausrat und an den Wänden war zum Teil noch immer kein Putz.
Sie bewohnten die alte Kate ihrer Großeltern, die schon zu deren Lebzeiten dem Verfall nahe war. Nach dem Tod der Großeltern ging die Kate in den Besitz von Josefas Vater, dem Töpfer Mändle, über. Dieser überließ sie der schonungslosen Natur, die, bis zur Heirat von Georg und Josefa, ganze Arbeit geleistet hatte. Nach der Heirat von Josefa und Georg überschrieb der Töpfer die Kate und das dazugehörige Land auf das junge Ehepaar. In der ersten Euphorie überblickten die beiden die anstehende Arbeit und die zwangsläufig anfallenden Kosten nicht und sie zogen in die feuchte, marode Kate, deren letzte Bewohner schon lange auf dem Kirchhof lagen. Zunächst wurde von Georg das Dach abgedichtet und ein Teil für die Schmiede hergerichtet. Zu Beginn kamen Freunde und Verwandte und packten mit an. Vater Mändle steuerte spärlich Geld und aufgrund eines angeblichen Rückenleidens nur wenig Arbeitskraft bei. Auch die angebotene Arbeitskraft derer, die nicht in dieses Haus einziehen würden, verebbte bald. So kam es, dass die Tage der Kümmernis sich häuften. Die anfänglichen Gespräche und das liebevolle Miteinander wurden bald von sorgenvollen Unterhaltungen abgelöst.
Der Mensch kann Unheil nur begrenzt ertragen, und so wurde das Paar von Monat zu Monat schweigsamer miteinander. Nur, wenn sich der Schleier der Nacht über die Kate legte und der Mondschein die Muster der schwankenden Bäume durch die Fenster, auf die sonst so kahlen Wände, scheinen ließ, waren die Stunden des Trostes gekommen. Dann gaben sie sich der erfüllenden körperlichen Liebe hin. Die Folgen waren die Hoffnungen, die ein beginnendes Leben im Leib der Mutter ihnen zu geben vermochte.
Viktoria ahnte einen Teil der Gedanken ihrer Schwägerin. „Ihr könnt selbstverständlich noch den Winter über hier wohnen. Im Frühjahr kann Georg doch an der Kate weiterarbeiten. Vielleicht sieht es dann im Sommer oder im Herbst schon ganz anders aus.“
„Und im Frühling zieht sie dann mit ihrem Bastard hier ein“, stellte Josefa traurig fest.
Viktoria setzte ihren Sohn Theodor auf den Boden und gab ihre Schwägerin mit ausgebreiteten Armen zu verstehen, dass sie jetzt ihre Tochter auf den Arm nehmen möchte. Die kleine Viktoria war gestillt und schlief im Arm ihrer Tante. Zögernd und vorsichtig übergab Josefa das Baby in die Arme der Mutter.
„Josefa, mach dir keine Sorgen. Ich bin froh, dass du da bist.“
„Wann soll es so weit sein?“, fragte Josefa.
„Was?“
„Die Geburt.“
„Ich weiß es nicht genau, aber ich habe schon ein bisschen gerechnet. Es müsste irgendwann im Februar sein.“
1 Kirchenlied von 1627
2 Volkslied aus dem 19. Jahrhundert
Kapitel 3
Donnerstag, 17. Februar 1887
Der Wind wehte stark aus nordöstlicher Richtung und wirbelte die Schneeflocken ziellos vor sich her. Wer nicht vor die Türe musste, blieb bei diesem Wetter mit seinen eisigen Temperaturen lieber daheim am warmen Herd. Eine Gestalt hatte sich trotzdem in ihr wärmstes Kleid gehüllt, eine wollene Mütze tief über die Stirn gezogen, einen Schal schützend um Hals und Kinn gewickelt und sich zu Fuß auf den Weg gemacht. Es war die Hebamme Anne. Ihr Pflichtgefühl und die Sorge um Vreni trieben sie bei diesem Wetter aus dem Haus.
Erst gestern hatte sie nach der werdenden Mutter geschaut und festgestellt, dass das Kind seine wohlige warme Umgebung bald verlassen und sich auf den Weg in eine ihm unbekannte Welt machen würde. Die Schwangere klagte über knapper werdende Atemluft, über ein Ziehen des Bauches und über schmerzhafte Kindsbewegungen. Anne beruhigte Vreni und versicherte ihr, dass alles in bester Ordnung war. Sie versprach ihr, am nächsten Tag wiederzukommen.
Anne konnte schon von weitem das Bauernhaus des Johann Salger durch das Schneetreiben hindurch schemenhaft erkennen. In einem der Fenster brannte ein Licht, was durch die mit Eiskristallen behafteten Fenster milchiggelb leuchtete. An der Tür angekommen, hämmerte Anne kräftig dagegen.
Knarrend öffnete sich die Tür, hinter der Bauer Salger erschien.
„Gott sei Dank! Kommen Sie schnell herein. Es geht schon los“, sagte der Bauer sichtlich erregt.
Anne trat in den schmalen Vorraum des Hauses. Er war mit Natursteinen gepflastert. Die Wände waren verputzt und mit Bildern verziert, die offensichtlich Familienangehörige aus vorangegangenen Generationen zeigten. Gleich neben der Tür hing ein Wandregal, auf dem ganz oben ein schmutziger Hut thronte.
„Guten Tag, Herr Salger! Darf ich ablegen?“, fragte Anne und legte Schal und Mütze auf das Regal, ohne die Antwort des Hausherrn abzuwarten.
„Ja, natürlich. Meine Frau ist schon bei der Vreni.“ Der Bauer hob ungeduldig die Hände und fing an zu klagen. „Mein Gott, dass sie ausgerechnet hier, in diesem gottesfürchtigen Haus, ihren Bastard zur Welt bringen muss“, sagte er und verdrehte seine Augen, bevor er mit seinen Händen eine wegwerfende Bewegung machte. „Sie wissen ja den Weg.“
„Wurde schon Wasser abgekocht?“, fragte Anne sachlich. Sie beachtete seine Klage nicht.
„Auch das noch. Ich werde welches machen“, sagte er mürrisch.
„Und saubere Tücher bitte.“ Anne war sich nicht sicher, dass dieser unwillig dreinblickende Mann ihren Wünschen Folge leisten würde.
„Das auch noch, als hätte ich irgendetwas mit der ganzen Schweinerei zu tun. Der Vater des Kindes sitzt wahrscheinlich in seinem warmen Kämmerlein und dreht Däumchen, während ich hier herumwiesele und seinem Bastard einen guten Empfang biete. So eine Sauerei!“, brüllte der Bauer und verschwand in der Küche.
‚Der Bauer klingt sonst anders, wenn er erzürnt ist. Etwas in seiner Stimme klang unsicher, zwar kaum wahrnehmbar, aber es war da‹, dachte Anne kurz, wandte sich aber sogleich dem eigentlichen Grund ihres Erscheinens zu.
Sie ging durch eine Tür, die zur Knechtstube führte. In dem kahl wirkenden Raum befanden sich ein großer Tisch, um den mehrere Stühle standen, einige Regale mit Geschirr und ein großer Wandschrank, der mit aufgemalten Blumen verziert war. An der längsten Wand waren drei Alkoven eingelassen. Die ersten beiden Alkoven waren geschlossen und raschelnde Geräusche in ihnen ließen für Anne den Schluss zu, dass sich die beiden Knechte in ihnen aufhielten.
Anne klopfte an die Türen der beiden geschlossenen Bettnischen und rief: „Ihr werdet sofort den Anstand besitzen und das Weite suchen.“
„Wo sollen wir denn hin?“, fragte eine Stimme im Jammerton, die sich durch den Holzverschlag nur dumpf vernehmen ließ.
„Sofort!“, rief Anne. Sie wollte ihre wertvolle Zeit nicht mit Diskussionen verstreichen lassen, sondern sich ganz der Gebärenden widmen.
Zeitgleich öffneten sich die Türen der Bettstatt. Die beiden ungepflegten und müde dreinblickenden Knechte, deren Haare zerzaust von den Köpfen abstanden, schlichen aus dem Raum.
„Guten Tag, Frau Salger!“, sagte Anne zu Frau Salger, die vor Vrenis Alkoven stand und einen Seufzer der Erleichterung ausstieß.
„Bin ich froh, dass Sie da sind. Die Wehen haben bereits eingesetzt und ich glaube, die Fruchtblase ist auch schon geplatzt“, sagte Frau Salger mit einer Miene, die ihre Unzufriedenheit über die Situation erkennen ließ.
„Danke für Ihre Mühe, Frau Salger. Ich denke, ich werde jetzt allein zurechtkommen. Wenn Sie so freundlich wären und mir abgekochtes Wasser und saubere Tücher bringen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar“, forderte Anne die Herrin des Hauses freundlich lächelnd auf.
„Ich werde sehen, was sich machen lässt“, erwiderte Frau Salger unverbindlich und verließ den Raum.
Anne stellte ihre Tasche auf den Tisch und wendete sich der Gebärenden zu.
„Ich bin da“, lächelte Anne Vreni mit einem Augenzwinkern zu, während sie ihre Hand nahm und sich über ihr Gesicht beugte.
„Ich freue mich“, antwortete Vreni, die sich gerade von einer der Wehen, die in immer kürzeren Abständen kamen, erholte. „Bis eben hatte ich Angst Sie könnten nicht rechtzeitig kommen. Jetzt wird bestimmt alles gut, das fühle ich. Ich bin so gespannt, was es wohl wird.“
Anne blickte in die optimistischen, kugelrunden Augen der Magd. ‚Egal, was es wird, es wird geliebt werden von einer Mutter, die zwar sorgenvoll in die Zukunft blickt, aber den unerschütterlichen Willen hat, das Leben ihres Kindes vor den Gefahren dieser Welt zu schützen‹, dachte Anne.
Die nächste Wehe unterbrach Annes Gedanken und ließ die junge Magd aufstöhnen. Anne schob das vom rinnenden Fruchtwasser klatschnasse Unterkleid nach oben und untersuchte in der nächsten Wehenpause den Muttermund der Magd.
„Es wird nicht mehr lange dauern“, stellte die kundige Hebamme fast.
Die Tür zum Raum öffnete sich leise und ein Mädchen trat schüchtern ein. Es war Adelheid, die mit ihren neun Jahren die älteste der drei Töchter vom Ehepaar Salger war. Unter einem ihrer Arme hatte sie saubere Tücher geklemmt. Zögernd trat sie einige Schritte näher.
„Ich soll diese sauberen Tücher bringen“, sagte Adelheid, während ihre jüngere Schwester Ludowika mit einer Schüssel eintrat. „Meine Schwester bringt das heiße Wasser mit“, fügte sie mit gesenktem Blick hinzu.
Ein unbehagliches Gefühl beschlich die Hebamme, genährt von der genauen Beobachtungsgabe einer unabhängigen Frau, die die äußerlichen Zeichen der Menschen, während ihrer berufsbedingten Anwesenheit in den Häusern der unterschiedlichsten Familien, genau studiert hatte. ‚Diese Kinder sind bedrückt und ängstlich‹, dachte Anne. Die Mundwinkel der beiden Mädchen liefen in feinen Linien in Richtung Kinn, als hätte sich auf ihren Mündern noch nie fröhliches Lächeln gezeigt. Ihre Blicke wirkten leer und nach innen gerichtet, so als würden sie sich gegen die Gefahren des Außenlebens abschotten.
„Legt bitte alles auf dem Tisch ab. Ich danke euch“, sagte Anne nachdenklich. Die Kinder machten einen Knicks und verließen eilig den Raum.
Nun ging alles sehr schnell. Nach kurz hintereinander auftretenden Presswehen erblickte das Neugeborene das Licht der Welt.
„Ein Mädchen!“, sagte die junge Mutter voller Freude. „Sie wird Maria heißen und ich werde immer bei ihr sein“, fügte Vreni leise hinzu.
Anne freute sich über das stille Glück dieser Mutter. Sie erlebte es selten, dass Kinder so bedingungslos willkommen geheißen wurden, und sah der Mutter dabei zu, wie sie ihr Kind liebkoste. ‚Maria wird gut gedeihen, da bin ich mir sicher‹, dachte Anne, während sie die Nachgeburtswehen beobachtete, die die Plazenta auszustoßen vermochten. Sie hatte längst erkannt, dass zwischen einer glücklichen, ausgeglichenen Mutter und dem Gedeihen eines Kindes Zusammenhänge bestanden.
Anne untersuchte Form, Gewicht und Aussehen der soeben ausgeschiedenen Plazenta. Sie war, wie sie schon zuvor vermutet hatte, genauso gesund wie die Mutter und das Kind.
Nun wischte Anne mit einem feuchten Tuch das Blut von der Haut der Mutter und wechselte die befleckten Tücher des Bettes aus. Danach nahm sie den Säugling, untersuchte ihn und wickelte ihn anschließend in sauberes Leinen.
„Damit das Winterkind sich nicht erkältet“, sagte Anne sanft und legte Maria zurück auf den Bauch der Mutter. Anschließend gab sie Vreni einen Becher mit kühlem Wasser, die ihn mit großen Schlucken austrank.
„So, liebe Vreni, ich habe meine Arbeit getan und werde jetzt gehen.“
„Ich danke Ihnen sehr, Anne“, sagte Vreni und schaute die Hebamme erwartungsvoll an.
„Ist noch etwas?“
„Ich weiß, es ist ein Unwetter draußen und eigentlich …“, begann Vreni zögernd.
„Nun rück schon raus damit, was möchtest du mir sagen?“, drängte Anne.
„Es ist mir unangenehm, aber ich sehe mich jetzt nicht in der Lage …“
„Wozu siehst du dich nicht in der Lage? Nun sag schon, Vreni.“
„Könnten Sie dem alten Wagner ausrichten, dass ich heute ein Kind bekommen habe?“
Anne war erstaunt und einen kurzen Augenblick sprachlos, was selten bei ihr vorkam. Sie hatte sich natürlich Gedanken gemacht, wer der Vater von Maria wohl sein könnte, aber mit dem Wagner hatte sie nicht gerechnet.
„Ist er der Vater?“, fragte Anne mehr zu sich selbst, denn es lag ihr fern, der Magd ein Geständnis zu entlocken. „Entschuldige, es geht mich natürlich nichts an. Selbstverständlich werde ich dir den Gefallen tun und Herrn Wagner die Geburt des Mädchens ausrichten.“
„Ich danke Ihnen für alles, was Sie für mich getan haben“, sagte Vreni. „Auch dafür, dass ich Ihnen vertrauen kann, möchte ich mich herzlich bedanken.“
„Morgen schaue ich nach dir und dem Kind. Servus!“
„Servus, Anne!“
Den Nachmittag nutzte Anne, um weiter an einer Stickarbeit zu arbeiten. Wenn Anne stickte, konnte sie ihre Gedanken sammeln, über vieles nachdenken und Erlebtes vernünftig einordnen. Sie hatte im vergangenen Jahr vom Juden Kindig ein schönes Stück Leinenstoff günstig erstanden und bald darauf begonnen, ihn zur Tischdecke umzunähen und mit Blumenmustern zu besticken. Die Decke sollte ein Geschenk für ihre Mutter werden, zu der sie ein inniges Verhältnis hatte.
Anne bewunderte ihre Mutter sehr. Sie war es auch, die ihr den Weg ermöglicht hatte, ihrer Berufung als Hebamme nachzugehen. Als Jugendliche durfte Anne ihre Mutter begleiten, wenn ihre Anwesenheit bei Geburten erwünscht war. Ihre Mutter hatte über das Dorf Glöttweng hinaus den Ruf eine versierte Geburtshelferin zu sein, erkannte aber auch die begrenzten Möglichkeiten, ohne eine vernünftige Ausbildung. „Solltest du einmal eine Hebamme werden wollen …“, sagte sie ihrer Tochter nach einer für die Mutter tragisch endenden Geburt, „… wirst du diesen Beruf richtig erlernen.“ Dass ihre Mutter ihr die selbständige Arbeit einer ausgebildeten Hebamme zutraute, erfüllte sie mit Stolz. Sie wusste, wie gerne auch ihre Mutter diese Ausbildung gemacht hätte. Aber ihr Schicksal war ein anderes. Sie verlor ihren Mann, einen selbständigen Tischler, als Anne drei Jahre alt war, an einer Tuberkulose-Infektion. Annes Bruder Martin war zu dieser Zeit schon ein junger Mann, der beim Vater das Tischlerhandwerk erlernt hatte. Die Witwe war froh, dass Martin die „Möbeltischlerei Vogt“ übernehmen konnte und so die Zukunft der Familie gesichert hatte.
An diese Zeit hatte Anne keine Erinnerung mehr, da sie damals noch zu klein war. Dennoch lauschte sie gerne den Erzählungen des Bruders, der den Vater bildhaft schildern konnte, ohne ihn mit seinen Worten auf einen heldenhaften Sockel zu heben. Überhaupt hatte der Bruder etwas sehr Sachliches. Anne liebte ihn sehr. Er war verlässlich, gerecht und Neid schien ihm ein Fremdwort zu sein. Martin war sofort einverstanden, als seine Mutter vorschlug, dass Anne eine Ausbildung zur Hebamme an der Berliner Charité machen sollte.
Martin wusste, dass seine Mutter einige Silberkreuzer zurückgelegt hatte. Sie bewahrte sie in einer Truhe unter ihrem Bett auf. Als er jünger war, faszinierten ihn diese kleinen, runden Geldstücke mit dem Konterfei von König Ludwig darauf. Dass er einige Goldmark aus dem Gewinn der Tischlerei für Annes Ausbildung dazulegen würde, war selbstverständlich für ihn.
Anne ermahnte sich, ihre Gedanken nicht zurück in die schöne Zeit ihrer Ausbildung in Berlin schweifen zu lassen. Schließlich galt es für diesen Moment darüber nachzudenken, welche Verbindungen es zwischen Vreni und dem alten Wagner gab und wie sie ihm gleich gegenübertreten sollte.
Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich Vreni mit dem Alten eingelassen hatte. Aber warum sonst sollte sie ausgerechnet ihm über die Geburt ihres Kindes berichten? Ihm würde Anne das Verlangen nach einer Frau wie Vreni durchaus zutrauen, denn Vreni war nicht nur jung und sah gut aus, sie war zudem intelligent und dies wiederum würde dem alten Wagner auch gefallen, bedachte Anne. Vielleicht hatte der alte Mann einige Ersparnisse, was aber nicht ausreichen dürfte, um die Magd in seine Abhängigkeit zu nötigen. Sosehr sie sich auch bemühte, ihr viel kein schlüssiges Argument ein, warum Vreni dem Werben dieses alten Mannes nachgegeben haben sollte.
Anne legte ihre Stickarbeit beiseite und beschloss den alten Wagner aufzusuchen.
Mit Anne kamen einige vom Wind aufgewirbelte Schneeflocken durch die Tür in den großen Saal des Wirtshauses „Zum Adler“ hinein. Das Wirtshaus bekam seinen Namen nicht etwa wegen der Begeisterung seines Besitzers über Bayerns Einverleibung unter die Fittiche des preußischen Adlers. Das durften die Kaisertreuen unter den oftmals weit gereisten Gästen ruhig denken, auch wenn die Mehrheit der Finks derzeit lieber einen unabhängigen bayerischen König als ihr Staatsoberhaupt gesehen hätte. Viele der Dorfbewohner gingen davon aus, dass der Name auf das Symbol des heiligen Apostel Johannes, der hier im Dorf sehr verehrt wurde, anspielte. Auch ihnen ließ der Wirt ihren Glauben und schwieg sich zu seinen ganz eigenen, banalen Gründen der Namensgebung aus. Tatsache war lediglich, dass er die dem Adler nachgesagten Eigenschaften Ausdauer, Kraft und Beständigkeit gerne auf sich bezog und die nachgesagte Freiheit des Adlers auch in seiner selbständigen Arbeit erkannte. Insgeheim war er sehr stolz darauf, „sein eigener Herr“ zu sein.
„Guten Abend, Wirt!“, sagte Anne, während sie sich den Schnee von den Kleidern klopfte.
„Grüß Gott, Anne!“, grüßte Theodor Fink freundlich zurück, denn er freute sich über die Ankunft der vielgeschätzten Hebamme. Ihm war bewusst, dass seine fünf Kinder durch ihre Mithilfe gesund zur Welt gekommen waren. Plötzlich fiel ihm das Gespräch mit seinem Schwiegervater während der Taufe seiner Tochter Viktoria ein und das Lächeln Theodor Finks verebbte hinter seinem unrasierten Bart. Es sollte an diesem Tag auch nicht mehr auf seinem Gesicht erscheinen.
„Ich ahne nichts Gutes“, sagte er schließlich.
„Aber nicht doch, ich bringe frohe Kunde“, gab Anne sich optimistisch und fragte sich gleichzeitig, warum die Kinnlade des Wirts plötzlich so weit offen stand.
„Nun bin ich aber gespannt“, stellte der Wirt fest und gab sich wenig zuversichtlich.
„Oh, Entschuldigung, aber die frohe Kunde wollte ich nicht Ihnen ausrichten.“
„Ach so! Frauensache, ich verstehe“, sagte er. „Einen Moment, ich hole meine Frau.“
„Nein, nein! Ich möchte gerne zum Herrn Wagner.“
„Also doch! Nun wird ja wohl der Hund in der Pfanne verrückt“, sagte der Wirt einen Tick zu laut, so dass ihn die zumeist männlichen Gäste erstaunt ansahen.
„Kommen Sie bitte mit“, sagte der Wirt. Er war jetzt sichtlich bemüht vor den Gästen leiser zu sprechen und deutete zur Tür, die zum Flur führte.
„Hinten rechts“, sagte der Wirt und deutete auf die Zimmertür des alten Wagner.
Anne klopfte an.
„Herein!“, ertönte eine Stimme hinter der Tür.
Anne öffnete die Tür und trat einen Schritt in den Raum, der auf einen ordentlichen Bewohner schließen ließ. Das Bett unter dem Fenster war frisch gemacht und daneben stand ein Hocker, auf dem eine saubere Schüssel für die Morgenwäsche bereitstand. Auf dem Tisch lag eine frischgebügelte Decke, in dessen Mitte ein Topf mit einem Alpenveilchen stand. Vor einer Wand befand sich etwas, das mit einem weißen Laken abgedeckt wurde. Anne hätte gerne gewusst, was sich darunter verbarg. Das Regal mit den Büchern daneben verriet den Schulmeister als einen belesenen Mann. Werke von Goethe, Schiller und Hölderlin standen neben großen Philosophen wie Sokrates, Descartes und Spinoza.
„Guten Abend, Herr Wagner!“, grüßte Anne. „Darf ich eintreten?“
„Danke, den wünsche ich Ihnen auch! Ich freue mich über Ihren Besuch“, sagte der Alte ruhig und lächelte.
„Es klingt, als hätten Sie mich erwartet.“ Sie sah den alten Mann an, der auf einem Stuhl saß und ein aufgeschlagenes Buch in seinen Händen hielt.
„Ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe, aber ich will ehrlich sein, denn dass Sie mich aufsuchen, war eine der Möglichkeiten, die ich in Betracht gezogen habe. Auf jeden Fall bin ich vorbereitet auf das, was Sie mir wahrscheinlich erzählen werden“, sagte der Alte in nachdenklichem Tonfall.
„Herr Wagner, ich war heute Morgen bei Vreni. Sie wissen wahrscheinlich, wen ich meine – die Magd von Bauer Salger.“
„Ich weiß, wer Vreni ist. Wie geht es ihr? Ich hoffe, sie ist wohlauf?“
„Es geht ihr gut. Sie schickt mich zu Ihnen.“
„Hat sie endlich das Kind bekommen?“
„Deshalb bin ich hier. Sie hat heute ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Gleich nach der Geburt bat Vreni mich, es Ihnen mitzuteilen.“
„Ein Mädchen“, sagte der Alte lächelnd. Er schien plötzlich mit seinen Gedanken weit weg zu sein.
„Ich werde dann wieder gehen. Auf Wiedersehen!“, sagte Anne. Sie hatte sich schon zum Gehen abgewendet, als der alte Mann ihr nachrief.
„Frau Vogt!“
Anne reagierte nicht. Sie ahnte, dass sie in etwas hineingezogen werden könnte, womit sie nicht das Geringste zu tun haben wollte.
„Frau Vogt!“, rief der Alte ein zweites Mal, worauf Anne sich wieder umdrehte und ihn fragend ansah. „Bitte, könnten Sie noch einen Augenblick bleiben?“





























