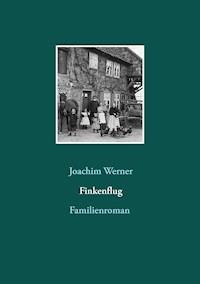Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Viktoria ist noch ein junges Mädchen, als ihr Vater im Jahre 1897 stirbt. Der Verlust bleibt für sie unverarbeitet. Ihre Mutter ist eine vielbeschäftigte Frau, die sich im Wesentlichen darauf konzentriert, die Gastwirtschaft ihres Mannes weiterzuführen und in dieser den ältesten Sohn als ihren würdigen Nachfolger zu etablieren. Für die Wirtin ist es selbstverständlich, dass alle ihre Kinder mit anpacken müssen und dadurch viele ihrer Hoffnungen und Gefühle unbeachtet bleiben. So schlittern Viktoria und ihre Geschwister, größtenteils auf sich allein gestellt, hinein in eine bedeutsame Phase des Lebens: Die Adoleszenz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch
Im ersten Familienroman „Finkenflug ›Frühe Kindheit‹“ wird das prägende Erleben der ersten zehn Lebensjahre von Viktoria Fink geschildert. Widrige Ereignisse und das nicht immer nachvollziehbare Verhalten ihrer Bezugspersonen haben maßgeblichen Einfluss auf das Seelenleben des Kindes gehabt. Im zweiten Teil, „Funkenflug ›Adoleszenz‹“, wird unter anderem der Frage nachgegangen, wie Viktoria im ausklingenden 19. Jahrhundert mit ihren Erfahrungen aus der frühen Kindheit in der Lage sein wird, ihre Jugendjahre zu bewältigen. Hierbei geht es zum Beispiel wegweisend um die Frage, ob Viktoria eine Resilienz entwickeln konnte, die sie befähigt, ihr inneres Gleichgewicht zu finden bzw. zu behalten. Wie greift sie auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zurück, um Krisen zu bewältigen?
Neben dem Erwachsenwerden der Hauptfigur soll aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten die Witwe Viktoria Fink für sich nutzt, nach dem Verlust ihres Mannes die Gastwirtschaft mit enormem Kraftaufwand erfolgreich weiterzuführen; aber auch, welche Chancen sie demzufolge in Bezug auf die Begleitung ihrer Kinder vergehen lässt.
Der Autor
Joachim Werner, Jahrgang 1963, wohnt mit seiner Frau in Quickborn am nördlichen Stadtrand von Hamburg. Er ist stolzer Vater zweier erwachsener Töchter und mit ganzem Herzen Großvater.
Umschlaggestaltung: Manfred Bredehöft
Für Kirsten, Katrin, Julia und Lina
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 Theodor hat hiebfeste Argumente
Kapitel 2 Die Idee, die Leben ausmacht
Kapitel 3 Der Wagen des Juden Kindig
Kapitel 4 Theodor geht fort
Kapitel 5 Leibesvisitation
Kapitel 6 Genoveva in Not
Kapitel 7 Sacht. Sanft. Still!
Kapitel 8 Das Hochzeitsfest
Kapitel 9 Leben und Tod, Gott und Freiheit
Kapitel 10 Der Preuße
Kapitel 11 Wachs in seinen Händen
Kapitel 12 Aus demselben Holz geschnitzt
Kapitel 13 Der Vagabund, der in Hamburg war
Kapitel 14 Ein letzter Blick
Glöttweng im Schwäbischen
1. Theodor hat hiebfeste Argumente
Mittwochvormittag, 28. April 1897
Erstmals in diesem Jahr konnte Viktoria, Wirtin des Gasthofs „Adler“, die Wäsche zum Trocknen im Garten aufhängen. Es war schlagartig wärmer geworden. Das Grau des zu Beginn kühlen, regenreichen Frühlings war einem sonnendurchfluteten Spätapriltag gewichen. Letzte weiße Wölkchen schob der leichte Wind vor sich her, um den Himmel bald in reiner Pracht erstrahlen zu lassen.
Viktoria bückte sich zum Korb hinunter und entnahm ihm ein Höschen ihrer Unterwäsche. Sie schüttelte den Schlüpfer einmal kräftig aus und klammerte ihn so an die Wäscheleine, dass er durch andere Wäschestücke verdeckt blieb. Niemand sollte sehen, was sie unter ihren Kleidern trug, schon gar nicht Johann Salger. Seit dem Tod ihres Mannes wurde der Bauer ihr gegenüber zunehmend aufdringlich.
In den letzten Tagen hatte Viktoria viel über ihren verstorbenen Theodor und sich selbst nachgedacht, und sie kam sich zuweilen auf beklemmende Weise schuldig vor. Kurz nach seinem Tod hatte sie sich einfach nur leer gefühlt und sie hatte sich viele Wochen in einer Lethargie verloren, aus der es sich nun zu befreien galt. Erst allmählich, mit dem nötigen Abstand, begriff Viktoria, was sie an ihrem Mann gehabt hatte. Merkwürdigerweise besserte ihr Zustand sich mit dieser Erkenntnis und sie spürte manchmal schon wieder die geistige Stärke und den Antrieb früherer Zeiten.
Vielleicht, so hatte sie noch vor Kurzem sinniert, könnte ihr Theodor noch am Leben sein, wenn er sich mehr Schonung gegönnt hätte, sie mehr auf ihn eingegangen wäre oder seinem Gesundheitszustand mehr Beachtung geschenkt hätte. Aber Viktoria war nach dem Tod ihrer beiden jüngsten Kinder in einer Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Umwelt versunken, aus der sie lange Zeit keinen Weg herausgefunden hatte. Erst mit der unfreiwilligen Übertragung der alleinigen Verantwortung für Gasthof und Familie fand sie allmählich aus dem tiefen Tal der Betrübnis, dem Zustand einer gräulich wabernden Dämmerung, heraus. Mit ihrer wiedergewonnenen Stärke wurde ihr bewusst, dass alles „Wenn und Aber“ ihren Mann, den sie, das wusste sie jetzt, sehr geliebt hatte, nicht wieder lebendig machen würde. Mit der Gewissheit ihrer wahrhaften, nie erloschenen Liebe zu ihrem Mann war Viktoria gestern an sein Grab getreten und hatte sich geschworen, ihm so lange die Treue zu halten, bis sie sich im Himmel wieder vereinigen würden. Erst nach diesem Gelübde hatte sie endlich ihre seit Langem zurückgehaltenen Tränen weinen können. Es war wie eine Befreiung gewesen!
„Grüß Gott!“
Viktoria, in Gedanken versunken, drehte sich erschrocken um.
„Ach, du bist es. Ich habe dich nicht kommen hören“, sagte Viktoria zu ihrem Schwager Joseph, dem ältesten Bruder ihres verstorbenen Mannes. Joseph kam in den letzten Monaten oft vorbei, um nach dem Rechten zu sehen, und stand Viktoria mit Rat und Tat zur Seite.
„Gut siehst du aus.“ Joseph meinte es ehrlich. Er war nicht der Mensch, der erlogene Komplimente von sich gab. Ihm war nicht entgangen, dass seine Schwägerin wieder etwas zugenommen hatte und ihre Gesichtszüge eine lange nicht dagewesene Entspannung zeigten. Sogar mehr Farbe nahm er in ihrem Gesicht wahr, die ein wenig von der schwarzen Trauerkleidung ablenkte.
„Es geht mir auch wieder besser. Ich habe wieder Ziele und plane für die Zukunft, so hätte es sich Theodor bestimmt von mir gewünscht.“
Auch wenn sich so etwas wie Herzlichkeit zwischen Viktoria und ihrem Schwager entwickelt hatte, nahmen sie sich nicht in den Arm. Derartige Herzlichkeit wurde in anderen Gesten ihres Miteinanders sichtbar. Zum Beispiel in der entgegenkommenden Weise, wie sie miteinander sprachen, oder wenn er ihr manchmal aufmunternd zuzwinkerte. Es entstand mit der Zeit ein stillschweigendes Abkommen, dergestalt, dass der eine dem anderen in seiner Not immer helfen würde, und Joseph hatte dies in den letzten Monaten eindrücklich unter Beweis gestellt. Viktoria war ihm sehr dankbar dafür.
„Hört sich so an, als würde ich hier bald entbehrlich sein“, sagte Joseph mit gespielter Traurigkeit, wobei er sein Lächeln nicht unterdrücken konnte.
„Na ja, es gibt da etwas, wo mir der Mann im Haus fehlt … “, sprach Viktoria verlegen, „… aber dabei wirst auch du mir wahrscheinlich nicht helfen können.“ Sie zuckte mit den Schultern.
„Bauer Salger?“, fragte Joseph knapp.
„Er kommt des Öfteren in die Wirtschaft, immer abends, setzt sich meistens allein an einen Tisch, bestellt sich ein Bier und gafft mich unentwegt an. Wenn ich ihm sein Bier bringe, macht er mir aufdringliche und zuweilen anzügliche Komplimente wegen meines ach so guten Aussehens.“ Viktorias wegwerfende Handbewegung ließ keinen Zweifel aufkommen. – Sie fand sich nicht gutaussehend. Die Schwangerschaften und die Nöte der letzten Jahre hatten Spuren hinterlassen, die eine Frau beim kritischen Blick in den Spiegel an sich selbst nicht übersehen wollte.
Joseph hingegen konnte den Bauern verstehen. Viktoria war trotz ihrer acht Geburten schlank geblieben, ihr kräftiges Haar trug sie sorgfältig gebürstet und hochgesteckt, was ihrem ohnehin interessanten Antlitz zusätzlich etwas ungewollt Verwegenes gab. Und jetzt, wo sie sich dem Leben wieder zu öffnen schien, wirkte ihr Gesicht hell und strahlend wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
„Hast du ihm deine Ablehnung schon zu verstehen gegeben?“, fragte Joseph, dem Männer wie Johann Salger, die Frauen belästigten, obwohl diese ihre Ablehnung deutlich signalisierten, zuwider waren. Besonders schwer wog für ihn das Verhalten des Bauern, da sich seine Schwägerin noch im Trauerjahr befand.
„Mehrmals habe ich ihm gesagt, dass seine Bemühungen umsonst sind, weil ich an keinem Mann, und schon gar nicht an ihm, interessiert bin.“
„Das müsste ihm eigentlich genügen, um einzusehen, dass sein Bemühen keinen Wert hat“, sinnierte Joseph.
„Johann Salger will es nicht einsehen. Er bleibt hartnäckig und respektlos.“
„Wie reagieren die anderen Gäste?“
„Die bekommen das meistens nicht mit, weil der Kerl sich fast immer abseits von den anderen Gästen hinsetzt.“
„Kommt er heute Abend wieder in die Wirtschaft?“
„Davon ist auszugehen, zumal er gestern nicht da war.“
„Ich werde mich heute zu ihm an den Tisch setzen“, äußerte Joseph entschlossen.
„Oh, Joseph!“, entgegnete Viktoria erschrocken und hielt sich eine Hand vor den Mund. „Nicht, dass es heute noch Ärger gibt. Du kennst ihn doch – der Kerl ist unberechenbar.“
„Willst du, dass es ewig so weitergeht?“
„Natürlich nicht.“
„Na also.“
Nachmittag
„Wir kneifen einfach die Augen zu und jeder stellt sich etwas Schönes vor. Wenn wir die Augen wieder geöffnet haben, erzählen wir uns gegenseitig, was wir uns vorgestellt haben. Einverstanden?“
„Na gut!“, antwortete Viktoria lustlos. Einerseits wollte sie keine Spielverderberin sein, konnte sich andererseits aber nicht vorstellen, auf Kommando an etwas Schönes zu denken. Gerade eben hatte Viktoria sich mit ihrer Freundin Adelheid, Tochter des Melkers Georg Karg, ins Gras gelegt. Sie hätte sich jetzt lieber auf das Gefühl des kühlen Grases konzentriert, welches so angenehm auf ihren Rücken überging. Nebenbei wollte Viktoria weiterhin dem Summen und Brummen der Insekten zuhören und das eifrige Treiben der Vögel beobachten. Danach hätte sie sich gerne noch einen Haarkranz aus Gräsern geflochten.
Doch Viktoria ergab sich den Wünschen der Freundin. Sie war sich nicht sicher, ob die Freundin sich gegen sie wenden würde, wenn sie nicht auf ihren Vorschlag einginge. Seit dem Tod ihres Vaters hatten ihre Verlustängste zugenommen. Viele Menschen, die Viktoria sehr geliebt hatte, waren in den letzten Jahren, meistens ohne ein Wort des Abschieds, für immer aus ihrem Leben verschwunden, obwohl sie selbst in diesem Jahr erst ihren elften Frühling zählte. Erst war ihre Tante Josefa verstorben, die Viktoria als Säugling an ihrer Brust genährt hatte. Dann der plötzliche Tod ihrer Cousine Josefa, die sie oft besucht hatte – bei ihr hatte sie so etwas wie Geborgenheit erfahren. Zu allem Unglück war nach ihren zwei kleinen Geschwistern nun auch noch ihr Vater gestorben. Der Vater war eine feste Größe in Viktorias Leben gewesen, der einzige Mensch, von dem sie gedacht hatte, dass er alles, aber auch wirklich alles, könnte und unbesiegbar wäre. Dass ihn der Tod eines Tages besiegen würde, daran hatte Viktoria niemals gedacht. Je länger der Vater tot war, desto mehr heroisierte Viktoria ihn. Sie stellte sein Fehlverhalten nicht mehr in Frage, versuchte eher sein ungerechtes Betragen vor sich zu rechtfertigen. So hielt Viktoria die Prügel im Nachhinein für die logischen Folgen ihres eigenen Fehlverhaltens. Durch die Täuschungen und Lügen ihrer älteren Brüder war der Vater zusätzlich herausgefordert und zum fehlgeleiteten Handeln getrieben worden. „Ihn trifft keine Schuld!“, redete ihr die gepeinigte Kinderseele ins Gewissen.
„Sind deine Augen geschlossen?“, wollte Adelheid wissen, die ihre Augen fest zugekniffen hatte.
„Ja, sie sind zu.“ Viktoria kniff die Augen zusammen und sah für kurze Zeit bunte Flecken vor schwarzem Hintergrund in die Unendlichkeit jagen.
„Das ist gut“, befand Adelheid.
Unvermittelt stellte sich eine Gesprächspause ein, in der Viktoria zunächst die Geräusche der Umgebung und das Kitzeln eines Grashalmes in ihrem Gesicht wahrnahm. Sie zwang sich, die Order, so empfand Viktoria den Einfall ihrer Freundin, auszuführen. Zu ihrer Überraschung wanderten ihre Gedanken in Windeseile zurück zu einem Dorffest, wo sie beim Sackhüpfen als Erste ins Ziel gekommen war. Das war ein tolles Erlebnis für Viktoria gewesen, die damals, nachdem sie die Ziellinie überquert hatte, in viele freundliche Gesichter geschaut hatte. Sie sah die jubelnden Gesichter ihrer Mutter und ihrer Schwestern Genoveva und Anna vor sich. Als sie den lächelnden Mund und die entzückten Augen ihrer ehemaligen Lehrerin, Annemarie Stadler, vor sich sah, wich die Fröhlichkeit aus ihren Gedanken. Auch Frau Stadler, die netteste Lehrerin, die sich Viktoria vorstellen konnte, war einfach aus ihrem Leben verschwunden. Ersetzt worden war sie durch Giesbert Nörgel, einen Lehrer mit mädchenverachtendem Verhalten.
„Und? Woran hast du gedacht?“
Viktoria erschrak, als Adelheid plötzlich die Stille mit ihrer Stimme durchbrach. Sie öffnete blinzelnd ihre Augen. „Ich habe daran gedacht, wie nett Frau Stadler war.“
„Du solltest doch an etwas Schönes denken, nicht an die Schule.“
„Ich habe nicht an die Schule gedacht, und selbst wenn, Frau Stadler hat auch in der Schule gute Sachen gemacht. Ihre Gedichte waren wunderbar, und nie hat sie uns so richtig ausgeschimpft.“
„Ich weiß gar nicht mehr, wie Frau Stadler ausgesehen hat“, bemerkte Adelheid. „Ist ja auch egal! Willst du wissen, an was ich gedacht habe?“
„Wenn du willst“, sagte Viktoria, die dieses Spiel lieber beendet und sich mit der üppigen Natur beschäftigt hätte.
„Ich habe daran gedacht, in der Glött zu baden.“
„Viel zu kalt“, sagte Viktoria und gab durch Gebärden vor zu frösteln.
„Aber die Sonne scheint so herrlich warm.“
„Das Wasser ist noch eiskalt.“
„Komm, wir probieren es einfach an der Biegung aus.“ Adelheid erhob sich. „Wenn es zu kalt ist, können wir uns noch etwas anderes überlegen.“
Viktoria dachte an die Stelle, wo die Glött einen kleinen Bogen machte. Dort wurde von der leichten Strömung feiner Sand aufgeschwemmt, was zum ausgiebigen Buddeln einlud. Sie stand auch auf, schaute ihre Freundin an und rief: „Wer als Erste da ist!“
Beide liefen gleichzeitig los, und ihr lautes Juchzen war noch eine Weile zu hören. Die Mädchen ahnten nicht, dass sie seit geraumer Zeit von einem Augenpaar beobachtet wurden.
Adelheid watete mit nackten Füßen durch das in den letzten Tagen leicht angestiegene Flüsschen, während Viktoria am Ufer stehend zuschaute.
„Es ist gar nicht so kalt.“ Adelheid spritzte mit einem Fuß unzählige glitzernde Wassertropfen zu Viktoria hinüber. „Komm auch rein, es ist angenehm.“
Langsam tastete sich Viktoria nun vor, um bald bis zu den Knöcheln im Wasser zu stehen. Schnell gewöhnte sie sich an das kühle Nass. Alsbald bückte sich Viktoria, hielt mit der rechten Hand ihr Kleid über der Wasseroberfläche fest und glitt mit der anderen freudig durch das Wasser. Langsam ließ Viktoria wasserdurchtränkten Sand, den sie vom Grund hochgeholt hatte, durch die Hände gleiten. Zum Teil besprenkelte Viktoria mit dem Wasser-Sand-Gemisch ihr sauberes Kleid.
„Mein Kleid wird ganz schmutzig“, bemerkte Viktoria mit vernehmbarem Schrecken in ihrer Stimme.
„Das ist doch nicht so schlimm“, meinte Adelheid, deren Kleid bereits erste nasse Stellen aufwies.
„Aber ich habe es heute frisch angezogen, weil meine Mutter mein anderes Kleid heute Morgen erst gewaschen hat.“
„Dann zieh es doch aus“, schlug Adelheid vor.
„Nein!“, entfuhr es Viktoria. „Wenn uns jemand sieht.“
„Außer uns ist hier niemand“, meinte Adelheid und blickte sich flüchtig um.
Auch Viktoria schaute sich um. Ringsumher wuchsen Gräser und Sträucher, die für das Auge undurchdringlich waren. Auch als sie sich auf ihre Zehenspitzen stellte, konnte sie niemanden entdecken.
„Nicht, dass sich jemand im Gebüsch versteckt hält.“ Viktoria hatte ein unbehagliches Gefühl. Ihr war, als ob sie beobachtet würden.
„Du siehst Gespenster“, sagte Adelheid, stieg aus dem Wasser und entkleidete sich. „Siehst du, ist doch nichts dabei“, ergänzte sie, während sie wieder ins Wasser trat. „Und jetzt bist du dran. Na, los!“
Viktoria sagte nichts, ging aber leise seufzend aus dem Wasser heraus und tat es ihrer Freundin gleich.
Es dauerte eine Weile, bis Viktoria ihre Hemmungen überwunden hatte und sich dem unbedarften Spiel mit ihrer Freundin hingab. Zusammen gingen die Freundinnen ein kleines Stückchen weiter flussaufwärts, wo sie auf eine Population Bachmuscheln trafen. Das kalte Wasser machte ihnen schon längst nichts mehr aus und so waren die beiden Mädchen vertieft in ihre Unternehmung, die Muscheln genauer zu untersuchen.
Die Mädchen konnten nicht ahnen, dass sich derweil zwei Hände in stetem Rhythmus aus dem Dickicht hervor- und zurückschoben und ein Kleidungsstück nach dem anderen in die Verborgenheit des Gestrüpps beförderten.
Im Gestrüpp verborgen saß Theodor, Viktorias Bruder, und lugte zwischen den Grünpflanzen, einem Geflecht aus Trieben der Silberweide, Schwarzerle und Esche, hervor. Er wusste, dass die Sicht aus seinem Versteck heraus ausgezeichnet war, während ihn vom Flüsschen her niemand sehen konnte.
Theodor konnte es kaum erwarten, dass die beiden aus dem Wasser stiegen, um sich wieder anzukleiden. Er hatte sein werdendes Interesse am anderen Geschlecht noch nicht in vollem Umfang realisiert, wollte jedoch seiner aufkommenden Neugierde, gespickt mit seinem Hang zu gemeinen Streichen, nachgeben. Bald sah er die beiden Mädchen kommen. Sie wateten gemächlich durch das Wasser und schienen es nicht eilig zu haben. Adelheid hielt etwas in ihrer Hand und beide Mädchen richteten ihre Blicke darauf. Aber was auch immer Adelheid in ihrer Hand hielt, es interessierte Theodor nicht. Vielmehr konzentrierte sich sein Blick auf ihren Körperbau, betrachtete er ihre Andersartigkeit, die sich ihm erst auf dem zweiten Blick vollends erschloss. Er betrachtete ihre sich zaghaft entwickelnden Brüste, die sich ein wenig hervorwölbten, und stellte fest, dass der Anblick seine Gefühlswelt aufs Angenehmste veränderte. Sein Herz schlug plötzlich schneller und ihm wurde auf prickelnde Art wärmer. Als Theodor seinen Blick auf tiefer liegende Regionen ihres Körpers richtete, wurde er eines zarten Flaumes gewahr – ein Anblick, der ihm fast die Sinne zu rauben schien.
Theodors Blick war ein entrücktes Starren, während ihm sein Gefühl außer Kontrolle zu geraten schien. Erst als Theodor die Stimme seiner Schwester vernahm, kehrte er ruckartig in die Wirklichkeit zurück.
„Wo sind unsere Kleider geblieben?“, fragte Viktoria entsetzt. Sie stöberte zwischen Mädesüß und Milzkraut, wo die Kleider vorhin noch gelegen hatten. „Ich weiß genau, dass sie hier waren.“
Nachdem Viktoria in seine Richtung blickte, schob Theodor seinen Kopf ein wenig tiefer zurück ins Dickicht, obgleich dies nicht nötig war, denn die Mädchen hätten ihn ohnehin nicht sehen können. Noch bevor er seine Hand aus der Hose zog, spürte er Schamesröte in sein Gesicht steigen. Was, wenn die Mädchen ihn so gesehen hätten?
„Es muss jemand hier gewesen sein“, stellte Adelheid fest. Sich umblickend versuchte sie einen Menschen in der Umgebung ausfindig zu machen. Beide Mädchen hielten sich die Hände und Arme vor ihre entblößten Körper.
„Was machen wir denn jetzt?“, fragte Adelheid, über deren verzweifelt dreinblickendes Gesicht die ersten Tränen liefen.
„Ich laufe schnell nach Hause“, sagte Viktoria.
„Und was ist mit mir?“ Adelheid wirkte bei der Vorstellung, sich in dieser Situation von der Freundin trennen zu müssen, noch verzweifelter als zuvor. „Ich kann doch jetzt nicht alleine … so, wie ich bin … oh, Gott!“
Viktoria begriff die Not ihrer Freundin sofort. Es schien etwas zu geben, was es ihr unmöglich machte, so nackt und schutzlos, wie sie war, bei sich zu Hause zu erscheinen. „Komm erst einmal mit zu mir.“
Gemeinsam schlichen sie, den Oberkörper nach vorne gebeugt, durch Dickicht und Gestrüpp, stets darauf bedacht, nicht gesehen zu werden. Als sie an Häuser vorbeikamen, beobachteten und lauschten die Mädchen, ob von ihnen aus die peinliche Gefahr der Entdeckung drohte.
Keines der beiden Mädchen ahnte, dass Theodor ihnen unauffällig folgte, sie aus sicherer Entfernung beobachtete und sich köstlich über seinen Streich amüsierte. Unter seinem Arm hielt er die Kleider der Mädchen fest an sich gedrückt.
Endlich kamen Adelheid und Viktoria im Garten des Wirtshauses an. Sie konnten das Stimmengewirr einiger Gäste hören, die anscheinend auf der Terrasse, die sich auf der Vorderseite des Hauses befand, in der Frühlingssonne saßen.
„Wir verstecken uns erst einmal zwischen der Wäsche“, entschied Viktoria. „Da wird uns so schnell niemand entdecken.“
In der gebeugten Haltung, die sie seit ihrem Aufbruch vom Fluss eingenommen hatten, liefen Viktoria und Adelheid zwischen die zum Trocknen aufgehängten Laken und Kleidungsstücke. Mit leisen, tippelnden Schritten folgte Theodor den beiden Mädchen, legte, sich vergewissernd herumsehend, die Kleider von Adelheid und seiner Schwester in einen auf der Wiese stehenden Wäschekorb und lief ungesehen zur Hintertür ins Haus. Er durchquerte die Küche, den Gastraum und rannte hastig durch die geöffnete Haustür hinaus, wo er auf seine Mutter und einige Gäste stieß, die bei seinem entsetzt wirkenden Anblick erstaunt verstummten.
„Ich glaube, Diebe wollen uns im Garten die Wäsche stehlen“, rief Theodor, Ängstlichkeit und drohende Gefahr vortäuschend.
„Diebe? Im Garten?“, fragte die Wirtin erschrocken. „Wie viele?“
„Ich glaube, ich habe zwei gesehen“, antwortete Theodor. „Wir sollten uns beeilen, solange sie noch da sind“, fügte er pflichteifrig hinzu und signalisierte mit seinen in die Hüfte gestemmten Armen, dass er keine Scheu haben würde, bei der Aufklärung einer Straftat mitzuwirken.
„Ich werde mal vorsichtig nachsehen“, erklärte Joseph nüchtern und erhob sich. Er dachte sich, dass ein Dieb, der Wäsche stehlen möchte, nicht allzu gefährlich sein konnte.
„Ich komme mit“, sagte Theodor, der neben Onkel und Mutter zum vermeintlichen Tatort schritt. Auch einige Gäste standen auf und folgten den Voranschreitenden auf den Fersen.
„Wer macht sich da an der Wäsche fremder Leute zu schaffen?“, rief Joseph, der den Gästen, seiner Schwägerin und Theodor bedeutete stehen zu bleiben. Theodors Versuch ein Grinsen zu unterdrücken entging Joseph nicht.
Es kam keine Antwort. Nur die leichten Bewegungen einiger Wäschestücke ließen auf die Anwesenheit von Menschen schließen.
„Dann müssen wir wohl den Wachtmeister Diepenbusch holen“, drohte Joseph.
„Nein, nicht! Wir sind es nur“, rief eine helle Kinderstimme zwischen den Wäschestücken.
Allmählich und zögernd tastete sich ein Knäuel, eingewickelt in ein Laken, hervor. Oben aus dem Knäuel lugten zwei Köpfe hervor.
„Was machst du denn schon wieder für einen Mist?“, entfuhr es der Wirtin. Die Mutter dachte an all die Arbeit, die das Wäschemachen mit sich brachte.
„Sofort raus aus dem Laken, sonst setzt es etwas.“
„Wir können nicht“, stammelte Adelheid.
„Was soll das heißen?“, fragte die Wirtin mit drohender Stimme.
„Wir haben nichts an“, erklärte Viktoria verzweifelt. „Man hat uns an der Glött die Kleider weggenommen, während wir badeten.“
Nun fingen einige der Gäste hinter vorgehaltener Hand an zu flüstern, worauf schadenfreudiges Lachen folgte.
„Was redest du für einen Unsinn“, sagte die Wirtin ärgerlich, holte den Wäschekorb mit den Kleidern der Mädchen und stellte ihn vor diesen ab. „Und was ist das?“
„Das sind unsere Kleider“, sagte Viktoria erstaunt.
„Ihr geht sofort ins Haus und zieht euch an“, entschied die Wirtin. „Und Sie …“, sie wendete sich an die Gäste, „… nehmen bitte wieder an den Tischen Platz. Hier gibt es nichts mehr zu gucken.“
Immer noch amüsiert über den Vorfall folgten die Gäste dem forschen Ton der Wirtin und setzten sich zurück an die Tische. In der Wirtin kam das befriedigende Gefühl auf, soeben etwas Nützliches gelernt zu haben, um eine Gastwirtschaft gut zu leiten. Mit entsprechender Haltung und Ansprache ließen sich Gäste führen.
Früher Abend
Theodor saß auf einer Bank im Garten und schaute von seinem Platz aus direkt auf den kleinen Misthaufen, auf dem sich einige pickende Hühner auf ihrer unentwegten Suche nach Nahrung aufhielten, andere scharrten unter Büschen, zwei breiteten suhlend ihr Federkleid auseinander.
Er konnte sich wegen seines gelungenen Streiches noch immer köstlich amüsieren. Wenn er sich jedoch an die Gefühle erinnerte, die ihm die unbekleidete Adelheid bei ihrem Anblick beschert hatte, so konnte er doch eine gewisse Unsicherheit verspüren. Er war sich nicht sicher, ob das, was er beobachtet hatte, und seine dazugehörigen Gefühle nicht sündhaft waren. In diesem Zusammenhang war es schwierig für Theodor, die Wortfetzen, die er zum Thema Mann und Frau in der Kirche aufgeschnappt hatte, in geordnete Bahnen zu lenken und sinnvolle von sinnlosen zu unterscheiden. Was seine Verwirrung noch verstärkte, war der Umstand, dass in der Schule die Jungen bestraft wurden, wenn sie sich den Mädchen „unsittlich“, wie es der Lehrer Nörgel schon bei der kleinsten Verfehlung betonte, näherten. Aus der daraus entstandenen Verunsicherung heraus hatte Theodor das Gefühl etwas Verbotenes zu tun, wenn er an die entblößte Adelheid dachte und er seine Hände an die Stelle legte, von der die größte Sünde ausging.
Seine Gedanken wurden schlagartig unterbrochen, als sich die Hintertür des Hauses laut und schnell öffnete. Geschwind und gerade noch rechtzeitig ließ Theodor seine Hände auf die Bank sinken, bevor sein herauskommender Onkel Joseph die Situation erfassen konnte.
Joseph ging mit einem Eimer in der Hand zum Misthaufen und leerte ihn dort aus. Sofort machten sich die Hühner über die neuen Kostbarkeiten her.
„Feucht gewordenes Korn, bereits ein wenig schimmelig geworden“, sagte Joseph und zeigte kurz mit dem Daumen seiner rechten Hand zum Misthaufen, während er den Eimer in seiner linken im steten Rhythmus hin und her schlendern ließ. „Der richtige Ort eine Pause zu machen, oder?“
„Genau! Von hier aus hat man einen schönen Blick und kann über allerlei nachdenken.“ Theodor ließ seinen Blick über die Wiese schweifen. Die kleinen hölzernen Gebäude auf dem Grundstück, wie der Hühnerstall, der Verschlag für das Feuerholz und das Klohäuschen, wurden von den Strahlen der untergehenden Sonne beschienen und glänzten dermaßen in rotgoldenen Farben, dass dies ein Maler auf einem Bild hätte verewigen mögen. In der Mitte des Grundstücks standen die Obstbäume, die schon bald in voller Pracht erblühen würden.
„Kann es sein, dass du über den Tag nachdenkst?“
„Es war ein aufregender Tag“, antwortete Theodor, ohne auf die Frage des Onkels direkt zu antworten. Es war ihm zu eigen geworden, möglichst wenig zu antworten, wenn er das Gefühl hatte in Gefahr zu geraten, sich zu verraten oder ungewollt etwas von sich preiszugeben. Theodor hatte schon mehrfach mitbekommen, dass sein Onkel gewisse Ahnungen besaß und ihm damit vielleicht auf die Schliche kommen würde. Ein ähnliches Gefühl hatte Theodor bisher nur bei Anne, der ehemaligen Hebamme des Dorfes, gehabt, die zu seiner außerordentlichen Freude nach Berlin gezogen war, um dort zu arbeiten. Was sein Onkel mit Worten bei ihm ausrichten konnte, vermochte Anne mit ihrem bloßen Blick zu erreichen: Unsicherheit!
Deshalb überkam Theodor ein unbehagliches Gefühl, als sein Onkel sich neben ihn setzte.
„Du warst vorhin ja ganz schön mutig“, begann Joseph.
Theodor horchte auf. Er konnte sich nicht daran erinnern, heute besonderen Mut bewiesen zu haben. „Was meinst du?“
„Nun, du bist, obwohl du dachtest, es wären Räuber zwischen der Wäsche, neben mir zum Tatort geschritten, um die Täter dingfest zu machen. Solchen Mut habe ich bei einem Jungen deines Alters selten erlebt.“
„Ach so, das meinst du“, antwortete Theodor, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, einen Räuber zu fassen. Insgeheim begann er sich zu freuen, dass der Onkel ihn für mutig hielt. „Wir waren doch stärker als die beiden Mädchen.“
„Das stimmt allerdings.“
Joseph baute bewusst eine Gesprächspause ein.
„Deshalb war es auch nicht sehr schwierig, weil wir ja vorher wussten, dass die Diebe Mädchen waren“, sagte Joseph wie nebenbei.
„Genau!“, entschlüpfte es Theodor, der seine Unachtsamkeit sofort bereute. „Ich wollte sagen, dass es eben nicht genau so war“, wehrte er sich kläglich und wusste doch, dass er durchschaut war.
„Das war also der Grund für so viel Mut“, sagte der Onkel und ging auf die letzten Worte des Neffen nicht ein. Er wusste, dass in Theodors Familie der umsichtige Mann im Haus fehlte, der den Umtrieben dieses Jungen Einhalt gebieten könnte. „Du weißt, dass deine Schwester deinetwegen Ärger von deiner Mutter bekommen hat. Ich erwarte von dir, dass du das Unrecht, was ihr zuteilgeworden ist, wiedergutmachst.“
Theodor überlegte, sagte jedoch nichts.
„Haben wir uns verstanden?“
„Ja, aber was soll ich denn machen?“
„Das wirst du dir selbst überlegen müssen. Wenn du dich rechtschaffen verhältst, wird von mir niemand etwas von unserem Gespräch erfahren.“ Joseph schaute seinem Neffen in die Augen, und als dieser zustimmend nickte, gaben sie sich die Hand darauf.
Joseph erhob sich von der Bank. „Nun komm rein, es gibt genug zu tun.“
Später Abend
In der Wirtschaft herrschte reges Treiben. Männer, die nach verrichtetem Tagwerk ein wenig Geselligkeit suchten, saßen an einzelnen Tischen beieinander und waren in Gespräche vertieft. Manche hielten den Henkel ihres Bierkruges in der Hand und tranken das köstliche Bier aus der Günzburger Radbrauerei. Aus der Küche, wo Genoveva und Anna, die ältesten Töchter des Hauses, heute walteten, drang der verführerische Duft von Gebratenem in die Wirtsstube. Viele Gäste konnten sich der olfaktorischen Verführung nicht entziehen und gaben ihre Bestellung bei Georg, dem ältesten Sohn der Familie Fink, auf.
Joseph stellte heute erneut seine Arbeitskraft zur Verfügung, um seiner Schwägerin Viktoria zu helfen. Er zapfte hinter dem Tresen Bier, das an diesem Abend reichlich floss.
„Fünf Biere und vier Klare“, sagte Viktoria und stellte ein rundes Tablett auf den Tresen. „Die vier Biere und die Klaren gehen an den Skattisch und ein Bier geht an Johann Salger.“ Sie deutete zu einem Ecktisch hinüber, an dem der ungewaschene Bauer saß und sie schamlos angrinste. „Er schert sich nicht darum, was die anderen Gäste von ihm halten – und schon gar nicht, was ich über ihn denke.“
Joseph nickte Viktoria wissend zu, ohne etwas zu sagen. Er stellte die gewünschten Getränke auf das Tablett und beobachtete seine Schwägerin, wie sie zum Skattisch ging und dort servierte. Danach sah er, wie sie zum Tisch des Bauern ging und ihm das Bier auf den Tisch stellte. Viktoria wollte sich schon abwenden, als Johann Salger sie mit einem Handzeichen zum Bleiben anhielt. Joseph kam es so vor, als würde der Bauer eine weitere Bestellung aufgeben.
Dann lachte der Bauer plötzlich schallend auf, gab Viktoria mit der flachen Hand einen ordentlichen Klaps auf ihren Po und rief so laut, dass alle Gäste es deutlich vernehmen konnten: „Nicht mehr lange, dann wirst du die Meine sein. Das Widerspenstige in dir gefällt mir.“
Die Gäste schauten zurückhaltend und verlegen zur Wirtin, die sich ihre Scham nicht anmerken lassen wollte. Bemüht aufrecht schritt sie zum Tresen, von dem sich Joseph jetzt langsam fortbewegte, hin zu dem Tisch, an dem der nun grinsende Bauer saß.
Im Schankraum war es leise geworden.
„Huh!“, schrie der Bauer plötzlich den gaffenden Gästen entgegen und schlug gleichzeitig mit der Faust auf den Tisch, so dass viele erschraken und zusammenzuckten. Laut lachend schlug er sich auf die Schenkel und bemerkte erst jetzt, dass Joseph auf ihn zukam.
Mit dem Blick eines unberechenbaren Stieres glotzte der Bauer dem vermeintlichen Widersacher in die Augen. „Na, was nun? Will sich da etwa jemand mit mir anlegen?“ Der Bauer grinste und blickte dem vor ihm stehenden Joseph entspannt in die Augen. „Nun habe ich aber Angst“, sagte er in gespielter Unterwürfigkeit, die etwas Abstoßendes in sich barg.
„Niemand soll hier im Wirtshaus Angst haben, so war es bisher und so soll es auch bleiben“, sagte Joseph ernst und mit Nachdruck in seiner Stimme.
„Nun komm schon zur Sache! Was willst du mir wirklich sagen?“
„Lass meine Schwägerin in Ruhe. Sie will nichts von dir, was du sicherlich schon bemerkt haben dürftest.“
„Das lass mal meine Sorge sein. Sie ist noch ein wenig kratzbürstig, aber wenn ihr Trauerjahr vorbei ist, wird sie die Meine sein.“ Der Bauer grinste siegesgewiss.
„Du lässt sie in Ruhe“, sagte Joseph mit drohendem Nachdruck in der Stimme. Ihm war anzumerken, dass er keine Angst vor dem ehemaligen Zuchthäusler hatte. „Sie will nichts von dir.“
„Willst du mir etwa drohen?“
„Ich teile dir nur die unwiderruflichen Tatsachen mit.“
„Der böse Joseph droht mir …“, begann der Bauer mit verächtlichem Tonfall in seiner Stimme, während er sich mit seinen Händen imaginäre Tränen von den zusammengekniffenen Augen wischte „… und will mich bestimmt gleich hauen.“
„Ich werde dich nicht schlagen, aber wenn du dich weiterhin unhöflich verhältst, erteilen meine Schwägerin und ich dir Hausverbot.“
Plötzlich schnellte die Faust des Bauern in Josephs Magengrube, so dass dieser, sich vor Schmerz krümmend, in die Knie sackte und in dieser Stellung verharrte. Der Bauer erhob sich gemächlich, ging langsam um den Tisch herum und postierte sich breitbeinig hinter Joseph. Mit seiner linken Hand packte er sein Opfer am Kragen, zog ihn langsam hoch und holte mit der rechten Faust zum finalen Schlag aus. Gerade als sich die Faust, angetrieben von der zerstörerischen Kraft muskelbepackter Oberarme, in die Beschleunigung begeben wollte, zerschellte ein Bierkrug mit der Wucht eines Hammerschlages auf dem Hinterkopf des Übeltäters. Langsam, wie ein Baum, den eine Axt von den Wurzeln getrennt hatte, fiel der Bauer zu Boden und blieb dort regungslos liegen. Dahinter kam nun Theodor zum Vorschein, der wie aus dem Nichts in der Wirtsstube aufgetaucht war und den Henkel des Kruges in der Hand hielt. Sein Gesichtsausdruck verriet nichts darüber, ob er über seine Handlung erstaunt war oder nicht. Die Gäste starrten erstaunt in seine reglose Miene.
Gegen Mitternacht
„Ahh!“, schrie Johann Salger, der seinen Schmerz nicht unterdrücken konnte. Doktor Willrich hatte soeben zum zweiten Mal eine Nadel durch die Kopfhaut des Bauern geschoben und verknotete anschließend den Faden. Die klaffende Wunde auf dem Kopf des Bauern war von beträchtlicher Länge.
„Ach, davon stirbt man nicht, Herr Salger“, sagte er, ohne das geringste Mitleid in seiner Stimme. „Wissen Sie, damals, es war der 4. August 1870, ich erinnere mich noch genau, der Deutsche Einigungskrieg war in vollem Gange. Da hat unser glorreiches II. Königlich Bayerisches Armee-Corps den Armeen des französischen Kaisers Napoléon III. in der Schlacht von Weißenburg kräftig eins auf die Mütze gegeben. – Was wollte ich eigentlich damit sagen?“
Der Doktor stand da und überlegte. Seine Hand hielt er mit der Nadel nach oben und ärgerte sich offensichtlich darüber, dass er den Faden seines Gedankens verloren hatte. „Ach ja …“, sagte er plötzlich, „… jetzt erinnere ich mich wieder. Damals hatten mir Sanitäter einen Verwundeten auf den Operationstisch gelegt. Ich schwöre Ihnen, Herr Salger, mit ihm hätten Sie, selbst in Ihrer derzeitigen Situation, nicht tauschen mögen.“
Doktor Willrich stach die Nadel erneut in die Kopfhaut des Patienten, der darauf abermals jammernd aufschrie. „Seine Wunde zog sich vom rechten Nasenflügel quer hinüber bis zum rechten Ohr“, erinnerte sich der ehemalige Feldlazarettarzt.
„Herr Doktor! Ich muss doch sehr bitten“, ermahnte ihn Wachtmeister Diepenbusch, der nun anscheinend Mitleid mit dem unbeliebten Bauern bekam.
„Nun ja, um das Gute dieser Geschichte nicht unerwähnt zu lassen, möchte ich noch hinzufügen, dass der schwer verletzte Patient – noch auf dem Operationstisch! – von unserem König, damals noch Kronprinz, Otto I. persönlich mit dem Militärverdienstorden IV. Klasse mit Schwertern ausgezeichnet wurde.“ Der Doktor hob den Kopf, machte ein nachdenkliches Gesicht und fügte aphoristisch hinzu: „Genutzt hat es ihm allerdings nicht mehr. Kaum verließ Otto den …“
„Herr Doktor!“, warnte Diepenbusch mit scharfer Stimme, worauf Doktor Willrich sich besann.
Mit dem vierten und damit letzten Stich endeten die Qualen des Bauern. Sogleich richtete er sich auf, schaute sich im Raum um und brüllte: „Wo ist dieser Bengel? Ich drehe ihm den Hals um!“
„Das werden Sie schön bleiben lassen“, mahnte der Wachtmeister. „Seien Sie froh, denn dieser Vorfall hätte Sie durchaus wieder hinter Gitter bringen können.“
„Der da ist schuld an dem Ganzen.“ Der Bauer zeigte auf Joseph, der nicht ohne Schadenfreude beim Vernähen der Wunde zugeschaut hatte. „Hätte der mich nicht so gereizt, wäre gar nichts los gewesen.“
„Das, was Sie da sagen, bestätigt die vielen Zeugenaussagen nicht. Joseph Fink hat Sie lediglich gebeten, seine Schwägerin nicht mehr zu belästigen. Es gab keinen Grund für Sie Gewalt anzuwenden.“
„Ich habe ihn doch nur ein wenig in der Magengegend gestreichelt“, knurrte Bauer Salger.
„Seien Sie froh, dass Herr Fink keine Anzeige gegen Sie erstattet.“ Der Polizist raffte seinen Oberkörper ein wenig höher, was seiner Autorität als Amtsperson Nachdruck verleihen sollte. „Das vorhin ausgesprochene Hausverbot von der Wirtin Viktoria Fink sollten Sie tunlichst beachten. Bei Nichteinhaltung droht Ihnen die Einleitung strafrechtlicher Verfolgung.“ Der Polizist führte seine Hand zum Schlagstock. „Ich fordere Sie nun auf, die Wirtschaft zu verlassen und sie erst bei ausdrücklicher Aufhebung des Lokalverbots durch mich oder eine andere polizeilich autorisierte Amtsperson wieder zu betreten.“
Mürrisch nahm Johann Salger die Worte des Polizisten auf, zog seine Jacke über, setzte sich seinen Hut auf den Kopf, worauf ihm ein leises, vom Schmerz herrührendes Stöhnen entfuhr, und ging, die Tür hinter sich zuknallend, hinaus in die einsame, dunkle Nacht.
Auf Viktorias Gesicht erschien ein Lächeln der Erleichterung.
„Auf den Schrecken sollten wir noch einen Schluck trinken.“ Joseph ging zum Tresen, wohin ihm Viktoria, Doktor Willrich, Schutzmann Diepenbusch und die zwei dagebliebenen Zeugen folgten.
Der eine Zeuge war Melker Gregor Karg, dessen Tochter Adelheid mit der jungen Viktoria befreundet war. Der Melker war ein ehrlich wirkender Mann mit einem freundlichen Gesicht. Er verdiente mit Sicherheit keine Reichtümer und war darauf bedacht, das wenige Geld, welches er sein Eigen nennen konnte, beisammenzuhalten. Er kam selten in die Wirtschaft, und wenn, dann nur, um ein oder höchstens zwei Humpen Bier in geselliger Runde mit seinesgleichen zu trinken. Die Frau des Melkers war vor einigen Jahren, ohne Vorankündigung, auf Nimmerwiedersehen verschwunden und hatte ihn und sein Kind ohne ein Wort des Abschieds zurückgelassen. Vielleicht, so wurde hinter vorgehaltener Hand getuschelt, hatte sie sich den fahrenden Zirkusleuten angeschlossen, die zuvor am Ortsrand Halt gemacht hatten, um hier ihr Lager für eine Nacht aufzuschlagen. Bis es dunkel wurde, hörte man ihre fröhlichen Lieder, zu denen eine dissonante Geige gespielt wurde. Mit dem ersten Hahnenschrei waren sie schließlich wieder verschwunden. Gregor Karg hatte den Verlust seiner Frau erst am späten Abend bemerkt, da er mit der Erfüllung seiner täglichen Pflichten beschäftigt war.
Der zweite Zeuge war der Schuster Winfried Auhuber. Auch er galt in der Gegend als zuverlässig und pflichtbewusst. Seine Arbeit wurde von vielen Glöttwengern gerne in Anspruch genommen, denn seine angefertigten Schuhe passten immer wie angegossen. Niemals hatte jemand, der seine Schuhe trug, je über Blasen, Hühneraugen, Schrunden oder dergleichen geklagt. So konnte er es sich leisten, für seine Schuhe höhere Preise zu veranschlagen als sein Konkurrent, Schuster Leihpold aus Landensberg. Winfried Auhuber galt im Ort als ruhiger, besonnener Mann, der seine Frau Theodora und seine beiden Kinder Ottilie und Wolf gut behandelte.
Die Wahl des Polizisten, diese beiden Männer als Zeugen im Protokoll zu erwähnen, war also mit Bedacht getroffen.
„Ein kühles Bier haben wir uns alle zum Ende eines aufregenden Tages verdient“, sagte Joseph und ließ das kühle Gebräu in sechs Krüge laufen.
„Einer fehlt eigentlich hier in der Runde“, stellte der Polizist fest. „Wo ist eigentlich der Theodor?“
„Ich habe ihn vor geraumer Zeit, gemeinsam mit Georg, Genoveva und Anna, in die Federn geschickt. – Ich denke, es ist auch gut so“, antwortete die Wirtin.
Der Wachtmeister nickte zustimmend.
„Ja, der Junge hat für heute seine Ruhe verdient.“ Der Doktor wirkte ungewohnt nachdenklich. „Sie müssen das Ganze morgen mit ihm besprechen“, sprach er Viktoria plötzlich eindringlich fordernd an. „Man weiß nicht, ob solche Erlebnisse ohne Folgen für das Gemüt bleiben.“
Alle Anwesenden schauten den Doktor fragend an. Keiner konnte sich vorstellen, wovon der Doktor sprach. Schließlich hatte der Junge doch mutig, sogar heldenhaft reagiert, indem er den Onkel mit seinem Eingreifen vor unabsehbarem Schaden bewahrt hatte.
„Ich erinnere mich noch genau an den Blick, der Otto I. in sein Gesicht geschrieben stand, damals nach der Schlacht von Weißenburg. Er hatte bereits mehr als genug mitgemacht in seinem bis dato jungen Leben, was seine zarte Seele nicht verkraften konnte“, sinnierte Doktor Willrich. „Heute sitzt er in seinem Schloss Fürstenried und …“
„Also, Herr Doktor, nun wollen wir aber nicht von so etwas sprechen“, fiel ihm ein gut aufgelegter Joseph ins Wort. „Der Abend ist, auch dank Ihrer ärztlichen Kunst, doch noch glimpflich ausgegangen.“
Joseph gab jedem einen Krug Bier und erhob den seinen.
„Zum Wohl!“, sagte die Wirtin und alle nahmen genüsslich einige Schlucke.
„Es wäre gut, wenn der Kerl aus eurem Dorf verschwinden würde“, meinte Joseph, nachdem er seinen Krug wieder auf dem Tresen abgestellt hatte.
„Am besten auch in den Saurüsselweiher mit ihm“, murmelte Winfried Auhuber wie zu sich selbst.
Es war die sorgenvoll anmutende Ernsthaftigkeit des Schusters, gepaart mit seiner eigenen Verwunderung über das, was ihm gerade über die Lippen gekommen war, die in dieser Runde nur dem Polizisten auffiel und ihn stutzen ließ. Zudem meinte Wachtmeister Diepenbusch das Wörtchen auch im Satz des Schusters vernommen zu haben, was ihm verdächtig vorkam.
„Wie meinen Sie das?“, fragte Diepenbusch, den Blick fest auf den Schuster gerichtet.
„Was meinen Sie, Herr Wachtmeister?“, entgegnete der Schuster verunsichert fragend.
„Das, was Sie eben über den Saurüsselweiher gesagt haben.“
„Es könnte doch sein, dass so mancher seine ungeliebten Dinge hineinschmeißt, die dann nie wieder auftauchen“, antwortete Schuster Auhuber, der wieder mehr an Sicherheit zu gewinnen schien.
„Kennen Sie jemanden, der das schon gemacht hat?“, fragte der Polizist, ohne sich noch weitere Hoffnungen auf aufschlussreiche Ergebnisse zu machen. Er rechnete damit, dass sein Gegenüber seine Frage verneinen würde.
„Nein, ich weiß nichts dergleichen.“
Wachtmeister Diepenbusch wollte das Thema hier und jetzt nicht weiter besprechen, würde es sich am nächsten Tag allerdings nochmals durch den Kopf gehen lassen. Es war spät geworden und er wollte gleich seinen Weg nach Hause antreten.
Donnerstag, 29. April 1897, kurz nach Mitternacht
Winfried Auhuber schlich leise zur Haustür hinein. Er war darauf bedacht, niemanden im Haus zu wecken, und schon gar nicht seine Frau. Der Schuster war froh darüber, dass seine Frau in den letzten Wochen keinen Grund gefunden hatte, ihm gegenüber argwöhnisch zu sein. Das sollte möglichst so bleiben und es wäre besser, dachte er, wenn sie sein spätes Heimkommen nicht bemerken würde.
Kurz vor der Tür zur Schlafkammer blieb Winfried Auhuber stehen und horchte. Kein Laut war aus der Kammer zu hören. Er wünschte sich von Herzen, dass er nur dieses eine Mal völlig unbekümmert in die Kammer gehen könnte. In seiner Wunschvorstellung rekelte sich seine Theodora verschlafen und zufrieden zugleich, nachdem sie sein Erscheinen wahrnahm, um anschließend in seinen Armen weiterzuschlafen. So, oder so ähnlich, hatte es sich der junge Winfried Auhuber in der Ehe vorgestellt, als er sich in die dunkelhaarige Theodora verguckt hatte.
Vor seinem inneren Auge erschienen die Bilder einer jungen Frau, deren Schönheit und Anmut damals für ihn unvergleichlich gewesen waren. In der gemeinsamen Schulzeit war es ihm niemals so bewusst geworden, erst später, es war ein sonniger Tag im Mai und er schon ein erwachsener, junger Mann gewesen, als er in Theodora die Frau, die er auf ewig begehren würde, erkannt hatte. Damals saß Winfried träumend in der Kirche. Während die Worte des Pastors mal wieder als undeutliche, breiige Masse an seinen Gehörgängen vorbeischrammten, nahm sein Unterbewusstsein etwas anderes, ihm gänzlich Neues wahr. Ihm war so, als würde etwas sein Gesicht berühren, ohne dass ihm etwas körperlich nahe war. Winfried erwachte aus seinem Tagtraum und sein Gefühl sagte ihm unmissverständlich, worauf er sein Augenmerk richten musste. Sofort traf sich sein Blick mit dem ihren – Theodoras unvergleichlichem Blick. Damals, als er in ihre Augen, die in Form und Farbe denen von Mandeln glichen, schaute, war es um Winfried geschehen. Sie musste die Seine werden, die junge Frau mit der silbern glänzenden Haut, den rabenschwarzen Haaren und den runden Bäckchen. Ein forderndes Lächeln von ihr flog zu ihm herüber.
„Wo kommst du jetzt so spät her?“
Die Stimme seiner Frau holte den Schuster abrupt aus der Welt seiner Erinnerungen. Gerade eben hatte er die Tür hinter sich angelehnt und war im Begriff, auf leisen Sohlen in Richtung Bett zu schleichen. Er wollte antworten, aber Theodora kam ihm zuvor.
„Meinst wohl, ich höre dich nicht. Der Herr Schustermeister hat wohl etwas zu verbergen.“ Die Stimme der Frau klang gehässig und barsch.
„Natürlich habe ich nichts zu verbergen. Ich kann dir gerne sagen, wo ich herkomme. Du wirst zufrieden sein, denn es gibt Zeugen für meinen Aufenthalt – einer davon bin sogar ich selbst.“ Der Schuster lachte ein wenig kleinlaut über seinen Scherz, den seine Frau noch nicht verstehen konnte.
„Du solltest dich schämen, steigst anderen Frauen nach und amüsierst dich noch vor mir darüber. Du geiler Bock!“
„Ich steige keiner anderen Frau nach.“ Der Schuster kannte die krankhaft anmutende Eifersucht seiner Frau nur zu gut. Oft gab es Diskussionen, weil er angeblich diesem oder jenem Rock nachgeschaut haben sollte. Wenn Kundinnen in den Laden kamen, denen Winfried Auhuber bei der Anprobe behilflich war oder mit denen er aus Höflichkeit etwas zu lange sprach, konnte er sich hinterher auf ein Donnerwetter gefasst machen. Theodora unterstellte ihm dann Dinge, mit denen er auch jetzt wieder rechnete.
„Auf Nymphen stehst du, du geiler Bock.“