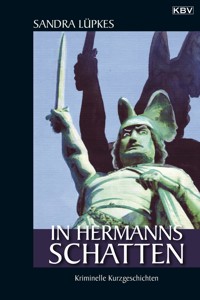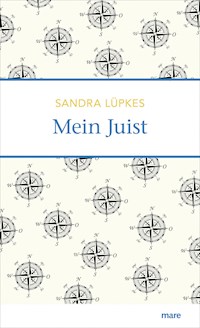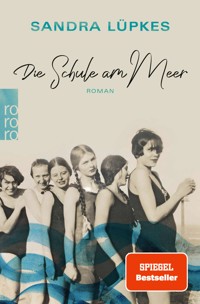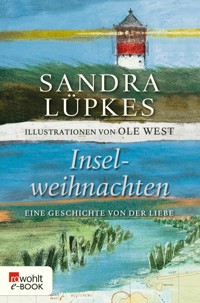8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Voller Elan tritt das «Küstenkind» Okka Leverenz ihren neuen PR-Job bei der Stiftung Liekedeeler in Norden an. Dort sollen Kinder spielerisch und behutsam zu guten schulischen Leistungen gebracht werden. Durch einen tragischen Unfall beim Spiel stirbt die kleine Jolanda. Doch die Autopsie ergibt, dass sie an unerklärlichen Gehirnblutungen gestorben ist – die nicht vom Sturz stammen können. Als die Stiftungsleitung den Vorfall vertuschen will, macht sich Okka auf, die wahren Ursachen für den Tod des Mädchens herauszufinden, und gerät dabei selbst in Gefahr. «‹Fischer, wie tief ist das Wasser› ist ein spannendes Buch, in einem Rutsch zu lesen. Eine gute Lektüre für den Urlaub, nicht nur an der Nordseeküste.» (Radio Bremen) «Ein schnörkellos spannend erzählter Krimi mit einem fulminanten Showdown. Nicht nur für Krimifans eine kurzweilige und niveauvolle Lektüre.» (Ostfriesland Magazin)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Sandra Lüpkes
Fischer, wie tief ist das Wasser
Ostfrieslandkrimi
Über dieses Buch
Voller Elan tritt das «Küstenkind» Okka Leverenz ihren neuen PR-Job bei der Stiftung Liekedeeler in Norden an. Dort sollen Kinder spielerisch und behutsam zu guten schulischen Leistungen gebracht werden. Durch einen tragischen Unfall beim Spiel stirbt die kleine Jolanda. Doch die Autopsie ergibt, dass sie an unerklärlichen Gehirnblutungen gestorben ist – die nicht vom Sturz stammen können. Als die Stiftungsleitung den Vorfall vertuschen will, macht sich Okka auf, die wahren Ursachen für den Tod des Mädchens herauszufinden, und gerät dabei selbst in Gefahr.
«‹Fischer, wie tief ist das Wasser› ist ein spannendes Buch, in einem Rutsch zu lesen. Eine gute Lektüre für den Urlaub, nicht nur an der Nordseeküste.» (Radio Bremen)
«Ein schnörkellos spannend erzählter Krimi mit einem fulminanten Showdown. Nicht nur für Krimifans eine kurzweilige und niveauvolle Lektüre.» (Ostfriesland Magazin)
Vita
Sandra Lüpkes, geboren 1971, aufgewachsen auf der Nordseeinsel Juist, lebt in Münster, wo sie als Autorin und Sängerin arbeitet. Im Rowohlt Verlag sind bislang acht Kriminalromane erschienen, sechs davon um ihre tatkräftige Kommissarin Wencke Tydmers. Mit «Die Inselvogtin» legte Sandra Lüpkes ihren ersten historischen Roman vor.
Mehr zur Autorin und zu ihrer Arbeit unter: www.sandraluepkes.de
Weitere Veröffentlichungen:
Halbmast
(In der Serie um die Kommissarin Wencke Tydmers:)
Die Sanddornkönigin
Der Brombeerpirat
Das Hagebutten-Mädchen
Die Wacholderteufel
Das Sonnentau-Kind
Die Blütenfrau
sowie ihr historischer Roman
Die Inselvogtin
und die Novelle
Inselweihnachten. Eine Geschichte von der Liebe
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2012
Copyright © 2003 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-47301-0
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Für meine Mutter
Prolog
Seine Mutter rannte voraus. Er versuchte sie einzuholen, doch die Abdrücke ihrer Schuhe im Sand hatten sich bereits mit Wasser gefüllt und die scharfen Konturen verloren, mit denen sie in den feuchten Boden gedrückt worden waren.
Seine kleinen Füße versanken in den schmalen Salzseen, die die Mutter hinterließ, er bemühte sich, den Schritten nachzueifern, wollte keine Spuren zwischen den ihren hinterlassen. Doch meist waren seine Beine zu kurz und er verfehlte sein Ziel, stolperte sogar und rieb seine Jeanshose in den harten Sand, sodass sich an den Knien dunkle Flecken in den blauen Stoff sogen.
Sie waren schon viel zu weit gelaufen. Die roten Dächer hinter der faserigen Mauer aus Dünen waren verschwunden und er musste Acht geben, dass er nicht über irgendein fremdartiges, verwaschenes Stück Treibholz fiel, da man an diesem Ende der Insel nicht jeden Morgen den Spülsaum nach Strandgut absuchte.
Er schaute der wehenden Gestalt seiner Mutter hinterher oder auf die riesigen Abstände zwischen ihren Fußabdrücken, doch als er nun stehen blieb, weil er einfach nicht mehr konnte, weil sein aufgeregtes Herz den trockenen Hals hinaufschlug, da blickte er zu den wild bewachsenen Hügeln zu seiner Rechten. Und er erschrak.
Sie waren nicht nur viel zu weit gerannt, sie hatten sich auch von der Dünenkette entfernt, statt parallel zu ihr zu laufen. Zwischen ihnen und dem sicheren Strand breitete sich ein Wassergraben aus, der so breit war wie eine Straße auf dem Festland und in dem das Wasser nicht ruhig und sinnig dahinfloss. Nein, der Graben nahm bereitwillig das rasch herbeieilende Meerwasser in sich auf, um sich noch mehr auszudehnen und an Tiefe zu gewinnen.
Sie waren auf einer Sandbank gelandet.
«Gehe nie unachtsam bei auflaufend Wasser an der Meereskante entlang, es könnte sein, dass die Flut dir den Rückweg versperrt», hatte Oma ihm immer als Mahnung mit auf den Weg gegeben, wenn er nach den lästigen Hausaufgaben an den Strand hinunter wollte.
Ihm lief es kalt den Rücken hinunter. Langsam drehte er sich um und als er ein paar hundert Schritte entfernt den plätschernden Priel erkannte, den er eben noch mühelos hätte überspringen können, der nun aber ein unüberwindbarer Strom geworden war, da schrie er.
«Mama.»
Sie hörte sein Rufen nicht, ging weiter in Richtung Osten, wo die Silhouette der Nachbarinsel bereits näher zu sein schien als die letzten Häuser und der breite Wasserturm ihres Dorfes. Dabei hätte sie doch auf ihn aufpassen müssen. Stattdessen lief seine unvernünftige Mutter in ihrem albernen rostroten Umhang rastlos ans Ende ihrer kleinen Welt und schaute nicht einmal zurück, wie es ihm ging. Er wusste, sie rannte sich die Trauer und den Schmerz aus dem Leib, weil sie das erste Mal auf der Insel war, seitdem Oma tot war. Heute Morgen beim Frühstück war sie von einer Sekunde auf die andere in Tränen ausgebrochen, nur weil er gesagt hatte, Omas Tee hätte irgendwie anders geschmeckt.
Aber er wusste ja auch, dass sie Angst hatte. Angst vor der Zukunft.
Wenn die Osterferien vorüber waren, würde er mit ihr weggehen. Sie würden das erste Mal zusammenleben wie Mutter und Sohn, in einer Wohnung in der Stadt, an demselben Esstisch sitzen, über demselben Waschbecken die Zähne putzen. Von nun an würde sie und nicht Oma ihm die Pausenbrote schmieren und ein Pflaster auf die Wunde kleben, wenn er sich geschnitten hatte. Sie war nun keine Sonntagsmutter mehr, die ihren Sohn für besser hielt, als er wirklich war. Sobald sie das erste Mal die Hausaufgaben mit ihm machte, würde sie schnell begreifen, dass er eben überhaupt kein Genie war und die Vier in Mathe tatsächlich verdient hatte.
Er schaute ihr nach. Sie hätte auf ihn aufpassen müssen.
Er wünschte für einen kurzen Moment, Oma hätte ihn heute Morgen mit sorgenvollem Gesicht vor dem auflaufenden Wasser gewarnt. Vielleicht wäre er dann nicht so weit gegangen.
Der Sand unter seinen Füßen brach in sich zusammen, die Flut hatte die Stelle, auf der er eben noch so sicher gestanden hatte, unterspült, wie ein wütendes Tier weggefressen, und in Sekundenschnelle umfasste das eiskalte Seewasser seinen Unterleib. «Mama», schrie er verzweifelt, «Mama.»
Er konnte sie nicht mehr ausmachen, die feste Sandbank lag einen halben Meter über ihm, er konnte nur hoffen, dass sie ihn gehört hatte und sich endlich, endlich nach ihm umsah.
Die übermächtige Strömung riss den Sand fort, an dem er sich festzukrallen versuchte. Es gab keinen Halt mehr und schließlich musste er schwimmen, der weiche, bewegte Boden unter ihm gab immer wieder unter den heranströmenden Fluten nach. Sein kleiner Körper wirbelte wie von starken Männerhänden geworfen mal über und mal unter die schäumende Wasseroberfläche. Das Salz brannte in seinen Augen, doch er wollte sie nicht schließen, um nicht ganz blind zu sein. Sie musste doch endlich kommen. Er wollte die Hand seiner Mutter nicht übersehen, wenn sie sich ihm rettend entgegenstreckte. «Mama», schrie er wieder, aber es war nicht mehr als ein Gurgeln.
Das Meer zog ihn immer weiter hinaus, fort von der Sandbank, fort von der Zuversicht, dass sie sein Rufen hören konnte.
Ich ertrinke, schoss es ihm durch den Kopf, und der Schreck lähmte seine inzwischen kraftlosen Arme und Beine noch mehr als die Kälte der Nordsee im frühen April. Ich ertrinke vor den Augen meiner Mutter, sie ist eine schlechte Mutter. Bin ich ihr denn gar nichts wert? Sie werden mit den Fingern auf sie zeigen und untereinander tuscheln, was für ein liebenswerter Kerl ich doch war und dass das nicht passiert wäre, wenn Oma noch lebte.
Seine Gedanken sprudelten mehr und mehr durcheinander, es gab kein Oben und kein Unten, ab und zu griffen seine fast starren Hände in einen Brei aus zermahlenen Muscheln und Sand, es war eine Quälerei, denn jedes Mal, wenn die winzigen Stücke festen Bodens zwischen seinen Fingern hindurchglitten, fühlte er eine Sekunde lang so etwas wie Hoffnung, dass alles gut gehen würde, dass alles gut gehen würde, dass … Und dann wurde dieser Gedanke von der Kraft mitgerissen, die ihn zum Spielball des Meeres gemacht hatte. Ich ertrinke …
«Oma!», schrie oder flüsterte er nun, er wusste es selbst nicht, da alles in ihm schrie, doch seine Lippen zusammengepresst waren, damit er nicht noch mehr schlucken musste von dieser dunkelgrünen Masse, die in seine Ohren, seine Nase, seine Augen eindrang. «Oma!» Er hatte immer nach ihr und nicht nach seiner Mutter gerufen. Wo war sie?
Dann umschloss eine feste Hand seinen Arm. Konnte er ihre hellbraunen Altersflecken darauf erkennen? Die durchscheinenden Adern und hervorstechenden Knochen der Hand, die er so gut kannte? Er spürte, wie er quer zur wütenden Strömung fortgezogen wurde, eine zweite Hand packte ihn unter seinem hilflosen Arm. «Oma?»
Der Sand legte sich unter das nass klebende T-Shirt auf seinen Rücken, als er an Land gezogen wurde. Er rührte sich nicht, lag einfach nur da. War er jetzt tot? Ein eisiger Wind streifte über seine nackten Arme, wie kleine Nadeln peitschten sandige Körner in seine Seite, es tat weh, und erst jetzt schluchzte er auf. Als er nun sein eigenes singendes Jammern hörte, wurde ihm bewusst, dass er gar nicht tot war, dass er lebte, dass er nur steif, aber in Sicherheit auf festem Boden lag.
«Alles in Ordnung, mein Junge», sagte eine angenehm dunkle Stimme und im selben Moment wurden seine Arme, sein ganzer Oberkörper von einem warmen Stück weichen Stoffs zugedeckt. Als er die Augen endlich öffnete, erwartete er beinahe, seine Oma über ihn gebeugt zu erblicken, doch den jungen Mann mit fast weißem Haar hatte er noch nie gesehen. «Dir kann jetzt nichts mehr passieren!»
Er schloss die Augen wieder, spürte, wie der Fremde seinen nassen Kopf im Schoß bettete, hörte, wie er mit tiefer, ruhiger Stimme auf ihn einredete.
«Hat dir denn nie jemand gesagt, dass du nicht unachtsam bei auflaufend Wasser an der Meereskante entlanggehen sollst?»
1.
Machen wir uns nichts vor: Es gibt Bessere als mich. Mein Haar ist zu dunkel, um richtig blond zu sein, meine Figur zu kompakt, als dass ich eine zierliche Erscheinung abgeben könnte. Nichts Besonderes, nur die vielen Sommersprossen im Gesicht sind ein wenig spektakulär. Ich bin keine Frau, bei deren Geburtstag die halbe Stadt zu Gast ist und die massenhaft ihr mit eindeutiger Absicht zugesteckte Telefonnummern am Kühlschrank kleben hat.
Genau genommen hängen dort nur fünf Zettel. Zwei aus dem «Ostfriesischen Kurier» ausgerissene Geburtstagsanzeigen von ehemaligen Schulkameradinnen, die ebenfalls die dreißig erreichten, ohne verheiratet zu sein, die aber wenigstens über eine alberne Clique verfügten, die Geld in eine saumäßig gereimte Annonce investierten, um den Rest der Stadt über das Elend aufzuklären: «Kaum zu glauben, aber wahr, die Petra wird heut’ dreißig Jahr, sie ist noch ledig – ohne Mann, drum komm zur Fete, wer ein Kerl ist und kann.» Ich hatte die Feten nicht besucht, hatte es noch nicht einmal in Erwägung gezogen, dort hinzugehen. Keine Ahnung, warum die fast vergilbten Inserate immer noch in meiner Küche hingen. Manchmal stand ich davor und überlegte, ob wohl etwas los gewesen war auf diesen Partys.
Die anderen drei Zettel waren tatsächlich Telefonnummern. Unspektakuläre Telefonnummern. Bens Nummer, die er mir damals am Anfang unserer Beziehung auf einem Bierdeckel notiert hatte, dann die Nummer meines Pizzataxis in großen roten Ziffern auf der länglichen Speisekarte und die Handynummer meines Vaters, die ich nie auswendig wusste, weil ich sie auch noch nie gebraucht hatte.
Dort, wo er war, ging sein Handy meistens sowieso nicht, weil er sich als Reisejournalist immer in den entlegensten Winkeln der Erde aufhielt, und da auch Ostfriesland einer der entlegensten Winkel der Erde ist, kamen Telefonverbindungen zwischen ihm und mir höchst selten zustande.
Und was immer ich ihm bislang hatte sagen wollen, konnte warten. Nichts in meinem Leben war so dringend gewesen, als dass ich es nicht aufheben konnte, bis er wiederkam, bis er die Tür zu unserer Wohnung aufgeschlossen hatte, mir um den Hals gefallen war und bis er augenzwinkernd seinen Lieblingsspruch aufgesagt hatte: «Ich hatte ganz vergessen, wie groß du schon geworden bist!» Danach legte er mir immer ein kitschigexotisches Souvenir auf den Esstisch. Das war sein Ankunftsritual, das ich so sehr an ihm liebte. Erst danach war für mich die Zeit gewesen, ihm beispielsweise zu sagen, dass es geklappt hatte und ich mein Volontariat bei derselben Hamburger Zeitung machen würde wie er. Oder später: dass ich die Journalistenschule geschmissen hatte und nun in Oldenburg BWL studierte, dann, dass ich von der trockenen Wirtschaftskunde die Nase voll hatte und es einmal mit Psychologie versuchen wollte. Als ich ihm sagte, dass ich wieder in unsere Heimatstadt Norden zurückkehren würde, um dort bei einer Teeimportfirma zu arbeiten, da hat er sich richtig gefreut. «Klar ziehst du wieder bei mir ein!», hatte er damals vor knapp zwei Jahren gejubelt. Ich war ihm dankbar, dass er mir nie Halbherzigkeit und mangelndes Durchhaltevermögen vorgeworfen hat, ich habe es mir selbst oft genug vor Augen geführt, dass ich bislang noch keine wirklichen Erfolge vorzuweisen hatte. Schließlich war ich wieder hier, in Norden, der kleinen, etwas altmodischen Küstenstadt, die den Namen einer Himmelsrichtung trug und wirklich so etwas wie der Rand der Welt zu sein schien. Zwischen den verträumten Backsteinvillen und alten Gutshöfen verlief die einzige Bundesstraße in dieser Gegend und führte die Nordseetouristen auf ihre letzten fünf Kilometer bis zur Küste. Durchgangsverkehr, nur ich war hier hängen geblieben. Ich liebe es, mich selbst zu kritisieren. Oft stehe ich neben mir und ermahne mich mit dem gehobenen Zeigefinger einer aufmerksamen Tante.
Gerade aus diesem Grund dachte ich an diesem Tag, an einem wunderschön warmen Sommertag, als Vater mir die Notiz hingelegt hatte, bevor er wieder für einen Auftrag verschwand, die Welt hielte für einen kurzen Moment inne und unterbrach ihre ewige Drehung um sich selbst.
«Liekedeler» hat angerufen, du kriegst den Job. Peng! Große, lebensverändernde Dramatik in sieben Wörter verpackt, auf einen abgerissenen Zettel geschrieben und neben dem Frühstücksgeschirr auf den Küchentisch gelegt.
Unfähig, mich wenigstens ein paar Millimeter zu rühren, blieb ich regungslos am voll gestellten Spültisch stehen und hielt das Blatt Papier in meiner Hand, so behutsam, weil ich dachte, die Buchstaben könnten herunterfallen und auf dem ungefegten Boden zwischen den Krümeln der letzten Woche verloren gehen.
Ich dachte an das erhabene alte, rote Gebäude auf der samtigen Warft am Rand von Norden. Liekedeler.
Die Backsteine waren phantasievoll aufeinander gelegt worden und zeichneten wiederkehrende Muster in das Mauerwerk und ganz oben unter dem Giebel war ein kreisrundes Fenster. Efeu rankte an der rechten Seite empor und versteckte fast die mannshohen, dunklen Fenster, sodass das Haus auf den ersten Blick aussah wie ein verwegener Pirat mit Augenklappe.
Ja, ich konnte mir vorstellen, jeden Morgen mit meinem schwarzen, federnden Hollandrad dort vorzufahren, eine Mappe voller neuer Ideen auf dem Gepäckträger, die den bereits tadellosen Ruf der Firma weiterhin auf Hochglanz polieren sollten. Lachende Kinder spielten zwischen den Bäumen, die rund um das Haus herum standen, und über der einladenden Holztür stand «Liekedeler-Stiftung».
Die ewig feuchten Hände meines alten Chefs auf der Bluse hatten also doch irgendwie ihr Gutes: Ohne diese unerträglichen, stets als Zufall getarnten Berührungen wäre ich vielleicht noch bis ans Ende meiner Tage im Teeimport versauert.
«Liekedeler» ist da eine ganz andere Liga. Ich brauchte nun nicht lang zu suchen, bis ich die Broschüre wieder fand, in der ich mich schon vor meinem Bewerbungsgespräch über die Stiftung informiert hatte. Drei lachende, wilde und glückliche Kinder schienen aus der Titelseite herauslaufen zu wollen. «Wir sind bereit!», stand über ihren fliegenden Haaren. Mir gefiel dieses Bild, ich hatte gleich das Gefühl, mitrennen zu wollen.
«Wir von Liekedeler haben einen Weg gefunden, Ihr Kind zu motivieren. Abenteuer, Zusammenhalt und Spaß sind die Begleiter, wenn Ihr Kind mit uns geht. Gesteigerte schulische Leistungen sind unser Ziel, wir möchten engagierte und interessierte Schüler formen und somit Ihrem Kind die Chance geben, das Beste in sich zu entdecken.»
Klang doch gut, nicht wahr? Natürlich darf man Werbebroschüren nur die Hälfte glauben, jedes Kind weiß, dass solche Versprechungen immer übertrieben sind und man Abstriche machen muss. Wir tragen alle viel zu dick auf. Schade eigentlich. Aber selbst wenn nur die Hälfte bei Liekedeler stimmt, wäre das ein guter Schnitt.
«In vielen Familien geht es drunter und drüber, Eltern können nicht immer da sein, das verstehen wir. Die Kinder sind nach derSchule oft auf sich allein gestellt und geraten viel zu häufig an ‹automatische› Unterhaltung wie Fernsehen und Computerspiele. Gerade bei Kindern zwischen 8 und 13 Jahren ist eine solche Entwicklung gefährlich, denn in dieser Zeit sind wir am lernfähigsten. Bei eintöniger, passiver Berieselung dauert es nicht lang, und das Gehirn Ihres Kindes stumpft ab, wird nicht mehr aufnahmefähig. Es ist wie ein Schwamm, der danach dürstet, sich mit allem voll zu saugen, was er geboten bekommt. Doch wenn er nichts bekommt, dann trocknet er aus, wird spröde und brüchig.»
Kinder liegen mir, das wusste ich. Oft ertappte ich mich dabei, dass ich vor mich hin sang, mit meinem Fahrrad durch Pfützen fuhr oder vor Begeisterung in die Hände klatschte, weil ich selbst noch wie ein kleines Mädchen war. Manchmal. Natürlich nur, wenn ich mich unbeobachtet fühlte. War ich wirklich schon dreißig? Die Aussicht, in Zukunft mit fröhlichen, albernen, aktiven Kindern oder auch Erwachsenen zu arbeiten, statt für Teebeutel zu werben, war sehr verlockend.
«Wir bieten Kindern von den Klassen 1 bis 6 einen regelmäßigen Alltag, der sie nach der Schule erwartet: gemeinsamer Mittags- und Abendtisch mit ausgewogenen Speisen, Ausgleichsspiel mit den Schulkameraden und gezielte, individuelle Pädagogik. Die Schule verfügt über ein Team qualifizierter Lehrkräfte, die sich auf schulischen Gebieten wie Naturwissenschaften, Sprachen und Philosophie auskennen und Ihren Kindern erstklassige Hausaufgabenhilfe und Förderunterricht bieten. Doch zusätzlich, und dies ist das Einmalige an Liekedeler, nehmen wir Ihr Kind an die Hand, um ihm zu zeigen, wie aufregend das Leben sein kann: Experimente in der Natur, musikalische und künstlerische Intensivarbeit, Segelkurse und Wandertage, dies alles wird den Horizont Ihres Kindes erweitern.»
«Ich habe diese Zeilen geschrieben», sagte Dr. Veronika Schewe mit einer sanften, dunklen Stimme, als ich sie bei meinem Bewerbungsgespräch auf die Broschüre ansprach. «Ich erhoffe mir von unserer neuen PR-Frau natürlich etwas Pfiffigeres als dieses Faltblatt. Vor drei Jahren hat es noch genügt, doch nun eröffnen wir in Bremen unsere zwölfte Filiale, da wird es Zeit für qualifizierte Werbefachleute.»
«Und deshalb haben Sie die Anzeige aufgesetzt?»
«Ihre Bewerbung hat mir sehr gefallen. Ihr beruflicher Werdegang ist im Prinzip genau das, was wir suchen: ein wenig Journalismus, etwas Wirtschaftswissen und dann natürlich Psychologie. In unserem Fall ist Ihre Ausbildung ein Volltreffer, liebe Frau Leverenz.» Sie schenkte sich noch eine Tasse schäumendfrischen Kaffee ein und ich bewunderte die langen, weinrot lackierten Fingernägel ihrer erstaunlich jungen Hände. Dr. Veronika Schewe mochte sicher schon fünfzig sein, doch sie war insgesamt so glatt und edel, dass sie mich an ein antikes, wertvolles Möbelstück erinnerte, welches man sorgsam polierte und pflegte, damit es auch neue Schränke immer noch überstrahlen konnte.
«Es ist uns wichtig, dass die Öffentlichkeit mehr über die wichtige Arbeit in unserer Stiftung erfährt», glitten die Worte aus ihren braunrot bemalten Lippen. «Selbst hier vor Ort denken die Menschen, dass das Betreuungsprogramm bei Liekedeler ein Vermögen kostet und wir uns in welcher Form auch immer lediglich am Bildungsboom unseres Landes bereichern wollen. Und dabei ist die Teilnahme an unserem Projekt für jedes Kind kostenlos. Dafür steht schon unser Name. Sie wissen doch, was Liekedeler bedeutet?»
Ich wusste es, jeder hier in Ostfriesland weiß es, da man stolz ist auf die grausig guten Geschichten des großen Seeräubers Störtebeker, der hier in der Gegend von den Friesen in einem roten, breiten Kirchturm versteckt wurde. Störtebeker war ein Räuber und hatte der Legende nach die blutig erworbene Beute unter seinen Gefolgsleuten gerecht verteilt, er war so etwas wie ein friesischer Robin Hood.
«Ich weiß natürlich, was es heißt. Liekedeler ist, ja, wörtlich übersetzt: Gleichteiler. Für die Stiftung stelle ich mir das so vor: Alle Schüler werden hier aufgenommen, keiner bekommt mehr als der andere, alles wird geteilt. Ich finde, Wörter wie Gerechtigkeit, Mut und Zusammengehörigkeitsgefühl klingen auch mit. Ein schöner Name.»
Dr. Schewe schien diese Bemerkung gefallen zu haben, denn sie lächelte mich an. «Noch einen Kaffee?»
Ich schüttelte den Kopf, obwohl es der beste Kaffee war, den ich je getrunken hatte. Bei einem Bewerbungsgespräch sollte man schließlich nicht zu gierig erscheinen.
«Wir haben in diesem vergleichsweise kleinen Haus angefangen, stellen Sie sich vor, ich habe vor vier Jahren selbst mit dem Kleistereimer und Tapeten hantiert, damit es so aussieht wie heute.»
Ich konnte mir Dr. Schewe beim besten Willen nicht mit verschmierten Händen und Farbe im dunklen, hochgesteckten Haar vorstellen.
«Nun haben wir in jeder größeren norddeutschen Stadt eine Filiale, über dreihundert Kinder im Weser-Ems-Gebiet gehören zu unseren Kunden. In naher Zukunft wollen wir uns bundesweit etablieren. Sinnvolle Bildung und eine zuverlässige Betreuung nach Schulschluss, ohne dass man einen Cent an uns bezahlen muss, alles ermöglicht mit Hilfe von Spenden.»
«Verstehe, zu diesem Zweck brauchen Sie wahrscheinlich eine Frau für die Öffentlichkeitsarbeit», unterbrach ich kurz.
Dr. Schewe nickte. «Wir müssen die Stiftung am Laufen halten, und das bedeutet Spenden, Spenden, Spenden sammeln. Es ist nicht so, dass wir mit dem Geld knapsen müssen, zum Glück nicht. Wir haben hier vor Ort einige Menschen, die uns in regelmäßigen Abständen Geld zukommen lassen. Doch wenn wir expandieren wollen, dann müssen wir auch den Kreis der Geldgeber erweitern.»
«Hmm», ich überlegte kurz und sah mich im hellen Bürozimmer um, an dessen Wänden zwischen den Aktenschränken Bilder von glücklichen Kindern neben offiziell aussehenden Zertifikaten hingen. «Was sind das für Menschen, die sich bislang finanziell am Projekt beteiligen?»
«Oh, das ist unterschiedlich. In erster Linie handelt es sich um wohl situierte Geschäftsleute, die auch einmal ganz klein angefangen haben und die nun durch Liekedeler, wie soll ich sagen …»
Ich griff den Satz auf. «Die nun durch Ihr Projekt daran erinnert werden, dass sie beim Schicksal, das es gut mit ihnen meinte, noch etwas wettzumachen haben?»
Dr. Schewe nickte lachend.
«Frau Dr. Schewe, was ich jedoch bislang vermisst habe, ist der Name des Stiftungsgründers. Soweit ich weiß, muss man zum Aufbau einer Stiftung ein ziemlich hohes Grundvermögen anlegen, sodass sich die Organisation von den anfallenden Zinsen tragen kann. Und das muss eine Menge Geld sein, wenn ich das mal so indiskret ansprechen darf. Wer hat denn den finanziellen Grundstein für all dies hier gelegt?»
Dr. Schewe lächelte, als wäre ich eine übereifrige Schülerin, die Fragen stellte, die erst im nächsten Schuljahr an der Reihe waren. Aber sollte ich diesen Job bekommen, musste ich schließlich bestimmte Informationen haben.
«Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Es gibt viele kleinere Geldgeber, doch in der Tat gibt es auch einen großen Spender, ohne den hier nicht ein einziger Stuhl im Gebäude stehen würde. Es ist nur so, dass dieser Mann nicht genannt werden möchte.»
«Ein anonymer Stiftungsgeber?»
«Ein sehr guter Mensch, wie Sie sich denken können. Ihm liegt das Wohl und die Bildung der Kinder am Herzen wie kaum einem anderen. Er war bereit, sein gesamtes privates Vermögen in ein beispielloses Experiment zu stecken, und das rechne ich ihm hoch an. Er hat schon ganz am Anfang an Liekedeler geglaubt, verstehen Sie?»
Natürlich verstand ich. Die Idee von Liekedeler war klar und gut, jeder wollte daran glauben und ein paar Leute hatten sich an dieses Projekt oder «Experiment», wie Dr. Schewe es nannte, gewagt. «In jedem Menschen steckt ein unglaubliches Potenzial an Intelligenz und Talent, das denke ich auch, es muss nur gefunden werden. Und jeder Mensch ist es wert, dass in ihm danach gesucht wird. Ich habe gelesen, dass Liekedeler zum Beispiel ein kleines Segelboot hat, auf dem die Schüler lernen, was Zusammenhalt ist, gleichzeitig verstehen sie aber auch die physikalischen Gesetze, die ein Boot vorantreiben und es im Gleichgewicht halten. Frau Dr. Schewe, mir gefällt das Lernen durch praktische Anwendung der theoretischen Formeln, weil die neueste Gehirnforschung ja dafür plädiert, dass Emotionen, das Erleben von Erfolg, eine positive Auswirkung auf das Langzeitgedächtnis haben. Dies ist, soweit ich begriffen habe, der Grundgedanke Ihrer Arbeit.»
Sie nickte erfreut. «Sie haben unsere Sache scheinbar sehr gut begriffen, Frau Leverenz. Das kindliche Gehirn ist noch in der Lage, neue Verbindungen zwischen den einzelnen Nervenzellen aufzubauen. Dazu muss das Kind aber auch auf vielfältige Weise gefördert werden, eine Kombination von verschiedenen Lernbereichen verstärkt die Vernetzung der Hirnstruktur. Musikalität und logisches Denken können zum Beispiel in unserer hervorragenden Instrumentalgruppe miteinander kombiniert werden. Wir spielen dort nicht nur klassische und populäre Musik, wir bauen auch teilweise die Instrumente selbst, lassen die Schüler eigene Kompositionen machen, analysieren erfolgreiche Stücke aus allen Musikepochen auf wiederkehrende Merkmale. Musiktheorie wie Noten, Taktmaße und Historie werden bei dem praktischen Unterricht beinahe unbewusst von den Kindern aufgenommen. Unsere polnische Schülerin Jolanda Pietrowska hat beispielsweise in nur anderthalb Jahren fast nebenbei das Klavierspielen erlernt.»
Ich zog erstaunt die Augenbrauen hoch, woraufhin sie mir ein eingerahmtes Foto an der Wand zeigte, auf dem ein hübsches, dunkelhaariges Mädchen stolz und gerade vor einem Klavier saß. Das war wirklich ein beachtlicher Erfolg.
«Können Sie sich vorstellen, wie glücklich es mich macht, die Früchte dieser Arbeit so langsam reifen zu sehen? Tatsächlich zeigen unsere Schüler bemerkenswerte Fortschritte, nicht nur in der Schule, sondern auch im gewöhnlichen Alltag, mit den Familien und Freunden kommen sie besser zurecht.» Sie schaute durch ihre feine, silberne Brille erst mich und dann meine Unterlagen an. «Sie haben keine Familie?»
«Nicht direkt. Mein Vater lebt zwar mit mir in einer Wohnung, doch als Journalist ist er ständig unterwegs. Meine Mutter ist früh verstorben und Geschwister habe ich keine.»
«Sie sind mit dem Fahrrad zum Vorstellungstermin gekommen, ich habe es durch das Fenster beobachtet. Haben Sie kein Auto?»
«Ich habe keinen Führerschein.»
Dr. Schewe lachte hell und klar. «Sehr sympathisch, sehr sympathisch! Wenn ich an das typische Wind und Wetter in Ostfriesland denke, an einen zünftigen Sturm aus Nordwest zum Beispiel, da würden mich keine zehn Pferde auf ein Fahrrad bringen. Ich liebe mein trockenes, warmes Auto! Aber ich bewundere Sie für Ihr Durchhaltevermögen, liebe Frau Leverenz.»
Ich nickte nur. Natürlich wäre es toll, wenn die Gründe für meine Abstinenz etwas mit Durchhaltevermögen zu tun hätten. Hatten sie aber nicht. Ich hatte nie genug Geld für einen Führerschein, geschweige denn für ein Auto. Ich liebte mein schwarzes Hollandrad, es hatte über dreißig Jahre auf seinem Buckel und die Einzige, die außer mir je auf seinem Ledersattel gesessen hatte, war meine Mutter.
«Falls Sie die Stelle bekommen, könnten Sie auch gern bei uns einziehen», sagte Dr. Schewe in einem so selbstverständlichen Plauderton, dass ich es fast überhört hätte. «Wir renovieren gerade das Dachgeschoss, dort wird in ein paar Wochen eine Zweizimmerwohnung frei, nichts Großes, versteht sich, doch für eine Person wirklich ausreichend, meine ich.»
Ich rückte mich auf dem Stuhl zurecht und starrte aus dem Fenster hinter ihrem Schreibtisch. Durch die Scheiben war viel Grün zu sehen, dazwischen ein nahtlos blauer Himmel. Das Fenster war gekippt und ich konnte das entfernte Tuckern eines Traktors hören, sonst nichts. Die Kinder waren noch nicht im Haus, es war später Vormittag und sie waren wohl noch in ihren Schulen. Doch ich war mir sicher, dass ihr Rufen und Lachen sich zu einer wunderbaren Geräuschkulisse zusammenfinden würde. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass mein Name auf dem Klingelknopf neben der alten Haustür stand und wie ich abends im Sommer schulterfrei und mit einem Glas Wein in der Hand im Garten sitzen und ein Buch lesen würde.
«Was ist denn nun, Frau Leverenz?»
«Es klingt gut … das mit der Wohnung unter dem Dach.» Eigentlich fand ich sogar, dass es wunderbar klang.
Vielleicht hatte ich in diesem kurzen Moment schon daran geglaubt, mit Sicherheit aber innig gehofft, dass ich den Job bekommen würde. Und als ich wieder auf dem Sattel meines Fahrrads saß, den Schotterweg hinabfuhr und einen Blick über die Schulter wagte, da hatte ich das Gefühl, der einäugige Pirat aus Backstein zwinkerte mir mit seinen Fensteraugen zu.
«Wir werden uns kennen lernen, Liekedeler», flüsterte ich mir auf dem Heimweg immer wieder zu.
Auch wenn es zu schön schien, um wahr zu werden. Ich wollte mir nichts vormachen, es gab Bessere als mich. Doch ich freute mich auf den Tag, an dem mein Leben bei Liekedeler beginnen sollte.
Die leeren Spiel- und Aufenthaltsräume gleich am Eingang warteten auf das Eintreffen der Kinder und durch die große, offene Tür ganz hinten konnte ich sehen, dass die Tische im Speisesaal bereits gedeckt waren. Eine Köchin kam gerade die Kellertreppe hinauf und trug einen Korb mit Brot unter dem Arm.
«Mahlzeit», grüßte sie. Ich eilte ein paar Schritte voraus und hielt ihr die Tür rechts vom Speisesaal auf, aus der Küche dahinter drangen geschäftige Geräusche und der Geruch von gegartem Gemüse.
«Vielen Dank, junge Frau», sagte die Köchin. «Und herzlich willkommen bei Liekedeler. Heute gibt es Gemüsesuppe.»
«Riecht gut», lobte ich lächelnd, dann ging ich in mein neues Büro, welches der Küche gegenüberlag. Dort roch es auch gut, nach frischer Farbe. Der Raum war so sauber und unpersönlich wie die Zimmer in den Fotografien eines Möbelhauses, doch er war sonnig und nur die Scheiben des Fensters trennten mich von einem grenzenlosen Blick über das flache, grüne, offene Land. Ich stellte meine Tasche auf die gläserne Schreibtischplatte, sie wirkte wie ein gerade zugefrorener See an einem Wintermorgen, wenn noch keine Schlittschuhkufen die Oberfläche zerkratzt hatten. Dann öffnete ich das Fenster, nahm einen tiefen Atemzug voller Sommerluft in meinen Körper auf und war glücklich und gespannt zugleich.
Schon johlten die ersten Kinderstimmen von draußen herein. Die Schule war vorbei und gleich würden die fünfzehn Liekedeler-Kinder das Haus mit ihrem Leben füllen. Die meisten kamen mit dem Rad, es waren nur zwei Kilometer von der Stadt bis hierher, nur die Kleineren wurden vom Schulbus ausgespuckt, der schwer und breit durch die grauen Landstraßen kroch.
Ein bunter Gummiball flog durch das offene Fenster in mein Büro, sprang dort ungezogen auf den leeren Regalen herum und blieb wie ein verschreckter Vogel auf meinem gepolsterten Bürostuhl liegen.
Ich griff nach dem farbenfrohen Eindringling und hörte eine aufgeregt flüsternde Stimme ein paar Meter von meinem Fenster entfernt.
«O Scheiße, das gibt Ärger.»
Ich beugte mich hinaus und erkannte das dunkelhaarige Mädchen sofort. Sie hatte auf der Fotografie in Dr. Schewes Zimmer so brav und beherrscht am Klavier gesessen. Nun kauerte sie mit den Knien im Kies und biss sich auf der Unterlippe herum, konnte sich ein Schmunzeln aber nicht verkneifen. Daneben saß ein dünner Junge mit ausgestreckten Beinen, er blinzelte und hob seine rechte Hand an die Stirn, als er zu mir hochsah und von der Sonne geblendet wurde.
«Wer von euch beiden war das?», fragte ich mit bemüht strenger Miene. Ich konnte mir den Spaß nicht verkneifen, ihnen einen süßen kleinen Schrecken einzujagen. «Wer von euch beiden glaubt, dass es wegen dieses harmlos herumspringenden Flummis Ärger gibt?»
«Ich», sagte der Junge. Ich konnte sehen, dass sein linker Fuß so dick und rund war wie ein Pferdehuf und in einem dunkelbraunen, merkwürdigen Schnürschuh steckte.
«Und wie heißt du?» Noch immer legte ich ein wenig gespielten Zorn in meine Stimme, doch der Junge schien den Spaß verstanden zu haben, denn er sprang fröhlich auf und salutierte.
«Melde mich gehorsamst: Ingo Palmer. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, mein Angriff mit dem Gummiball war keine Absicht!»
Ich musste laut lachen, erstaunlich, wie redegewandt der Kleine war, und auch das Mädchen stand nun auf und blickte mich mit fröhlicher Neugierde an. «Und ich bin Jolanda Pietrowska.»
«Du bist die Pianistin, oder?», sagte ich. «Frau Dr. Schewe hat mir von dir erzählt. Ich verstehe zwar nicht viel von Musik, aber ich freue mich schon darauf, dich spielen zu hören.»
Sie schien sich über meine Worte zu freuen, verlegen strich sie mit dem Fuß durch die feinen Steine. «Da sollten Sie erst mal Ingo hören.»
«Spielst du auch Klavier, Ingo?»
«Nein, ich bin unmusikalisch. Aber ich kann dichten», sagte er stolz.
Jolanda sah bei diesen Worten genauso stolz aus wie er.
Ich setzte mich auf die Fensterbank, lehnte mich gegen den Holzrahmen und fühlte die Wärme des Sommertages auf meinem Gesicht. Liekedeler würde mir viel Spaß machen. «Ein Dichter und eine Musikerin. Alle Achtung. Da habe ich aber einen schweren Stand. Ich bin hier nämlich nur für die Werbung zuständig. Nichts Besonderes also. Mein Name ist Okka Leverenz.» Dann warf ich ihnen den Gummiball entgegen, den ich unauffällig in meiner Hand verborgen hatte. Prompt sprang er gegen einen Stein, prallte in einem flachen Winkel ab und flog unaufhaltsam direkt in den sumpfigen Graben, der zehn Meter weiter das Ende des Grundstückes markierte. «Oh», rief ich und schlug mir die Hand vor den Mund.
«Lassen Sie mal, den holen wir raus!», sagte Ingo Palmer eifrig und rannte humpelnd los.
«Kommt gar nicht infrage. Ich hab’s vermasselt, dann bin ich auch dafür zuständig, das Ding vor dem Ertrinken zu retten», sagte ich, schaute mich schnell um, und als ich mir sicher war, dass keiner meiner neuen Kollegen in der Nähe stand und mich beobachtete, sprang ich aus dem Fenster.
Jolanda sah mich mit großen Augen an, folgte mir dann aber hüpfend zum Graben. Ingo hatte bereits einen langen Ast gefunden, der sich an der Spitze gabelte und ideal war, um im trüben dunklen Wasser nach einem kleinen Ball zu fischen.
«Ich glaube, er ist weiter links reingefallen», sagte Jolanda und stemmte dabei ihre schlanken Hände in die Hüfte. Wichtig und gebannt verfolgte sie meine stochernde Suche. Ich schritt ein Stück weiter nach vorn, der Grabenrand war ein wenig schlammig, also zog ich mit die Lederschuhe von den Füßen, warf sie im hohen Bogen ins trockene Gras und stieg dem dunklen Wasser entgegen.
«Fallen Sie da bloß nicht rein, die Suppe stinkt nach Furz», warnte Ingo.
«Das war aber eben nicht sehr poetisch», kicherte ich und rutschte vorsichtig noch etwas tiefer. Der Junge ergriff von hinten meine Bluse und der dünne Sommerstoff spannte eng über meinem Busen.
«Ich halte Sie schon fest, keine Panik!»
Endlich tauchte ein regenbogenfarbenes Etwas zwischen den zwei Zweigen auf. «Ich hab ihn!», johlte ich und balancierte den Stock mit der Beute hinauf, bis alles sicher auf dem kleinen Rasenstück landete. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und entdeckte erst danach, viel zu spät, dass meine Hände vom moosigen Holz ganz grün waren. «Na prima! Und, wie sehe ich aus?», fragte ich die beiden Kinder, die mich bewundernd und ehrfürchtig anstarrten.
«Wie eine Außerirdische, ganz grün im Gesicht!», lachte Jolanda.
«Ich finde Sie wunderschön!», sagte Ingo und ich musste mich anstrengen, damit er mir nicht anmerkte, wie sehr mich seine ernste, feierliche Miene in diesem Moment amüsierte.
Alles war in Ordnung, dachte ich. Der Flummi war gerettet, die Kinder waren wie aus Zucker und das Leben hier begann mit einem wilden, schönen Lachen. Doch dann ertönte der Gong und die Kinder sagten: «Au Backe, Mittagessen!» Und ich stand da, mit klumpiger Erde bis zum Schienbein und einem grün gestreiften Gesicht.
«Ab, marsch, Händewaschen!», sagte ich und die beiden Kinder liefen davon.
«Ein Fallbeispiel, eine Erfolgsstory, das ist es, was wir bringen müssen. Glückliche Eltern mit erfolgreichen Kindern in einer Fernsehshow, das wäre es. Oder ein Buch, natürlich von einem Ghostwriter geschrieben, in dem eine Mutter die Entwicklung ihres mäßig begabten Kindes zum kleinen Genie bei uns beschreibt. Was glauben Sie, Frau Leverenz?» Jochen Redenius, einer der Pädagogen, die seit der ersten Stunde dabei waren, saß mir gegenüber und unterstützte seine Rede mit einer bestimmenden Geste, die besagte: «Natürlich habe ich Recht!» Soll ich sagen, dass er mir von Anfang an unsympathisch war? Seine Idee war gut, ich konnte mich sofort dafür begeistern, doch die Art, wie er nun Beifall heischend in die Runde schaute und mich dabei geflissentlich übersah, machte mich wütend.
Ich schaute ihm direkt in die Augen, er sollte wissen, dass ich mich nicht ignorieren ließ, besonders nicht, wenn ich es war, die angesprochen wurde. «Sie kennen die Schüler besser als ich, Herr Redenius.» Nun musste er zu mir hinüberschauen. «Meinen Sie, dass wir ein Kind dabeihaben, welches sich für diesen Zweck eignen würde?» Ich stolperte kurz über meine eigenen Worte. «Das hört sich seltsam an: Kinder, die sich für einen Zweck eignen, finden Sie nicht?» Lächelnd schaute ich die anderen Anwesenden an. «Ich werde mich wohl daran gewöhnen müssen, die Kinder als Produkt zu sehen. Es ist schon komisch, in meiner vorherigen Firma habe ich Teemischungen beworben, Ceylon und Darjeeling und Earl Grey. Nun sind die Objekte meiner Arbeit eben Kinder.»
«Das geht uns allen manchmal so», beruhigte mich Dr. Schewe freundlich.
Jochen Redenius hatte sich allem Anschein nach diese Betrachtungsweise bereits vollständig zu Eigen gemacht. «Ich denke an einen bestimmten Jungen. Er ist noch nicht lange bei uns, genau genommen seit Mitte April.»
«Mitte April? Das sind lediglich drei Monate. Kann man in einem Vierteljahr schon derartige Fortschritte machen, dass sich darüber in einer Talkshow reden lässt?»
Redenius blätterte kurz mit seinen blassen Fingern in einer penibel geführten Mappe und zog ein Blatt hervor. «In allen Fächern um ein bis zwei Noten rauf. Und das trotz Schulwechsels. Ich halte es für erstaunlich.»
«Vielleicht liegt es auch an der Schule?», unterbrach ich.
Doch mein Gegenüber schüttelte den Kopf. «Nein, das ist es nicht. Er kommt von Juist und auf der Insel gibt es keine wirklichen Weiterbildungsmöglichkeiten für Kinder, trotzdem haben wir ihn eine Klasse höher einschulen lassen. Wir haben den Klassenwechsel angeregt, obwohl der Intelligenztest, den wir bei allen neuen Schülern vor Beginn der Förderung durchführen, einen eher durchschnittlichen Wert von 112 ergab.»
«Sie führen IQ-Tests durch? Bei allen Kindern?» Das war mir neu und ich war mir nicht sicher, ob mir diese Tests gefielen.
Redenius schien über meine heftige Reaktion erstaunt zu sein. «Nichts geschieht hier ohne Einwilligung der Eltern, und Sie glauben gar nicht, wie erpicht die meisten darauf sind, die Werte ihrer Sprösslinge zu erfahren. Haben Sie sich etwa noch nie testen lassen?»
«Um Himmels willen, nein!», entfuhr es mir. Manchmal hielt ich mich zwar selbst für unglaublich schlau, doch genauso oft überkam mich die Gewissheit, dass sich mein IQ locker mit dem kleinen Einmaleins ausrechnen ließ. «Ich möchte lieber gar nicht wissen, wie es wirklich um mich steht.»
«Sie müssen noch eine Menge lernen, wenn Sie in unserem Hause Fuß fassen möchten», sagte Redenius. Zwei seiner Kollegen nickten, doch Dr. Schewe – sie saß eher etwas abseits am Ende des Konferenztisches – räusperte sich.
«Jochen, du solltest wissen, dass Liekedeler von neuen, anderen Sichtweisen nur profitieren kann, und wenn Frau Leverenz eine kritische Einstellung zu unseren Methoden hat, so ist sie in meinen Augen umso qualifizierter für ihren Job in der PR-Abteilung.»