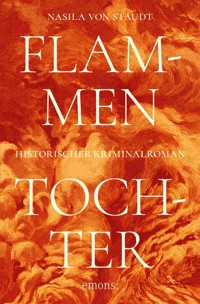
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal eines jungen Mädchens, das als Hexe angeklagt werden soll. 1627, Rothenburg ob der Tauber: Nach dem Tod ihrer Eltern lebt die dreizehnjährige Margaretha bei einer Müllersfamilie, wo sie tagein, tagaus schikaniert wird. Um den Umständen zu entfliehen und endlich bei ihrem geliebten Bruder unterzukommen, bezichtigt sich Margaretha als Hexe. Ihr Plan geht vorerst auf, doch dann soll sie trotz ihrer jungen Jahre vor Gericht gestellt werden. Obwohl der Stadtrat von ihrer Unschuld überzeugt ist, scheinen düstere Mächte ihre Finger im Spiel zu haben. Für Margaretha beginnt ein Kampf ums Überleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nasila von Staudt lebt in Unna, wo sie 2022 ihr Abitur machte. Seitdem hat sich die Neunzehnjährige vollkommen dem Schreiben dieses Romans gewidmet. Schriftstellerin zu werden, war ihr allererster Berufswunsch, und so erfüllt sie sich mit diesem Buch einen Kindheitstraum. Neben dem Schreiben interessiert sie sich für Geschichte, Kunst und Musik und ist immer auf der Suche nach dem nächsten Projekt.
Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch sind die meisten Personen nicht frei erfunden, sondern existierten wirklich. Ihre Handlungen beruhen auf einem historischen Hintergrund.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Leonardo Magrelli, unter Verwendung eines Motivs von istockphoto.com/duncan1890
Lektorat: Hilla Czinczoll
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-075-4
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
7. MAI 1627
Es war ein frischer Frühlingsmorgen. Die ersten Sonnenstrahlen brachten den Tau auf den Grashalmen zum Glitzern. Ein leichter Windstoß ließ die Äste sanft hin und her schwingen, und einzelne Tautropfen fielen wie feine Perlen zu Boden. Und wie der Tau, so fielen auch die Tränen der jungen Margaretha Hörber. In sich zusammengesunken, die Hände ineinandergelegt, saß sie auf dem Friedhof in Gebsattel. Der Schwarze Tod hatte vor einem Jahr in dem kleinen Städtchen gewütet und viele mit sich gerissen. Unter anderem Margarethas Eltern. Die Pest hatte so viele Opfer gefordert, dass es in all der Eile nur für zwei kleine Kreuze aus Holz gereicht hatte, um an diese verlorenen Menschen zu erinnern. Das war alles, was von ihnen übrig geblieben war. Das war alles, an dem Margarethas kleines, gebrochenes Herz nun hing.
Margaretha schaute auf die Wiese vor sich. Sie streckte ihre Hand aus und pflückte zwei kleine Gänseblümchen, die neugierig neben ihr aus der Wiese emporwuchsen. Eines davon drehte sie ein Weilchen in ihrer rechten Hand und betrachtete eingehend die weißen Blütenblätter, bevor sie beide zu Füßen der Grabeskreuze legte. Eine neue Welle der Trauer überkam Margaretha. Sie würde doch gern mehr tun, aber es war zu spät, es war längst alles vorbei.
Obwohl der Tod der Eltern schon ein Jahr zurücklag, war der Umstand für die dreizehnjährige Margaretha noch lange nicht zur Realität geworden. Die Kreuze und Gänseblümchen verschwammen vor ihren Augen, und Tränen rannen ihre von der frischen Morgenluft geröteten Wangen hinunter. Sie war ein hübsches Kind, feines blondes Haar, die blauen Augen der Mutter, die Haut so weich wie das Blütenblatt einer roten Rose. Diese Blumen mochte Margaretha am liebsten. An einer ihrer Hauswände war früher eine große Ranke gewachsen, als die Eltern noch lebten und das Leben fast sorgenfrei war.
»Jetzt wisch dir die Tränen ab, Margaretha. Es wird Zeit zu gehen.« Die warme Stimme gehörte Michael, Margarethas großem Bruder. Er war einige Jahre älter als sie und lebte allein. Der Vater hatte ihm schon früh alles über das Handwerk des Tischlers beigebracht.
Margaretha trocknete sich mit dem Ärmel ihres Kleides die Tränen ab und drehte sich zu ihrem Bruder um. Wenn man die beiden sah, mochte man gar nicht meinen, dass sie Geschwister waren. Michaels Haare waren braun, vom Wind zerzaust. Seine Augen hatten die Farbe von frischem Laub im November, wenn die warme Herbstsonne darauf schien. Doch seit dem Tod der Eltern hatte sich ein grauer Schatten über sie gelegt, in seine Stirn und um seine Augen hatten sich tiefe Falten eingegraben. Das ließ ihn um einiges älter wirken.
»Trauerst du gar nicht?« Margaretha verstand nicht, weshalb ihr Bruder so kühl war. Wieso saß er nicht mit ihr am Grab und weinte?
»Doch, Margaretha. Aber vor allem bin ich zornig. Ich bin wütend auf den Heerführer Tilly und auf die Liga. Wären sie nicht einmarschiert, wäre die Pest mit Sicherheit an Gebsattel vorbeigegangen.«
Seit einigen Jahren tobte der Krieg in Deutschland. Die katholischen Ligatruppen des Kaisers durchstreiften das Land im Kampf gegen die protestantische Union und verbreiteten Furcht und Schrecken in der Bevölkerung. Viele wurden durch das Schwert dahingeschlachtet wie Tiere. Doch noch mehr Opfer forderten die Seuchen, die die Soldaten in jede neu eroberte Stadt einschleppten wie ein Geschenk des Teufels.
Margarethas Blick hatte sich in den wehenden Baumkronen verfangen. Verstand sie auch nicht viel von Politik und Kriegen, wusste sie doch, dass dieser Krieg und der Tod ihrer Eltern mit nichts zu rechtfertigen wären.
»Komm jetzt, Margaretha, oder willst du wieder Ärger mit der Müllerin bekommen?«
Die Worte rissen Margaretha aus ihren Träumereien. Sie schaute ihren Bruder entgeistert an und schüttelte heftig den Kopf, Tränen schossen ihr in die Augen. Verzweifelt warf sie sich an Michaels linkes Bein und klammerte sich daran fest. »Bitte bring mich nicht wieder in die Siechenmühle! Bitte lass mich doch bei dir wohnen!«, flehte sie mit weinerlicher Stimme.
»Ach, lass doch los, Margaretha.« Michael versuchte, sie von seinem Bein abzustreifen, aber sie ließ nicht locker. Er hielt inne und schaute seine kleine Schwester an, wie sie sich in der Erwartung, was nun passieren würde, an sein Bein klammerte, so fest, dass ihre Fingerkuppen ganz weiß wurden, die Augen fest zusammengedrückt, die Lippen aufeinandergepresst und die Schultern bis zu den Ohren gezogen.
Michael legte den Kopf schief, ließ die Schultern sinken und stieß einen tiefen Seufzer aus. Langsam bückte er sich zu seiner kleinen Schwester hinunter und strich ihr sanft über das blonde Haar. Es war noch weicher als Daunen.
»Du weißt doch, dass das nicht geht«, versuchte er, sie zu besänftigen. »Ich muss den ganzen Tag arbeiten, keiner könnte sich um dich kümmern. Und in der Siechenmühle geht es dir doch nicht schlecht. Du bekommst etwas zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, und ich bezahle dafür, dass du in die Schule gehen und etwas lernen kannst. Dieses Vorrecht haben die anderen Mägde in der Mühle nicht.«
Margaretha löste sich aus ihrer Verspannung und schaute ihren Bruder einige Sekunden eindringlich an, bevor sie langsam ihre Ärmel hochschob und damit eine Reihe blauer und violetter Flecken offenbarte. »Wonach sieht das für dich aus?«, fragte sie vorwurfsvoll.
Michael verzog schmerzvoll sein Gesicht und schaute seine Schwester schuldbewusst an. »Es tut mir leid, Margaretha, ich kann nichts für dich tun. Wenn du älter bist, wirst du es vielleicht verstehen. Es ist so am besten für dich. Die Müller erziehen dich im protestantischen Glauben, und dann wirst du –«
Barsch wurde er unterbrochen. »Das nennst du protestantische Erziehung?« Mit Entsetzen streckte Margaretha ihrem Bruder die verletzten Arme direkt vors Gesicht, sodass er einen Schritt zurückweichen musste. »Wenn das so ist, will ich mit Religion nichts zu tun haben!«
»Margaretha!« Michael packte die vor ihn hingestreckten Unterarme seiner Schwester und funkelte sie streng an. Als er ihren angsterfüllten Blick sah, erschrak er jedoch selbst über seine erhobene Stimme und ließ sie los. »Es tut mir leid«, flüsterte er.
Margaretha schaute ihn nicht an, sondern rieb sich nur die schmerzenden Stellen. Michaels Reaktion hatte nicht nur in ihren Armen einen stechenden Schmerz verursacht. Sie biss die Zähne zusammen, um nicht wieder anzufangen zu weinen, obwohl sie einen riesigen Kloß im Hals hatte und die Welt vor ihren Augen schon wieder zu verschwimmen begann. Michael sollte ja nicht denken, dass sie sich durch ihn eingeschüchtert fühlte.
Vorsichtig legte er seine Hand auf ihren Rücken. »Jetzt komm. Es wird Zeit.«
Widerwillig folgte Margaretha ihrem Bruder. Noch einmal drehte sie sich um, zu den beiden Kreuzen, vor denen immer noch so friedlich die kleinen Gänseblümchen lagen. Wenn Vater und Mutter nur wüssten, was ihre Tochter alles zu erleiden hatte. Sie sah ihre besorgten Blicke vor ihrem geistigen Auge und ärgerte sich über sich selbst, als sie die salzigen Tränen wieder auf ihrer Zunge schmeckte. Sie biss sich fest auf die Lippen und wandte ihren Blick von den Gräbern ab.
Vorsichtig schaute sie zu ihrem Bruder auf, der seinen Arm immer noch fest um sie gelegt hatte, um sie vorwärtszuschieben. Sein Blick war angestrengt nach vorn gerichtet. Als ihm die Sonne ins Gesicht fiel, entdeckte Margaretha eine getrocknete Träne auf seiner Wange. Schnell richtete sie ihren Blick wieder geradeaus und tat so, als hätte sie es nicht gesehen. Sie hatte es gewusst, ihr Bruder trauerte genau wie sie. Ihr eigenes Herz war gebrochen, seines war zu Stein geworden.
***
Nach einiger Zeit kamen Margaretha und Michael bei der Siechenmühle an. Umgeben von hohen Bäumen, lag sie ganz versteckt am Fuße eines Hangs in einer hügeligen Landschaft. Zu der Hofanlage gehörten eine Scheune für die Tiere und eine Wassermühle. Schon von Weitem hörte man die Holzschaufeln des Mühlrads in dichter Folge auf das Wasser einschlagen, immer und immer wieder. Zwischen Mühle und Scheune führte ein schmaler Kiesweg auf eine große Wiese, neben der sich die Tauber mit einem beruhigenden Plätschern durch die Landschaft schlängelte. Von hier aus konnte man weit über die Hügel blicken.
Margaretha und ihr Bruder hatten soeben den Hof betreten, da sprang aus einem Busch der Kater des Müllers. Eigentlich war er dazu da, die Mäuse von den Getreidesäcken fernzuhalten, aber er bevorzugte es eher, in der prallen Mittagssonne auf dem Hof zu faulenzen und sich die Sonnenstrahlen auf den flauschigen Bauch scheinen zu lassen, worum Margaretha ihn manchmal beneidete. Der Kater hatte ein hellbraunes Fell mit dunkleren Streifen und eine weiße Schnauze. Es sah so aus, als habe er sein Köpfchen etwas zu tief in die Milchschüssel gehalten.
Margaretha lächelte, als das Tier schnell auf sie zugetippelt kam. Der gestreifte Schwanz sprang dabei freudig von links nach rechts. Schnurrend schmiegte sich der Kater an ihre Beine, schloss die Augen und strich immer wieder von links nach rechts und von rechts nach links. Er schien es zu genießen. Auch Michael musste schmunzeln.
Margaretha wollte sich gerade bücken, um ihren pelzigen Freund zu streicheln, da schallte ein unangenehm krächzender Ruf über den ganzen Hof: »Grüß Gott, Herr Hörber!«
Der Kater zuckte zusammen und zog den Schwanz ein. Mit einem lauten Fauchen sprang er in einem großen Satz davon und war mit zwei weiteren zwischen den grünen Büschen verschwunden. Margaretha richtete sich enttäuscht auf und griff nach Michaels Hand.
Den Ruf hatte die Müllerin geschmettert. Sich die Hände an einer Schürze abtrocknend, trat sie aus der Tür der Mühle heraus und eilte Margaretha und ihrem Bruder entgegen. Schwer schnaubend setzte sie ein Bein vor das andere. Ursula Herman hatte das Kreuz eines Mannes, wulstige Arme und Hände und Beine wie Säulen. Margaretha wusste, dass auch Michael einen gesunden Respekt vor ihr hatte. Auch wenn sie nicht die schnellste Läuferin war, sie hatte enorme Kraft. Die hatte Margaretha oft genug zu spüren bekommen.
»Michael Hörber, wie schön, dich mal wieder hier auf unserem Hof begrüßen zu dürfen!«, flötete die Müllerin laut atmend. Sie strich sich eine ihrer struppigen Strähnen hinters Ohr und fragte mit verstellter, piepsiger Stimme: »Kann man was anbieten?«
Ihre Lippen lächelten, aber die Augen taten es nicht. Ihre Augen musterten und verurteilten. Die so leicht und mit sanfter Stimme dahingesprochenen Worte konnten die Abscheu in ihrem Herzen nicht verbergen. Sie schätzte nur eines an dem unerfahrenen Tischlersohn, wie Margaretha wusste: sein hart erarbeitetes Geld. Denn das hatte die Mühle bitter nötig. Wohlgesonnen war sie Michael dennoch nicht, denn Margaretha hing zu sehr an ihm. Irgendwann würde der Tag kommen, an dem er sie wieder zu sich nehmen würde, und dann würde der Mühle eine Arbeitskraft fehlen. Er sollte bloß nicht den Eindruck bekommen, Margaretha würde es hier schlecht gehen.
»Danke für das Angebot, aber ich bin nur gekommen, um Margaretha herzubringen.« Michaels Stimme war kalt. Auch er wusste um die wahren Beweggründe der Müllerin. Er hatte die blauen Flecken gesehen. Er hatte Margarethas Tränen gesehen. Er hatte ihre Erzählungen angehört, und er hatte ihr jedes Wort geglaubt.
»Ich mach mich direkt wieder auf den Weg zurück nach Gebsattel, für heute steht viel Arbeit an.« Während er das sagte, schaute er seine Schwester an. Sicherlich waren ihre Augen immer noch rot und verweint.
»Nun«, setzte die Müllerin an, nahm Margarethas Hand und zog sie mit einer ruppigen Bewegung von ihrem Bruder weg zu sich hin, »dann ist es wohl Zeit, Auf Wiedersehen zu sagen.« Sie grinste breit und zeigte ihre gelben Zähne, zwischen denen noch Teile des Frühstücks wiederzufinden waren.
Michael hob kurz die Augenbrauen und schaute etwas verdutzt, erwiderte dann aber zögerlich das aufgesetzte Lächeln. Ein letztes Mal strich er Margaretha über die rosige Wange. »Pass auf dich auf«, flüsterte er. Seine Stimme brach, und bevor Margaretha sehen konnte, ob er weinte, drehte er sich ruckartig um und eilte schnellen Schrittes vom Hof.
Ursula Herman lächelte immer noch, den Kopf niedlich zur Seite geneigt, die Hände auf Margarethas Schulter scheinheilig übereinandergelegt, für den Fall, dass sich Michael noch mal umdrehen würde.
Margaretha streckte ihre Hand nach ihm aus, um ihm zu winken. Die Müllerin presste ihre Hände fester auf Margarethas Schulter, jederzeit bereit zuzupacken, wohl in der Angst, sie würde ihrem Bruder im letzten Moment noch hinterherlaufen. Doch das tat sie nicht. Sie hätte es gern getan, aber ihre Füße fühlten sich so schwer an wie Blei, als sei sie am Boden festgekettet, als sei sie umgeben von einem unsichtbaren Käfig, der es ihr unmöglich machte, aus dieser Hölle zu entkommen.
Kaum war Michael zwischen den Baumstämmen verschwunden, wurde der Griff der Müllerin an Margarethas Schulter eisern. Sie versuchte, nach unten auszuweichen und sich herauszuwinden, aber da hatte Ursula Herman schon ihren Arm gepackt. Die Finger bohrten sich in Margarethas ohnehin schon geschundenen Oberarm.
»Wieso hat’s so lang gedauert?« Die Müllerin spuckte ihr die Worte regelrecht ins Gesicht.
»Wir waren am Grab«, presste Margaretha kaum hörbar hervor.
»Ich weiß, wo ihr wart, wieso’s so lange gedauert hat, will ich wissen!«
Keine Antwort. Margaretha zog die Schultern nach oben. Sie wusste, was jetzt folgen würde. Wutentbrannt stieß die Müllerin sie von sich, und Margaretha fiel in den Schutt. Sie presste die Hände auf die schmerzenden Knie. Als sie sie wieder anhob, waren sie blutverschmiert.
»Wir gehen unter in Arbeit, aber die feine Margaretha macht einen entspannten Morgenspaziergang auf dem Friedhof? So funktioniert’s nicht. So ein faules Drecksblag wie dich können wir nicht gebrauchen! Was denkst, wer du bist? Schau dir doch bloß deine Händ’ an!« Die Müllerin packte Margarethas Unterarme.
»So dünne Fingerchen, wie Stöcke sehen s’ aus. Die haben noch gar keine Arbeit kennengelernt. Entweder bist in der Schule und lernst Lesen wie die Hochwohlgeborenen, oder du faulenzt! So sehen arbeitende Hände aus!« Demonstrativ streckte die Müllerin Margaretha ihre großen Pranken ins Gesicht. »Die haben Kraft, siehst?« Kaum hatte sie das gesagt, holte sie aus und verpasste Margaretha eine schallende Ohrfeige, um sie das eben Gesagte spüren zu lassen.
Margaretha konnte die Tränen nicht zurückhalten, sosehr sie es auch wollte, beständig wie das Wasser der Tauber rannen sie an den Wangen herunter. Sicher hatte die Hand einen roten Abdruck in ihrem feinen Gesicht hinterlassen. Es brannte, als sei sie vorwärts in einen Brennnesselstrauch gefallen.
Zufrieden mit ihrem Tun stemmte die Müllerin beide Arme in die Hüften und richtete sich auf, die Brust weit nach vorn gestreckt. »So, lass dir das eine Lehre sein, dass ich auf mei’m Hof keine Faulheit dulde! Hast gehört?«
Margaretha nickte.
»Du wirst jetzt die Wäsche machen. Die Körbe stehn da vorn. Bis Mittag ist’s fertig. Sonst weißt ja, was passiert.«
Margaretha nickte nochmals und hielt sich ihre glühend heiße Wange.
»Na los! Schleich dich!«
Schnellen Schrittes eilte Margaretha zu den geflochtenen Körben, stapelte gleich zwei aufeinander und hob sie hoch, um sie bis zur Tauber zu schleppen. Sie konnte nicht sehen, wohin sie lief, weil die Körbe so groß waren, aber sie bemühte sich, möglichst schnell aus dem Sichtfeld der Müllerin zu verschwinden, die mit verschränkten Armen und kritischem Blick immer noch wie ein Fels an derselben Stelle stand.
»Und dass du mit deinen blutigen Knien nicht an die frische Wäsche kommst!«, schrie sie ihr noch hinterher, als Margaretha schon längst zwischen Scheune und Mühle verschwunden war.
Margaretha verlangsamte ihren Schritt, als das Rauschen der Tauber lauter wurde, und setzte die Körbe vorsichtig vor sich auf dem Boden ab. Als sie sich wieder aufrichtete, blickte sie in die Baumkronen, durch deren Lücken einzelne Sonnenstrahlen stießen. Margaretha musste blinzeln und unterdrückte einen Niesreiz.
Normalerweise wäre sie an so einem schönen Tag durch die Felder gestreift und hätte Blumen für die Mutter gepflückt. Der Vater hätte draußen Holz gehackt und sie ihn dabei ein bisschen geärgert, bis er versucht hätte, sie zu fangen und sie um das Haus herumzujagen. Die Mutter hätte nur schmunzelnd den Kopf geschüttelt, während sie die frisch gewaschene Wäsche aufhängte. Margaretha schaute den Fluss entlang und sah vor ihrem geistigen Auge, wie der Vater sein vor Freude kreischendes Mädchen einholte und hochhob, so tat, als wolle er sie mit Schwung in die Tauber werfen, um dann doch im letzten Moment herumzuwirbeln, sie wieder auf dem Boden abzusetzen und ihr einen dicken Kuss auf die Stirn zu geben. Margaretha sah seine braunen Augen, braun wie die von Michael, aber ohne den grauen Schatten. Da war nichts als Freude und Liebe in seinem Blick gewesen. Bei dem Gedanken hob sich für den Bruchteil einer Sekunde einer ihrer Mundwinkel.
Während Margaretha so vor sich hin starrte, spürte sie plötzlich etwas Weiches am Bein. Sie blickte an sich herunter und sah den Kater, der sich wieder voller Liebe an ihr Bein drückte und sinnlich schnurrte. Margaretha kniete sich zu ihm hinunter. »Jetzt bin wohl ich die, die Wäsche wäscht«, flüsterte sie dem Kater in sein geschlitztes Ohr. Dieser antwortete nur mit einem Maunzen. Margaretha drückte das Tier ein letztes Mal an sich und grub ihre Nase in das flauschige Fell, bevor sie sich an die Arbeit machte.
Sie hatte viel zu tun, und während sie so vor sich hin schrubbte, kamen ihr die Worte der Müllerin wieder in den Sinn. War sie wirklich so faul? Ja, es fiel ihr schwer zu arbeiten, sie musste immer wieder an Mutter und Vater denken und konnte sich nicht konzentrieren. Michael schaffte das doch auch irgendwie. Wieso konnte sie das nicht?
Margaretha hob das tropfende Unterhemd des Müllers hoch, hielt es gegen die Sonne und untersuchte, ob sie einen Fleck übersehen hatte. Als dem nicht so war, stand sie auf und hängte das Hemd über die Wäscheleine, wo es jetzt vom Wind aufgeblasen wurde wie ein weißer Balg. Margaretha machte sich an das nächste Kleidungsstück. Es war eines ihrer eigenen Kleider. Am rechten Ellenbogen entdeckte sie ein Loch und vereinzelte Blutspritzer. An dem Tag, als das passiert war, war Margaretha das Essen angebrannt, und die Müllerin hatte sie die Treppe hinuntergestoßen.
Sie steckte das Kleid in das kühle Nass und sah zu, wie das Wasser durch die Fasern floss und langsam den gesamten Stoff durchnässte. Sie konnte sich nicht einmal daran erinnern, warum das Essen angebrannt war. Sie musste wohl wieder in Gedanken gewesen sein, wie so oft. Das Loch würde sie später noch flicken.
Nach hartnäckigem Schrubben lösten sich langsam die Blutflecken, und das rot gefärbte Wasser trieb schnell davon. Wenigstens schrubben konnten die kleinen, zarten Hände. Sie waren doch zu etwas zu gebrauchen. Michael wäre stolz auf sie.
Michael. Die Wut über die Liga hatte sein Herz hart und verbittert gemacht. Er war kurz nach dem Tod der Eltern zum evangelischen Glauben übergetreten, enttäuscht von dem, was die Katholiken angerichtet hatten. »Dahinter kann Gott nicht stehen«, hatte er damals gesagt.
Margaretha konnte ihn nicht verstehen. Ihn nicht, den Krieg nicht, den Tod nicht. Die Protestanten kämpften doch auch. Sie töteten auch Menschen und rissen Familien auseinander, nahmen ihnen das, was ihnen am liebsten war. Die Menschen bekriegten sich, aus welchen Gründen auch immer, die Unschuldigen starben. Und Gott? Wo war er die ganze Zeit? Um ihn ging es schließlich bei den ganzen Religionskriegen, oder war dem doch nicht so? Wem würde er seine Anerkennung schenken? Es schien, als würde er warten, bis sich die Menschheit selbst vernichtet hatte. Nichts von dem, was Margaretha über den Krieg zu wissen glaubte, ergab Sinn. Vielleicht sieht er uns gar nicht, dachte sie bei sich.
Warum mussten ausgerechnet Mutter und Vater sterben? Sie hatten gewiss nie jemandem etwas Böses getan, mit dem Krieg hatten sie eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Sie waren doch gläubige Katholiken gewesen, sie hatten immer gebetet, waren zur Kirche gegangen. Nichts hatte es ihnen gebracht. Michael sagte immer, Vater und Mutter würden in den Himmel kommen, doch er wusste genau wie sie selbst, dass das nicht möglich war. Es war nur ein kläglich abgeknickter Strohhalm, an dem er sich mehr verzweifelt als stur festhielt.
Die Geistlichen in Gebsattel und der Umgebung hatten zu den ersten Opfern der Pest gehört, weil sie zu den Betroffenen gegangen waren und sich dabei angesteckt hatten. Vater und Mutter waren später also ohne jeglichen kirchlichen Beistand, ohne Gebet, ohne Segen gestorben.
Margaretha schüttelte den Kopf, als könnte sie dadurch die trüben Gedanken aus ihrem Kopf vertreiben. Sie musste sich konzentrieren. Den Handabdruck auf ihrer Wange konnte sie immer noch spüren, er brannte heiß. Die Sonne wanderte, während die Stunden vergingen, und immer mehr Wäsche fand ihren Platz auf der kettenartigen Leine, wehte nun im Wind und wurde von den Strahlen der warmen Sonne getrocknet.
Sie strich gerade das letzte Wäscheteil auf der Leine glatt, als von hinten die Müllerin angestampft kam. Margaretha hätte schwören können, eine regelrechte Erschütterung des Bodens zu spüren. Ursula Herman ging geradewegs auf den Korb zu, um einen Blick hineinzuwerfen. Sie öffnete schon den Mund, um sich über die restliche, nicht gemachte Wäsche zu beschweren, doch zu ihrem Erstaunen war nichts mehr im Korb aufzufinden. Margaretha schaute ihr triumphierend entgegen.
Die Müllerin stieß ein kurzes verwundertes Schnauben aus, dann richtete sie sich mit klimpernden Wimpern und einer aufgesetzten Freundlichkeit an Margaretha. »Bist fertig, wie ich sehe. Hast Glück gehabt. Die Magd Marie hat sich beim Kochen heut wie eine Idiotin angestellt, ’s hat ewig gedauert. Aber so konntest du mit der Wäsche fertig werden. Komm jetzt. Je schneller mit Essen fertig bist, desto schneller kannst wieder an die Arbeit. Die Wäsche springt nicht allein von der Leine.«
Während sie noch redete, hatte sie sich schon umgedreht und ging zurück zur Mühle. Margaretha beeilte sich, die beiden großen Wäschekörbe zu stapeln und sie der Müllerin hinterherzutragen, während sie an allein von der Leine springende Wäsche dachte.
Aus dem Haus waren schon die vielen Stimmen zu hören. Alle saßen bereits am hölzernen Esstisch, der aufgrund eines zu kurzen Beines ein wenig wackelte. Margaretha war die Letzte, die hinzukam.
Die Hermans beherbergten noch andere Waisenkinder als Mägde und Knechte, die Kost und einen Schlafplatz für ihre Arbeit erhielten. Margaretha war die Einzige, die an zwei Tagen in der Woche die Schule besuchen durfte. Michael musste die Arbeitskraft, die den Müllern in dieser Zeit wegfiel, durch Geld ersetzen.
Schweigend setzte sich Margaretha neben den Knecht Peter. Er war zwei Jahre älter als sie, sein Gesicht war gesprenkelt mit Sommersprossen. Peter war ein lieber und fleißiger Junge, aber auch ein riesengroßer Tollpatsch. Noch oft bekam auch er die harte Hand der Müllerin zu spüren.
»Marie, teil Essen aus, sind jetzt alle da«, befahl Ursula Herman. Marie war mit siebzehn Jahren die älteste Magd auf dem Hof. Sie musste sich aus diesem Grund auch um das meiste kümmern und war die rechte Hand der Müllerin. Margaretha war fasziniert von der Anmut der jungen Magd, die schon mit sechs Jahren auf dem Hof aufgenommen wurde, nachdem ihre Eltern bei einem Hausbrand ums Leben gekommen waren. Mit den Jahren sei die Erinnerung an sie verloren gegangen, sagte sie immer, deswegen trauere sie nicht so sehr. Schrecklich, dachte Margaretha bei sich, deren größte Angst es war, dass eines Tages die Gesichter ihrer Eltern in ihrem Gedächtnis verblassen würden.
»Ich teile das Essen sofort aus, ich schneid nur eben noch paar Scheiben Brot«, antwortete Marie mit sanfter Stimme. Die Müllerin nickte.
Als Marie sich nach vorn beugte, um das Brot zu schneiden, fiel ihr langer, schwarzer geflochtener Zopf über die Schultern nach vorn, und einzelne lose Strähnen rahmten ihr weißes Gesicht mit den vollen rosafarbenen Lippen. Margaretha bemerkte, dass Peter Marie genauso fasziniert anschaute wie sie selbst. Als er Margarethas beobachtenden Blick bemerkte, lachte er und kratzte sich verlegen am Hinterkopf. Margaretha schaute ihn vielsagend an, indem sie die Lippen zusammenpresste und die Augen weitete.
»Meine liebe Maike bekommt zuerst«, trompetete die Müllerin und strich ihrer Tochter über die rötlichen Haare. Maike war das einzige leibliche Kind der Hermans auf dem Hof und der Müllerin ganzer Stolz. Ihr Engel hatte im Gegensatz zu den anderen Kindern keinen Finger zu rühren.
Angewidert schaute Margaretha das Mädchen an, das noch nie auch nur ansatzweise mit Tischmanieren bekannt gemacht worden war. Kaum hatte Marie ihr den Teller hingestellt, fing sie schon an zu essen wie ein Schwein. Sie hob die Schüssel hoch und begann, sich das Essen in den Mund zu schaufeln, als habe sie eine ganze Woche nichts gegessen.
»Maike, das Tischgebet!«, grummelte der Müller von der anderen Seite des Tisches. Hans Herman war ein kleiner Mann mit dickem Bauch und rötlichem Vollbart. Im Grunde genommen sah er aus wie ein pummeliger Bär. Er war immer etwas in sich gekehrt, sagte nicht viel und kommentierte das meiste durch brummende Geräusche, dessen Tonlage man je nach Situation deuten musste.
»Ach, sei doch nicht so streng mit’m Kind, Hans. Wenn’s nun mal Hunger hat!«
Maikes Gesicht war immer noch tief in der Schüssel verschwunden, und die anderen Kinder schauten sie mit fragenden Gesichtern und hungrigen Bäuchen an. Der Müller zuckte nur mit den Schultern. Als Marie auch sich selbst eine Schüssel hingestellt hatte, setzte sie sich und nickte der Müllerin zu.
»Sprich dann das Tischgebet für uns, Marie. Also, faltet eure Hände!«, wies Ursula Herman die Kinder an, faltete selbst die Hände und senkte den Kopf. Die Waisenkinder taten es der Müllerin nach. Außer Margaretha. Sie konnte nicht genau festmachen, was es war, aber etwas in ihr schien ihre Unterarme fest auf ihrem Schoß zu fixieren. Es fühlte sich nicht richtig an, jetzt zu beten. Für was sollte sie danken? Man hatte ihr alles genommen. Um was sollte sie bitten? Es würde ja doch nicht erhört werden.
Peter blinzelte und bemerkte, dass Margaretha die Hände nicht gefaltet hatte. Er stieß sie unter dem Tisch mit dem Bein an. »Mach! Oder willst Ärger?«, zischte er ihr leise zu. Doch Margaretha regte sich nicht.
Maike bohrte in ihrer Nase und musterte Margaretha missbilligend. Sie stieß ihre Mutter an. »Die Margaretha will nicht beten!«, durchbrach sie harsch quäkend die Stille.
Die Müllerin hob den Kopf, die Stirn gerunzelt. »Na?«, sagte sie vorwurfsvoll mit einem drohenden Unterton. In den meisten Fällen reichte ein Wort dieser Art, und die Kinder taten, was Ursula Herman von ihnen erwartete. Doch Margaretha tat so, als hätte sie sie nicht gehört.
»Na, so was hab ich auch noch nicht erlebt.«
Maike gluckste vor Freude darüber, Margaretha erfolgreich verpetzt zu haben. Ihre Mutter machte Anstalten aufzustehen, und Margaretha schloss in Erwartung der Schläge schon ihre Augen. Doch da ließ sich die Müllerin wieder zurück auf ihren Stuhl plumpsen. Die Faulheit hatte gesiegt.
»Ich will jetzt essen. Marie, kümmer du dich drum. Verpass ihr die Strafe, die man für Gotteslästerung verdient. Peter, sprichst du eben das Tischgebet.«
Peter nickte langsam, und Marie erhob sich seufzend von ihrem Stuhl. Sie lief um den Tisch herum und nahm Margaretha an die Hand. »Na, komm schon«, forderte sie sie leise auf, »dann haben wir’s beide schnell hinter uns.«
Maries Hand war warm und ihre Haut rau vom Waschwasser. Margaretha konnte ihren Blick nicht von ihr lassen, als sie sie hinter sich in das Nebenzimmer zog und bedächtig die Tür schloss. Dass ausgerechnet sie ihr jetzt wehtun sollte. Marie hatte bei Margaretha so etwas wie eine Mutterrolle eingenommen, auch wenn nichts und niemand je ihre leibliche Mutter ersetzen konnte. Aber als sie auf den Hof kam, vor einem Jahr, da hatte Marie sie unter ihre Fittiche genommen, so gut sie das eben konnte, hatte das ein oder andere Missgeschick Margarethas auf sich genommen und die Strafe für sie erlitten.
Jetzt seufzte Marie und ließ die Schultern hängen, das Gesicht noch zur Tür gerichtet. Dann drehte sie sich um und schaute Margaretha tief in die Augen. »Du machst es uns damit allen nicht einfach, Margaretha. Mir auch nicht. Du bringst mich in eine sehr unangenehme Situation. Das wird mir mehr wehtun als dir, glaub mir.«
Margaretha schaute Marie mit großen Augen an, sie hing an ihren Lippen. Sie hörte ihre Worte, aber sie verstand sie nicht. Was hatte sie vor? Sie wollte sie doch nicht wirklich schlagen? Sie war doch anders als die Müllerin!
Marie konnte Margaretha nicht in die Augen blicken. Sie schaute aus dem Fenster, als sie langsam und zitternd ihre rechte Hand erhob. Margaretha machte sich klein und schloss fest die Augen. Ein heftiger Schlag ertönte. Margaretha öffnete den Mund, um zu schreien, dann hielt sie inne. Es hatte nicht wehgetan. Als sie die Augen öffnete, sah sie, dass Marie ihre eigenen Hände zusammengeschlagen hatte. Sie verstand sofort und stieß einen schmerzverzerrten Schrei aus.
»Lass dir das eine Lehre sein!«, rief Marie mit wackliger Stimme und klatschte erneut mit aller Kraft in beide Hände. Wieder ein Schrei.
Schmunzelnd und zufrieden riss die Müllerin im Nebenzimmer mit den Zähnen ein großes Stück von ihrer Brotscheibe ab.
»Musste das sein?«, brummelte der Müller.
»Ach«, ächzte sie, »ist doch noch gar nichts. Das Schlimmste wird s’ noch in der Hölle erwarten. Da kommen Gotteslästerer wie die nämlich hin!« Sie brach in schallendes Gelächter aus, offensichtlich in dem Glauben, einen guten Witz gerissen zu haben. Maike stimmte gackernd ein.
Hans Herman schüttelte nur den Kopf. Er wusste, dass er gegen seine Frau keine Chance hatte, sich durchzusetzen.
Peter hatte sein Essen nicht angerührt. Ihm war der Appetit vergangen. Sein Blick war auf die Tür geheftet, hinter der in regelmäßigen Abständen immer erst ein Schlag und dann ein schriller Schrei ertönten. Bei jedem Schlag zuckte ihm das rechte Augenlid. Er war bitter enttäuscht von Marie. So etwas hatte er ihr nicht zugetraut. Irgendwann, schwor er sich, irgendwann würde er in einer nebligen Nacht wegrennen, so weit ihn die Füße trugen. So weit, dass die Müllerin ihn nicht mehr finden würde. Margaretha würde er mitnehmen. Schlimmer als hier konnte es ja nicht werden.
»Iss jetzt!«, fauchte die Müllerin. »Oder brauchst auch eine Extraeinladung?«, fragte sie und deutete mit dem Kopf auf die Tür.
»Nein, nein«, murmelte Peter und fing an, hektisch in seiner Suppe herumzurühren, als wäre er nach etwas auf der Suche.
Während des ganzen Essens sprach keiner mehr ein Wort. Zwischendurch war nur Maikes leises Kichern zu vernehmen. Keines der Waisenkinder traute sich aufzuschauen. Alle starrten nur peinlich berührt auf das Gemüse, das vor ihnen in der Schüssel schwamm. Sie waren schwer mit sich selbst beschäftigt, doch in Gedanken bei Margaretha.
8. MAI 1627
Als die ersten Sonnenstrahlen die Oberfläche der Tauber zum Glitzern brachten und die Vögel wild umherfliegend den Frühlingsmorgen mit ihrem Gezwitscher lautstark begrüßten, stapfte Margaretha bereits an dem Flüsschen entlang Richtung Rothenburg ob der Tauber. Heute musste sie den halben Tag nicht arbeiten, heute ging sie zur Schule. »Bildung«, sagte Michael immer, »Bildung ist der Schlüssel zu allem. Wenn du Lesen und Schreiben lernst, Rechnen und Religionslehre, dann kannst du dir die ganze Welt erschließen!«
Margaretha hatte bis heute nicht verstanden, was er damit meinte. Es gab so vieles, was sie sich nicht erschließen konnte. Wieso können Adler fliegen, obwohl sie so groß und schwer sind? Wieso landet der Hofkater immer auf seinen Pfoten? Wieso gehen die zartesten Blumen bei stärkstem Sturm nicht kaputt? Wo waren Mutter und Vater jetzt? Und würde sie sie jemals wiedersehen? Margaretha schluckte. Da war er wieder, der Kloß im Hals. Sie durfte nicht so viel nachdenken.
Aber es war einfach unmöglich, sich abzulenken. Alles weckte Erinnerungen und katapultierte sie zurück in die Zeit vor der Pest. Und jedes Mal wurde ihr aufs Neue bewusst, dass sie allein gelassen war. Allein gelassen von ihren Eltern, von Michael und … von Gott? Sie war sich nicht sicher. War er je bei ihr gewesen? Margaretha machte einen großen Schritt über einen Stock, auf dem ein roter Marienkäfer saß. Sein roter Panzer mit den schwarzen Punkten glänzte glatt in der Sonne, als hätte er ihn soeben poliert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Punkte zählte Margaretha. Sie musste ein bisschen schmunzeln. Maike konnte bestimmt nicht mal bis sieben zählen. Die lag jetzt noch in ihrem Bett und schnarchte, dass die Wände bebten.
Margaretha legte ihren Finger vor dem Marienkäfer auf den Stock. Zunächst versuchte er ihm noch auszuweichen, aber als Margaretha ihm den Weg mit dem anderen Zeigefinger versperrte, krabbelte er endlich auf ihre Hand. Er war so leicht, dass man ihn kaum spüren konnte. Margaretha stand auf und setzte mit dem Käfer in der Hand ihren Weg fort.
Sie hob die Hand vor ihr Gesicht, um den Käfer anblicken zu können. »Hast du eine Familie?«, fragte sie ihn und machte eine Pause, als würde sie auf eine Antwort warten. Doch der Käfer krabbelte nur verwirrt von links nach rechts, verwundert über die neue Umgebung. Margaretha ließ die Hand sinken, behielt den Marienkäfer aber im Blick. Als er zurück auf die Spitze ihres Zeigefingers gekrabbelt war, streckte sie ihre Hand nach oben aus, wo der Wind den Käfer umwehte. Da klappte er seine durchsichtigen Flügelchen aus und brummte davon. Er flog so hoch, dass er erst nur noch als Punkt und dann gar nicht mehr zu sehen war.
Margaretha betrachtete die Wolken. Sie waren weiß, dick und bauschig. So stellte sie sich die Betten der Fürsten vor. Wolken müssen unheimlich weich sein, dachte sie bei sich. Aber sie wusste es nicht genau. Wieder eine Sache, die sie sich nicht erschließen konnte. Vielleicht würde sie ihren Lehrer danach fragen. Hinter einer dieser Wolken musste Gott sitzen. Er versteckte sich dort vermutlich.
Von Weitem konnte Margaretha die Mauern Rothenburgs erkennen. Die großen Steine und Tore erhoben sich aus dem Boden und wirkten ganz unwirklich in der sonst so unberührten Landschaft. Es schien, als könne nichts und niemand die Mauern erklimmen oder durchbrechen, so fest, beständig und unverrückbar standen sie dort. Immer mehr Leute kamen Margaretha nun entgegen, von links oder von rechts, mit Körben in den Händen, mit Hühnern auf dem Arm. Reiter überholten sie auf ihrem Weg in die Stadt, Kutschen ratterten laut über das Steinpflaster. Es war immer ein wildes Treiben in Rothenburg, nicht zu vergleichen mit Gebsattel, wo es vergleichsweise ruhig war.
Ein junger Knecht rannte einer Ziege hinterher. »Bleib doch stehen, Greta!« Schon war er hinter der nächsten Ecke verschwunden. Plötzlich ertönten die lauten Kirchenglocken, es schlug zur vollen Stunde. Margaretha erschrak. Die Schule begann schon! Der Lehrer mochte es gar nicht gern, wenn man zu spät kam.





























