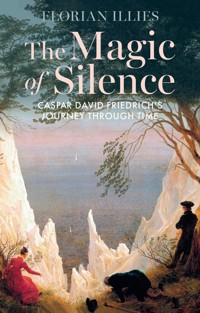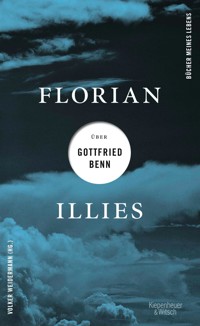
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bücher meines Lebens
- Sprache: Deutsch
Bei Gottfried Benn kann es nie um reine Liebe gehen. Wer sich seit über zwei Jahrzehnten so intensiv mit Benn beschäftigt wie Florian Illies, der erlebt zahlreiche Enttäuschungen angesichts der politischen Verirrungen und der menschlichen Kälte des Autors – und doch wird er immer wieder gefangen genommen vom einzigartigen Klang der Benn'schen Verse. Von dieser so leidenschaftlichen wie wechselhaften Beziehungsgeschichte erzählt Florian Illies in diesem Buch. Davon, wie ihn einst Frank Schirrmacher mit dem Untergangspropheten vertraut machte, wie er Benns zwei letzten Geliebte besuchte, denen der sonderbare Dichter ein einziges Rätsel blieb. So sind es dann eben doch am Ende allein die Worte Benns, die einen berühren können, ihre Weisheit und ihr Klang. »Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehn« etwa, oder »Es ist ein Knabe, dem ich manchmal trauere«. Illies durchwandert die Untiefen des Lebensweges von Benn, beleuchtet seine Freundschaften, seine Irrwege - und seine späte Wehmut. Illies zweifelt, wo Benn sich sicher ist, und schwärmt, wo Benn unsicher wird. Es ist also vor allem ein Versuch, die Bennschen Verse vor ihrem Schöpfer in Sicherheit zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Florian Illies
Florian Illies über Gottfried Benn
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Florian Illies
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Florian Illies
Florian Illies, Jahrgang 1971, veröffentlichte nach Jahren im Feuilleton der FAZ und der ZEIT bei S. Fischer die Beststeller »1913« und »Liebe in Zeiten des Hasses«. Er lebt als Schriftsteller und Mitherausgeber der ZEIT in Berlin.
Volker Weidermann leitete das Feuilleton der FAS und war Gastgeber des Literarischen Quartetts. Er schrieb die Bestseller »Ostende – Sommer der Freundschaft« und »Träumer – Als die Dichter die Macht übernahmen«. Er ist Feuilletonchef der ZEIT.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Bei Gottfried Benn kann es nie um reine Liebe gehen. Wer sich seit über zwei Jahrzehnten so intensiv mit Benn beschäftigt wie Florian Illies, der erlebt zahlreiche Enttäuschungen angesichts der politischen Verirrungen und der menschlichen Kälte des Autors – und doch wird er immer wieder gefangen genommen vom einzigartigen Klang der Benn’schen Verse.
Von dieser so leidenschaftlichen wie wechselhaften Beziehungsgeschichte erzählt Florian Illies in diesem Buch. Davon, wie ihn einst Frank Schirrmacher mit dem Untergangspropheten vertraut machte, wie er Benns zwei letzte Geliebte besuchte, denen der sonderbare Dichter ein einziges Rätsel blieb.
So sind es dann eben doch am Ende allein die Worte Benns, die einen berühren können, ihre Weisheit und ihr Klang. »Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehn« etwa, oder »Es ist ein Knabe, dem ich manchmal trauere«. Illies durchwandert die Untiefen von Benns Lebensweg, beleuchtet seine Freundschaften, seine Irrwege – und seine späte Wehmut.
Illies zweifelt, wo Benn sich sicher ist, und schwärmt, wo Benn unsicher wird. Es ist also vor allem ein Versuch, die Benn’schen Verse vor ihrem Schöpfer in Sicherheit zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Je länger ich Gottfried Benn liebe ...
Gottfried Benn lässt sich nicht berühren
Gottfried Benn freundet sich an
Gottfried Benn leuchtet
Gottfried Benn »irrt« sich
Gottfried Benn zählt
Gottfried Benn lebt doppelt
Gottfried Benn erinnert sich
Gottfried Benn glaubt
Lebensdaten
Vorwort
Als ich damit begann, mir über eine Bibliothek der »Bücher des Lebens« Gedanken zu machen, war Florian Illies der Erste, an den ich dachte, der Erste, von dem ich mir ein solches Lebensbuch idealerweise wünschte. Ich glaube vor allem aus zwei Gründen: erstens, weil ich ihn schon so lange kenne, ohne ihn zu kennen. Das heißt, ich kenne seine Bücher, seine Texte fast von Anfang an, fast seitdem er schreibt. Und ihn selbst habe ich Ende der neunziger Jahre im Feuilleton der FAZ kennengelernt, wo ich für kurze Zeit Praktikant im Literaturteil war. Seitdem ist er mir fern und vertraut zugleich. Mal haben wir zusammengearbeitet, mal fern voneinander. Sein gleichzeitiges emphatisches Gegenwartsbewusstsein, verbunden mit dieser Begeisterung für die Traditionen, auf denen wir stehen, seiner Begeisterung für die alten Meister der Malerei und der Literatur, das hat mich stets eine Verwandtschaft fühlen lassen. Zugleich jedoch gruben wir immer an anderen Enden der Tradition. Ich weiß noch, wie er mich früh darum bat, ihm einmal mein Lebensbuch auszuleihen. Ich gab ihm meine völlig zerlesene, von Anmerkungen und Klebestreifchen durchmarkierte Ausgabe der Briefe Joseph Roths. Ein paar Wochen später gab er sie mir etwas ratlos und betreten zurück. Weil er ahnte, dass ich hoffte, in ihm nun einen Mit-Begeisterten gefunden zu haben. Aber mein Lebensbuch war ihm verschlossen geblieben. Da reichten nicht ein paar Anstreichungen und bunte Markierungen, um das Feuer der Begeisterung weiterzugeben.
Gleichzeitig blieb mir seine Liebe zu den Gedichten Gottfried Benns immer fremd. So gern und enthusiastisch ich all seine Artikel über Benn und dessen Geliebte, über Benns Verse las, so prallte ich jedes Mal wieder an den Gedichten selbst ab. Wie hinter einer Glaswand blieben sie für mich verschlossen. Gleichzeitig erzählte mir Florian Illies schon früh von seinem Traum-Projekt einer Biographie, die er über den Verehrten schreiben wolle. »Big Benn« sollte die heißen. Immer wieder fragte ich ihn in den Jahren darauf, wann er sie endlich schreiben würde. Denn wer, wenn nicht er, würde mir das Geheimnis Benn enträtseln können. Wer, wenn nicht Florian Illies, der auf so unvergleichliche Weise in seinen Büchern die Kunst, die Vergangenheit lebendig zu machen, perfektioniert hat. Der die alten Bücher belebt, die toten Künstlerinnen und Künstler zu unseren Zeitgenossen macht. Zeitgenossen, die uns verstören, aufklären, begeistern. Die wir besser verstehen, wenn wir sie mit seinen Augen gesehen, ihre Bücher mit seinen Augen gelesen haben. Jetzt ist er da – sein Benn. Es ist eine große Liebeserklärung an Benns Gedichte geworden. Und eine mitunter verstörte und verstörende Beschreibung des Menschen Gottfried Benn. Es ist geworden, was ich so lange zu lesen hoffte: die Geschichte seiner Gedichte, seines Lebens, seiner Irrtümer. Die Geschichte von Big Benn.
Volker Weidermann
Je länger ich Gottfried Benn liebe, desto weniger verstehe ich meine Liebe. Doch mit jedem neuen Nichtverstehen liebe ich ihn noch ein kleines bisschen mehr.
Dieses Buch könnte so beginnen: Als Gottfried Benn geboren wurde, Sohn eines knorrigen Landpfarrers, im Mai 1886, da erblühte gerade der Flieder auf dem kargen preußischen Land, jenseits der Oder, »wo die Ebenen weit«. Als er starb, im Sommer 1956, im noch immer vom Krieg zerfurchten Berlin, da war der Flieder längst verblüht. In diesen sieben Jahrzehnten: ein Medizinstudium, zwei Weltkriege, drei Ehen, vier deutsche Staaten. Ein Leben bevorzugt in der zweiten Reihe, unscheinbar, blasses Grün, harmloser Wuchs, ein Leben wie das des Flieders in den einundfünfzig langen Wochen des Jahres. Aber dann immer wieder doch urplötzlich: »rauschbereit«, diese mitreißende Eigenschaftserfindung, die Benn dem Flieder zuschrieb, wenn sich dessen Knospen für eine leuchtende Maiwoche in einem hellvioletten Blütenzauber entladen. Und »rauschbereit«, das war eben auch er, Gottfried Benn, dieser große Kokainist, Koffeinist und Schwerenöter, immer auf der Suche nach dem einen besonderen, berauschenden Wort, nach dem Vers, der schon beim Anblick der Knospe von deren Verblühen erzählen kann. Ist das nicht schrecklich? Nein. Bei Benn ist das auf eine verstörende Weise tröstlich.
Gottfried Benn lässt sich nicht berühren
Eigentlich muss ich ganz anders beginnen: Denn ich selbst war sehr lange nicht rauschbereit. Erst im Frühling des Jahres 1999, als das Jahrhundert schon dämmerte, da stieß ich auf diesen Dichter. Nein, ich wurde auf ihn gestoßen – und zwar von Frank Schirrmacher, mit dem ich in den Jahren um die Jahrhundertwende immer wieder durch die Straßen in Berlin lief und der dann oft seine große Kinderhand in die vielen Schusslöcher legte, die an den grauen, kargen Gebäuden rund um die Friedrichstraße bis heute von den Schlachten des Zweiten Weltkrieges erzählen. Dann wurde er kurz ganz still, ließ die Hand in dem ausgebrochenen Loch des alten Maschinengewehrschusses im steinernen Sockel liegen und begann Benn zu zitieren. Jedes Mal. Manchmal zitierte er: »Jeder sieht hier etwas enden, keiner sieht, was hier beginnt«. Manchmal: »Dennoch die Schwerter halten«.[1] Und dann sprach er von dem Vergangenen, dem Heutigen, dem Fließen der Zeit, der Gegenwart als erinnerter Katastrophe, der Sinnlosigkeit. Und Benn’sche Verse und Schirrmachers apokalyptische Visionen verschmolzen ineinander. Den Text, den Schirrmacher über Benn in seinem Buch »Die Stunde der Welt« geschrieben hat, ist für mich das Klarste und Kühnste, was ich je von ihm gelesen habe. Es ist natürlich auch ein Selbstportrait (und ich ahne, dass jeder Text über Benn, also auch dieser, mehr vom Erzählenden preisgibt, als er denkt).
Frank Schirrmacher war zeitlebens besessen von einer Stelle in Stefan Zweigs »Die Welt von Gestern«. Dort erzählt Zweig, dass er einer Frau die Hand gegeben habe, einem ehemaligen Dienstmädchen aus Weimar, das selbst noch Goethes Hand berührt hatte. Und da er, Schirrmacher, nun wiederum jemanden begrüßt hatte, der noch Stefan Zweig die Hand gegeben hatte, war er nur drei Menschen von Goethe entfernt. Als könne man die Jahrhunderte überspannen und sich verbinden mit den großen Toten, weil das olympische Feuer des Geistes über ganz wenige Stationen von Hand zu Hand weitergereicht wird. Mich berauschte dieser Gedanke nicht. So glaubte ich zumindest. Aber: »Wir denken etwas anderes, als wir sind«, wie Benn einmal so schön schrieb.[1] Und so merkte ich doch, wie es mich in den Fingern juckte, als ich im Jahr 2000 hörte, dass in Berlin in einer Erdgeschosswohnung in der Innsbrucker Straße noch Ursula Ziebarth lebte, Benns ehemalige Geliebte, die selbst einen legendären Ruf erlangte, als sie nach Benns Tod im warmen Juli des Jahres 1956 in das frisch ausgehobene Grab am Waldfriedhof in Dahlem sprang, um dort einen Totentanz aufzuführen. Was geschieht, so fragte ich mich, wenn ich einer Frau die Hand gebe, die Benns Geliebte war? Würde ich dann mehr verstehen von diesem rätselhaften Dichter, ja, würde ich auch etwas spüren von ihm selbst, durch den Handschlag, über das Jahrhundert hinweg?
Jedes Foto, das ich von Benn kenne, zeigt, wie stocksteif und unnahbar und schweigend er durchs Leben lief, ein »Noli me tangere« auf zwei Beinen, er trug, wenn nicht von Geburt an, so spätestens seit seinen Jahren in den Kellern der Pathologie der Westberliner Krankenhäuser eine imaginäre Halskrause, die ihn unbeweglich machte, weil er zu erschüttert war von dem Schleudertrauma, das Leben heißt. Konnte ich ihm also vielleicht näherkommen, wenn ich eine Frau traf, der er sich geöffnet hatte? Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich die sehr kurze, sehr alte Berliner Festnetznummer wählte und Ursula Ziebarth tatsächlich »abnahm«, wie man das damals sagte, als man noch Hörer von der Gabel nahm, es war eine tiefe, tiefe Stimme, die sich langsam aus der Versunkenheit des 20. Jahrhunderts nach oben in die Gegenwart arbeitete. »Ja«, so sagte sie bald, »kommen Sie, lassen Sie uns über Benn reden, ich denke ohnehin an nichts anderes seit siebenundvierzig Jahren.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: