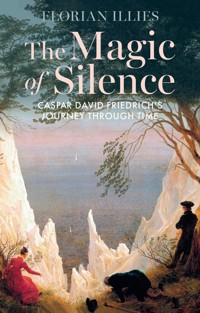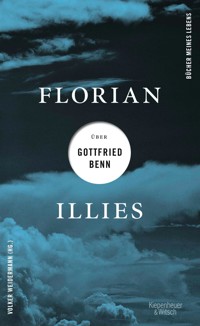12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Absolut mitreißend: Auf jeder Seite gibt es etwas Neues zu entdecken.« Daily Telegraph In einem virtuosen Epochengemälde erweckt Florian Illies die dreißiger Jahre, dieses Jahrzehnt berstender politischer und kultureller Spannungen, zum Leben. Als Jean-Paul Sartre mit Simone de Beauvoir im Kranzler-Eck in Berlin Käsekuchen isst, Henry Miller und Anaïs Nin wilde Nächte in Paris und Stille Tage in Clichy erleben, F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway sich in New York in leidenschaftliche Affären stürzen, fliehen Bertolt Brecht und Helene Weigel wie Katia und Thomas Mann ins Exil. Genau das ist die Zeit, in der die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland ergreifen, Bücher verbrennen und die Gewalt gegen Juden beginnt. 1933 enden die »Goldenen Zwanziger« mit einer Vollbremsung. Florian Illies führt uns zurück in die Epoche einer singulären politischen Katastrophe, um von den größten Liebespaaren der Kulturgeschichte zu erzählen: In Berlin, Paris, im Tessin und an der Riviera stemmen sich die großen Helden der Zeit gegen den drohenden Untergang. Eine mitreißend erzählte Reise in die Vergangenheit, die sich wie ein Kommentar zu unserer verunsicherten Gegenwart liest: Liebe in Zeiten des Hasses. »Eine Gesellschaftsgeschichte in Zweier- und Dreierbeziehungen. Indiskret, schonungslos und aufregend. Desillusionierend und anrührend zugleich. Ein Bravourstück.« Harald Jähner
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Florian Illies
Liebe in Zeiten des Hasses
Chronik eines Gefühls 1929–1939
Über dieses Buch
Als Jean-Paul Sartre mit Simone de Beauvoir im Kranzler-Eck in Berlin Käsekuchen isst, Henry Miller und Anaïs Nin wilde Nächte in Paris erleben, F. Scott Fitzgerald und Frida Kahlo sich in Europa in leidenschaftliche Affären stürzen, fliehen Bertolt Brecht und Helene Weigel und Thomas und Katia Mann ins Exil. Genau das ist die Zeit, in der die Nazis die Macht in Deutschland ergreifen, Bücher verbrennen und die Gewalt gegen die Juden beginnt.
1933 enden die »Goldenen Zwanziger« mit einer Vollbremsung.
In einem virtuosen Epochengemälde führt Florian Illies uns zurück in ein Jahrzehnt berstender politischer und kultureller Spannungen. Eine mitreißend erzählte Reise in die Vergangenheit, die sich wie ein Kommentar zu unserer verunsicherten Gegenwart liest: Liebe in den Zeiten des Hasses.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Mit Eleganz und Leichtigkeit verwandelt Florian Illies vergangene Epochen in lebendige Gegenwart. Er zieht überraschende Querverbindungen zwischen den Protagonisten und verknüpft Szenen und Momentaufnahmen zu mitreißenden Panoramen. Sein Welterfolg »1913. Der Sommer des Jahrhunderts«, mit dem Illies ein neues Genre begründete, führte monatelang die SPIEGEL-Bestsellerliste an. Illies, geboren 1971, studierte Kunstgeschichte in Bonn und Oxford. Er war Feuilletonchef der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« und der »ZEIT«, Verleger des Rowohlt Verlages, leitete das Auktionshaus Grisebach und gründete die Kunstzeitschrift »Monopol«. Heute ist Florian Illies Mitherausgeber der »ZEIT« und freier Schriftsteller. Er lebt in Berlin.
Inhalt
Davor
Davor, Fortsetzung
1933. Kapitel
Danach
Bibliographie
Allgemeine Literatur zum Zeitraum 1929–1939
Literaturauswahl zu den Hauptfiguren des Buches
Dank
Personenregister
Davor
Als der junge Jean-Paul Sartre im Frühling 1929 in der École Normale in Paris erstmals Simone de Beauvoir in die Augen blickt, da verliert er das einzige Mal in seinem Leben den Verstand. Nachdem er es ein paar Wochen später, Anfang Juni, endlich geschafft hat, sich mit ihr allein zu verabreden, erscheint sie einfach nicht. Sartre sitzt in einer Teestube in der Rue de Médicis und wartet vergeblich. Es ist wonnig warm in Paris an diesem Tag, weiße Wolken balgen sich oben am tiefblauen Himmel, er hat extra keine Krawatte umgebunden, denn er will mit ihr nach dem Tee in den nahen Jardin du Luxembourg gehen und kleine Boote fahren lassen, er hat gelesen, dass man das so macht. Als er seinen Tee schon halb ausgetrunken, fünfzehnmal auf die Uhr geguckt und seine Pfeife langwierig gestopft und angezündet hat, kommt eine junge blonde Frau auf ihn zugestürmt. Sie sei die Schwester von Simone, sagt sie, Hélène de Beauvoir, ihre Schwester könne heute leider nicht kommen, sie bedaure. Da fragt Sartre: Aber wie haben Sie mich so schnell gefunden, inmitten all dieser Menschen hier? »Simone«, erklärt sie, »hat mir gesagt, Sie seien klein, trügen Brille und seien sehr hässlich.« So beginnt also eine der seltsamsten Liebesgeschichten des zwanzigsten Jahrhunderts.
Am späten Nachmittag, wenn die Sonne in Berlin doch noch einmal hervorlugt unter der Wolkendecke und ihre Strahlen flach hineinschießt in die Auguststraße, dann blinzelt Mascha Kaléko und bleibt kurz stehen, genießt die Wärme auf ihrer Haut.
Um Punkt sechzehn Uhr hat sie immer Feierabend, sie rennt die Treppe runter vom Büro des »Arbeiterfürsorgeamtes der Jüdischen Organisationen«, wo sie seit fünf Jahren arbeitet, und stößt die Tür auf. Mascha Kaléko, geborene Engel, steht einfach nur da. Lässt sich erwärmen, lässt die Gedanken kreisen, hört von fern das Quietschen der Trambahnen, die Fuhrwerke der Bierkutscher auf den Straßen, die Schreie der rennenden Kinder in den Hinterhöfen hier in dem jüdischen Viertel rund um den Alexanderplatz und die der Zeitungsjungen, die lauthals die Abendausgaben anpreisen. Doch dann schließt sie auch ihre Ohren und genießt nur die weiche Wärme des Lichts. Die Sonne versinkt hinter den hohen Gebäuden rund um die Friedrichstraße, ein paar letzte Strahlen fangen sich auf der goldenen Kuppel der Synagoge in der Oranienburgerstraße, schließlich kommt die Dämmerung. Die 22-jährige Mascha Kaléko zieht es aber noch nicht nach Hause, sondern in die Cafés des Westens, ins Romanische Café zumeist, dort sitzt sie und debattiert, mit ihrer hellen Stimme, die so wunderbar berlinern kann. Kurt Tucholsky, Joseph Roth, Ruth Landshoff, sie alle rücken ihre Stühle näher heran, wenn Mascha Kaléko kommt, sie lieben ihren braunen Wuschelkopf, ihr wissendes Lachen, ihren menschenfreundlichen Witz, der ihre braunen Augen leuchten lässt. Oft kommt später auch ihr Mann dazu ins Romanische Café, der stille Saul, Gelehrter durch und durch, Nickelbrille, schütteres Haar, ein spindeldürrer promovierter Journalist der Jüdischen Rundschau, Dozent für Hebräisch – und schwer verliebt. Er sieht die Blicke der anderen Männer auf seine ungestüme junge Frau, er sieht auch, wie seine wilde Mascha diese Blicke genießt, und dann wird der stille Saul von Minute zu Minute noch ein bisschen stiller, und er bestellt sich einen Tee, während die anderen mit der ersten Flasche Wein beginnen. Irgendwann entschuldigt er sich höflich, setzt seinen Hut auf, nimmt seine Aktentasche, empfiehlt sich und geht nach Hause. Als Mascha irgendwann spätabends ankommt in ihrer gemeinsamen Wohnung am Hohenzollernkorso in Tempelhof, schläft er schon. Sie schaut ihn an, seine feierlichen Züge, die sich im Rhythmus des Atmens sanft heben und senken. Sie geht an den Küchentisch, nimmt sich Papier und Bleistift – und dann schreibt Mascha Kaléko ihm ein kleines Liebesgedicht, das zu den berührendsten gehört, die je geschrieben wurden: »Die anderen sind das weite Meer. Du aber bist der Hafen. So glaube mir: kannst ruhig schlafen, ich steure immer wieder her.« Sie schreibt noch dazu: »Für einen«, legt es ihm auf den Frühstücksteller und kuschelt sich zu ihm ins Bett. Sie wird morgen früh wieder um sechs Uhr lossegeln, um rechtzeitig im Büro zu sein am anderen Ende der großen Stadt. Als Saul sie hinter sich spürt, im sicheren Heimathafen, da wacht er kurz auf, seine Hand greift nach hinten und er streichelt Mascha, erleichtert.
Niemand hofft 1929 noch auf die Zukunft. Und niemand will an die Vergangenheit erinnert werden. Darum sind alle so hemmungslos der Gegenwart verfallen.
»Wer würde schon riskieren, einen Mann aus Liebe zu heiraten? Ich nicht.« Sagt Marlene Dietrich voller Überzeugung in jenem Frühjahr 1929 – und zwar auf der Bühne der Komödie am Kurfürstendamm in George Bernard Shaws Stück Eltern und Kinder. Sie zieht dazu genüsslich an ihrer Zigarette, lässt die Augenlider etwas hängen und zeigt, was das ist: träge Eleganz.
Danach fährt sie nach Hause zu dem Mann, den sie nicht aus Liebe geheiratet hat, zu Rudolf Sieber. Mit ihm führt sie täglich das Stück Eltern und Kinder zu Hause auf. Sie nennt ihn »Papi«, er sie »Mutti«. Ihre Tochter Maria ist fünf. Das Kindermädchen Tamara schläft inzwischen im Ehebett neben Rudolf Sieber – und das erleichtert Marlene Dietrich sehr. Endlich kein schlechtes Gewissen mehr, wenn sie Nacht für Nacht um die Häuser zieht, durch die Bars und durch unbekanntes weibliches und männliches Gelände. Nach ihren Auftritten auf der Bühne oder nach den Dreharbeiten bei der UFA in Babelsberg kommt sie oft erst spätabends nach Hause, macht eine kurze Hafenrundfahrt, richtet im Entrée die Blumen in der Vase, küsst der schlafenden Maria die Stirn, zieht sich um, trinkt ein Glas Wasser, legt noch einen frischen Hauch Parfüm auf – und dann verlässt sie das Haus auf hohen Schuhen mit dem ersten warmen Wind der Nacht.
Klaus Mann treibt haltlos durch die zwanziger Jahre. Er ist, obwohl erst 23 Jahre alt, also ganz am Anfang, oft schon ganz am Ende. Er will geliebt werden. Doch sein Vater, der emotional hüftsteife Thomas Mann, der ihm nicht verzeihen kann, dass er seine Homosexualität so munter auslebt, während er selbst sie zeitlebens so kunstvoll unterdrücken muss, lässt seinen Sohn am ausgestreckten Arm verhungern. Einmal, 1920, da schrieb er noch, er sei »verliebt« in Klaus. Doch das lässt er diesen fortan nicht mehr merken, verordnet ihm stattdessen ein Leben im Schatten. In Unordnung und frühes Leid hat Thomas Mann seinen Sohn porträtiert, als »Söhnchen und Windbeutel«. Furchtbar. Manchmal ist das Leben eine reine Entziehungskur. Klaus schreibt danach einen Brief an den Vater, klagt über seine »Verwundung« angesichts des Spotts, aber ihm fehlt der Mut, den Brief abzusenden. Sein Vatermord geschieht nur literarisch: In seiner Kindernovelle schildert er unverkennbar das Leben der Familie Mann in Bad Tölz – all seine Geschwister kommen vor – nur der Vater, der ist in seinem Buch leider bereits frühzeitig verschieden. Aber literarischer Mord ist natürlich auch keine Lösung für vorenthaltene Liebe. In seiner Autobiographie schreibt Klaus über Thomas Mann: »Mir war natürlich am Beifall keines Menschen wie an seinem gelegen.« Doch Thomas Mann klatscht nicht, er räuspert sich nur.
Pablo Picasso malt seine junge Geliebte Marie-Thérèse Walter einmal liegend, einmal stehend und einmal sitzend. Und danach das Ganze noch mal von vorn. Er hat ihr extra in der Rue de Liège 11 eine kleine Wohnung gemietet, wo er sie heimlich malen und heimlich lieben kann. Er küsst sie und eilt dann heim zu Frau und Kind. Noch merkt niemand etwas. Erst seine Bilder werden ihn später verraten. Der Pinsel ist der einzig verbliebene Zauberstab einer entzauberten Zeit.
Die zwanziger Jahre waren ein schreckliches Jahrzehnt für ihn. Alles war zu laut in Berlin, zu schnell, zu vergnügungssüchtig für diesen Liebhaber des Halbschattens. Er ist in die lieblosen Räume seiner Praxis in der Belle-Alliance-Straße 12 gezogen, erster Stock rechts, sein »Altersheim«, wie er es nennt. Da ist Gottfried Benn gerade einmal 43 Jahre alt. Hier kümmert er sich von acht bis achtzehn Uhr um Haut- und Geschlechtskrankheiten, aber kaum eine Patientin verirrt sich noch zu ihm, »selten unterbricht die Klingel«, so schreibt er einer Geliebten, »meine sehr erwünschte Dämmerung«.
Abends trinkt er ein Bier und isst ein Kasseler im Reichskanzler um die Ecke und versucht manchmal, ein Gedicht zu schreiben. Aber so richtig gelingt es ihm nicht mehr, die Strophen haben zwar immer acht Zeilen, aber die Worte bleiben unerlöst, und kein Verlag will sie mehr drucken. Er stellt sich nachts ans Schlafzimmerfenster, löscht das Licht und hofft auf die Rückkehr der Inspiration. Er lauscht den schnulzigen Melodien aus dem Musikcafé, das hinten im Hof Stühle hat, er hört Paare von unten zu laut und zu grundlos lachen, weil sie unbedingt wollen, dass dieser Abend nicht so trist endet wie der letzte. Benn versucht, Kaffee bis zum Koffeinrausch zu trinken, schläft zwei, drei Tage nicht, nimmt Kokain, alles nur, um wieder die Urkräfte der Poesie in sich zu wecken. Doch sie bleiben versteckt. Seine Frau ist gestorben, seine Tochter hat er zu einer kinderlosen Liebschaft nach Dänemark verfrachtet, seine riesige Wohnung in der Passauer Straße musste er aufgeben, sein Bruder wurde wegen Beteiligung an einem Fememord zum Tode verurteilt. Das waren seine »Goldenen« Zwanziger. Affären hatte er immer wieder, meist mit Schauspielerinnen oder Sängerinnen, gerne Witwen, aber seine stocksteife Haltung, seine Veilchensträuße, seine militärische Vornehmheit und seine fistelige Stimme waren nicht gerade das, was die modernen Frauen im Romanischen Café oder in den Bars in Schöneberg oder am Kurfürstendamm in Ohnmacht fallen ließ. Er machte Verbeugungen beim Hineingehen und beim Hinausgehen, er konnte nicht anders. Es waren immer eher Stürzende, Suchende, die sich von dem Dichter im Arztkittel und seiner unerschütterlichen Melancholie ein klein wenig Trost erhofften – in Form von körperlichen und chemischen Betäubungsmitteln – und eigentlich also nur Verständnis suchten für die schilfumstandenen Tümpel der eigenen Verlorenheit. Ja, er hat vor dem Krieg für Furore gesorgt mit seinen expressionistischen Gedichten aus der Pathologie und aus der »Krebsbaracke«, aber das ist fünfzehn Jahre her. Jetzt redet jeder auf der Straße so beiläufig über den Tod und den Sex wie er 1913. Im Jahre 1929 also ist Dr. med. Gottfried Benn nur noch ein Mann mit Vergangenheit und hängenden Augenlidern, ein »Vorgänger«.
Als am 1. Februar in seiner Praxis das Telefon klingelt, ist Lili Breda am Apparat, seine aktuelle Geliebte, eine arbeitslose Schauspielerin, eine Stürzende auch sie, 41 Jahre alt, sterbensmüde von all ihren unerfüllten Hoffnungen an Benn und an das Leben. Sie sagt ihm, dass sie sich jetzt umbringen werde, dann schluchzt sie, leise erst, dann immer lauter, von ganz tief. Sie legt auf. Benn rennt aus der Praxis, jagt mit einem Taxi zu ihrer Wohnung, doch als er ankommt, liegt Lili Breda schon zerschmettert auf der Straße. Sie ist aus dem Schlafzimmerfenster im fünften Stock gesprungen. Die Feuerwehr legt gerade gnädig eine Decke über ihren toten Leib, den Benn noch kurz zuvor liebkost hat. Benn setzt eine Anzeige in der BZ auf. Organisiert die Beerdigung. Keiner der zwanzig Trauergäste sagt etwas, als sie in Stahnsdorf bei Potsdam in die kalte Erde gesenkt wird. Es ist erst halb vier, aber es dämmert schon. Benn richtet ein tröstendes Wort an Elinor Büller, Lilis beste Freundin. Dann setzt er seinen dunklen Hut auf, schlägt den Mantelkragen hoch und geht mit bleischweren Schritten durch den leichten Schnee. Er ist viel zu früh am Bahnhof, erst in einer Stunde geht der nächste Zug. Abends, allein in der leeren Praxis in Berlin, in der es nach Formaldehyd riecht und nach Aussichtslosigkeit, merkt Benn, dass er vergessen hat, wie man weint. »Natürlich«, so schreibt er an seine Vertraute Sophia Wasmuth, »natürlich starb sie an oder durch mich, wie man sagt.« Das Schluchzen am Telefon war das Letzte, was er von ihr hörte.
Am nächsten Morgen aber, nach traumloser Nacht, greift Benn zum Hörer und ruft Elinor Büller an, Lilis Freundin, der er gestern am Grab kurz die Hand gedrückt hat. Sie telefonieren lange. Sie redet, er hört zu. Dann treffen sie sich, zwei Wochen später, sie gehen in die China-Ausstellung, sie trinken einen Wein im Café Josty. Und dann gehen sie zu Benn und werden ein Paar. Er könne, sagt er später, »ohne das« einfach nicht leben. »Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch«, wie er einmal lakonisch gedichtet hat.
Bald überlegen sie zu heiraten, Elinor Büller zum vierten, Benn zum zweiten Mal. Sie lässt sich Visitenkarten drucken, »Elinor Benn, geborene Büller«. Sie wird sie nie benutzen dürfen. Aber immerhin bleibt sie für neun lange Jahre: Elinor Büller, Geliebte Benns. »Kindchen, lass uns nicht heiraten«, so beruhigt er sie immer wieder, die Ehe sei doch nur »eine Institution zur Lähmung des Geschlechtstriebs«. Und das könne ja nun nicht ihr Ziel sein, oder?
»In nicht wenigen Gebilden der Viktorianischen Zeit, keineswegs bloß englischen«, so schreibt Theodor Adorno, »wird die Gewalt des Sexus und des ihm verwandten sensuellen Moments fühlbar erst durchs Verschweigen.« Es gäbe Stellen »von so überwältigender Zärtlichkeit, wie wohl nur der sie auszudrücken vermag, dem sie versagt blieb«. Theodor Adorno, diesem genussfreudigen Sohn eines Frankfurter Weinhändlers mit überwältigendem Zärtlichkeitsbedürfnis, blieb in jener Zeit wenig versagt. Er lebte in den zwanziger Jahren als Student in Frankfurt, Wien und Berlin sehr reichhaltig, sowohl in Bezug auf seine Studienfächer, Promotion und Habilitation wie in Bezug auf seine Frauen. Dazwischen komponierte er und schrieb Musikkritiken. Der promovierten Chemikerin und Unternehmertochter Margarete Karplus aus Berlin ist er besonders verfallen. Die beiden Väter hatten die Verbindung hergestellt, denn Adornos Vater lieferte aus seinem Weinbetrieb jene überflüssigen Tannine, die seinen Wein zu schwer machten, nach Berlin, um die Handschuhe, die Margarete Karplus’ Vater produzierte, geschmeidiger werden zu lassen. Ist das nicht eine schöne Symbolik? Ein Leben lang wird Margarete Karplus, die später zu Gretel Adorno geworden ist, die schweren Tannine in den Gedanken ihres Gatten ein wenig geschmeidiger machen, indem sie sie hinterfragt, verbessert und mit der Schreibmaschine ins Reine bringt.
1929 aber ist das alles längst nicht so klar, obwohl sie sich im Jahr zuvor mit Adorno verlobt hat. Die hochgewachsene, schöne Frau aus einer jüdisch assimilierten Familie hat einen sehr eigenen Kopf. Sie ist eng mit Bertolt Brecht befreundet, mit László Moholy-Nagy, mit Siegfried Kracauer, mit Kurt Weill und Lotte Lenya. Und sie ist in ihrem Herzen zwischen drei Genies hin und her gerissen. Da ist auf der einen Seite Adorno, ihr Verlobter, die feste Fernbeziehung in Frankfurt am Main, aber in Berlin sind da noch Ernst Bloch und Walter Benjamin. Mit Bloch hat sie auch eine körperliche, mit Benjamin eine geistige Beziehung, und wie so oft ist es eher die zweite, die in den Briefen fast nach Liebe klingt.
Am 27. März 1929 stellt Cole Porter erstmals die große Frage: »What is this thing called love?«
Dietrich Bonhoeffer liebt erst einmal nur Gott – und sich selbst. Als der junge, rastlose Theologiestudent aus gutem Grunewalder Hause seine erste Auslandsstelle in der evangelischen Gemeinde in Barcelona antreten soll, schreibt er vorher an den dortigen Pastor Fritz Olbricht, einen knorrigen Bayern, um zu fragen, wie er sich am besten vorbereiten könne. Und Bonhoeffer meint damit: seine Garderobe. Er habe gehört, dass das Wetter in Barcelona zwar heiß, aber wechselhaft sei. Deshalb frage er sich, welchen Anzugtyp Olbricht empfehle und welche Stoffart. Brauche er auch eine spezielle Sportkleidung für die Clubs? Und welche Anzüge und Krawatten trage man bei den abendlichen Dinners? Pastor Olbricht braucht vier Wochen, bis seine Wut über den eitlen jungen Theologen im fernen Berlin verraucht ist. Dann antwortet er Dietrich Bonhoeffer, er könne zu seinen Kleidungsproblemen leider nichts beitragen, aber es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn er als Pfarrer einen Talar in den Koffer packen würde.
Was für ein Frühjahr für Bertolt Brecht. Am Ostersamstag hat das Stück Pioniere in Ingolstadt seiner früheren Geliebten Marieluise Fleißer Premiere im Theater am Schiffbauerdamm. Ins Programm schreibt er: »Man kann an dem Stück gewisse atavistische und prähistorische Gefühlswelten studieren.« Zum Beispiel die prähistorischen Gefühlswelten des Bertolt Brecht. Im Stück nämlich erfährt das Dienstmädchen Berta, dass ihr Geliebter Korl nicht nur andere Frauen neben ihr hat, sondern darüber hinaus verheiratet ist und sogar Vater. Genau diesen Schock hat Marieluise Fleißer einst durch Brecht erfahren. Und so lässt sie ihre Berta klagen: »Wir haben was ausgelassen, was wichtig ist. Die Liebe haben wir ausgelassen.« Brecht jedoch schreitet kurz nach der Premiere zur nächsten Tat, da er außer der Liebe in seinem Leben eigentlich auch sonst nichts auslassen möchte. Er heiratet am 10. April 1929 Helene Weigel, mit der er bereits einen kleinen Sohn hat. Sie sei, so sagt er, »gutartig, schroff, mutig und unbeliebt«. Man könnte also sagen: in allem das genaue Gegenteil des Gatten. Denn was macht der unmittelbar nach dem Jawort auf dem Standesamt in Charlottenburg? Er fährt zum Bahnhof, um dort die Geliebte abzuholen. Dumm nur, dass Bertolt Brecht noch immer den Strauß von der Trauung in der Hand hat, müde Osterglocken. Als er Carola Neher am Gleis am Bahnhof Zoo gesteht, dass er vor einer halben Stunde Helene Weigel geheiratet habe, was »unvermeidlich«, aber eigentlich »unbedeutend« sei, da knallt sie ihm den welken Strauß vor die Füße und rauscht wütend ab. Sie war den ganzen weiten Weg aus Davos, wo sie ihren moribunden Mann, den Dichter Klabund, gepflegt hat, bis nach Berlin gefahren, nur um zu erfahren, dass Brecht wieder geheiratet hat und schon wieder nicht sie. Und noch größer der Schock bei Elisabeth Hauptmann, Brechts engster Mitarbeiterin und engster Geliebten jenes Frühjahrs 1929: Als sie die Nachricht von der überraschenden Hochzeit hört, versucht sie, sich in ihrer Wohnung das Leben zu nehmen. Aber keine Sorge. Kaum ist sie wieder bei Gesundheit und Verstand, beginnt sie sechs Tage später ein neues Theaterstück zu schreiben und nennt es, ohne Witz: Happy End.
Ob Brecht bitte die Songs dafür schreiben könne, fragt sie ihn, er bekomme auch ein Drittel der Honorare. Doch dafür braucht er Hilfe von Kurt Weill, er doktert lieber gleich am Stück selbst mit herum, zusammen mit Elisabeth Hauptmann im Arbeitsurlaub in Oberbayern. Als im Juli die Proben für Happy End beginnen, zeigt Brecht, was er persönlich unter einem glücklichen Ende versteht: Im Stück der einen Geliebten übernimmt die andere Geliebte, Carola Neher, die Hauptrolle, da sie ja ohnehin gerade in Berlin ist, und seine Ehefrau die Nebenrolle mit der bezeichnenden Charakterisierung »Die Graue Frau«. Die männliche Hauptrolle spielt Theo Lingen, der neue Partner von Brechts Ex-Frau Marianne Zoff und Stiefvater seiner Tochter Hanne (ja, es ist nicht immer einfach, hier den Überblick zu behalten). Brechts sadistische Lust, all seine Frauen gleichzeitig leiden zu sehen, ist bühnenreif. Was er über die Frage der Eifersucht denke, fragt ihn die Zeitschrift Uhu ausgerechnet in diesen Tagen. Darauf Brecht breitbeinig: »Spießer sind heute die letzten Träger dieser einst tragischen Eigenschaft.« Schreibt es – und blickt selbstzufrieden auf den Gipsabguss des eigenen Gesichtes, den er auf seinem Schreibtisch postiert hat. Wer so um sich selbst kreist, dem droht eigentlich ein Schleudertrauma. Doch bei Brecht bedroht es nur all die anderen, die ihn beim beständigen Kreiseln zu stören wagen.
Die gemeinsamen Nächte mit Asja Lācis, der radikalen Kommunistin aus dem fernen Lettland, die er in Capri kennengelernt hat, enden für Walter Benjamin sehr unbefriedigend. Er will ihr, mit halb geöffneten Augen, noch halb im Schlummer, in der Morgendämmerung von seinen Träumen erzählen. Doch Asja Lācis »hörte sie ungern und unterbrach ihn, aber er erzählte sie doch«. Sie bittet ihn stattdessen, sich doch endlich scheiden zu lassen von Dora, seiner Frau. Das sei ihr einziger Traum. Dann gibt es Frühstück, die Stimmung ist wie eine müde Scheibe Roggenbrot.
Am 14. März besteigt Christopher Isherwood, dieser 24-jährige, frisch abgebrochene Mediziner und angebrochene Schriftsteller, den Nachmittagszug in London Richtung Dover, draußen Regen, Donner, fliehende Wolken, er hat sich die Krawatte aus Cambridge umgebunden, sein Burberry-Mantel ist nass geworden, er hängt ihn zum Trocknen an den Haken. In Dover, im dunklen Nebel, nimmt er den Dampfer nach Ostende, in der Dritte-Klasse-Bar lauter laute Soldaten, die nach Wiesbaden abkommandiert worden sind. Zwei immerhin erkennen seine Krawatte und prosten ihm zu. In Ostende nimmt er den Zug nach Köln, dort trägt ein Beamter auf dem Gleis feierlich ein Holzschild und kündet bereits den Zug nach Berlin an wie eine Offenbarung, er steigt ein und dämmert vor sich hin, lässt die wintermüde Landschaft an sich vorbeiflitzen, denkt an nichts und ahnt doch, dass gerade seine Zukunft beginnt. Er reist mit leichtem Gepäck und schwerer Sehnsucht. Er denkt an Berlin, denn Berlin, so weiß er, »das bedeutet: Jungs«.
Isherwood wohnt gleich neben Magnus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft. Fast täglich ist er dort, nachmittags um fünf trinkt er Tee mit Karl Giese, dem Lebensgefährten des Institutsgründers Hirschfeld, dem berühmten und berüchtigten »Einstein of Sex«. Wenn Giese von Hirschfeld spricht, diesem um Jahrzehnte älteren imposanten Gelehrten mit Rauschebart, dann nennt er ihn ehrfurchtsvoll »Papa«. Isherwood nennt Giese respektvoll einen »derben Bauernjungen mit dem Herzen eines Mädchens«.
Papa Hirschfeld hat in seinem Essay Mein Verhältnis zur schönen Literatur im Jahr 1928 erkannt, dass eigentlich die Poesie seine »erste Geliebte« gewesen ist, bevor er sich ganz der Sexualwissenschaft verschrieb. So sind es nicht ohne Grund Schiller und Goethe, auf die er sich in seinen Schriften über die Homosexualität immer wieder als Kronzeugen beruft. Und ein Nachbar wie der Literat Christopher Isherwood ist für Hirschfeld ein besonderes Glück. Oft führt Isherwood Freunde aus England durch das Museum des Instituts, das ein »Must see« für alle Freunde der Gleichgeschlechtlichkeit ist, weil Hirschfeld jahrzehntelang die schönsten Artefakte, Lustbeschleuniger und Absonderlichkeiten der sexuellen Zwischenzonen zusammengetragen hat. 1929 schreibt Hirschfeld gerade an seinem neuen Buch Liebesmittel. Eine Darstellung der geschlechtlichen Reizmittel, es wird vierhundert Seiten stark und enthält einhundert ausführliche Tafeln als Anschauungsunterricht. Im Eldorado, Berlins berühmtestem Tempel der Homosexualität, geht ein bewunderndes Raunen durch die Reihen, wenn der altersweise Hirschfeld nach getaner wissenschaftlicher Arbeit persönlich die Bar betritt, um sich nach der Theorie der Praxis zuzuwenden. Hier wird er nicht »Papa« genannt, sondern »Tante Magnesia«, wie wir von Christopher Isherwood wissen.
Selbst Albert Einstein, der Erfinder der Relativitätstheorie, weiß, dass in der Liebe Zeit und Raum doch eine sehr relevante Rolle spielen und nicht einfach so überwunden werden können. »Schreiben ist dumm«, telegraphiert er an seine Frau am sommerlichen See in Caputh, »am Sonntag küss ich dich mündlich.« Der Sonntag also ist: Kuss mal Zeit zum Quadrat.
Billy Wilder schreibt im Frühsommer 1929 sein Drehbuch für Menschen am Sonntag, einen der letzten Stummfilme und vor allem einen echten Berlinfilm – also arm, aber sexy –, geschrieben im Romanischen Café bei sehr vielen geschnorrten Tassen Kaffee und untergehender Sonne. Das Agfa-Filmmaterial ist Ausschussware aus den UFA-Studios, die Dreharbeiten, die am 12. Juli 1929 beginnen, müssen immer wieder unterbrochen werden, weil das Geld aus ist. Vier der fünf Hauptdarsteller haben noch nie vor einer Kamera gestanden, der Drehbuchautor ist ein Tänzer, Reporter und Schlawiner, die Assistenten flüchten, die Schauspieler sollen improvisieren. Gedreht wird erst am Bahnhof Zoo im ohrenbetäubenden Lärm der ankommenden Züge und dann draußen am Wannsee auf einer kleinen Lichtung, es gibt Würstchen mit Kartoffelsalat, Flirts unter hohen Kiefern, Sonne, die plötzlich auf leichte Sommerkleider fällt und von der Kamera sekundenlang verfolgt wird. Und es gibt Männer, die an Zigaretten ziehen, wenn sie ihren Text vergessen haben. Das können die beiden Hauptdarsteller sehr gut, denn auch im Leben vergessen sie oft den Text, und Wilder und sein Kompagnon Curt Siodmak hatten ihnen ja gesagt, sie sollten einfach sich selbst spielen. Und so sind der Taxifahrer und der Weinvertreter, das Mannequin und die Schallplattenverkäuferin ganz sie selbst, ein Film so flüchtig und unlogisch wie das Leben, zumindest das Leben in Berlin.
Das schnell ausgelebte Begehren der Menschen am Sonntag im Schatten der hohen Baumwipfel erzeugt im Licht der Nachttischlampe bei den Menschen am Sonntagabend aber doch etwas Schmerz und ziemlich viel Melancholie. Von Liebe allerdings ist die ganze Zeit nicht die Rede, und das liegt nicht daran, dass es ein Stummfilm ist.
Wie zwei der Hauptdarsteller aus Menschen am Sonntag lümmeln sich in diesen Tagen auch Kurt Tucholsky und Lisa Matthias auf einer behaglichen Wiese an einem großen schwedischen See. Da sie in keinem Stummfilm sind, dürfen sie unaufhörlich miteinander quasseln. Und das tun Kurt Tucholsky und Lisa Matthias von der ersten Sekunde an, seit sie sich auf einem Kostümfest kennengelernt haben: Tucholsky, der soeben aus Paris ohne seine Ehefrau nach Berlin zurückgekehrt ist, um als Nachfolger des verstorbenen Siegfried Jacobsohn die Weltbühne zu leiten, hat der erfahrungshungrigen Lisa gleich in den ersten weinseligen Stunden ausgiebig von seinen Eheproblemen erzählt, so »wie das von reifen Männern im Morgengrauen gerne geübt wird«, wie die offenbar branchenerfahrene Matthias später zu Protokoll gibt.
Lisa Matthias also, zweifach verheiratet, zweifache Mutter, ist mit ihrem Bubikopf, ihrem Cabrio, ihrem ausschweifenden Liebesleben und ihren launigen Texten über Hemingway und das Autofahren das perfekte role model der Berlinerin jener Zeit, nicht nur von Tucholsky, sondern auch von Peter Suhrkamp und Lion Feuchtwanger umworben.
Zunächst sehen die beiden sich nicht allzu häufig, meist nur für kurze Rendezvous in Tucholskys Berliner Pied-à-terre, aber »Lottchen«, wie er Lisa nennt, taucht ab sofort ständig auf in seinen Feuilletons als dauerquatschende Berliner Pflanze. Doch als Lisa Matthias in Tucholskys Zeitungstexten präsenter ist als in seinem Leben, wird sie langsam etwas schmallippig – wenn er sie sieht, dann nur, um rasch mit ihr ins Bett zu gehen. Sie klagt ihrer Freundin: »Es wird ein bisschen viel geliebt ohne wirkliche Liebe. Wir haben dazu beide keinen rechten Mumm.« Aber egal: »Interessant ist diese Liaison auf alle Fälle.« Für ihren Geist ist gesorgt. Und bei den Gefühlen darf man nicht allzu viel verlangen: »Liebe ist nicht ohne Bitter, sagt Daddy. Stimmt.«
Er ist ihr »Daddy«, und sie? »Ich war Tucholskys Lottchen«, so nennt sie auch gleich ihre gesamten Memoiren. Wodurch man weiß, dass ihr Sofa »Sündenwiese« heißt und Tucholsky so stark schnarcht, dass sie immer gegen zwei Uhr genervt ins Gästezimmer umzieht. Doch Lisa Matthias ist das alles zu wenig – sie will ihren Dichter ganz für sich allein haben, ohne Redaktionskollegen, ohne all die anderen Kaffeehausgäste, ohne dieses summende, schwirrende, nervende Berlin. Sie will mit ihm verreisen. Da weiß sie noch nicht, was Urlaubmachen mit Kurt Tucholsky für eine Frau bedeutet – nämlich Liebe als Materialbeschaffung für das nächste Buch. Als er einst mit seiner Geliebten Else Weil nach Rheinsberg in den Liebesurlaub gefahren ist, da wurde wenig später Rheinsberg daraus, das hinreißende »Bilderbuch für Verliebte«, als er mit Mary Gerold, seiner derzeitigen Frau, durch die Pyrenäen reiste, da war das der Kern von, genau: Das Pyrenäenbuch.
Und als er nun im April 1929 mit Lisa Matthias nach »Gripsholm« in Schweden fährt, da denkt er natürlich auch bereits die Anführungszeichen mit. Sie düsen gen Norden in Lisa Matthias’ schickem Cabrio, einem Chevrolet mit dem Kennzeichen IA 47–407. Und als dann ein Jahr später Tucholsky ihr schwedisches Liebesabenteuer samt einiger skurrilen Ausschmückungen zu dem Buch Schloß Gripsholm umgeschnitzt hat, widmet er es im Vorwort tatsächlich »IA 47–407«. Das sagt zwar seiner Ehefrau Mary im fernen Paris nichts, aber die Gäste der Terrassen der Cafés auf dem Kurfürstendamm und in Schöneberg wissen Bescheid, denn dort parkt Lisa Matthias ihr riesiges Gefährt zu allen Tages- und Nachtzeiten unbekümmert auf dem Bürgersteig. Und Lisa Matthias erfüllt es mit leisem Stolz, nun so leicht dechiffrierbar die Partnerin des großen Tucholsky zu sein. Aber langsam. Erst einmal müssen sie ja losfahren nach Schweden! Dort liegen sie dann also nebeneinander auf einer recht grünen Wiese im schwedischen Läggesta, am Mälarsee, gegenüber dem mächtigen Schloss von Gripsholm am anderen Seeufer und blinzeln in die Kamera. Ihre Blicke sagen: Mal schauen, wo das hinführt. Aber es ist ein hübsches Foto, die Sonne scheint. Und sie finden auch sehr bald eine kleine Sommervilla aus schönstem roten Holz und versuchen sich als Liebespaar, auch wenn Lisa immer wieder zu Protokoll gibt, dass sie »erotisch nicht sonderlich interessiert ist«. Aber er sei eben so lustig, dieser Tucholsky, und so lässt sie sich doch immer wieder verführen. Und am nächsten Morgen, wenn draußen die Vögel zwitschern, die Sonne die Katzen wach gekitzelt hat und die Staubflocken durch die Räume schweben, wenn es in der Küche nach Kaffee riecht und nach guter Laune, dann halten sie sich mitunter sogar für glücklich. Dann gehen sie raus, zum See, baden, spritzen sich gegenseitig voll, lachen. Sie essen rote Grütze. Lisa steht in der Küche und macht dazu Vanillesoße für ihren »Daddy«. Sie sei für ihn »Mutter, Wiege, Kamerad«, sagt Tucholsky dann – und meint das romantisch. Wenn sie sich geliebt haben am Nachmittag und Lisa noch einmal zum Baden an den See geht, der jetzt schon diese nachmittägliche, herrliche Kühle hat, dann setzt Tucholsky sich an den improvisierten Schreibtisch und schreibt an seine Frau Mary nach Paris: »Sonst geht es so lala – ich lebe hier wie ein Eremit.« Na ja.
Manchmal muss Picasso noch Olga malen, seine Frau. Er hat sie in den Jahren zuvor fast ständig gemalt, ihren grazilen Ballerinakörper, doch nun ist Marie-Thérèse Walter zu seinem wichtigsten Modell geworden. »Wie schrecklich, dass eine Frau meinen Bildern genau ansehen kann, wenn sie ausgetauscht wurde«, sagt Picasso. Und Olga macht dieses Gefühl, ausgetauscht worden zu sein, fast wahnsinnig. Sie schreit, sie tobt, sie wütet, bevor sie wieder für Wochen in Depressionen versinkt und sich selbst einliefert in Kliniken an fernen stillen Seen. Ihre Wut aber zündet in Picasso die kreativen Kräfte, die angetrieben werden von Schuld und Trotz.
So willigt Picasso am 5. Mai 1929 doch noch einmal ein, Olga zu malen. Und ist das Porträtsitzen früher ein Spiel zwischen beiden gewesen, ein Fingerhakeln, eine erotische Machtprobe, so ist es jetzt zu einem kalten Krieg geworden. Keiner sagt ein Wort. Picasso starrt sie an und malt. Sie fühlt sich nicht bewundert, sondern entblößt in ihrer Nacktheit, sie friert in ihrem Sessel. In ihr gären der Selbsthass und der Hass auf den Mann, den sie so geliebt hat und der sie nun betrügt. Stoisch malt Picasso weiter. Irgendwann bricht er ab und setzt seine Signatur unter das Bild, dessen Öl noch feucht ist. Als Olga sich einen Kimono umgelegt hat und hinter ihren Mann tritt, um das Bild anzuschauen, sacken ihr vor Schock die Beine weg. Das Bild zeigt keine Frau, sondern ein Monster, mit schreckverzerrtem Gesicht und verbogenen Gliedmaßen. Sie sagt kein Wort, zieht sich an und geht.
Picasso stellt sich ans Fenster und raucht und denkt an Marie-Thérèse, die später noch zu Besuch kommen will. Wenn Picasso im Jahre 1929 Olga malt, sind das keine Porträtsitzungen mehr, sondern Teufelsaustreibungen. Picasso will sie sich von der Seele malen. Was das für sie bedeutet, ist ihm egal. Er nennt das Bild Großer Akt im roten Sessel. Es ist ein erster Schlussakt eines langen Dramas.
Erich Mühsam vergisst oft, dass er verheiratet ist. Nicht, dass er seine Zenzl nicht liebt, nein, das nicht. Er liebt sie schon. Also: vor allem ihren Charakter.
Aber es gibt eben so viel anderes zu tun: Mühsam, der große, ewig rastlose Sozialrevolutionär mit mächtigem Bart, der kommunistische Warner und Propagandist der »Lebenswildheit« und eines humaneren Deutschland, ist auch nach fünf Jahren Festungshaft für seine Arbeit in der Münchner Räterepublik fast jeden Abend unterwegs, um junge Arbeiter für den Anarchismus zu gewinnen und für den Freiheitskampf. Er ist auch sehr oft im Theater, trinkt für sein Leben gern in den Bohemekneipen in Berlin und München, er spielt Schach, flirtet, schreibt für die KPD-Zeitung Die rote Fahne, reist durchs Land, hetzt von Vortrag zu Vortrag. Wenn er sich gerade wieder besonders begeistert hat für junge Revolutionärinnen und Revolutionäre, bringt er schon mal fünf, sechs von ihnen mit nach Hause nach Berlin-Britz in Bruno Tauts revolutionäre Hufeisensiedlung und erklärt der Zenzl, dass sie jetzt erst einmal alle bei ihnen einziehen. Anarchismus dürfe doch nicht an der Türschwelle enden, sagt er ihr. Und sie geht mürrisch an den Herd und kocht für sieben oder acht statt für zwei. Sie weiß, dass er in der Regel schon mit mindestens einer der jungen Revolutionärinnen im Bett war. Wenn sie darüber weint, dann schaut er sie ratlos an: Er habe ihr doch immer gesagt, dass er nur eine »freiheitliche Ehe« führen könne. Keiner dürfe dem anderen Vorhaltungen machen. Ob sie sich daran erinnere, dass sie dem zugestimmt habe? Ja, das habe sie, sagt Zenzl dann, aber sie stimme dem eben jetzt nicht mehr zu. Dann wird sie wütend, weint, schreit, und Erich Mühsam flieht, für ein paar Tage und manchmal auch für ein paar Wochen. Es ist kein Spaß, mit einem Anarchisten verheiratet zu sein. Am 1. Mai 1929, dem Tag der Arbeit, ist er unterwegs auf der Straße, ohne Zenzl, die ihn gewarnt hat. Er zieht mit den Kommunisten in Treptow durch die Häuserblocks, hält flammende Reden, es gibt erste kleine Scharmützel mit der Polizei, am nächsten Tag geht es weiter nach Neukölln, wo die Arbeiter Barrikaden errichtet haben und sich Straßenschlachten liefern mit der Polizei. Es ist ein Gemetzel am Schluss, der Berliner »Blutmai«, danach wird die Kampforganisation der KPD, der Rote Frontkämpferbund, verboten (Bertolt Brecht übrigens beobachtet die Straßenschlacht vom Fenster seines Freundes Fritz Sternberg, und wird dadurch wohl zu einem noch fanatischeren Kommunisten). Am 6. Mai aber, alle sind noch in Aufruhr über 33 Tote und 250 Verletzte, geht Erich Mühsam, dieser ewige Romantiker, zur »Anarchistischen Jugend« in der Weinmeisterstraße direkt am Alexanderplatz und hält einen Vortrag. Thema: »Über die Freiheit in der Liebe«. Ob er danach heim zu seiner Zenzl geht oder andernorts mühsam die freie Liebe pflegt, ist nicht überliefert.
Der einzige Brief, den Vladimir Nabokov, der später so große und damals noch unbekannte Schriftsteller, seiner Frau im Jahre 1929 schreibt, hat nur zwei Worte und ein Ausrufezeichen: »Thais gefangen!«. Vielleicht legt er ihn ihr aufs Bett, als sie noch schläft, in dem sonnendurchfluteten Zimmer in Le Boulou in den Pyrenäen, wo sie in einem kleinen Hotel ihren ersten richtigen Urlaub verbringen. Das, was er da gefangen hat, ist ein Schmetterling, ein seltenes spanisches Exemplar der Gattung der Ritterfalter, und Véra lächelt, als sie den Zettel sieht, denn sie weiß, dass ihr Mann nichts so liebt wie frühmorgens, wenn die Schuhe noch nass werden vom Tau der Nacht, durch die Wiesen zu streifen, um im weißen Netz Schmetterlinge zu fangen.
Véra selbst hatte Vladimir Nabokov ein paar Jahre zuvor mit Worten eingefangen, die er ihr über die russische Emigrantenzeitung Rul durch ein Gedicht zukommen ließ, das er »Die Begegnung. Im Banne dieser seltsamen Nähe« nannte. Darin die Verse, die nur sie zu deuten verstand: »Mein Herz muss noch wandern / Doch wenn du mein Schicksal bist …« Sehr kurz darauf war die Wanderung seines abenteuerlichen Herzens abgeschlossen, und er erkannte, dass Véra sein Schicksal war. Vladimir Nabokov also schrieb: »Eines muss ich dir sagen: Vielleicht habe ich es dir schon einmal gesagt, aber für alle Fälle sage ich es ein weiteres Mal, Kätzchen, es ist sehr wichtig – bitte pass auf: Es gibt viele wichtige Dinge im Leben, wie z.B. Tennis, die Sonne, Literatur – aber diese Sache ist mit alldem gar nicht zu vergleichen, sie ist so viel wichtiger, tiefer, breiter, erhabener. Diese Sache – übrigens bedarf es gar keiner so langen Vorrede; ich sage dir ganz einfach, worum es geht. Also: Ich liebe dich.«
Da wusste Véra, dieser wunderschön und nobel funkelnde Schmetterling, dass sie nicht mehr weiterflattern musste. Sie heirateten und schlugen sich durch im seltsamen Berlin der zwanziger Jahre. Die meisten Russen, die vor der Oktoberrevolution nach Deutschland geflüchtet waren, sind längst weitergezogen nach Paris. Aber Véra übersetzt und arbeitet in einer Anwaltskanzlei und Vladimir gibt Tennisunterricht, spielt als Komparse in UFA-Filmen mit, unterrichtet aufgeweckte Jungen aus dem Grunewald in Schach und ältere Damen in Russisch. Vor allem aber schreibt er natürlich. Und dass sie jetzt im Frühling des Jahres 1929 diesen herrlichen Urlaub im Süden machen können, das verdanken sie dem Ullstein Verlag, der doch tatsächlich sein neues Buch Bube, Dame, König vorabdruckt und später als Roman veröffentlicht und ihm die für ihn ungeheure Summe von 7500 Mark dafür zahlt. Nabokov hat sein Glück mit Véra in dieses Buch hineingeschmuggelt. Er lässt sie beide hineintanzen als ein Paar, das alle Blicke auf sich zieht: »Franz war dieses Paar schon lange aufgefallen. Manchmal trug der Mann ein Schmetterlingsnetz bei sich. Das Mädchen hatte einen zart geschminkten Mund und zärtliche graublaue Augen, und ihr Verlobter oder Gatte, schlank, elegant kahl werdend, voller Verachtung für alles auf der Welt außer ihr, blickte sie stolz an, und Franz beneidete dieses glückliche Paar.«
Véra und Vladimir Nabokov sind ein sehr ungewöhnliches Paar, denn sie sind glücklich miteinander und sie werden es bleiben.
Am 8. Juli 1929 trifft Jean-Paul Sartre die umschwärmte Simone de Beauvoir dann wirklich das erste Mal außerhalb der Mauern der Sorbonne. Diesmal gemeinsam mit seinem Studienkollegen René Maheu in seinem kleinen Zimmer im Studentenwohnheim. Nur 76 Studenten aus ganz Frankreich sind zur »Agrégation« der École Normale zugelassen worden, wer sie besteht, darf als Lehrer ein Leben lang Philosophie an einer französischen Schule unterrichten. Nach der schriftlichen lernen nun alle für die mündliche Prüfung, die als mörderisch schwierig gilt. Der Druck ist enorm, die Kandidaten müssen sich quer durch die europäische Philosophiegeschichte lesen. Als Simone de Beauvoir Sartres Zimmer betritt, ist sie verstört von dem Dreck, Chaos und den Gerüchen, aber sie versucht, sich nicht ablenken zu lassen, und trägt, als alle sich gesetzt haben, vierzig Minuten lang ihre Interpretation zur Metaphysik von Leibniz vor. Sartre und Maheu haben wenig hinzuzufügen, sie haben sich das Treffen etwas entspannter vorgestellt, vor allem Maheu, der sich sehr zu Simone hingezogen fühlt, ist enttäuscht von dem förmlichen Besuch. Nur einmal ist sie kurz irritiert bei ihrem Vortrag, als sie bemerkt, dass der Schirm der Nachttischlampe aus roten Dessous genäht ist. Sie weiß nicht, dass Sartre ihn von Simone Jollivet geschenkt bekommen hat, seiner Geliebten aus Toulouse, einer literarisch ambitionierten Edelprostituierten, und das ist wohl auch besser so. Als Simone gegangen ist, überlegen sich die beiden Männer einen Spitznamen für sie. Sartre will sie gerne »Walküre« nennen, weil sie ihm wie eine jungfräuliche nordische Kriegsgöttin vorgekommen ist. Nein, sagt Maheu, sie sei wie ein Biber, der an den Bäumen der Erkenntnis nage und daraus neue Gebäude baue, darum: le Castor. Darauf einigen sie sich. Beim nächsten Treffen empfängt Simone de Beauvoir den Titel »Castor«. Und diesem Namen bleibt sie ein Leben lang treu. Als am 17. Juli die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung bekannt gegeben werden, haben Sartre und de Beauvoir bestanden und sind zur mündlichen Prüfung zugelassen, René Maheu, der sie zusammengeführt hat, ist durchgefallen. Er reist sofort aus Paris ab. Jean-Paul Sartre aber lädt Simone de Beauvoir an diesem Abend zum ersten Mal zum Essen ein, bestellt guten Wein und spricht: »Von jetzt an werde ich mich um Sie kümmern, Castor.« Aber am nächsten Morgen müssen sie erst einmal weiter Philosophie lernen – und sie bleiben daraufhin gleich die nächsten vierzehn Tage zusammen. Sie beide, mit Kant, mit Rousseau, mit Leibniz, mit Platon. Dazwischen mal einen Kaffee und abends ein Glas Wein, danach ein Western im Kino. Am nächsten Tag beginnt sie um acht Uhr wieder mit dem Lernen. Von Zärtlichkeiten noch keine Spur. Aber immerhin: Ihre Gedanken halten sich bereits eng umschlungen. Am 30. Juli werden die Ergebnisse der mündlichen Prüfung bekannt gegeben. Den ersten Platz belegt Jean-Paul Sartre, den zweiten Simone de Beauvoir. Die glückliche Zweitplatzierte reist am Tag darauf mit ihrer Familie zur Tante aufs Land, für einen langen Sommer in den Feldern und den Hügeln des Limousin. Sie streift durch die Wiesen, denkt nach über Sartre, aber vor allem auch über dessen anziehenden Freund Maheu, und schreibt in ihr Tagebuch: »Ich brauche Sartre und liebe Maheu. Ich liebe Sartre für das, was er gibt, und Maheu für das, was er ist.« Doch dann lädt sie nicht Maheu, sondern Sartre ein, sie spontan auf dem Land zu besuchen, in Saint-Germain-les-Belles. Er steigt sofort in den Zug, zieht in ein kleines Hotel in der Nähe, und sie treffen sich jeden Tag, legen sich auf eine kleine Lichtung in einem nahen Kastanienwäldchen, trinken Cidre, essen Käse und Baguette und philosophieren. Es ist warm, es ist August, der Wind weht leicht von den Bergen her. Sie küssen sich zärtlich. Und sie träumen sich, wenn es dämmert, eine gemeinsame Zukunft herbei. Es sind die schönsten Tage ihres Lebens.
Als die Nackttänzerin Josephine Baker und der italienische Graf Giuseppe Pepito Abatino in Paris heiraten wollen, geben sie einfach eine Pressekonferenz im Hotel Ritz. Die ganze Welt schreibt darüber und sieht die Fotos des glücklichen, kichernden Paares, und fortan gelten sie als Mann und Frau. Es ist die Geschichte vom Aschenputtel, geboren in den Slums von St. Louis, das das Herz eines smarten europäischen Grafen erobert. Und das sollte reichen. Denn zum Standesamt will der Bräutigam lieber nicht gehen, dann wäre aufgeflogen, dass er kein italienischer Graf aus jahrhundertealter Linie ist und auch kein ruhmreicher Leutnant der Kavallerie, sondern ein sizilianischer Steinmetz.
Josephine Baker aber ist tatsächlich Josephine Baker, ein 21-jähriges ausgelassenes afroamerikanisches Mädchen, das zwar keine Schulbildung hat, keine falsche Scham und kein Zeitgefühl, aber ein untrügliches Gespür für Rhythmus und ein unnachahmliches Talent für Tanz. Erst der Steinmetz Pepito jedoch formt ihren Körper zur vollkommenen modernen Skulptur. Und bereits in den zwanziger Jahren heißt das: Er macht ihn zu einer Marke. Er zelebriert ihr Können, kultiviert ihre Marotten und filetiert ihre Gegner. Aus Josephine Baker wird »Josephine Baker« – sie kann sehr schnell nicht nur ihren Namen tanzen, sondern auch ihre Anführungszeichen, denn die wippen davor und dahinter so schön auf und ab wie ihr Markenzeichen, das Bananenröckchen.
Als noch Georges Simenon ihr Manager und Liebhaber gewesen ist, der große, ach was, der größte Krimi-Autor aller Zeiten, da ordnete er nur Josephines Papiere, sorgte dafür, dass alle paar Wochen die Rechnungen für die Seidenwäsche bezahlt wurden und dass sie wenigstens zweimal die Woche pünktlich in ihrer Revue ankam. Aber Pepito reicht das nicht, er will nicht Ordnung schaffen, sondern Vermögen. Und Josephine Baker lässt ihn gewähren. Dass das erste Mal ein weißer Mann mit ihr nicht nur ins Bett will, sondern sie sogar heiratet (also das zumindest behauptet), gibt ihr jenen emotionalen Halt, der ihr zuvor immer gefehlt hat. Und Pepito schenkt ihr nicht nur Stabilität, sondern entwirft auch einen Karriereplan. Auf den Werbeplakaten, die zu Josephines Revue im Folies Bergère einladen, steht jetzt: »Mit Joséphine Baker, Gräfin Pepito Abatino«. Er verleiht ihr also nicht nur einen Titel, sondern auch noch einen Accent aigu.
Pepito hat dafür gesorgt, dass die Frauen für ihre Töchter kleine Josephine-Baker-Barbie-Puppen kaufen können und für sich selbst die Hautpflegeprodukte, die er »Bakerfix« genannt hat, Sonnenöl nämlich, eine Körperlotion und die berühmte Pomade, mit der sich die Namensgeberin und ihr Manager so gerne die Haare zurückgelen. Und die Männer? Die dürfen auch nach dem Besuch in der Revue noch von der Schönheit und Ungezwungenheit der schwarzen Tänzerin träumen. »Un vent de folie«, eine Brise Leichtsinn, nennt Pepito Josephine Bakers Show. Er weiß, wie man es macht, es ist genau die Brise, nach der sich ganz Paris sehnt in den späten zwanziger Jahren. Doch Pepito merkt, dass der Effekt langsam nachlässt. Als Erstes lässt er Josephine Baker deshalb mit Anfang zwanzig allen Ernstes ihre Autobiographie veröffentlichen, arglos, naiv, exzentrisch, es geht um Kosmetik und es geht um ihre Tiere, es geht um ihren rosa Morgenmantel und es geht um Paris. Dann planen sie, sich mitten in der Stadt ein Haus von Adolf Loos bauen zu lassen – dem großen Wiener Modernisten. Es wäre eine Sensation geworden, ein Symbolbau, draußen mit Streifen von schwarzem und weißem Marmor und innen eine einzige Bühne für Josephine Baker, den ersten afroamerikanischen Superstar Europas, im Zentrum des Hauses ein Pool, Josephine als schwimmende Venus. Leider kommt es nicht dazu, denn Josephines Stern in Paris beginnt zu sinken. Und so organisiert Pepito für sie eine großangelegte Europatournee. Sie wird zu einer merkwürdigen Reise zwischen Triumph und Rassismus.
Bevor Josephine Baker losfährt, muss sie sich von ihren Tieren verabschieden. Schweren Herzens lässt sie ihre Sittiche, ihre Kaninchen, ihre Katzen, ihr Ferkel zurück in Paris. Nur ihre beiden Pekinesen Fifi und Baby Girl dürfen mit in den Zug. Dazu kommen fünfzehn Schrankkoffer, gefüllt mit 196 Paar Schuhen, 137 Kostümen und Pelzen. Man versteht, warum Pepitos Mutter an ihre Freundin schreibt, dass ihr Josephine ruhig mal ein paar mehr Kleider und Schuhe überlassen könne. Was die Ausfuhrliste außerdem vermerkt, sind 64 Kilogramm Gesichtspuder. Auf die Vermarktung dieses Puders hat ihr geschickter Manager Pepito in weiser Voraussicht verzichtet – denn hätte alle Welt gewusst, dass sich Josephine Baker vor ihren Bühnenauftritten im Gesicht pudert, um weißer zu erscheinen, wäre sie wohl bei allen Schwarzen unten durch gewesen. Bei den Weißen des östlicheren Europas ist es jedoch so, dass die 64 Kilogramm Puder nicht ausreichen. Während sie in Wien und in Budapest in den Nächten auf der Bühne gefeiert wird als die große Tanzsensation aus Paris, wird tagsüber schweres Geschütz gegen sie aufgefahren. Überall formieren sich die konservativen und kirchlichen Kreise. Als sie in Wien mit dem Zug einfährt und am Gleis von einer begeisterten Menge empfangen wird, läuten gleichzeitig – zur Anprangerung von so viel Fleischeslust und getanzter Sünde – die Glocken der Paulanerkirche, um vor dem »schwarzen Teufel« zu warnen. Die Priester sonntagmorgens im Gottesdienst weisen so eindringlich und bilderreich auf die Gefahren der verwerflichen Tänze hin, die Baker am Abend aufführen wird, dass sich viele Besucher direkt nach dem Vaterunser eine Karte besorgen. Josephine Baker wird für Wochen im Johann-Strauß-Theater vor ausverkauftem Haus auftreten.
Und so geht es dann weiter durch Europa mit den fünfzehn Schrankkoffern, den beiden Hunden und dem einen Ehemann. Nach Budapest, nach Prag, nach Zagreb, nach Amsterdam. Sogar in Basel darf sie auftreten, nur in München nicht, der Freistaat ist schon 1929 kein Ort für die Freikörperkultur gewesen. Am heftigsten jedoch werden die Proteste in Berlin – in jenem Berlin, wo sie noch 1926 die größten Triumphe erlebt hat, verführt von Ruth Landshoff, verehrt von Harry Graf Kessler, der ein Ballett für sie geschrieben hat … Eigentlich war sie gekommen, um mindestens ein halbes Jahr zu bleiben, vielleicht sogar, um hier einen Ableger ihres französischen Clubs Chez Joséphine zu gründen, so gut hat sie die Stadt in Erinnerung, das Flirren, die Rasanz, die Toleranz. Aber die Brise Leichtsinn ist verflogen. Als sie mit einer blonden deutschen Tänzerin auftritt, empört sich ein Kritiker am nächsten Tag: »Wie können sie es wagen, unsere wunderschöne blonde Lea Seidl mit einer Negerin auftreten zu lassen?« Der Völkische Beobachter nennt sie einen »Halbaffen«. Und die Zeitungen, die nicht rassistisch schreiben, schreiben antisemitisch. Denn die Organisatoren der Tanzrevue sind Juden, und die Kombination aus schwarzer nackter Tänzerin und jüdischen Veranstaltern – das ist zu viel für die nationalsozialistische Presse. Als ein Störtrupp der SA bei einer Aufführung Stinkbomben wirft, packt Josephine Baker mitten im Programm ihre Siebensachen und verschwindet. Die Show muss abgesetzt werden, Josephine Baker und Pepito kehren im Frühsommer 1929 Hals über Kopf nach Paris zurück.
Als Anaïs Nin und ihr Mann Hugo Guiler in den zwanziger Jahren nach Paris in die Rue Schoelcher 11 ziehen, direkt neben den Friedhof von Montparnasse, da ist weder zu ahnen, dass dies ein zentrales Ereignis für die Geschichte der Stadt der Liebe sein könnte, noch dass dreißig Jahre später ausgerechnet Simone de Beauvoir in genau diese Wohnung einziehen sollte. Anaïs Nin jedenfalls notiert in ihr Tagebuch, ernüchtert von der jungen Ehe und von Paris: »Ich wünschte, ich wäre nie gekommen. Man muss Paris romantisch sehen können, sonst ist es ein totaler Reinfall.« Ihr Mann, der Bankier Hugo, schenkt ihr immer neue Ausgaben des Kamasutra, die er an den Buchläden der Quays kauft, doch Anaïs schreibt in ihr Tagebuch: »Ich liebe die Reinheit.« Ansonsten liebt sie nur ihre Tagebücher, ja, sie sind ihr eigentliches Lebenselixier. Sie versieht sie jeweils mit einem kleinen Schloss und trägt den Schlüssel an einer Goldkette um den Hals. Sie nimmt den Schlüssel nur kurz ab, wenn sie Bauchtanz lernt, aber die Lehrerin hält sie für zu unbegabt. Sie muss sich was Neues überlegen. Anaïs Nin verlässt oft tagelang ihr Bett nicht, schreibt Tagebuch über ihren Dämmerzustand, weiß nicht so recht, wie man liebt und verschlingt deshalb D.H. Lawrence’ Roman Liebende Frauen. Sie ist hingerissen von der Art, wie sich Lawrence ins Chaos stürzt, so schreibt sie in ihr Tagebuch, »da die Vertiefung ins Chaos ein Kennzeichen unserer Epoche ist«. Sie wurde bald auch ein Kennzeichen ihres Lebens.
Gleichzeitig liegt Henry Miller in New York auf seinem Bett in der kleinen Wohnung in der Clinton Avenue in Brooklyn und liest ebenso D.H. Lawrence’ Liebende Frauen. Er fühlt sich von diesem Teil der Menschheit aber gerade in hohem Maße ungeliebt. Henry Miller kann nicht verwinden, dass seine Frau June ihre Geliebte Mara Andrews einfach in die eheliche Wohnung eingeladen hat – und er, der Ehemann, seine Kissen zusammenpacken und aufs Sofa ziehen musste. Nacht für Nacht ziehen die beiden Frauen trinkend durch die Bars, eines Abends hängt Miller in seiner Verzweiflung die Heiratsurkunde an den Flurspiegel, damit sie das Erste ist, was die beiden sehen, wenn sie torkelnd und kichernd die Treppe hinaufgefallen sind. Aber sie laufen daran vorbei und gehen ins Ehebett.
Ruth Landshoff küsst nur mit offenen Augen. Sie weiß gerne, wem sie da gerade an den Lippen hängt. Wie ein aufgeregter Vogel fliegt sie in diesen späten zwanziger Jahren in Berlin umher, immer zwitschernd, herumhüpfend zwischen Josephine Baker und Mopsa Sternheim und Klaus Mann und Karl Vollmoeller, zwischen Cafés und Salons und Varietés, zwischen high and low und zwischen den Geschlechtern, man erschrickt fast, wenn sie einmal ruhig dasitzt oder gar schweigt. Sobald sie lächelt, fließt das Gold. Wenn sie nicht lächelt, wirkt es, als weine sie.
Heute holt sie Charlie Chaplin vom Flughafen ab. Sie soll ihm Berlin zeigen. Aber sie wird ihm vor allem sich selbst zeigen.
Die fünfzigjährige Alma Mahler heiratet am 6. Juli 1929 endlich den elf Jahre jüngeren Schriftsteller Franz Werfel, ihr »Mannkind«, und wird zu Alma Mahler-Werfel. Sie haben da bereits zehn Jahre in wilder Ehe zusammengelebt, und Werfel ist sehr dankbar, sich schon unmittelbar nach der Heirat wieder in Almas Haus in Breitenstein am Semmering zurückziehen zu dürfen. Sie heiraten also an dem Punkt, an dem sie eigentlich kurz vor der Trennung stehen. Alma will, dass Werfel »Weltliteratur« produziert – und er ist froh, so oft wie möglich seine Ruhe zu haben. Denn Alma will eigentlich immer nur über Sex tratschen, also wer mit wem gerade ein Verhältnis hat. Wenn sie so in Wallung kommt und dazu noch ein Glas ihres Lieblingslikörs Benediktiner nach dem anderen gierig herunterkippt, sehnsüchtig nach der »starken Empfindung«, packt der geschwächte Franz seine Koffer und seinen Hut und zieht rasch hinauf in die Ruhe der Berge. Der jüdische Werfel hat inzwischen regelrecht Angst vor den antisemitischen Wutattacken seiner Frau. So ist er sehr froh, dass sie meist auf Reisen ist. Kaum ist sie nach der Hochzeit nach Venedig abgerauscht, tritt Werfel heimlich wieder dem Judentum bei – für die Hochzeit hat Alma vier Wochen zuvor seinen Austritt verlangt (und seine jüdischen Eltern wollte sie auf der Hochzeitsfeier auch partout nicht sehen). Sie schreibt benebelt in ihr Tagebuch: »Ich trinke, um glücklich sein zu können.« Und er schreibt ein Buch nach dem anderen, um nicht unglücklich zu werden.
Er war schon vollkommen erschöpft, als er 1874 auf die Welt kam. »Ganz vergessener Völker Müdigkeiten / kann ich nicht abtun von meinen Lidern«, so dichtete Hugo von Hofmannsthal als achtzehnjähriges Wunderkind. Da wurde Wien aber überhaupt erst wach, und der Weltgeist weckte die wilden kreativen Energien bei Egon Schiele und Georg Trakl, bei Ludwig Wittgenstein und Sigmund Freud, bei Arthur Schnitzler und Karl Kraus und all den anderen. Hugo von Hofmannsthal stand da nur daneben, hilflos den Modernisierungsschüben um sich ausgeliefert, er ist mit 25 Jahren bereits eine Legende gewesen und jetzt, mit 55, ein gutgekleidetes Fossil, ein Aristokrat des Geistes, ein unerträglicher Snob und ein gelegentlicher Libretto-Lieferant für Richard Strauss. Und zwischendurch etwas Prosa, so fein gezwirbelt wie die Enden seines Schnurrbartes. Er hatte verkündet, dass die »konservative Revolution« die große Vision der zwanziger Jahre sein müsse. Und dazu gehört für ihn eine permanente Verteidigung der Ehe. Ja, all seine Lustspiele und Libretti sind in Wahrheit dröhnende Verherrlichungen der Ehe, alles, so schreibt er an seinen Freund Carl Burckhardt, was er darüber denke, sei in seinen Stücken versteckt. So gut versteckt offenbar, dass seine eigene Frau Gerty sehr lange danach suchen muss. Denn der große Theoretiker der Ehe ist als Praktiker nicht sonderlich aktiv. Seine Haupttugend als Ehemann scheint Verständnis zu sein. So findet er es völlig richtig, dass sich seine Frau nicht für die Themen interessiert, die er mit seinen Freunden bespricht. Und dass sie aus dem Zimmer geht, wenn er etwas vorlesen möchte: »Eine Ehe«, so sagt er, »besteht nicht darin, dass man alles teilt.«
In seinen Büchern drückt er es etwas komplizierter aus. Die Ehe, so schreibt er in Ad me ipsum, löse die »zwei Antinomien des Daseins, die der vergehenden Zeit und Dauer – und die der Einsamkeit und der Gemeinschaft«. Leben ohne Bindung führe deshalb zu einem Leben ohne Bestimmung, wer nicht heirate, vegetiere vor sich hin in einer Art »Präexistenz«. Es ist relativ naheliegend, dass sich Hugo von Hofmannsthal mit diesen Theorien in den Goldenen Zwanzigern in Berlin und Paris eher nicht durchsetzen kann. In Rodaun aber, dem vornehmen Vorort Wiens, in den er sich zurückgezogen hat, und in Salzburg, bei den Festspielen, da nehmen die Ehepaare seine gesungenen Thesen mit einem dankbaren Lächeln auf und halten sich ein paar Sekunden fest an der Hand.
Und wie oft hält wohl Hugo von Hofmannsthal selbst seine Gerty an der Hand? Das ist sehr schwer zu sagen. In seiner gesamten Prosa und seinen Briefen kommen zwei Personen eigentlich überhaupt nicht vor: Gerty und er selbst, ja sogar seinen Freunden gilt er als der größte Ich-Verschweiger, sowohl was sein Innenleben als auch was seine jüdische Herkunft betrifft. Und das soll auch so bleiben, schon in den zwanziger Jahren warnt er alle panisch davor, über ihn eine Biographie schreiben zu wollen, das sei »läppisch«, er werde Weisungen hinterlassen, um »dieses verwässernde Geschwätz zu unterdrücken«.
Seine innersten, gefährdetsten Zonen verschließt er also fest, das Körperliche, das Erotische hat seine übersensible Seele unter einen Bann gestellt. Ehe ist für ihn eine Sache des Kopfes – einfach, so kann man sagen, ein vollkommen überzeugendes Konzept. Ob er selbst merkt, dass es bei diesem wie bei so vielen guten Konzepten ein Umsetzungsproblem gibt? Drei Kinder bekommt seine Frau Gerty von ihm, 1902 Christiane, 1903 Franz und 1906 Raimund, aber Hugo von Hofmannsthal richtet es so ein, dass er zu den jeweiligen Geburtsterminen gerade auf ausgedehnten Vortragsreisen im Ausland unterwegs ist. Und er hat es auch nicht eilig zurückzukommen. Ja, er ist lebenslang ein Virtuose in der Kunst, sich zu entziehen. Freunden, Pflichten, Kindern, der Arbeit. Und den Frauen? Wir wissen es nicht. Stefan George hat er als junger Mann zwar abgewiesen, aber er pflegt enge Freundschaften mit vielen Homosexuellen, mit Leopold von Andrian, mit Rudolf Alexander Schröder, mit Harry Graf Kessler. Und dieser Graf Kessler notiert in seiner Hellsicht früh: Wenn Hofmannsthal mit Frauen rede, habe das »etwas von einem Diplomaten, von einem Achtzigjährigen«. Da ist Hofmannsthal gerade dreißig.
Als er Gerty Schlesinger, seine künftige Frau, kennengelernt hat, schreibt er ihrem Bruder, warum er sie zur Gattin erwählt: »Dem Leben steht sie mit Vertrauen und ganz ohne Sehnsucht gegenüber.« Das scheint ihn zu entspannen. Gerty habe »einen glücklichen Mangel an Schwere«. Oder anders und sehr viel unschöner gesagt: Sie habe eine wunderbare Art, »alles, was ihr geistig nicht gemäß ist, einfach damit abzuwehren, dass sie eine gewisse Beschränktheit ihres Verstandes mit freundlichem Gleichmut als ein Gegebenes ansieht«. Damit sei sie völlig zufrieden, so dass es keinen Sinn habe, »sie durch Bücher oder Gespräche über irgend etwas aufzuklären«. So also stellt sich Hugo von Hofmannsthal eine ideale Ehefrau vor.
Ja, wenn Hofmannsthal davon spricht, dass er »das Leben nicht ohne Ehe denken kann«, dann hat das in seiner Lautstärke und Bestimmtheit immer auch einen Hauch von Abwehrzauber. Ehe in seinem Fall also eher als ein Modell formvollendeter Einsamkeit. Ein lebenslanger Versuch, die eigenen homophilen Neigungen wortreich zu untergraben. Als habe der Verfasser des Librettos für den Rosenkavalier in der Öffentlichkeit ein besonders leuchtendes Bild der Gattung »Ehemann« erschaffen wollen, um sich so vor sich selbst zu schützen. Es scheint fast, als habe er seine wahren Neigungen durch permanente Verschönerung der Fassade und die lyrischen Panzer der Kunst auch vor sich selbst perfekt versteckt. Es gibt keinen Gustav von Aschenbach in seinem Werk, der jungen Männern am Lido sehnsuchtsvoll nachblickt, keinen adretten Kellner, der durch die Tagebücher stolziert wie bei Thomas Mann. Es ist mit der Ehe bei Hugo von Hofmannsthal ein wenig so wie mit dem Heldenmut: Während des Ersten Weltkrieges rühmt er allüberall den kühnen Siegeswillen und die männliche Opferbereitschaft der Soldaten, er selbst aber setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um von der lebensgefährlichen Front schnellstmöglich in die warme Schreibstube versetzt zu werden.
Seiner schlimmsten Schlacht jedoch kann er nicht entfliehen. Im Sommer 1929 wird aus dem Waffenstillstand zwischen ihm und seinem Sohn Franz ein zermürbender Stellungskrieg. Der vom Leben gezeichnete Sohn zieht mit 26 Jahren zurück zu den Eltern ins Haus nach Rodaun. Franz kämpft darum, aus dem Schatten des mächtigen Vaters treten zu dürfen, dichtet, verliebt sich unglücklich, wettert gegen den Übervater, der seine Schwester bevorzugt. Aber immer wieder stockt ihm die Stimme, schweigt er in seiner Wut, als könne er nicht wirklich sagen, was seine Seele martert. Dann plötzlich, eines Nachts, am 13. Juli ein Schuss im Zimmer des Sohnes. Hugo von Hofmannsthal und seine Frau Gerty schrecken in ihren jeweiligen Schlafzimmern auf. Franz hat sich erschossen. Hugo von Hofmannsthal sitzt nur noch apathisch im Sessel. Als er sich am 15. Juli daraus erheben will, um zur Beerdigung seines Sohnes aufzubrechen, stirbt er an einem Schlaganfall. Nein: an gebrochenem Herzen. »Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht.« (1. Johannes, 5,12) Hugo von Hofmannsthal wird zwei Tage später auf dem Kalksburger Friedhof neben dem frischen Grab Franz von Hofmannsthals beigesetzt. Da er sich dem Orden der Franziskaner eng verbunden fühlte, wird er seinem letzten Willen gemäß im Gewand eines Franziskaners beerdigt. So endet das Leben dieses großen Theoretikers der Ehe als keuscher Mönch.