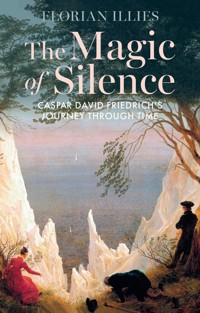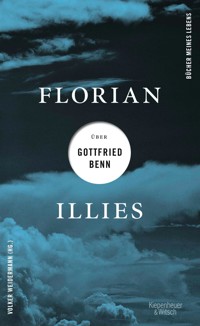22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»So elegant und mühelos erzählt. Dieses neue Buch von Florian Illies zu lesen, ist wie einen Billy-Wilder-Film zu schauen – einfach großartig.« Ferdinand von Schirach Mit Florian Illies kann man Vergangenheit plötzlich als Gegenwart erleben. In »Zauber der Stille« breitet er erstmals die abenteuerlichen Geschichten Caspar David Friedrichs vor uns aus. Eine wilde Zeitreise zu dem Mann, der für die Deutschen die Sehnsucht erfand. Friedrichs abendliche Himmel wecken seit Jahrhunderten die leidenschaftlichsten Gefühle: Goethe macht ihre Melancholie so rasend, dass er sie auf der Tischkante zerschlagen will, Walt Disney hingegen verliebt sich so heftig in sie, dass er sein »Bambi« nur durch Friedrich'sche Landschaften laufen lässt. Von Hitler so verehrt wie von Rainer Maria Rilke, von Stalin so gehasst wie von den 68ern, von der Mafia so heiß begehrt wie von Leni Riefenstahl – am Beispiel von Caspar David Friedrich werden in diesem mitreißend erzählten Buch 250 Jahre deutscher Geschichte sichtbar. Und Friedrich, der Maler, wird zu einem Menschen aus Fleisch und Blut. Nach »1913« und »Liebe in Zeiten des Hasses« das dritte große historische Epochenportrait von Florian Illies.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Florian Illies
Zauber der Stille
Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten
Über dieses Buch
Das abenteuerliche Leben der Sehnsuchtsbilder von Caspar David Friedrich
Kein deutscher Maler löst solche Emotionen aus wie Caspar David Friedrich: Seine abendlichen Himmel sind bis heute Ikonen der Sehnsucht, er inspirierte Samuel Beckett zu »Warten auf Godot« und Walt Disney zu »Bambi« – Goethe jedoch machte die rätselhafte Melancholie seiner Bilder so wütend, dass er sie auf der Tischkante zerschlagen wollte.
In seiner groß angelegten Reise durch die Zeiten erzählt Florian Illies erstmals die Geschichte der Bilder Friedrichs: Zahllose seiner schönsten Gemälde sind verbrannt, erst in seinem Geburtshaus und dann im Zweiten Weltkrieg, andere, wie der »Kreidefelsen auf Rügen« tauchen hundert Jahre nach Friedrichs Tod aus dem Nebel der Geschichte auf. Illies erzählt, wie Friedrichs Bilder am russischen Zarenhof landen, zwischen den Winterreifen in einer Autowerkstatt der Mafia und in der Küche einer hessischen Sozialwohnung. Von Hitler so verehrt wie von Heinrich von Kleist, von Stalin so gehasst wie von den 68ern – am Beispiel von Friedrich werden 250 Jahre deutsche Geschichte sichtbar.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Mit Eleganz und Leichtigkeit verwandelt Florian Illies vergangene Epochen in lebendige Gegenwart. Er zieht überraschende Querverbindungen zwischen den Protagonisten und verknüpft Szenen und Momentaufnahmen zu mitreißenden Panoramen. Sein Welterfolg »1913. Der Sommer des Jahrhunderts«, mit dem Illies ein neues Genre begründete, führte monatelang die SPIEGEL-Bestsellerliste an. Illies, geboren 1971, studierte Kunstgeschichte in Bonn und Oxford. Er war Feuilletonchef der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« und der »ZEIT«, Verleger des Rowohlt Verlages, leitete das Auktionshaus Grisebach und war Mitbegründer der Kunstzeitschrift »Monopol«. Heute ist Florian Illies Mitherausgeber der »ZEIT«, Kurator und freier Schriftsteller. Bei S. FISCHER erschien zuletzt das inzwischen in 18 Sprachen übersetzte Epochenportrait »Liebe in Zeiten des Hasses«. Sein Kunst-Podcast »Augen zu« (gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo) gehört zu den meistgehörten Podcasts deutscher Sprache. Er lebt in Berlin.
Inhalt
Auf dem Segler
Kapitel I Feuer
Kapitel II Wasser
Kapitel III Erde
Kapitel IV Luft
Dank
Zeittafel
Weiterführende Literatur
Abbildungsnachweis
Auf dem Segler
Es ist ein schöner Augusttag des Jahres 1818. Leuchtende Sonne, glitzerndes Meer. Am frühen Morgen sind sie beide in Wiek auf Rügen an Bord gegangen, haben ihr Gepäck und Friedrichs Malsachen auf dem kleinen Segler verstaut, und dann sind sie lautlos über den verschlafenen Bodden geglitten, haben rechts die hellgrünen Buchenhaine von Hiddensee passiert, um dann mit ihrem Segler südlichen Kurs auf Stralsund zu nehmen. Von Osten, von Rügens sanften Hügeln und den Hünengräbern aus tiefversunkener Zeit, weht ein warmer Wind herüber, der die Segel bläht, bis die Taue ihre Muskeln spannen. Oh, wie liebt er diesen Moment, wenn sich die großen Leinensegel plötzlich lauthals straffen und dann das Schiff auf magische Weise in Gang setzen. Hat eigentlich, so fragt er sich, der menschliche Geist je etwas Schöneres erdacht? Genau so will er es auch machen, wenn er zurück in Dresden ist, so unsichtbar den Stoff der Leinwand mit seinem Pinsel beleben wie der Wind das Segel. Da reißt ihn Line aus seinen Gedanken, schau, Caspar, sagt sie, schau doch, da bei den Sandbänken, siehst du die Seehunde, wie sie aus den Fluten steigen? Entschuldige, Line, lächelt er verlegen, entschuldige bitte, ich war ganz in meinen Träumen versunken.
Es ist der 11. August 1818, sie haben gerade ihre Flitterwochen auf Rügen verbracht, er, der kauzige 44-jährige Maler aus Greifswald, und sie, die 25-jährige Dresdnerin. Auf ihrem Segler ist es still, manchmal hören sie aus der Luft die kräftigen Flügelschläge und das Kreischen der Möwen, und ab und an spritzt die Gischt herauf zu ihnen und ein paar salzige Tropfen glitzern dann noch eine Weile in Friedrichs mächtigem roten Backenbart. Line ist noch nie auf einem Boot gewesen vor dieser Reise, sie hat richtig Angst gehabt, aber wenn sie denn untergehe, dann doch am liebsten gleich mit ihm, hat sie gesagt, ja, das hat sie wirklich gesagt. Caspar David Friedrich kann sein Glück nicht fassen. Wie habe ich dich nur gefunden, murmelt er und hält ihre Hand ganz fest. »Die Liebe ist ein schnurrig’ Ding«, hat er seinem Bruder Christian geschrieben, als er sie Hals über Kopf geheiratet hat. Line, das Landei, verstehe inzwischen sogar perfekt, so schrieb er weiter, die pommerschen Heringe zu schnabelieren, die er dem Hochzeitspaar aus Greifswald geschickt habe. Ja, seit sich bei ihm das Ich in ein Wir verwandelt habe, sei in seiner Wohnung in Dresden manches anders geworden. Gut, er dürfe jetzt nicht mehr überall volle Spucknäpfe herumstehen haben, das störe sie, aber ansonsten: »Es wird mehr gegessen, mehr getrunken, mehr geschlafen, mehr geschäkert, mehr gelepscht.« Ja, gelepscht, das hat er geschrieben, was immer das jenseits von Dresden heißen mag, auf jeden Fall bekommen sie gleich im nächsten Jahr ihr erstes Kind.
Fast einen ganzen Tag dauert ihre Segelfahrt durch das glitzernde Wasser des Boddens, das mal dunkelblau leuchtet und mal türkis, Friedrich kann nicht genug davon bekommen, er saugt alles auf mit seinen Maleraugen, die Boote, die Taue, den Mast, das knatternde Segel, die Küstenlinien links und rechts, die sattgrünen Bäume über den Klippen. Als dieser magische Augusttag langsam verdämmert, steckt die Wärme der Sonnenstrahlen noch immer im Holz der Planken unter ihnen, sie brauchen keinen Mantel und keinen Schal. Da taucht Stralsund im abendlichen Dunst vor ihnen auf, wie eine Erscheinung. Line steckt sich feierlich die Haare hoch. Aus dem rötlichen Licht erheben sich die Türme der Stadt, ihr Segler gleitet sanft darauf zu, Friedrich ist voll sehnsüchtiger Andacht und, so glaubt er, Line auch. Genau diesen Moment muss ich malen, denkt er voll innerem Feuer; vielleicht, vielleicht bin ich gerade das erste Mal in meinem Leben wirklich glücklich, das Wasser unter mir, die Erde vor mir, die Luft um mich, meine Hand in der ihren.
Können wir bitte, fragt ihn Line da plötzlich, heute Abend in Stralsund einmal etwas anderes essen als Fisch?
Kapitel IFeuer
Lau ist diese Frühsommernacht, der Himmel verfärbt sich gerade langsam von einem tiefen Dunkelblau in ein zartes Hellgelb, und in den Fliederbüschen singen die Nachtigallen ihr letztes Lied. Da fängt München urplötzlich an zu leuchten: Meterhoch schlagen grellrote Flammen aus dem riesigen Glaspalast in die Höhe, der Widerschein des Feuers erhellt die Häuserfronten der nahen Sophien- und Elisenstraße, und das ganze Firmament scheint zu flackern. Die Stille wird von dem ohrenbetäubenden Bersten der riesigen Eisenstränge und den zersplitternden Fenstern zerrissen, die krachend hinabstürzen in den Feuerschlund.
Es ist der frühe Morgen des 6. Juni 1931. Alles, was Caspar David Friedrich geliebt hat, geht im Münchner Glaspalast in Flammen auf: das Gemälde vom steinigen »Ostseestrand«, seinem ewigen Sehnsuchtsort, »Der Hafen in Greifswald«, das Bild seiner wehmütig vermissten Geburtsstadt, der tägliche Blick aus dem Fenster seiner Wohnung, eingefangen in der »Augustusbrücke in Dresden«, und, besonders schmerzlich, die »Abendstunde«, das Bild seiner Frau Line und ihrer Tochter Emma, die sich umarmen und dabei versonnen aus dem Fenster in eine laue sächsische Frühsommernacht hinausschauen. Gierig verschlingen die Flammen das trockene Holz der Keilrahmen und lassen die Reste der Leinwände als kleine schwarze Aschefetzen in den verschlafenen Himmel hinaufwirbeln, immer wieder aufs Neue werden sie von den heißen Wogen der Flammen in die Höhe geweht, immer und immer wieder, bis das Auge sie irgendwann nicht mehr sehen kann.
Die Trägergesellschaft des Münchner Glaspalastes hat, da Glas und Stahl ja ganz offensichtlich nicht brennen können, die 1854 beim Bau geschlossene Feuerversicherung für das Gebäude übrigens im Jahr 1931 aus Kostengründen erstmals nicht verlängert.
In der Wohnung von Eugen Roth, nur hundert Schritte vom Glaspalast entfernt, klingelt um kurz nach halb vier am 6. Juni 1931 schrill das Telefon. Die Redaktion der Münchner Neuesten Nachrichten ist am Apparat, und sie beordert ihren Lokalreporter schnellstmöglich zum brennenden Glaspalast. Roth zieht hastig seine Kleider an und legt mit schläfrigen Fingern einen Film in seine Kamera. Dann blickt er kurz auf die zwei Zeichnungen von Caspar David Friedrich, die über seinem Bett noch im Dämmerlicht schlummern. Aber er kennt jeden Grashalm auf ihnen, egal, ob es hell ist oder dunkel, Roth ist ein besessener Sammler, jede Mark, die ihm sein Schreiben lässt, trägt er zu den Kunsthändlern der Stadt, und sein Gott heißt Caspar David Friedrich. Jeden Abend vor dem Einschlafen schaut er kurz auf dessen kleines Blatt aus der Sächsischen Schweiz und lange auf den stillen, magischen Ostseestrand, den Friedrich auf Rügen gezeichnet hat.
Letzte Woche ist Roth bei der glanzvollen Eröffnung der Sonderausstellung »Werke deutscher Romantiker von Caspar David Friedrich bis Moritz von Schwind« im Glaspalast gewesen, 110 der schönsten romantischen Bilder überhaupt, geliehen aus den besten Museen. Und für den Nachmittag dieses dienstfreien Samstags hat er sich tatsächlich vorgenommen, ein zweites Mal hinzugehen, um zu schauen und zu genießen. Nun hetzt er leider schon zwölf Stunden früher als geplant dorthin, und er ahnt, dass statt Genuss das Entsetzen auf ihn warten wird. Die Glocke der Dreifaltigkeitskirche schlägt viermal, als er sich von der Arcisstraße her den Weg über die prallen roten Schläuche der Feuerwehr bahnt und den Schutzmännern seinen Presseausweis entgegenhält. Der Himmel über ihm ist dunkelrot, und da sieht er ihn – den Glaspalast oder das, was von ihm übrig ist. Auf 234 Metern Länge und auf 67 Metern Breite brennt das gigantische Gebäude lichterloh, ihm schlagen die Hitzeschwaden wie glühende Fäuste ins Gesicht. Er versteckt sich in einem Hauseingang, zückt Bleistift und Notizbuch und will schreiben, doch er kann seinen Blick nicht von dem grauenvollen Schauspiel vor seinen Augen abwenden. Er denkt hier in den frühen Morgenstunden dieses schönen und schrecklichen Junitages an jedes einzelne der neun Gemälde Caspar David Friedrichs, das dort gerade vor seinen Augen verglimmt, an die »Abendstunde« mit Frau und Tochter, an den Hafen von Greifswald, die Riesengebirgslandschaft. Er denkt an den armen Mann, der auf dem »Herbstbild« auf verlassenen Feldern karge Äste sammelt, um sich abends ein Feuer anzuzünden, und der nun selbst in den Flammen versinkt. Und dann denkt er natürlich vor allem an sein liebstes Bild, an die »Dame am Meeresstrand«, die mit einem Taschentuch einem Boot hinterherwinkt, sehr zart, er sieht ihren Gruß noch vor sich, es hat ihn sehr gerührt, nun weiß er, dass es ein Abschied für immer ist. Ihr weißes Taschentuch ist ein schwarzer Aschefetzen geworden; die Dame ist nicht mehr von dieser Welt. Um nicht zu weinen, fängt Eugen Roth an zu schreiben: »Der Blick irrt über das Feuermeer. Züngelnd schlägt es herauf, wie Brandung donnert es heran, sinkt hinunter, braust wieder empor, funkelnd, zerstiebend und verzuckend, mit breiten Zungen fressend, feige zurückgeduckt vor dem schmetternden Wasserstrahl und sofort wieder tausendfach anlaufend, höhnisch tanzend und winkend und wirbelnd.«
Nur wenige Stunden später wird sein bebender Augenzeugenbericht in der Frühausgabe der Münchner Neuesten Nachrichten erscheinen, die Zeitungsjungen werden ihn lauthals anpreisen, wenn sie durch die Gassen in Schwabing und über den in Schreck erstarrten Marienplatz laufen. Eugen Roth zeichnet in seinem Text ein Porträt dieses Feuers, mit einer Genauigkeit, als sei er Caspar David Friedrich, jede einzelne Flamme sieht er, jeden Widerschein am Firmament, jeden brodelnden, fauchenden Wind, ja, mit diesem Text wird er zu dem Dichter, der er werden will. Irgendwann muss er abbrechen beim Schreiben im Ascheregen, weil er die verzweifelten Tauben nicht mehr aushält, sie flattern panisch durch die Luft, fliegen selbstvergessen in das Flammenmeer hinein, bis Eugen Roth begreift, dass sie in den Nischen der Eisenstangen ihre Nester suchen, in denen doch gerade noch ihre Jungvögel selig unter ihrem Gefieder geschlummert haben.
Und wie hat wohl Thomas Mann dieses verstörend leuchtende München, diesen verheerenden Brand am frühen Morgen des 6. Juni erlebt, der ausgerechnet sein 56. Geburtstag ist? Ob er sich bei seiner Frau Katia beschwert hat über den unnötigen Lärm der Feuerwehr? Oder über den unerfreulichen Brandgeruch, der seine Nase »affiziere«? Ob er sich die Brandstätte angeschaut hat? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er im Juli eine Benefizlesung in der Universität halten wird, um Geld für die Brandopfer zu sammeln. Und dass er Adele Schopenhauer in seinem wenig später geschriebenen Roman Lotte in Weimar von dem »himmlischen David Caspar Friedrich« schwärmen lässt. Das ist alles, was wir wissen, denn die Tagebücher des Jahres 1931, die uns Auskunft über seine Reaktion auf diese Vernichtung der Schätze der romantischen Malerei geben könnten, hat Thomas Mann im Jahre 1945 im Garten seines Hauses im kalifornischen Exil von Pacific Palisades ganz unromantisch, nun ja, verbrannt.
Adolf Hitler und seine Nichte Geli Raubal, die Tochter seiner Halbschwester, mit der er seit zwei Jahren am Prinzregentenplatz 16 in München in einer wie auch immer gearteten Lebensgemeinschaft zusammenwohnt, werden von den Sirenen der Feuerwehrfahrzeuge, die die ganze Stadt durchdröhnen, aus dem Schlaf gerissen. Aus allen Stadtteilen eilen die Löschzüge herbei, die Münchner reißen ihre Fenster auf, schauen in der morgendlichen Dämmerung in Richtung der gigantischen Rauchschwaden, die von den frühen Winden aus der Innenstadt schnell bis weit nach Schwabing getrieben werden.
Hunderte von Menschen laufen schlaftrunken und verstört durch die Straßen, hin und her gerissen zwischen Angst und Neugier. Am Himmel kämpfen die ersten Strahlen der Sonne mit dem roten Widerschein der Flammen und den rußigen Aschewolken. Als Hitler den Stachus erreicht, sieht er, dass der gigantische Glaspalast, die Zierde Münchens, die als unbrennbar galt, sich in ein einziges brodelndes Feuermeer verwandelt hat, die Abertausenden Glasscheiben sind zerbrochen, und die Eisenträger sehen aus wie ein riesiges schwarzgekohltes Spinnennetz, durch das sich die Flammen wild emporranken. Die Kronen der hohen Linden, die den Glaspalast umstehen, rauschen panisch im Wind des Feuers, ihre hellgrünen Blätter versengen in der Hitze und rollen sich ein. Vor ein paar Tagen erst hat Hitler hier im Glaspalast die große Ausstellung deutscher Romantiker besucht, die prachtvollste Zusammenstellung aus deutschen Museen seit Jahrzehnten. Doch jetzt haben die Flammen all diese 110 einzigartigen Bilder von Runge, von Friedrich und Schinkel geraubt, zerstört, dem Gedächtnis für immer entrissen. In Hitler wächst eine unbändige Wut. Er schwört sich, dass er hier, am Ort dieses zerstörerischen Feuers, der deutschen Kunst einen Tempel bauen wird, der niemals vergehen soll, ein »Haus der Kunst«. Genau so wird es kommen. Und Geli Raubal, die Nichte Hitlers, wird drei Monate nach dem schockierenden Brand des Glaspalastes, am 18. September 1931, in der gemeinsamen Wohnung am Prinzregentenplatz 16, deren Miete von den Tantiemen für Mein Kampf bezahlt wird, im Alter von 23 Jahren ein tödliches Feuer auf sich selbst eröffnen.
Caspar David Friedrich spielt mit dem Feuer. Ständig zeichnet er Figuren, obwohl er es überhaupt nicht kann. An der Akademie in Kopenhagen haben sie ihn schon verlacht deswegen, und in Dresden, da verspotten sie ihn schon wieder dafür. Dieses Aktzeichnen. Er bekommt es einfach nicht hin. Immer sind die Beine zu lang und die Oberkörper schlaff. »Sie sind doch der größte Aktzeichner hier«, spottet der Maler Johann Joachim Faber, als sie in der Dresdner Akademie nebeneinandersitzen, »ich meine: der längste Aktzeichner.« Friedrich funkelt ihn zornig an durch seine roten Wimpern. Wenn der wüsste. Bei ihrem breiten Sächsisch sollten die Sächsinnen doch eigentlich froh sein, wenn er sie ein bisschen länger zeichnet. Aber so witzig ist er nur, wenn er an seine Brüder schreibt. Bei den nackten Fräuleins im Zeichensaal vergeht ihm der Humor, sie kann er immer nur ganz kurz ansehen – dann muss er erst einmal lange weggucken, weil ihm etwas blümerant wird, kein Wunder eigentlich, dass dann auch die Arme und Beine sehr langatmig werden. Ach, die Menschen, denkt er dann, sie sind mir so fremd. Und die Frauen erst. Wären sie Bäume, dann wüsste er, wie sie fühlen. Dann könnte er sie stundenlang anschauen und malen, in all ihren Details.
Wir schreiben das Jahr 1802, der kauzige Pommer, ein Spargeltarzan mit rotem Backenbart und schleppendem Gang, hat sich ein kleines Zimmer bei der Witwe Vetter am Festungsgraben in Dresden genommen, er nennt sie »Madam« und ihre halbwüchsigen Töchter »Madmosels«, aber die sind längst tödlich beleidigt, weil er sie nie anspricht, nicht ausführt, und ihnen keine Blume schießt, wenn Kirmes ist. Macht er seinen Mund auf, dann verkrampft sich alles, er bekommt nichts heraus, sein bleiches Gesicht läuft rot an, er ist heilfroh, wenn er an einem Tag nicht mehr sagen muss als »Guten Morgen« und »Guten Abend«, oder noch besser, nur »Nu«, das schöne Wort hat er in Dresden gelernt, und das passt eigentlich immer. Es ist mehr ein Seufzer als ein Wort. So sitzt er nun in einer Winternacht bei Kerzenschein in seiner kargen Stube, die Wirtin und ihre Töchter schlafen endlich, es ist kalt, darum hat er den Pelzmantel an, den ihm seine Familie aus dem hohen Norden geschickt hat, damit er im fernen Sachsen überlebt. Und die Kerzen, die kommen auch aus der Heimat, direkt aus seinem Elternhaus in Greifswald, der Bruder zieht sie mit dem Vater in ihrer kleinen Seifensiederwerkstatt hinter dem Dom. Sein Vater hat gewollt, dass auch Caspar David dieses Handwerk erlerne, aber er ist zu ungeschickt, ständig hat er sich die Finger verbrannt. Und so zieht er statt der Kerzen die Personen auf seinen Zeichnungen in die Länge. Das nennt man Familientradition.
Friedrich nimmt also an diesem trübsinnigen Dresdner Winterabend die Radiernadel zur Hand und kratzt feinste Linien in die Metallplatte. Er fängt, natürlich, mit den Bäumen an, große Linden in voller Pracht, das kann er. Davor Ruinen, das kann er auch, er ist schließlich Romantiker. Doch dann entwirft er noch eine kauernde Frau und einen Mann mit Hut, der ungelenk und überlängt an einer Säule lehnt. Man sieht deutlich, dass der Künstler gehörige Probleme hat, sie zu zeichnen, und versteht trotzdem nicht genau, welches Problem die beiden haben. Sie scheinen in jedem Fall mit der Gesamtsituation unzufrieden zu sein. Erst der Titel erklärt die Lage: »Mann und Frau vor den Resten ihres verbrannten Hauses«, so nennt Friedrich dieses verstörende Blatt. Der Brand muss aber schon eine Weile her sein, denn es brennt nichts mehr, und es raucht auch nicht auf dem Bild, eigentlich wirken die Reste des Hauses sogar so antikisch, als läge das Feuer schon ein paar Jahrhunderte zurück. »Mann und Frau vor den Resten ihres verbrannten Hauses« – warum zeichnet man so etwas Deprimierendes? Und warum wundert man sich hinterher, dass es keiner kaufen will?
Ein paar Jahre später malt er noch mal ein verbranntes Haus. Er kann es nicht lassen. Diesmal in Öl, und diesmal auch mit Feuer. Und mit Rauch! Der zieht übers Gemälde und macht es düster und seltsam. Leider ist ohnehin Nacht auf dem Bild, man sieht kaum etwas, eine apokalyptische Landschaft. Ein verkohlter Dachstuhl glimmt vor sich hin. Vorne dunkle, krakelige Bäume, vom Feuer schwach beleuchtet. Darüber eine Kirche, unversehrt. Die Menschen hat Friedrich diesmal weggelassen, er hat eingesehen, dass das seine Sachen nicht besser macht. Aber es bleibt trotzdem ein seltsames Bild. Es hat keinen Zauber, etwas fehlt. Es hat keinen Himmel.
Hundert Jahre später, am 10. Oktober 1901 brennt Caspar David Friedrichs Geburtshaus in der Langen Straße 28 in Greifswald in der nachmittäglichen Dämmerung nieder. »Mann und Frau vor den Resten ihres verbrannten Hauses« aus Friedrichs Radierung von 1802, das sind also jetzt: der Enkel von Friedrichs Bruder Adolf, Adolph Wilhelm Langguth, und seine Ehefrau Therese. Der Brand ist gegen 17 Uhr am Nachmittag entstanden, als in der Drogerie und alten Seifensiederwerkstatt im Vorderhaus beim Kochen von Bohnermasse die Flammen auf einen Benzinbehälter übergesprungen sind, der sofort explodiert ist. Von dort greift das Feuer auf das Treppenhaus über und breitet sich, »unterstützt durch die vielen vorhandenen brennbaren Stoffe«, in den oberen Etagen aus. Welche brennbaren Stoffe das genau gewesen sind, darüber schweigt sich das Greifswalder Tageblatt vornehm aus. Als die ersten Löschzüge der Feuerwehr über den Marktplatz heranfahren, steht der hintere Gebäudeteil bereits in Flammen. Dutzende Feuerwehrmänner spritzen aus acht Schläuchen ohne Unterlass Wasser auf das brennende Haus. Der Himmel über Greifswald leuchtet, die dunklen Wolken erglühen in hellem Rot. Wegen des starken Qualms ist ein Vordringen der Feuerwehrmänner in das enge Gebäude selbst unmöglich, sie müssen von außen löschen und pausenlos Wasser in die Glut spritzen. Das Vordergebäude brennt dennoch komplett ab, und die Feuerwehr schützt nun die umliegenden Gebäude, damit sich die Flammen in den engen Gassen nicht weiter ausbreiten und vor allem der nahe Dom nicht in Gefahr gerät. Es sieht genauso aus wie auf Friedrichs Bild »Brennendes Haus«: vorne die verkohlten Reste des Dachstuhls, dahinter in alter unzerstörbarer Pracht die Kirche.
Nach drei Stunden ziehen die Löschzüge ab, sie haben getan, was sie konnten. Die ganze Stadt riecht nach Rauch und Ruß, und aus den Resten des stark zerstörten Hauses steigt Dampf auf. Die Polizei hat eingreifen und die Unglücksstätte räumen müssen, ein Schaulustiger und sein halbwüchsiger Sohn haben sich beschwert und krakeelt, weil sie einen besseren Blick aufs Feuer haben wollten. Ihre Personalien sind laut Greifswalder Tageblatt festgehalten worden.
Dass allerdings zu den »vorhandenen brennbaren Stoffen« im Obergeschoss des Hintergebäudes auch neun Gemälde Caspar David Friedrichs aus altem Familienbesitz gehören, das ist nicht festgehalten worden. Um 1901 ist der Künstler in Deutschland komplett vergessen, in fast keinem öffentlichen Museum hängt ein Bild von ihm und auch in seiner pommerschen Familie gilt er nur noch als der skurrile malende Vorfahr, der einst aus der Hansestadt nach Sachsen geflüchtet ist, weil er zu tollpatschig zum Seifesieden und Kerzenziehen war.
Allein Alfred Lichtwark, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, weiß um die Einzigartigkeit der Bilder jenes schwarzen Schafes der Familie. Als er 1902 ein zweites Mal nach Greifswald kommt, um bei den Nachfahren der Geschwister Gemälde für sein Museum anzukaufen, da ist er geschockt: »Ein Teil der Bilder von Friedrich, zum Glück nicht die besten, sind, seit ich sie im Herbst gesehen, verbrannt. Ich suchte das Haus in der Langen Straße, an seiner Stelle erhebt sich ein Neubau. Der Besitzer führte mich auf den Speicher, dort lagerten die Ruinen. Es ist nichts mehr zu retten. Der Anblick bewegte mich. Rahmen und Leinwand waren unberührt, nur die Farbschicht hatte die Hitze nicht aushalten können.« Die Bilder sind nach dem Feuer mit Brandblasen bedeckt und verkohlt vom Ruß, die Malerei ist überall aufgeplatzt, die neun Bilder sehen aus wie eine Mondlandschaft, dunkelgrau, von Kratern übersät. Es sind ganz besondere, ganz familiäre Friedrichs, die zerstört werden: die beiden Porträts, die er von seiner Frau Caroline gemalt hat, einmal auf der Treppe, einmal mit einem Leuchter in der Hand, dann ein Bild von Neubrandenburg, der Heimatstadt seiner Mutter, mit dem dortigen Stargarder Tor und ein Gemälde des dunkelgrünen Uttewalder Grunds bei Dresden, in den er sich einmal sechs Tage lang verkrochen hat, als sich die napoleonischen Truppen genähert haben. Und eine Harzlandschaft ist darunter, eine Rügenlandschaft, ein Schiff am Strand bei Greifswald und die Ruine Eldena mit ihren mächtigen Eichen, die Friedrich so geliebt hat. Neun Bilder, eine Autobiographie. Nur ein Bild kann übrigens nicht aus den Flammen gerettet werden, Caspar David Friedrichs großes Selbstbildnis. Es verbrennt vollständig im Geburtshaus seines Schöpfers.
Um die vergangene Pracht der versengten Gemälde vielleicht doch wieder zum Leuchten zu bringen, wird in der Familie nach einer Lösung gesucht, die offenbar unbedingt den Vornamen Adolph tragen muss. Denn der Besitzer Adolph Langguth, der Enkel von Friedrichs Bruder Adolf Friedrich, bittet seinen Verwandten Friedrich Adolph Gustav Pflugradt um Hilfe, der der Enkel von Friedrichs Schwester Dorothea ist. Da er nicht nur Adolph heißt und irgendwie verwandt ist, sondern auch noch malt, übergibt man ihm die neun ruinierten Gemälde, er säubert und übermalt sie dann nassforsch und ohne jede Rücksicht mit bunten Farben. Die vielen Brandblasen drückt er mit dem Pinsel ein, damit seine Farben dann in den Löchern besser halten. Man weiß danach nicht, was schlimmer für die Bilder gewesen ist, der Brand oder Pflugradts Pinsel. Immerhin, den Ersten Weltkrieg überleben diese Gemälderuinen dann ohne neue Schäden in der Langen Straße 28. Der nächste Besitzer der neun armen Friedrichs, auch er irgendein verstreuter Urenkel der Schwester des Malers, ist dann pleitegegangen – oder, das ist in diesem Fall vielleicht das passendere Wort: Er ist abgebrannt. Zuvor hat er in der Weltkunst noch vergeblich ein Inserat aufgegeben: »Caspar David Friedrich Gemälde zu verkaufen«. Aber niemand hat sich gemeldet.
Irgendwie findet dann doch noch eines der Bilder, und zwar der düstere »Uttewalder Grund«, aus dem abgebrannten Greifswalder Geburtshaus den Weg nach Berlin. Es landet passenderweise bei Wolfgang Gurlitt, einem schillernden Kunsthändler, der selbst ständig fast pleite ist und dessen Liebesverhältnisse den goldenen zwanziger Jahren alle Ehre machen. Sein Charme wedelt welpenhaft in alle Richtungen. Und so lebt Gurlitt fröhlich mit seiner Exfrau, seiner ihm ebenfalls sehr zugewandten Exschwägerin, seiner neuen Ehefrau, ihren gemeinsamen Töchtern und seiner großen Liebe Lilly Agoston zusammen.
Muss man erst mal hinbekommen.
Gurlitts Damen leben in unterschiedlicher Besetzung in zwei Wohnungen im Berliner Westen, zwischen denen Gurlitt hin- und hersegelt. Als sein Lebensstil zu aufwendig wird und ihn die Gläubiger verklagen, versucht er sich mit einem Erotik-Verlag zu retten, in dem er Darstellungen seiner kurzzeitigen Geliebten Anita Berber veröffentlicht, doch das bringt ihm nur neue Prozesse wegen der Verbreitung unzüchtiger Schriften ein, 1932 muss er den Offenbarungseid leisten. In Gurlitts Galerie in der Potsdamer Straße hängt derweil jahrelang, jedes Auf und Ab des Lebens ignorierend, die arg mitgenommene Friedrich-Landschaft aus dem Uttewalder Grund an der Wand, aber niemand will sie ihm abkaufen. Wohlwollend betrachtet, ist vielleicht ein Fünftel des Bildes wirklich noch von des Meisters Hand gemalt, der Rest, die dunklen Brauns und Grüns der sächsischen Schluchten aber stammen von Friedrichs Nachfahren Pflugradt und verschiedenen Restauratoren, die die aufgeplatzten Brandblasen so lange mit Farbe gefüllt haben, bis jeder Zauber ausgelöscht ist.
Aber Gurlitt hütet dieses Bild wie seinen Augapfel, er nimmt es sogar, als er Deutschland wegen seiner jüdischen Großmutter verlassen muss, zwischen seinen Hemden in einem Koffer versteckt, mit nach Österreich. So rettet er den Friedrich vor dem zweiten, endgültigen Verbrennungstod, denn seine gesamte Berliner Wohnung wird in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1943 ausgebombt.
Gurlitt jedoch ist rechtzeitig mit seinem gesamten Harem, seinen Töchtern und seinen wertvollsten Bildern nach Bad Aussee übergesiedelt – und wohnt dort pikanterweise nur wenige hundert Meter neben jenem Kalistollen, in dem Adolf Hitler die wertvollsten Gemälde aus ganz Europa lagert, die er für sein geplantes »Führermuseum« in Linz zusammengeraubt hat. Dort liegen der »Genter Altar« von Jan van Eyck, Werke von Leonardo, von Michelangelo und Rembrandt unterirdisch versteckt. Sie alle kehren nach dem Krieg an ihren angestammten Ort zurück. Der halbverkohlte Friedrich aber bleibt in Gurlitts Haus in Bad Aussee. Da Gurlitt ganz offensichtlich ein Mann von größter Geschicklichkeit ist, der traumwandlerisch nicht nur durch die Klippen des Lebens segelt, sondern auch durch die Nazizeit, gelingt es ihm nach dem Krieg, sich als Direktor eines neuzugründenden Museums in Linz ins Spiel zu bringen. Das wird er auch tatsächlich, ohne allerdings seinen Kunsthandel ruhen zu lassen. In einem tollkühnen Coup kauft er als Museumsdirektor die eigene Kunstsammlung für einen Betrag von 1,6 Millionen Mark für sein Museum an. So verkauft Gurlitt den verbrannten und deshalb unverkäuflichen Friedrich am Ende also für einen stattlichen Preis an sich selbst, der Staat bezahlt und er kassiert.
Muss man auch erst einmal hinbekommen.
Wenn Caspar David Friedrich an seine Kindheit denkt und an seine Familie, dann sieht er immer lodernde Feuer vor sich und hat Aschegeruch in der Nase. Die Bechlys aus Neubrandenburg, die Eltern seiner Mutter, sind Schmiede gewesen, und von frühesten Kindertagen an hat der kleine Caspar David die Glut bestaunt, die das Metall der Hufeisen und der Stahlbeschläge zum Schmelzen gebracht hat.
Als er als junger Knabe einmal eine griechische Gottheit aus dem Zeichenbuch von Preissler, das ihm sein Lehrer Quistorp gegeben hat, malen soll, da entscheidet er sich natürlich für Hephaistos, den Gott des Feuers, den er genießerisch lächeln lässt. Im Keller seines eigenen Zuhauses, in der Langen Straße 28 in Greifswald, brennt zu jener Zeit täglich das Feuer unter dem großen Talgkessel, in dem sein strenger Vater und dessen Gesellen die Reste von Tieren zu Seife verkochen, ein übler Geruch, vor dem Friedrich sich ekelt, steht im ganzen Haus. Wie viel lieber hat er den anderen Geruch aus dem anderen Kessel, in dem das Wachs von den brennenden Holzscheiten flüssig gehalten wird, damit der Vater und seine Brüder Kerzen daraus ziehen können.
Wenn er später auf Reisen ist und beim tagelangen Wandern übers Land wehmütig wird und sich verloren fühlt, zieht er eine der Kerzen aus der Heimat aus seinem Rucksack und riecht daran. Dann geht es ihm gleich ein wenig besser.
Nachdem Walt Disney am 7. Juli 1935 von Baden-Baden nach München gereist ist, zieht er mit seiner Frau für einige Tage ins Hotel Grand Continental. Disney ist ins Dritte Reich gekommen, um mitzuerleben, wie eine seiner tierischen Erfindungen ins offizielle Kurzfilmprogramm der bayerischen Kinos aufgenommen wird, nämlich: Die lustige Palette – Im Reiche der Micky Maus. Auf Mäuseebene also dulden die Nationalsozialisten andere Herrschaftsbereiche, zumal Hitler ein ausdrücklicher Freund der Walt Disney Produktionen ist. Den galanten Amerikaner Disney mit seinem weltmännischen schmalen Schnurrbart und dem wohligen kalifornischen Teint zieht es nach der Filmvorführung in die Münchner Buchhandlungen, zu Chr. Kaiser im Rathaus und Hugendubel am Salvatorplatz. Die Buchhändler und Buchhändlerinnen bekommen leuchtende Augen, denn Disney kauft an diesem Tag nicht weniger als 149 Bildbände und illustrierte Bücher bei ihnen. Er will die europäische Zeichen- und Malkunst mit in sein Studio nach Hollywood nehmen, er braucht die Ideen von Ludwig Richter, den Zeichenstil des Simplicissimus und die Landschaften von Caspar David Friedrich als Anregung für die jungen Zeichner in seiner explodierenden Traumfabrik. Deutsche Maler-Poeten von Georg Jacob Wolf nimmt er sich mit auf das Schiff, mit dem er nach Amerika zurückfährt, aber auch Der deutsche Wald und seine Vögel.
Drei Jahre später, im Sommer 1938 wird Disney und Thomas Mann in Harvard gleichzeitig die Ehrendoktorwürde verliehen. Und beim festlichen Dinner danach hat wohl Dr.h.c. Thomas Mann seinen Tischnachbarn Dr.h.c. Walt Disney auf das Buch von Felix Salten aufmerksam gemacht, das von den Abenteuern eines Rehs erzählt, das Bambi heißt. Ob das nicht einmal Stoff für einen seiner Zeichentrickfilme sein könnte?
Disney besorgt sich das Buch, liest es und ist entbrannt. Er zieht die alten deutschen Bücher aus dem Regal der Firmenbibliothek und gibt sie den Zeichnern, damit sie eine Geschichte erfinden, die den Geist der deutschen Romantik lebt. Und Disney holt sogar zwei echte Rehkitze ins Studio, die dort für seine Zeichner Modell stehen. Ein Männchen und ein Weibchen, ein Bambi und eine Feline, deren Bewegungen sie naturgetreu erfassen. Der Film lebt wie das Buch vom Feuer: Die Gefahr droht durch die Jäger, die ein Lagerfeuer anzünden, dessen Rauchschwaden Bambi wittert. Der Funkenflug wird bald den ganzen Wald in Brand setzen.