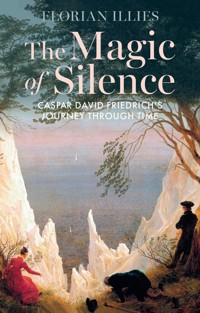9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte eines ungeheuren Jahres – der internationale Bestseller jetzt als hochwertiges Taschenbuch! »Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen – Illies' Geschichten sind einfach großartig.« Ferdinand von Schirach Florian Illies entfaltet virtuos ein historisches Panorama. 1913: Es ist das eine Jahr, in dem unsere Gegenwart begann. In Literatur, Kunst und Musik werden die Extreme ausgereizt, als gäbe es kein Morgen. Zwischen Paris und Moskau, zwischen London, Berlin und Venedig begegnen wir zahllosen Künstlern, deren Schaffen unsere Welt auf Dauer prägte. Man kokst, trinkt, ätzt, hasst, schreibt, malt, zieht sich gegenseitig an und stößt sich ab, liebt und verflucht sich. Es ist ein Jahr, in dem alles möglich scheint. Und doch wohnt dem gleißenden Anfang das Ahnen des Verfalles inne. Literatur, Kunst und Musik wussten schon 1913, dass die Menschheit ihre Unschuld verloren hatte. Florian Illies lässt dieses eine Jahr, einen Moment höchster Blüte und zugleich ein Hochamt des Unterganges, in einem grandiosen Panorama lebendig werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Florian Ilies
1913
Der Sommer des Jahrhunderts
Über dieses Buch
Virtuos entfaltet Florian Illies das Panorama eines unvergleichlichen Jahres, in dem unsere Gegenwart beginnt: 1913. In Literatur, Kunst und Musik werden die Extreme ausgereizt, als gäbe es kein Morgen. Malewitsch malt ein Quadrat, Proust sucht nach der verlorenen Zeit, Benn liebt Lasker-Schüler, Strawinsky feiert das Frühlingsopfer, Kirchner gibt der Metropole ein Gesicht, Kafka und Joyce trinken am selben Tag in Triest einen Cappuccino – und in München verkauft ein österreichischer Postkartenmaler namens Adolf Hitler seine biederen Stadtansichten. 1913: Anfang und Ende, Triumph und Melancholie verschmelzen, alles wird Kunst. Nach diesem Sommer ist nichts mehr, wie es war. Wie kein anderer erweckt der elegante Stilist Florian Illies den Zauber eines Schlüsselmoments der Kulturgeschichte zum Leben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Florian Illies, geboren 1971, liebt mit großer Leidenschaft die Kunst und die Literatur - zuerst im Studium in Bonn und in Oxford, dann bei der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, bei der Kunstzeitschrift »Monopol« und später als Leiter des Feuilletons der »Zeit« und als Literaturchef. Danach war er Leiter des Auktionshauses Grisebach in Berlin, seit dem Herbst 2018 ist er Verleger des Hamburger Rowohlt Verlages. In seinen Büchern versucht er immer wieder Vergangenheit als Gegenwart erlebbar zu machen - so in ›Generation Golf‹ im Jahre 2000 und in seinem großen, internationalen Bestseller ›1913. Der Sommer des Jahrhunderts‹, der monatelang die SPIEGEL-Bestsellerliste anführte. 2017 veröffentlichte er im S.Fischer Verlag ›Gerade war der Himmel noch blau‹, das die FAZ eine »mitreißende Reise in die Vergangenheit« nannte und 2018 schließlich erschien die Fortsetzung seines Erfolgsbuchs ›1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte‹, die es erneut auf die SPIEGEL-Bestsellerliste geschafft hat.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2012 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg Agentur für kulturelle Kommunikation Gundula Hißmann und Andreas Heilmann
Coverabbildung: Heinrich Kühn, Mary Warner und Edeltrude am Hügelkamm, Autochrom
ISBN 978-3-10-401420-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
JANUAR
FEBRUAR
MÄRZ
APRIL
MAI
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DEZEMBER
Auswahlbibliographie
Dank
Abbildungsnachweis
JANUAR
Das ist der Monat, in dem sich Hitler und Stalin beim Spazierengehen im Schlosspark von Schönbrunn begegnen, Thomas Mann fast geoutet und Franz Kafka vor Liebe fast verrückt wird. Zu Sigmund Freud auf die Couch schleicht eine Katze. Es ist sehr kalt, der Schnee knirscht unter den Füßen. Else Lasker-Schüler ist total verarmt und verliebt in Gottfried Benn, bekommt eine Pferdepostkarte von Franz Marc, nennt Gabriele Münter aber eine Null. Ernst Ludwig Kirchner zeichnet die Kokotten am Potsdamer Platz. Der erste Looping wird geflogen. Aber es hilft alles nichts. Oswald Spengler arbeitet schon am »Untergang des Abendlandes«.
Es ist die erste Sekunde des Jahres 1913. Ein Schuss hallt durch die dunkle Nacht. Man hört ein kurzes Klicken, die Finger am Abzug spannen sich an, dann ein zweiter, dumpfer Schuss. Die alarmierte Polizei eilt herbei und nimmt den Schützen sofort fest. Er heißt Louis Armstrong.
Mit einem gestohlenen Revolver hatte der Zwölfjährige in New Orleans das neue Jahr begrüßen wollen. Die Polizei steckt ihn in eine Zelle und schickt ihn schon am frühen Morgen des 1. Januar in eine Besserungsanstalt, das Colored Waifs’ Home for Boys. Er führt sich dort so wild auf, dass der Leiter der Anstalt, Peter Davis, sich nicht anders zu helfen weiß, als ihm spontan eine Trompete in die Hand zu drücken (eigentlich hat er ihn ohrfeigen wollen). Louis Armstrong aber wird urplötzlich stumm, nimmt das Instrument fast zärtlich entgegen, und seine Finger, die noch in der Nacht zuvor nervös mit dem Abzug des Revolvers gespielt hatten, spüren erneut das kalte Metall, doch statt eines Schusses entlockt er der Trompete noch im Zimmer des Direktors erste warme, wilde Töne.
»Gerade der Mitternachtsschuss. Schreien auf der Gasse und der Brücke. Glockenläuten und Uhrenschlagen.« Aus Prag berichtet: Dr. Franz Kafka, Angestellter der Arbeiter-Unfall-Versicherung für das Königreich Böhmen. Sein Publikum sitzt im fernen Berlin, in der Etagenwohnung in der Immanuelkirchstraße 29, es ist nur eine Person, doch es ist für ihn die ganze Welt: Felice Bauer, fünfundzwanzig, etwas blond, etwas knochig, etwas schlaksig, Stenotypistin in der Carl Lindström A. G. Im August, es goss in Strömen, da hatten sie sich kurz kennengelernt, sie hatte nasse Füße bekommen, er sehr schnell kalte. Aber seitdem schreiben sie sich nachts, wenn ihre Familien schlafen, hochtemperierte, zauberhafte, seltsame, verstörende Briefe. Und nachmittags meist noch einen hinterher. Als Felice einmal ein paar Tage nichts von sich hören ließ, da fing er, als er aus unruhigen Träumen erwachte, verzweifelt »Die Verwandlung« an zu schreiben. Er hatte ihr von dieser Geschichte erzählt, kurz vor Weihnachten war sie fertig geworden (sie lag jetzt in seinem Sekretär, gewärmt von den beiden Fotos, die ihm Felice von sich geschickt hatte). Doch wie schnell sich ihr ferner, geliebter Franz selbst in ein schreckliches Rätsel verwandeln konnte, das erfuhr sie erst mit diesem Silvesterbrief. Ob sie ihn wohl, so fragt er aus dem Nichts, mit dem Schirm kräftig schlagen würde, wenn er einfach im Bett liegen bliebe, wenn sie sich für ein Treffen in Frankfurt am Main verabredet hätten, um nach einer Ausstellung ins Theater zu gehen, so also fragt Kafka einleitend in einem dreifachen Konjunktiv. Und dann beschwört er scheinbar harmlos ihre gemeinsame Liebe, träumt davon, dass Felices und seine Hand unlösbar zusammengebunden sind. Um dann fortzufahren: Es sei »immerhin möglich, dass einmal auf solche Weise zusammengebunden ein Paar zum Schafott geführt wurde«. Was für ein reizender Gedanke für einen Brautbrief. Man hat sich noch nicht einmal geküsst, da phantasiert der Mann schon vom gemeinsamen Gang zum Schafott. Kafka selbst scheint kurzzeitig erschrocken über das, was da aus ihm herausbricht: »Aber was läuft mir denn da alles durch den Kopf?«, schreibt er. Die Erklärung ist einfach: »Das macht die 13 in der neuen Jahreszahl.« So also beginnt 1913 in der Weltliteratur: mit einer Gewaltphantasie.
Vermisstenanzeige. Es fehlt: Leonardos »Mona Lisa«. 1911 wurde sie aus dem Louvre gestohlen, es gibt noch immer keine heiße Spur. Pablo Picasso wird von der Pariser Polizei verhört, doch er hat ein Alibi und darf wieder nach Hause gehen. Im Louvre legen die trauernden Franzosen Blumensträuße an der kahlen Wand ab.
In den ersten Januartagen, ganz genau wissen wir es nicht, kommt aus Krakau mit dem Zug ein leicht verwahrloster, vierunddreißigjähriger Russe am Wiener Nordbahnhof an. Draußen Schneegestöber. Er hinkt. Seine Haare sind in diesem Jahr noch nicht gewaschen worden, sein buschiger Schnurrbart, der sich wie wucherndes Gestrüpp unter seiner Nase ausbreitet, kann die Pockennarben im Gesicht nicht verbergen. Er trägt russische Bauernschuhe und einen vollgestopften Koffer, kaum angekommen, steigt er sofort in eine Trambahn, die ihn rausbringen soll nach Hietzing. In seinem Pass steht »Stavros Papadopoulos«, das soll nach einer griechisch-georgischen Mischung klingen, und so verwahrlost, wie er aussah, und so kalt, wie es gerade war, nahm ihm das jeder Grenzer ab. In Krakau, im anderen Exil, hatte er am Abend zuvor Lenin ein letztes Mal beim Schach besiegt, zum siebten Mal hintereinander. Das konnte er deutlich besser als Fahrradfahren. Lenin hatte verzweifelt versucht, ihm auch das beizubringen. Revolutionäre müssen schnell sein, hatte er ihm eingebläut. Doch der Mann, der eigentlich Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili hieß und sich jetzt Stavros Papadopoulos nannte, lernte das Radfahren nicht. Kurz vor Weihnachten stürzte er übel auf den vereisten Kopfsteinpflaster-Straßen Krakaus. Sein Bein war noch voller Wunden, sein Knie verstaucht, erst seit ein paar Tagen konnte er überhaupt wieder auftreten. Mein »prächtiger Georgier« hatte Lenin ihn lächelnd genannt, als er ihm entgegengehinkt kam, um den gefälschten Pass für die Reise nach Wien entgegenzunehmen. Und nun gute Fahrt, Genosse.
Unbehelligt überquerte er die Grenzen, fieberhaft saß er im Zug über seinen Manuskripten und Büchern, die er beim Umsteigen hektisch in seinen Koffer stopfte.
Nun, in Wien angekommen, legte er den georgischen Tarnnamen ab. Vom Januar 1913 an sagte er: Mein Name ist Stalin, Josef Stalin. Als er aus der Tram gestiegen war, sah er rechts das Schloss Schönbrunn, hell erleuchtet im matten Wintergrau, dahinter den Park. Er geht in die Schönbrunner Schlossstraße 30, so stand es auf dem kleinen Zettel, den ihm Lenin gegeben hatte. Und: »Bei Trojanowski klingeln«. Also schlägt er sich den Schnee von den Schuhen, schnäuzt in sein Taschentuch und drückt etwas unsicher den Klingelknopf. Als das Hausmädchen erscheint, sagt er das verabredete Codewort.
Eine Katze schleicht sich in der Wiener Berggasse 19 in das Arbeitszimmer von Sigmund Freud, in dem sich gerade die Mittwochsgesellschaft zum Kolleg versammelt hat. Das ist die zweite Überraschungsbesucherin innerhalb kurzer Zeit: Im Spätherbst war schon Lou Andreas-Salomé zu der Herrenrunde gestoßen, erst argwöhnisch beäugt, nun schmachtend verehrt. Lou Andreas-Salomé trug an ihrem Strumpfband eine lange Reihe von Skalps erlegter Geistesgrößen: Mit Nietzsche war sie in einem Beichtstuhl im Petersdom, mit Rilke im Bett und in Russland bei Tolstoi, Frank Wedekind nannte angeblich seine »Lulu« nach ihr und Richard Strauss seine »Salomé«. Nun erlag ihr Freud zumindest intellektuell – sie durfte in diesem Winter sogar in seiner Arbeitsetage wohnen, diskutierte mit ihm sein neues Buch über »Totem und Tabu«, an dem er gerade saß, und hörte ihm zu, wenn er sein Leid klagte über C. G. Jung und die abtrünnigen Psychologen aus Zürich. Vor allem aber ließ sich die inzwischen 52-jährige Lou Andreas-Salomé, Autorin mehrerer Bücher über den Geist und die Erotik, vom Meister selbst in der Psychoanalyse ausbilden – im März dann würde sie in Göttingen ihre eigene Praxis eröffnen. So sitzt sie also im feierlichen Mittwochskolleg, neben ihr die gelehrten Kollegen, rechts die schon damals legendäre Couch und überall die kleinen Skulpturen, die der antikenversessene Freud sammelte, um sich über die Gegenwart hinwegzutrösten. Und in diese andächtige Runde huschte nun, als Lou durch die Tür trat, auch eine Katze hinein. Erst war Freud irritiert, doch als er sah, mit welcher Neugier die Katze die griechischen Vasen und römischen Kleinskulpturen musterte, da ließ er ihr gerührt etwas Milch bringen. Aber Lou Andreas-Salomé berichtet: »Dabei nahm sie jedoch von ihm trotz seiner steigenden Liebe und Bewunderung durchaus keine Notiz, richtete ihre grünen Augen mit den schiefen Pupillen kaltsinnig auf ihn wie auf einen beliebigen Gegenstand, und wenn er auch nur für einen Augenblick mehr wollte als ihr egoistisch-narzisstisches Schnurren, dann musste er den Fuß vom bequemen Liegestuhl heruntertun und mit den erfinderisch bezauberndsten Bewegungen der Stiefelspitze um ihre Aufmerksamkeit werben.« Woche für Woche erhielt die Katze fortan Zutritt zum Kolleg, als sie kränkelte, durfte sie mit Wickelkompressen auch auf Freuds Couch liegen. Sie erwies sich als therapierbar.
Apropos kränkelnd. Wo steckt eigentlich Rilke?
Die Angst, dass sich 1913 als Unglücksjahr erweisen könnte, sitzt den Zeitgenossen im Nacken. Gabriele D’Annunzio schenkt einem Freund sein »Martyrium des Heiligen Sebastian« und datiert es in der Widmung lieber vorsorglich als »1912 + 1«. Und Arnold Schönberg hält den Atem an angesichts der Unglückszahl. Nicht ohne Grund erfand er die »Zwölf-Ton-Musik« – eine Grundlage der modernen Musik, geboren auch aus dem Schrecken ihres Schöpfers vor dem, was danach kommen würde. Die Geburt des Rationalen aus dem Geist des Aberglaubens. In Schönbergs Stücken kommt die Zahl »13« nicht vor, nicht als Takt, kaum einmal als Seitenzahl. Als er mit Entsetzen merkte, dass seine Oper über Moses und Aaron 13 Buchstaben haben würde, strich er Aaron das zweite a, und so heißt sie seitdem »Moses und Aron«. Und nun also ein ganzes Jahr im Zeichen der Unglückszahl. Schönberg wurde an einem 13. September geboren – und es trieb ihn die panische Angst um, an einem Freitag, dem 13. zu sterben. Aber es half alles nichts. Arnold Schönberg starb an einem Samstag, dem 13. (allerdings erst 1913 + 38, also 1951). Doch auch 1913 wird für ihn noch eine schöne Überraschung bereithalten. Er wird öffentlich geohrfeigt. Aber der Reihe nach.
Nun erst einmal: Auftritt Thomas Mann. Am frühen Morgen des 3. Januar setzt sich Mann in München in den Zug. Er liest erst ein paar Zeitungen und Briefe, blickt hinaus auf die schneebedeckten Hügel des Thüringer Waldes, nickt dann im überheizten Abteil immer wieder ein über den sorgenden Gedanken um seine Katia, die schon wieder zu einer Kur in die Berge aufgebrochen ist. Im Sommer hatte er sie in Davos besucht und im Wartezimmer des Arztes hatte er plötzlich eine Idee für eine große Erzählung gehabt, doch jetzt kommt sie ihm sinnlos vor, zu weltabgewandt, diese Sanatoriumsgeschichte. Na ja, jetzt würde ja erst einmal in ein paar Wochen sein »Tod in Venedig« erscheinen.
Thomas Mann sitzt im Zug und sorgt sich um seine Garderobe, ärgerlich, dass die langen Zugfahrten immer diese Druckfalten an den Kleidern hinterlassen, er würde den Mantel nachher im Hotel noch einmal aufbügeln lassen müssen. Er steht auf, schiebt die Abteiltür zur Seite und beschließt, ein wenig auf und ab zu gehen. So steif, dass die anderen Gäste immer denken, der Schaffner kommt. Draußen fliegen die Dornburger Schlösser vorbei, Bad Kösen, die Weinhänge der Saale, tiefverschneit, die Rebenreihen ziehen sich wie Zebrastreifen die Hänge empor. Hübsch eigentlich, aber Thomas Mann spürt, wie die Angst in ihm hochsteigt, je näher er Berlin kommt.
Er lässt sich, als er den Zug verlassen hat, sogleich ins Hotel Unter den Linden fahren und schaut an der Rezeption umher, ob er denn auch erkannt werde von den anderen Gästen, die hinter ihm zu den Aufzügen drängen. Dann bezieht er sein Zimmer, dasselbe wie stets, um sich aufwendig neu einzukleiden und seinen Schnurrbart noch ein wenig zu kämmen.
Im Grunewald, tief im Westen der Stadt, bindet sich zur selben Stunde Alfred Kerr im Ankleidezimmer seiner Villa in der Höhmannstraße 6 seine Fliege und zwirbelt die Enden seines Schnurrbartes kampfeslustig empor.
Um zwanzig Uhr soll ihr Duell beginnen. Um Viertel nach sieben steigen beide in ihre Droschken. Sie fahren zu den Kammerspielen des Deutschen Theaters, gleichzeitig treffen sie ein. Und ignorieren sich. Es ist kalt, schnell eilen beide hinein. Einst in Bansin am Ostseestrand, aber das muss unter uns bleiben, da hatte er, Alfred Kerr, Deutschlands größter Kritiker und eitelster Fatzke, um Katia Pringsheim geworben, die reiche Jüdin mit den Katzenaugen. Doch sie hatte ihn, den gedankenwilden, stolzen Breslauer, abgewiesen und sich Thomas Mann an die Brust geworfen, diesem stocksteifen Hanseaten. Unbegreiflich eigentlich. Aber vielleicht konnte er es ihm ja heute Abend heimzahlen.
Thomas Mann setzt sich in die erste Reihe und versucht gravitätische Ruhe auszustrahlen. Heute Abend hat seine »Fiorenza« Premiere in Berlin, das Buch, das er schrieb, als er Katia liebenlernte. Aber er ahnt, dass es heute ein Debakel geben könnte, das Stück war seit langem sein Sorgenkind. Man hätte es nicht zu einem Drama machen sollen, um ein Drama zu verhindern, denkt er. »Ich habe einiges zu retten versucht, glaube aber nicht, dass man auf mich hört«, hatte er an Maximilian Harden geschrieben, bevor er in München aus der Mauerkircherstraße 13 aufbrach.
Er hasste es, sehenden Auges in ein Unglück zu gehen. Das war eines Thomas Mann nicht würdig. Aber was er im Dezember bei den Proben gesehen hatte, verhieß nichts Gutes. Gequält verfolgt er das Stück, das die Florentiner Hochrenaissance zum Leben erwecken soll, aber es kommt nicht in Fahrt, mehr Uff als Uffizien.
Irgendwann erlaubt sich Mann einen verstohlenen Blick über die linke Schulter. Dort, in der dritten Reihe, entdeckt er Alfred Kerr, dessen Bleistift über den Notizblock rast. Tief ist das Dunkel im Zuschauerraum, und doch meint er auf den Zügen Kerrs ein Lächeln zu erkennen. Es ist das Lächeln des Sadisten, der sich freut, dass ihm diese Inszenierung schönsten Stoff zum Quälen bietet. Und als er den unruhigen Blick Thomas Manns erhascht, durchläuft ihn noch ein wohligerer Schauer. Er genießt es, dass Thomas Mann und seine verunglückte »Fiorenza« nun in seiner Hand liegen. Denn er weiß: Er wird sehr fest zudrücken, und wenn er loslässt, wird sie leblos zu Boden taumeln.
Da fällt der Vorhang, und freundlicher Applaus kommt auf, so freundlich sogar, dass es dem Regisseur in seiner einzig wirklich geglückten Inszenierung gelingt, Thomas Mann zweimal auf die Bühne zu bitten. Er wird dies in unzähligen Briefen in den nächsten Wochen nie vergessen zu bemerken. Zweimal! Würdevoll versucht er sich also zu verbeugen, zweimal!, es wirkt eher ungelenk. In der dritten Reihe sitzt Alfred Kerr und klatscht nicht. Noch in der Nacht, als er in seiner Villa im Grunewald ankommt, lässt er sich einen Tee bringen und fängt an zu schreiben. Feierlich setzt er sich an seine Schreibmaschine und setzt als Erstes eine römische Eins aufs Papier. Kerr nummeriert seine Absätze einzeln, als seien es Bände einer Werkausgabe. Zunächst wetzt er den Säbel: »Der Verfasser ist ein feines, etwas dünnes Seelchen, dessen Wurzel ihre stille Wohnung im Sitzfleisch hat.« Und dann legt er los: Die Dame Fiorenza, die wohl als Symbol Florenz’ zu gelten habe, sei völlig blutleer, das ganze Stück in den Bibliotheken zusammengeschrieben, steif, trocken, kraftlos, kitschig, überflüssig. Das sind so seine Worte.
Als Kerr auch seinen zehnten Absatz nummeriert und abgeschlossen hat, zieht er zufrieden das letzte Papier aus der Maschine. Eine Vernichtung.
Am nächsten Morgen, als Thomas Mann in den Zug zurück nach München steigt, lässt Kerr den Text in die Redaktion der Zeitung »Der Tag« bringen. Am 5. Januar erscheint er. Als Thomas Mann ihn liest, bricht er zusammen. »Unmännlich« sei er, so schreibt Kerr – das wird Mann am meisten treffen. Ob Kerr damit auf Thomas Manns verheimlichte Homosexualität anspielte oder ob es Mann nur als eine Anspielung verstand, ist einerlei. Kerr sah so genau wie sonst nur Kraus, wo er mit Worten tiefe Wunden hinterlassen konnte. Thomas Mann in jedem Fall fühlt sich tief getroffen, »bis ins Blut«, wie er schreibt. Das gesamte Frühjahr 1913 wird er sich von dieser Kritik nicht erholen, in keinem Brief fehlt der Hinweis, kein Tag ohne Wut auf diesen Kerl, auf diesen Kerr. An Hugo von Hofmannsthal schreibt Mann: »Ich hatte ungefähr gewusst, was kommen würde, aber es übertraf alle Erwartungen. Ein giftiges Gejökel, dem der Ahnungsloseste die persönliche Mordlust anmerken muss!«
Das hat er nur geschrieben, weil er mich nicht bekommen hat, du lieber Thommy, sagt Katia zum Trost und streicht ihm mütterlich über den Scheitel, als sie aus der Kur zurückgekommen ist.
Zwei Nationalmythen werden begründet: In New York erscheint die erste Ausgabe der »Vanity Fair«. In Essen eröffnet die Mutter von Karl und Theo Albrecht den Prototyp des ersten Aldi-Supermarkts.
Und wie geht es Ernst Jünger? »Noch gut«. So jedenfalls lautet die Note, die der 17-jährige Jünger in der Reformschule in Hameln für seinen Aufsatz über Goethes »Hermann und Dorothea« erhält. Er schrieb zwar: »Das Epos versetzt uns in die Zeit der Französischen Revolution, deren glutsstrahlender Flackerschein sogar die friedlichen Bewohner des stillen Rheintals aus dem zufriedenen Halbschlaf der Alltäglichkeit stört.« Doch dem Lehrer war das nicht gut genug. Er schrieb mit roter Tinte an den Rand: »Ausdruck diesmal zu nüchtern«. Wir lernen: Ernst Jünger war also schon nüchtern, als ihn alle anderen noch nicht einmal für voll nahmen.
Jeden Nachmittag steigt Ernst Ludwig Kirchner in die neugebaute U-Bahn und fährt bis zur Station Potsdamer Platz. Mit Kirchner waren auch die anderen Maler der »Brücke« gerade aus Dresden, ihrem Gründungsort, dieser wunderbar vergessenen sommerlichen Stadt des Barock, nach Berlin gezogen, Erich Heckel, Otto Mueller, Karl Schmidt-Rottluff. Sie waren eine eingeschworene Gemeinschaft gewesen, die die Farben und Frauen teilten und deren Bilder sich zum Verwechseln ähnlich sahen – aber Berlin, diese pochende Überforderung, die sich Hauptstadt nennt, macht sie zu Individuen und sägt an den Brücken, die sie verbinden. Alle anderen waren in Dresden bei sich gewesen, als sie die reinen Farben, die Natur und die menschliche Nacktheit feiern konnten. In Berlin drohen sie unterzugehen.
Ernst Ludwig Kirchner aber kommt erst in Berlin zu sich – mit Anfang 30. Seine Kunst ist städtisch, rauer, die Figuren überlängt und sein Zeichenstil so hektisch und aggressiv wie die Stadt selbst, seine Gemälde tragen den Ruß der Metropole wie einen Firnis auf der Stirn. Schon in den Waggons der U-Bahn saugen seine Augen die Menschen gierig auf, auf dem Schoß macht er seine ersten, schnellen Studien, zwei, drei Striche mit dem Bleistift, ein Mann, ein Hut, ein Regenschirm. Dann steigt er aus, zwängt sich durch die Menschenmassen, seine Skizzenblöcke und die Farben in der Hand. Es zieht ihn zum Aschinger, dort kann man den ganzen Tag sitzen bleiben, wenn man einmal eine Suppe bezahlt hat. Da also hockt Kirchner und schaut und zeichnet und schaut. Der Wintertag dämmert schon, der Lärm auf dem Platz ist ohrenbetäubend, es ist der verkehrsreichste Platz Europas, und auf ihm kreuzen sich vor aller Augen nicht nur die zentralen Verkehrsadern der Stadt, sondern auch die Linien der Tradition und der Moderne: Wer aus der U-Bahn hinaufkommt in den Schneematsch des Tages, der sieht oben noch Pferdefuhrwerke, die Fässer transportieren, direkt daneben die ersten noblen Automobile und die Droschken, die den Pferdeäpfeln auszuweichen versuchen. Mehrere Trambahnen ziehen gleichzeitig über den großen Platz, ein schleifendes, metallisches Ziehen erfüllt den weiten Raum, wenn sie sich in die Kurve legen. Und dazwischen: Menschen, Menschen, Menschen, alle rennen, als liefe ihnen die Zeit davon, über ihnen die Reklametafeln, die die Würstchen anpreisen, das Kölnisch Wasser und das Bier. Und unter den Arkaden die elegant gekleideten Kokotten, die Prostituierten, die Einzigen, die sich kaum bewegen an diesem Platz, wie Spinnen am Rande des Netzes. Sie tragen den schwarzen Witwenschleier vorm Gesicht, um der polizeilichen Aufsicht zu entgehen, vor allem aber sieht man ihre riesigen Hüte, skurrile Turmbauten mit Federn, unter den Laternen, deren grünes Gaslicht angezündet wird, wenn der frühe Winterabend hereinbricht.
Es ist dieses fahle Grün, das in den Gesichtern der Kokotten auf dem Potsdamer Platz aufleuchtet, und der malmende Lärm der Großstadt dahinter, den Ernst Ludwig Kirchner zu Kunst machen will. Zu Gemälden. Aber er weiß noch nicht wie. Und zeichnet deshalb vorerst weiter – »meine Zeichnungen duze ich«, sagt er, »meine Bilder sieze ich«. Er packt also seine Duzfreundschaften, Stapel voller Skizzen, die er in den letzten Stunden vom Tisch aus gemacht hat, in seine Mappe und hetzt nach Hause, in sein Atelier. In Wilmersdorf, in der Durlacher Straße 14, zweite Etage, hat sich Kirchner eine Höhle geschaffen: Fast komplett behängt mit orientalischen Teppichen, vollgestellt mit afrikanischen und ozeanischen Figuren und Masken und japanischen Schirmen, daneben eigene Skulpturen, eigene Möbel, eigene Bilder. Es gibt Fotos von Kirchner aus dieser Zeit, da ist er entweder nackt oder aber trägt den schwarzen Anzug mit Binder, das hochgeschlossene Hemd blütenweiß, die Zigarette so lässig in der Hand, als sei er Oscar Wilde. Daneben immer Erna Schilling, seine Geliebte, die Nachfolgerin der selbstvergessenen, weichumrandeten Dresdener Dodo, eine Frau der Gegenwart mit freiem Geist unterm Bubikopf, physiognomisch von bestürzender Ähnlichkeit zu Kafkas Felice Bauer. Sie hat die Wohnung mit Stickereien nach Kirchners und eigenen Entwürfen dekoriert.
Kirchner hatte Erna und ihre Schwester Gerda Schilling ein Jahr zuvor in einem Berliner Tanzlokal kennengelernt, wo auch Heckels Freundin Sidi auf der Bühne stand. Er lockt die hübschen Tänzerinnen mit den traurigen Augen noch am ersten Abend in sein Atelier, denn er wusste auf den ersten Blick: Deren architektonisch aufgebaute Körper »erziehen mein Schönheitsempfinden zur Gestaltung der körperlich schönen Frau unserer Zeit«. Erst ist Kirchner mit der 19-jährigen Gerda zusammen, dann mit der 28-jährigen Erna und dazwischen auch mit beiden. Kokotte, Muse, Modell, Schwester, Heilige, Hure, Geliebte – man darf das nicht so genau nehmen bei ihm. Durch Hunderte von Zeichnungen kennen wir jedes Detail der beiden Frauen, Gerda sinnlich provozierend, Erna mit kleinen, hochsitzenden Brüsten und einem ausladenden Gesäß, gesammelt, in melancholischer Ruhe. Es gibt ein herrliches Gemälde aus dieser Zeit, drei nackte Frauen links, werbend, rechts der Künstler in seinem Atelier, die Zigarette im Mund, die Frauen kennerschaftlich checkend, so gefällt er sich, »Urteil des Paris« schreibt er mit schwarzer Farbe hinten auf die Leinwand, 1913, Ernst Ludwig Kirchner.
Doch als der Paris Kirchner in dieser Nacht heimkehrt vom Potsdamer Platz, sind die Lichter schon gelöscht, Paris kommt zu spät zu seinem Urteil, und Erna und Gerda sind eingeschlafen, vergraben in die riesigen Kissen im Wohnraum, der durch dieses Trio infernale zum berühmtesten Berliner Zimmer der Welt werden wird.
Die preußische Prinzessin Viktoria Luise und Ernst August von Hannover küssen sich im Januar zum ersten Mal.
In der Neujahrsausgabe der »Fackel« in Wien, der damals schon legendären Ein-Mann-Zeitschrift von Karl Kraus, erscheint ein Hilferuf: »Else Lasker-Schüler sucht 1000 Mk zu Gunsten der Erziehung ihres Sohnes.« Es unterzeichnen unter anderen Selma Lagerlöf, Karl Kraus, Arnold Schönberg. Die Schriftstellerin konnte nach ihrer Scheidung von Herwarth Walden nicht mehr die Kosten für die Odenwaldschule bezahlen, wo sie ihren Sohn Paul untergebracht hatte. Ein halbes Jahr hat Kraus mit sich gerungen, ob er den Aufruf abdrucken soll, inzwischen geht Paul längst in Dresden ins Internat, aber an Weihnachten hatte selbst ihn, Kraus, diesen Scharfrichter und rigiden Trenner zwischen Emotion und Rationalität, die Barmherzigkeit übermannt. Also setzt er die kleine Anzeige tatsächlich auf den letzten freien Platz der »Fackel«. Davor schreibt Kraus: »Ich sehe einen apokalyptischen Galopin die Vorbereitungen zur Weltbaisse treffen, den Sendboten des Verderbens, der die Vorhölle der Zeitlichkeit überheizt.«
Es ist eiskalt im winzigen Mansardenzimmer in der Humboldtstraße 13 in Berlin-Grunewald, Else Lasker-Schüler hat sich in mehrere Decken gewickelt, als die Türklingel sie mit ihrem schrillen Laut aus ihren Tagträumen reißt. Lasker-Schüler, wilde schwarze Augen, dunkle Mähne, liebessüchtig, lebensuntüchtig, schlingt sich ihren orientalischen Morgenmantel um und öffnet dem Briefträger, der ihr die Post entgegenhält. Die leuchtend rote »Fackel« aus Wien ihres fernen, strengen Freundes Karl Kraus und dann, direkt darunter, ein kleines blaues Wunder: Eine Postkarte von Franz Marc, dem Künstler des »Blauen Reiter«. Lasker-Schüler, mit ihren bunten Gewändern, den klappernden Ringen und Armreifen, ihrer wilden, märchenhaften Phantasie; sie war in jener Zeit die Verkörperung des inneren Orients einer in die Moderne hetzenden Gesellschaft, eine Traumgestalt, das Sehnsuchtsobjekt von so unterschiedlichen Männern wie Kraus, Wassily Kandinsky, Oskar Kokoschka, Rudolf Steiner und Alfred Kerr. Aber vom Vergöttertwerden kann man nicht leben. Else Lasker-Schüler geht es sehr schlecht, jetzt wo ihre Ehe mit Herwarth Walden, dem großen Galeristen und Verleger der »Sturm«-Zeitschrift, geschieden ist und er mit der schrecklichen Nell, seiner neuen Frau, in den Cafés sitzt, in die sie deshalb nicht mehr gehen kann. Aber genau in solch einem Künstlercafé traf sie im Dezember Franz und Maria Marc, und sie werden zu ihrer Leibgarde, ihren Schutzengeln.
Else Lasker-Schüler nimmt also die »Fackel« in die Hand, nichts ahnend von der rührenden Anzeige von Karl Kraus, und dann dreht sie die Postkarte um, die ihr Franz Marc geschickt hat. Sie erstarrt in stillem Jubel. Auf winzigem Raum hat ihr ferner Freund hier einen »Turm der blauen Pferde« gemalt, kraftstrotzende Tiere, die sich zum Himmel türmen, ganz aus der Zeit gefallen und doch mitten in ihr stehend. Sie spürt, dass sie ein einzigartiges Geschenk bekommen hat: die ersten blauen Pferde des Blauen Reiters. Vielleicht spürt diese besondere Frau, die immer alles spürt, sogar noch mehr – dass aus der Idee dieser Postkarte in den Wochen danach im fernen Sindelsdorf ein noch viel größerer »Turm der blauen Pferde« entstehen sollte, ein Gemälde als Programm, ein Jahrhundertbild. Es wird später verbrennen, und es wird allein diese winzige Postkarte sein, die die Fingerabdrücke von Franz Marc und Else Lasker-Schüler bis heute bewahrt hat, die auf alle Ewigkeit von dem Moment erzählen wird, als der Blaue Reiter zu galoppieren begann.
Gerührt sieht die Dichterin, wie der große Maler ihre Zeichen, den Halbmond und die goldenen Sterne, in sein kleines Pferdebild aufgenommen hat, ein Dialog beginnt, die Assoziationen, die Worte und die Postkarten gehen hin und her. Sie ernennt ihn zum imaginären »Fürsten von Cana«, sie ist der »Prinz Jussuf von Theben«. Schon am 3. Januar schreibt Else zurück und dankt für ihr blaues Wunder: »Wie schön ist die Karte – ich habe mir zu meinen Schimmeln immer solche meiner Lieblingsfarbe gewünscht. Wie soll ich Ihnen danken!!«
Als Marc sie dann per Postkarte sogar einlädt, mit nach Sindelsdorf zu kommen, sagt sie, völlig erschöpft von der Scheidung und von Berlin, sofort zu und steigt mit den Marcs in den Zug. Sie ist viel zu dünn angezogen, Maria Marc packt sie in eine mitgebrachte Decke. Es ist sehr gut möglich, dass sie im selben Zug sitzt, in dem Thomas Mann nach seiner verkorksten »Fiorenza«-Premiere zurückeilt in die heimische Familienburg. Das ist eine schöne Vorstellung, dieser Nordpol und dieser Südpol der deutschen Kultur des Jahres 1913 gemeinsam in einem Zug.
Als die geschwächte Dichterin dann eintrifft in Sindelsdorf im Voralpenland, lebt sie zunächst tatsächlich bei Franz Marc und seiner Frau Maria, einer wuchtigen Matrone, unter deren Fittiche Marc schlüpfte, wenn die Winde zu rau bliesen. »Maler Marc und seine Löwin«, wie Else sie nannte.
Sie hält es nur ein paar Tage im Gästezimmer des kinderlosen Paares aus, dann zieht sie weiter in das Sindelsdorfer Gasthaus, mit weitem Blick über das Moor bis zu den Bergen. Doch auch hier kommt sie nicht zur Ruhe, die Wirtin rät ihr besorgt zu einer Kneippkur und leiht ihr die entsprechenden Bücher. Das hilft alles nichts, Else Lasker-Schüler reist Hals über Kopf ab aus Sindelsdorf nach München, findet ein Zimmer in einer Münchner Pension in der Theresienstraße.
Die Marcs reisen ihr nach und finden sie dort im Frühstücksraum, vor sich auf dem Tisch ganze Armeen von Zinnsoldaten, die sie wohl für ihren Sohn Paul gekauft hat, und wie sie dort auf dem weiß-blau karierten Tischtuch »heftige Kämpfe ausfocht – an Stelle der Kämpfe, die ihr Leben ihr ständig brachte«. Sie war in Kampfeslaune, wütend, bebend, nicht ganz bei Sinnen in diesen Tagen. Ende Januar, in der Galerie Thannhauser bei der Eröffnung der großen Franz-Marc-Ausstellung, lernt sie Kandinsky kennen, dann gerät sie in einen Clinch mit der Malerin Gabriele Münter. Die hatte etwas bemerkt, was Lasker-Schüler als Beleidigung von Marc auffasste, woraufhin sie durch die Galerie schrie: »Ich bin Künstlerin und lasse mir das nicht bieten von solch einer Null.«
Maria Marc stand zwischen den keifenden Frauen, völlig überfordert, und rief nur »Kinder, Kinder«. Später wird sie klagen, Else Lasker-Schüler habe schon sehr viel »von der Pose der weltschmerzlichen Literatin an sich«, aber immerhin: »sie hat auch wirklich was erlebt im Gegensatz zu den jungen Weltschmerzlern in Berlin«. So also sieht die Welt des Jahres 1913 aus, von Sindelsdorf aus betrachtet.
Am 20. Januar findet im mittelägyptischen Tell el-Amarna eine Fundteilung der neuesten, vom Berliner James Simon finanzierten Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft statt: Dabei wird die Hälfte der Funde dem Museum in Kairo zugesprochen, die andere Hälfte den deutschen Museen, darunter die »bemalte Gipsbüste einer Prinzessin der Königsfamilie«. Der Direktor der französischen Altertümerverwaltung in Kairo genehmigt die vom Grabungsleiter, dem deutschen Archäologen Ludwig Borchardt, vorgenommene Aufteilung. Borchardt allein ahnte sofort, dass er einen Jahrtausendfund in der Hand hatte, als ihm ein aufgeregter ägyptischer Grabungsgehilfe die Büste in die Hand drückte. Schon ein paar Tage später tritt die Gipsbüste ihre Reise nach Berlin an. Noch trägt sie nicht den Namen Nofretete. Noch ist sie nicht die berühmteste Frauenbüste der Welt.
Es ist ein völlig überdrehtes Jahr. Kein Wunder also, dass der russische Pilot Pjotr Nikolajewitsch Nesterow mit seinem Kampfflugzeug 1913 den ersten Looping der Menschheitsgeschichte flog. Und dass der österreichische Eiskunstläufer Alois Lutz auf einem zugefrorenen See im bitterkalten Januar sich so gekonnt in der Luft drehte, dass dieser Sprung bis heute den Namen Lutz trägt. Man muss dafür rückwärts Anlauf nehmen, dann muss man von der Auswärtskante des linken Beins abspringen. Die Drehung wird erreicht, indem man die Arme ruckartig an den Oberkörper reißt. Für den doppelten Lutz macht man das, logisch, zweimal.
Vier Wochen wird Stalin in Wien bleiben. Nie wieder wird er Russland für so lange Zeit verlassen, die nächste längere Auslandsreise wird ihn dreißig Jahre später nach Teheran führen, seine Gesprächspartner heißen dann Churchill und Roosevelt (der eine war 1913 englischer Marineminister, der andere kämpfte als Senator in Washington gegen die Abholzung der amerikanischen Wälder). Stalin verlässt sein geheim gehaltenes Versteck in der Schönbrunner Schloßstraße Numero 30 bei den Trojanowskis nur selten, er ist komplett damit beschäftigt, seinen Aufsatz »Der Marxismus und die nationale Frage« zu verfassen – ein Auftrag von Lenin. Nur ganz manchmal, am frühen Nachmittag, vertritt er sich die Füße im nahen Park von Schloss Schönbrunn, der kalt und wohlgeordnet daliegt im Januarschnee. Einmal am Tag gibt es eine kurze Aufregung, wenn der Kaiser Franz Joseph das Schloss verlässt und mit seiner Kutsche in die Hofburg zum Regieren fährt. Unglaubliche fünfundsechzig Jahre, seit 1848, ist Franz Joseph jetzt an der Macht. Den Tod seiner geliebten Sissi hat er nie verwunden, bis heute hängt ihr lebensgroßes Porträt über seinem Schreibtisch.
Der greise Monarch geht gebeugt die paar Schritte zur dunkelgrünen Kutsche, sein Atem hinterlässt eine kleine Wolke in der kalten Luft, dann schließt ein livrierter Diener die Tür, und die Pferde traben los durch den Schnee. Dann wieder Stille.
Stalin geht durch den Park, denkt nach, es dämmert schon. Da kommt ihm ein anderer Spaziergänger entgegen, 23 Jahre alt, ein gescheiterter Maler, dem die Akademie die Aufnahme verweigerte und der nun die Zeit totschlägt im Männerwohnheim in der Meldemannstraße. Er wartet, wie Stalin, auf seine große Chance. Sein Name ist Adolf Hitler. Vielleicht haben sich die beiden, von denen ihre Bekannten aus dieser Zeit erzählten, dass sie beide gerne im Park von Schönbrunn spazieren gingen, einmal höflich gegrüßt und den Hut gelüpft, als sie ihre Bahnen zogen durch den unendlichen Park.
Das Zeitalter der Extreme, das schreckliche kurze 20. Jahrhundert, beginnt an einem Januarnachmittag des Jahres 1913 in Wien. Der Rest ist Schweigen. Selbst als Hitler und Stalin 1939 ihren verhängnisvollen »Pakt« schlossen, sind sie sich nicht begegnet. Sie waren sich also nie näher als an einem dieser bitterkalten Januarnachmittage im Park von Schloss Schönbrunn.
Die Droge Ecstasy wurde erstmals synthetisiert, das ganze Jahr 1913 über läuft der Patentantrag. Dann aber gerät sie für einige Jahrzehnte in Vergessenheit.
Da meldet sich endlich Rainer Maria Rilke! Rilke ist auf seiner Flucht vor dem Winter und seiner Schaffenskrise im südspanischen Ronda gelandet. Die Reise nach Spanien hatte ihm eine Unbekannte in einer nächtlichen Séance befohlen, und da Rilke zeitlebens angewiesen war auf die Handlungsanweisungen reifer Damen, musste er offenbar zu okkulten Zwischenreichbewohnerinnen greifen, wenn die realen Mäzeninnen und Geliebten ihm gerade keine Order zu erteilen wussten. Nun also residiert er in Ronda im schicken Hotel Reina Victoria, einem britischen Haus auf neuestem Stand, aber jetzt, außerhalb der Saison, fast leer. Brav schreibt er von hier oben jede Woche an »die liebe gute Mama«. Und an die anderen fernen Damen, mit denen er gemeinsam so schön schmachten kann, an Marie von Thurn und Taxis, an Eva Cassirer, Sidie Nádherný, an Lou Andreas-Salomé. Wir werden noch hören von diesen Damen in diesem Jahr, keine Sorge.
Zurzeit steht Lou, die Frau, die ihn entjungferte und ihn überredete, das René seines Vornamens zu Rainer aufzumöbeln, plötzlich wieder sehr hoch im Kurs: »Wenn wir uns nur sehen, liebe Lou (das Wort »liebe« dreimal unterstrichen), das ist jetzt meine große Hoffnung.« Und an den Rand kritzelt er noch »mein Halt, mein Alles, wie immer«. Dann ab zum Postzug, der drei Stunden bis Gibraltar braucht. Und von dort dann weiter in die Berggasse 19, Lou Andreas-Salomé c/o Prof. Dr. Sigmund Freud. Und Lou schreibt an den »lieben, lieben Jungen«, sie glaube, jetzt härter mit ihm sein zu können als damals. Und: »Ich glaube, dass Du leiden musst und immer wirst.« Ist das noch Sado-Maso oder schon Liebe?
Mit Leiden und Briefeschreiben gehen die Tage so dahin. Manchmal arbeitet Rilke weiter an seinen »Duineser Elegien«, immerhin die ersten 31 Verse der sechsten Elegie gelingen ihm, doch er wird einfach nicht fertig damit, lieber geht er in seinem weißen Anzug und seinem hellen Hut spazieren oder liest im Koran (um sofort danach ekstatische Gedichte auf Engel und Marias Himmelfahrt zu schreiben). Man könnte sich wohlfühlen hier, fernab des finsteren Winters, und zunächst genießt es Rilke auch, dass hier die Sonne auch im Januar erst um halb sechs hinter den Bergen versinkt, dass sie vorher die so stolz auf ihrem Felsplateau thronende Stadt Ronda noch einmal warm aufleuchten lässt, »ein unvergleichliches Schauspiel«, wie er seiner Frau Mama schreibt. Die Mandelbäume blühen schon, die Veilchen, im Hotelgarten sogar die lichtblaue Iris. Rilke zückt sein kleines schwarzes Taschenbuch, bestellt einen Kaffee auf der Terrasse, schlägt die Decke um die Hüften, blinzelt noch einmal in die Sonne und notiert dann: »Ach wers verstünde zu blühn: Dem wäre das Herz über alle / Schwachen Gefahren hinaus und in der großen getrost.«
Ja, wers verstünde zu blühn. In München arbeitet Oswald Spengler, der dreiunddreißigjährige Misanthrop, Soziopath und Mathematiklehrer außer Dienst, am ersten Hauptteil seines Monumentalwerkes »Der Untergang des Abendlandes«. Er selbst geht bei diesem Untergang mit gutem Beispiel voran. »Ich bin«, so schreibt er 1913 in den Notizen zu seiner Autobiographie, »der letzte meiner Art«. Alles gehe zu Ende, in ihm und an seinem Leib würden die Leiden des Abendlandes sichtbar. Negativer Größenwahn. Verwelkende Blüten. Spenglers Urgefühl: Angst. Angst davor, einen Laden zu betreten. Angst vor Verwandten, Angst, wenn andere Dialekt sprechen. Und natürlich: »Angst vor Weibern – sobald sie sich ausziehen.« Unerschrockenheit kennt er nur im Denken. Als 1912 die Titanic sank, erkannte er darin eine tiefe Symbolik. In seinen parallel entstandenen Notizen leidet er, lamentiert, klagt über eine schwere Kindheit und eine noch schwerere Gegenwart. Täglich neu notiert er: Es geht eine große Zeit zu Ende, merkt es denn keiner? »Kultur – noch letztes Aufatmen vor dem Erlöschen.« Im »Untergang des Abendlandes« formuliert er es dann so: »Jede Kultur hat ihre neuen Möglichkeiten des Ausdrucks, die erscheinen, reifen, verwelken und nie wiederkehren.« Aber so eine Kultur gehe langsamer unter als ein Ozeandampfer, keine Sorge.
Seit Anfang des Jahres vertreibt der Verlag Carl Simon in Düsseldorf eine neue Original-Lichtbilder-Serie mit 72 farbigen Original-Glas-Platten, sieben Pappschachteln in einer hölzernen Kiste, mit einem 35-seitigen Zusatzheft. Thema: »Der Untergang der Titanic«. Überall im Land wurden die Lichtbildervorträge gezeigt. Zuerst sieht man den Kapitän, das Boot, die Kabinen. Dann den nahenden Eisberg. Die Katastrophe, die Rettungsboote. Das sinkende Schiff. Es stimmt: Ein Ozeandampfer geht schneller unter als das Abendland. Leonardo DiCaprio ist noch nicht geboren.
Franz Kafka übrigens, einer von denen mit großer Angst, wenn die Weiber sich ausziehen, hat erst einmal eine ganz andere Sorge. Ihm fällt siedend heiß etwas ein. In der Nacht vom 22. zum 23. Januar schreibt er seinen etwa zweihundertsten Brief an Felice Bauer und fragt: »Kannst Du eigentlich meine Schrift lesen?«
Kannst du eigentlich die Welt lesen? So fragen sich Pablo Picasso und Georges Braque und erfinden immer neue Chiffren, die die Betrachter entziffern sollen. Gerade haben sie der Welt beigebracht, dass man Perspektivwechsel malen kann – genannt Kubismus, nun, im Januar 1913, gehen sie schon wieder einen Schritt weiter. Synthetischer Kubismus wird man das später nennen, weil sie nun Holzfaserfolie auf die Bilder kleben und allerlei anderes, die Leinwand wird zum Abenteuerspielplatz. Braque hatte gerade ein neues Atelier in Paris bezogen, ganz oben im Hotel Roma in der Rue Caulaincourt, da nahm er plötzlich seinen Kamm und zog ihn durch sein Bild »Obstschale, Kreuz As« – und die Linien sahen aus wie Holzmaserung. Picasso nahm das noch am selben Tag auf. Und wie immer konnte er es bald besser als der Erfinder selbst. So eilten die Revolutionäre der Kunst immer weiter, getrieben von der panischen Angst, vom bürgerlichen Publikum vollständig verstanden zu werden. Es dürfte Picasso beruhigt haben, wenn er gewusst hätte, dass Arthur Schnitzler am 8. Februar in sein Tagebuch schreibt: »Picasso: die frühern Bilder außerordentlich; heftiger Widerstand gegen seinen jetzigen Kubismus.«
Mit knapper Not hat er überlebt. Und nun muss Lovis Corinth ordentlich bezahlen für sein Lebenswerk. Am 19. Januar soll in der »Secession« am Kurfürstendamm 208 eine spektakuläre Ausstellung eröffnet werden, 228 Gemälde, Titel »Lebenswerk«. Heute, am ersten Tag des Jahres, erschöpft und verkatert auf seinem Kanapee in der Klopstockstraße 48 liegend, graut ihm ein wenig davor. Es ist kaum vier Uhr und schon wieder dunkel, vom Himmel kommt Schneeregen.
Nun will also erst einmal die Rahmenhandlung Weber aus der Derfflingerstraße 28 ihr Geld für die Einrahmung des »Lebenswerkes« – und zwar stolze 1632,50 Mark. Und für den Empfang, den er zur Eröffnung gibt, braucht der Caterer, Adolf Kraft Nachfolger, Kurfürstendamm 116, 200 Mark Vorkasse. Dafür wird geliefert: »1 Schüssel Zunge. 1 Schüssel Coburger Schinken mit Cumberlandsauce. 1 Schüssel Rehrücken mit Cumberlandsauce. 1 Schüssel Roastbeef mit Remoulade.« Lovis Corinth wird schon beim Lesen übel. Lebenswerk mit Cumberlandsauce. Ihm liegt noch der schlecht gekochte polnische Karpfen vom Abend zuvor im Magen. Wenn seine geliebte Charlotte weg ist, dann frisst er immer zu viel, das ist die Sehnsucht, er kennt das schon. Und so schreibt er einen Neujahrsbrief an seine Frau Charlotte, die fern in den Bergen durch den Schnee wandert: »Wer weiß, wie nun dieses neue Jahr gehen wird; schön war ja nicht das alte. Schwamm drüber.« Fürwahr. Corinth, dieser immer vor Kraft strotzende Maler, den es aus dem Hochbarock ins Berlin des frühen 20. Jahrhunderts hinübergefegt hatte, wurde von einem schweren Schlaganfall gebeutelt, seine Frau hatte ihn aufopfernd gepflegt. Als die »Lebenswerk«-Ausstellung geplant wurde, befürchteten alle, dass ebenjenes bei Corinth abgeschlossen war. Doch er hatte sich zurückgekämpft ins Leben. Und auch an die Staffelei. Nun hingen überall in der Stadt die Plakate für die große Ausstellung, täglich 9–4 Uhr, Eintritt 1 Mark, darauf Corinth, ungläubig staunend über sich selbst, während Charlotte sich also fern von Corinth in Tirol ein wenig von Corinth erholte. Rechtzeitig zum Empfang ist sie zurück. Gut sehen Sie aus, Madame, sagt Max Liebermann zu ihr am 19. Januar in der »Secession« bei der Eröffnung, den Rehrücken mit Cumberlandsauce in der rechten Hand. Gut sieht es aus, mein Lebenswerk, denkt sich Lovis Corinth, als er brummelnd durch die Ausstellungsräume stapft. Doch jetzt geht es weiter. Aber auch künftig bitte ohne diesen Kubismus.
Noch einmal kurz zu Freud in die Berggasse 19. Der sitzt also in diesen Januartagen in seinem Arbeitszimmer an dem Abschluss seiner Arbeit über »Totem und Tabu«. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass das Unbewusste mit aller Macht hineindrängt in dieses Buch über ethnologische Prinzipien von Tabubruch und Fetischisierung. Aber es scheint, als sei es ihm selbst gar nicht bewusst geworden: In jenem Moment jedenfalls, in dem ihn seine Schüler, vor allem der Zürcher C. G. Jung, Jahrgang 1875, herausfordern und mit heftigen Vorwürfen überziehen, entwickelt Freud, Jahrgang 1856, seine Theorie vom »Vatermord«. Jung hatte Freud im Dezember 1912 geschrieben: »Ich möchte Sie aber darauf aufmerksam machen, dass Ihre Technik, Ihre Schüler wie Ihre Patienten zu behandeln, ein Missgriff ist.« Er erzeuge so »freche Schlingel« und »sklavische Söhne«. Und weiter: »Unterdessen bleiben Sie immer schön oben als Vater. Vor lauter Untertänigkeit kommt keiner dazu, den Propheten am Barte zu zupfen.«
Selten in seinem Leben hat Freud etwas so getroffen wie dieser Vatermord. Sein Bart wird in jenen Monaten viele neue graue Haare bekommen haben, er entwirft einen ersten Antwortbrief, den er nicht abschickt und den man erst nach seinem Tod in seinem Schreibtisch finden wird. Am 3. Januar 1913 aber nimmt er doch seine ganze Kraft zusammen und schreibt an C. G.Jung nach Küsnacht: »Ihre Voraussetzung, dass ich meine Schüler wie Patienten behandle, sind nachweisbar unzutreffend.« Und dann: »Im übrigen ist Ihr Brief nicht zu beantworten. Er schafft eine Situation, die im mündlichen Verkehr Schwierigkeiten bereiten würde, im schriftlichen Wege ganz unlösbar ist. Es ist unter uns Analytikern ausgemacht, dass keiner sich seines Stückes Neurose zu schämen braucht. Wer aber bei abnormen Benehmen unaufhörlich schreit, er sei normal, erweckt den Verdacht, dass ihm die Krankheitseinsicht fehlt. Ich schlage Ihnen also vor, dass wir unsere privaten Beziehungen überhaupt aufgeben. Ich verliere nichts dabei, denn ich bin gemütlich längst nur durch den dünnen Faden der Fortwirkung früher erlebter Enttäuschungen an Sie geknüpft.« Was für ein Brief. Ein Vater, vom Sohn herausgefordert, sticht wütend zurück. Nie ist Freud so in Rage geraten wie in diesen Januartagen, nie habe sie ihn so deprimiert erlebt wie in jenem Jahr 1913, wird Anna, seine geliebte Tochter, später erzählen.
C. G. Jung antwortet am 6. Januar: »Ich werde mich Ihrem Wunsche, die persönliche Beziehung aufzugeben, fügen. Im übrigen werden Sie wohl am besten selber wissen, was dieser Moment für Sie bedeutet.« Das schreibt er mit Tinte. Und dann setzt er maschinengeschrieben hinzu, es wirkt wie ein Grabstein für eine der großen intellektuellen Männerbeziehungen des 20. Jahrhunderts: »Der Rest ist Schweigen«. Es ist eine schöne Ironie, dass einer der meistgedeuteten und meistbeschriebenen und meistdiskutierten Brüche des Jahres 1913 mit einem Schweigegelöbnis beginnt. Von diesem Moment an arbeitet sich Jung an Freuds Methoden ab und Freud umgekehrt an denen von Jung. Und vorher definiert er noch einmal ganz genau den Vatermord bei den Naturvölkern: Sie setzen Masken des gemordeten Vaters auf – und beten ihr Opfer dann an. Das ist ja schon fast Dialektik der Aufklärung.