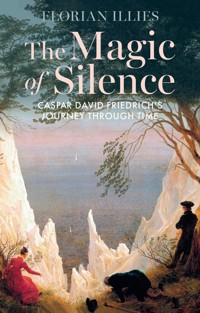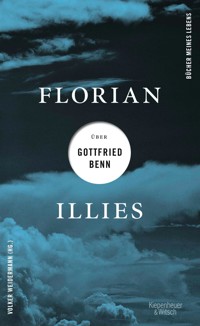9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Ich habe das neue ›1913‹ in einer einzigen Nacht durchgelesen. Es ist phantastisch, so reich, ein großes Geschenk.« Ferdinand von Schirach Sie hätten sich gewünscht, dass das Buch ›1913‹ von Florian Illies noch lange nicht zu Ende ist? Dem Autor ging es genauso. Seit Jahren hat er nach neuen aufregenden Geschichten aus diesem unglaublichen Jahr gesucht – und sie gefunden. So gibt es jetzt 271 neue Seiten mit vielen hundert weiteren aberwitzigen, berührenden, umwerfenden und bahnbrechenden Episoden aus diesem Jahr außer Rand und Band. Die genau da weitermachen, wo ›1913. Der Sommer des Jahrhunderts‹ aufgehört hat. Freuen Sie sich auf neue Geschichten voll Liebe und Witz, die so unglaublich sind, dass sie nur wahr sein können. Der Nachfolgeband des internationalen Beststellers und »erzählerischen Juwels« (The Guardian) ›1913. Der Sommer des Jahrhunderts‹, der in 26 Sprachen übersetzt wurde. Mit dem Register für beide Bände! »Dieses Jahr 1913 lässt mich einfach nicht los. Und je tiefer ich hineingetaucht bin, um so schönere Schätze fand ich auf dem Meeresgrund.« Florian Illies
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Florian Illies
1913
Was ich unbedingt noch erzählen wollte
Über dieses Buch
Sie hätten sich gewünscht, dass das Buch »1913« von Florian Illies noch lange nicht zu Ende ist? Seien Sie beruhigt: Dem Autor ging es genauso. Seit dem Erscheinen seines Bestsellers hat er immer weiter nach neuen Geschichten aus diesem unglaublichen Jahr gesucht – und sie gefunden. Es sind neue, aberwitzige Erzählungen aus einem Jahr außer Rand und Band, die genau da weitermachen, wo »1913. Der Sommer des Jahrhunderts« aufhört.
Der Bestsellerautor und Kunsthistoriker Florian Illies unternimmt eine neue mitreißende Reise in die Vergangenheit: Über 100 neue Seiten mit zahlreichen Figuren und Geschichten aus Literatur, Kunst und Musik.
Erstmals mit Register für diesen und den ersten Band »1913«, um alle Helden schneller zu finden.
»Dieses Jahr 1913 lässt mich einfach nicht los. Und je tiefer ich hineingetaucht bin, um so schönere Schätze fand ich auf dem Meeresgrund.«
Florian Illies
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
WINTER 1913
Stanislaw Witkacy fotografiert die [...]
Oskar Barnack erfindet die [...]
Am 5. März reist Herwarth [...]
DER FRÜHLING
Am 1. April, kein Scherz, [...]
Seine Kaiserliche und Königliche [...]
Um ein Uhr in [...]
DER SOMMER
Artur Rubinstein, größter Pianist [...]
Nach den rauschenden Erfolgen [...]
Wie groß ist die [...]
DER HERBST
Alfred Lichtenstein, gerade zurück [...]
In Bayern gehen die [...]
Im November bringt die [...]
Auswahlbibliographie
Abbildungsnachweis
Kurzer Dank
Register
WINTER 1913
Maxim Gorki holt sich einen Sonnenbrand auf Capri. Peter Panter jagt Theobald Tiger. Hermann Hesse sehnt sich nach seinem Zahnarzt, und Puccini hat keine Lust auf ein Duell. Ein neuer Komet erscheint am Himmel, und Rasputin verhext Russlands Frauen. Aber Marcel Proust findet keinen Verleger für »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Dr. med. Arthur Schnitzler kümmert sich um seinen schwierigsten Patienten, die Gegenwart. Ein Feuerschlucker aus Berlin-Pankow wird König von Albanien. Nur für fünf Tage. Aber immerhin.
Stanislaw Witkacy fotografiert die hinreißend schöne Jadwiga Janczewska. Doch sie hat sich schon einen Revolver besorgt.
In dieser Silvesternacht, in den Stunden zwischen dem 31. Dezember 1912 und dem 1. Januar 1913, beginnt unsere Gegenwart. Es ist für die Jahreszeit zu warm. Das kennen wir ja. Sonst kennen wir nichts. Herzlich willkommen.
Es ist spät geworden an jenem 31. Dezember in Köln, draußen leichter Regen. Rudolf Steiner, der Messias der Anthroposophie, hat sich in Rage geredet, er spricht am vierten Abend hintereinander in Köln, die Zuhörer hängen an seinen Lippen, gerade greift er zum Jasmintee, nimmt einen Schluck, da läuten die Glocken zwölf Mal, man hört die Menschen draußen auf den Straßen schreien und jubeln, aber Rudolf Steiner spricht einfach weiter und verkündet, dass eigentlich nur durch Yoga das verstörte Deutschland wieder zur Ruhe finden kann: »Im Yoga macht sich die Seele von dem frei, worin sie eingehüllt ist, überwindet das, worin sie eingehüllt ist.« Spricht’s, geht und hüllt sich in Schweigen. Prost Neujahr.
Picasso blickt hinab zu seinem aufschauenden Hund: Frika, diese seltsame Mischung aus bretonischem Spaniel und deutschem Schäferhund, mag es nicht, wenn er seinen Koffer packt, sie winselt und will dann immer unbedingt mit. Egal, wohin es geht. So nimmt er sie also kurzerhand an die Leine, ruft nach Eva, seiner neuen Geliebten, und zu dritt brechen sie in Paris auf, um mit dem nächsten Zug nach Barcelona zu fahren. Picasso will seinem alten Vater seine neue Liebe vorstellen (kaum ein Jahr später sind der Vater, der Hund und Eva tot, aber das gehört nicht hier hin).
Hermann Hesse und seine Frau Mia wollen es noch einmal versuchen. Sie haben ihre Kinder Bruno, Heiner und Martin bei der Schwiegermutter abgeladen und sind nach Grindelwald gefahren, es ist nicht weit von ihrem neuen Haus bei Bern hinauf in die Berge, zum kleinen Hotel »Zur Post«, das in diesen Tagen schon kurz nach drei Uhr am Nachmittag im Schatten der mächtigen Eigernordwand versinkt. Hesse und seine Frau hoffen, hier im Schatten die Leuchtkraft ihrer Liebe wiederzufinden. Sie kam ihnen abhanden wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Doch es nieselt. Wartet nur, balde, sagt der Hotelier, wird der Regen zu Schnee. Also leihen sie sich Skier aus. Aber es nieselt weiter. Und der Silvesterabend im Hotel ist lang und quälend und sprachlos, der Wein ist gut, immerhin. Irgendwann ist es endlich zwölf Uhr. Sie stoßen müde an. Dann gehen sie aufs Zimmer. Als sie morgens den schweren Vorhang zur Seite schieben und aus dem Fenster schauen, regnet es noch immer. Nach dem Frühstück bringt Hermann Hesse die unbenutzten Skier wieder zurück.
Rilke schreibt da gerade aus Ronda richtig Rührendes an den rüstigen Rodin.
Hugo von Hofmannsthal spaziert am 31. Dezember missmutig durch die Straßen von Wien. Ein letzter Gang durchs alte Jahr. Der Frost hält die Zweige der Bäume in den Alleen ummantelt, und auch auf den Fugen der Mauern sitzen die weißen Kristalle. Langsam senkt sich die dunkle Kälte über die Stadt. Als er in der Wohnung zurück ist, beschlagen seine Brillengläser, er reibt sie sauber mit seinem Taschentuch mit dem herrlich verschnörkelten Monogramm. Mit der noch kalten Hand streicht er über die Kommode, auf die er seinen Schlüssel legt. Ein Erbstück. Fasst dann auch den kunstvollen Spiegel an, der einst im Haus der Ahnen hing. Setzt sich an seinen prachtvollen handgearbeiteten Sekretär und schreibt: »Man hat manchmal den Eindruck, als hätten uns Spätgeborenen unsere Väter und unsere Großväter nur zwei Dinge hinterlassen: hübsche Möbel und überfeine Nerven. Bei uns ist nichts zurückgeblieben als frierendes Leben, schale, öde Wirklichkeit. Wir schauen unserem Leben zu; wir leeren den Pokal vorzeitig, und bleiben dennoch unendlich durstig.« Dann ruft er nach dem Diener. Und bittet um einen ersten Cognac. Er weiß aber längst: das wird auch nicht helfen gegen die Melancholie, die auf seinen müden Lidern liegt. Er kann nichts dagegen tun, aber er weiß den Untergang, wo andere ihn nur erahnen, er kennt das Ende, wo andere nur damit ihre zynischen Spiele treiben. Und so schreibt er an seinen Freund Eberhard von Bodenhausen, dankt für den Gruß »über das ganze große umdüsterte beklommene Deutschland hinweg«, um dann zu gestehen: »Mir ist so eigen zumut, alle diese Tage, in diesem konfusen, leise angstvollen Österreich, diesem Stiefkind der Geschichte, so eigen, einsam, sorgenvoll«. Auf mich, so heißt das, hört ja keiner.
Mit jungen Jahren war Hofmannsthal zu einer Legende geworden, seine Verse verzückten Europa, Stefan George, Georg Brandes, Rudolf Borchardt, Arthur Schnitzler, sie alle gerieten in den Bann dieses Genies. Doch Hugo von Hofmannsthal trug schwer an der Bürde des Frühvollendeten, er publizierte quasi nicht mehr, und jetzt, 1913, war er ein fast vergessener Mann, ein Relikt aus alten Zeiten, aus der »Welt von gestern« und so gründlich vergangen wie die Gesellschaft, deren Wunderkind er gewesen war. Er war der letzte Dichter des alten Österreichs, jenes Wiens, in dem im Jänner 1913 die Regentschaft von Kaiser Franz Joseph I. ins unglaubliche fünfundsechzigste Jahr geht. 1848 war er gekrönt worden, und 1913 trug er diese Krone noch immer, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. Doch genau unter seiner ermatteten Regentschaft, die aus den Tiefen des 19. Jahrhunderts kam, übernahm in Wien die Moderne die Herrschaft. Mit den Revolutionsführern Robert Musil, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud, Stefan Zweig, Arnold Schönberg, Alban Berg, Egon Schiele, Oskar Kokoschka und Georg Trakl. Die alle mit Worten und Tönen und Bildern die Welt umkrempeln wollen.
Hedwig Pringsheim, Thomas Manns mondäne Schwiegermutter, fährt, die Masseuse ist endlich gegangen, am frühen Abend von ihrer Villa in der Münchner Arcisstraße 12 aus zum Silvesteressen »bei Tommy’s« (das ist kein Restaurant in New York, sondern ihre patriarchalische Bezeichnung für die Familie ihrer Tochter Katia, verheiratete Mann, die in der Mauerkircherstraße 13 wohnt). Aber schon beim Setzen in der Mann’schen Wohnung jagt ihr der Schmerz erneut in den Rücken, der verdammte Ischias. Weil der gute Tommy am nächsten Tag nach Berlin reisen muss (was er noch bitter bereuen wird), bricht der alte Spielverderber den Silvesterabend um elf Uhr abrupt ab: »Ihr wisst, ich muss morgen früh raus.« Aber auch vorher schon war es, so die Schwiegermutter, höchstens »leidlich gemütlich«. In der ratternden Tram, auf der Heimfahrt, schlägt die Uhr vom Odeonsplatz dann zwölf Mal. Ihr Rücken schmerzt, ihr Mann, der Mathematiker Professor Alfred Pringsheim, sitzt neben ihr, schweigt und rechnet irgendetwas mit komplizierten Primzahlen. Wie unromantisch. Genau eine Straße weiter sitzt Karl Valentin und schreibt in dieser Nacht an Liesl Karlstadt: »Gesundheit und unser köstlicher Humor sollen uns nie verlassen, und bleibe fernerhin mein gutes braves Lieserl«. Wie romantisch.
Ja, genau, das ist eben jene Nacht, in der Louis Armstrong im fernen New Orleans damit beginnt, Trompete zu spielen. Und in Prag Franz Kafka am offenen Fenster sitzt und schmachtend und wundervoll und verstörend schreibt an Fräulein Felice Bauer, Immanuelkirchstraße 4, Berlin.
Der große ungarische Romancier, Freudianer, Morphinist und Erotomane Géza Csáth sitzt in dieser Nacht hingegen in seiner kleinen Arztwohnung im Sanatorium des winzigen Kurortes Stubnya, im letzten Zipfel des riesigen Habsburgerreichs, liest noch ein wenig in den Schriften Casanovas, steckt sich dann eine Luxor-Zigarre an, spritzt sich noch einmal 0,002 Gramm Morphium und zieht dann eine erfolgreiche Jahresbilanz: »360- bis 380-mal Koitus«. Geht’s noch konkreter? Aber ja. Csáth erstellt eine penible Auflistung seiner Beziehung zu seiner Geliebten Olga Jónás, die in ihrer Genauigkeit nur von der Robert Musils übertroffen wird: »424-mal Koitus an 345 Tagen, also täglich 1,268 Koitus«. Und weil er schon dabei ist: »Verbraucht an Morphium: 170 Zentigramm, also täglich 0,056 Gramm«. Und weiter geht es in der »Bilanz des Jahres«: »Einkommen von 7390 Kronen. Zehn verschiedene Frauen eingeheimst, darunter 2 Jungfrauen. Erscheinen meines Buches über Geisteskrankheiten«. Und was soll werden in 1913? Der Plan ist klar: »Koitus jeden zweiten Tag. Zähne machen lassen. Neues Jackett.« Na, dann mal los.
Alles ist neu im Jahr 1913. Überall werden Zeitschriften gegründet, die die Uhren auf null drehen wollen. Während Maximilian Harden schon seit 1892 in seiner Zeitschrift »Die Zukunft« dieselbige für sich reklamiert, nimmt sich die nächste Generation die Gegenwart vor. Gottfried Benn, der junge Arzt im Westend-Krankenhaus in Berlin, bietet gerade geschriebene Gedichte sowohl Paul Zechs Zeitschrift »Das neue Pathos« an wie Heinrich Bachmairs »Die neue Kunst«. Nur das ebenfalls 1913 neugegründete Blatt »Der Anfang« lässt er erst einmal aus. Dafür schreibt dort, also in Heft Nr. 1 von »Der Anfang« auf Seite 1, der junge Walter Benjamin. Was für ein symbolischer Start, was für ein symbolisches Ende einer »Berliner Kindheit um Neunzehnhundert«.
Marcel Proust ist endlich fertig mit dem ersten Teil von »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Geschafft. 712 engbeschriebene Seiten sind es geworden. Er schickt das dicke Manuskriptbündel an den Pariser Verlag Fasquelle, dann an den Verlag Ollendorff, dann an Gallimard. Alle lehnen ab. Bei Gallimard kam die Absage vom Cheflektor persönlich, dem Schriftsteller André Gide, der sich rühmen durfte, mit Oscar Wildes Hilfe vor kurzem in Marokko in die Freuden der gleichgeschlechtlichen Liebe eingeführt worden zu sein. Er brach die Lektüre des Manuskripts von Proust nach etwa 70 Seiten ab, weil er bei einer Frisurbeschreibung eine syntaktische Ungenauigkeit entdeckte, die ihm ungeheuer auf die Nerven ging. André Gide ist in etwa so leicht reizbar wie Marcel Proust. In jedem Fall hatte Gide den Eindruck, diesem Autor könne man nicht trauen. Später, als er selbst kaum noch Haare hatte, wird André Gide dieses Stolpern über eine falsche Frisur als den größten Fehler seines Lebens bezeichnen. Jetzt aber ist erst einmal Marcel Proust verzweifelt. »Das Buch«, so schreibt er, »verlangt jetzt nach einem Grab, das bereit ist, bevor sich meines über mir schließt.«
Am Morgen des 1. Januar, und zwar um 8.30 Uhr, wenn Sie es genau wissen wollen, besteigen Kaiser Wilhelm II. und seine Frau Auguste Viktoria am Neuen Palais in Potsdam ihr Automobil, um sich zum offiziellen Hauptquartier der Monarchie fahren zu lassen, dem Berliner Stadtschloss. Sie kommen dort an, ohne dass etwas Nennenswertes geschieht. Ist das ein gutes Omen?
Am Nachmittag des 1. Januar wird Kalifornien von einem Erdbeben durchgerüttelt. Das Epizentrum liegt in jenem Tal, das später als Silicon Valley die Welt regieren wird. Unbeeindruckt von dem Erdbeben wird am 1. Januar erstmals in Amerika ein Paket mit der Post versandt. Wenige Tage später bricht Franz Kafka, vollkommen ratlos, trotzdem die Arbeit an seinem Roman »Amerika« ab.
Am 2. Januar demonstrieren der ungarische Parlamentspräsident Istvan Graf Tisza und der Oppositionsführer Mihaly Graf Károlyi von Nagykárolyi ihren naiven bürgerlichen Kollegen, wie politische Fragen am sinnvollsten zu lösen sind: mit einem Duell. Im Morgengrauen des 2. Januar stehen sie sich mit Säbeln gegenüber. Beide verletzen sich leicht. Und nehmen am nächsten Tag ihre parlamentarische Arbeit wieder auf. Graf Károlyi muss danach dringend heiraten, denn er hatte durch Kartenspiel unvorstellbare Schulden in Höhe von 12 Millionen Kronen angehäuft. Und Graf Tisza wird am 10. Juni wieder ungarischer Regierungschef. Aber das hielt ihn nicht davon ab, sich am 20. August erneut zu duellieren, diesmal mit dem Oppositionsabgeordneten György Pallavicini, der Tisza der Zeugenbeeinflussung in einem Ehrbeleidigungsprozess beschuldigt hatte.
Auch diesmal wurden beide Duellanten verletzt. Als Tisza nach zahllosen weiteren Wirren während des Krieges im Oktober 1918 von Aufständischen erschossen wurde, sprach er immerhin die preisverdächtigen goldenen letzten Worte: »Es musste so kommen.«
Muss es so kommen? Nein. Giacomo Puccini erhält am 2. Januar in seinem toskanischen Landsitz eine Aufforderung zum Duell. Der Münchner Baron Arnold von Stengel kann Puccinis Affäre mit seiner Ehefrau Josephine nicht länger ertragen. Doch Puccini schießt viel lieber auf Enten und Wildschweine als auf Menschen. Er lässt dem Baron ausrichten, er habe für ein solches Duell im Moment leider keine Zeit.
Am Tag drauf schickt Arthur Schnitzler aus Wien nach Kopenhagen an die Filmfirma Nordisk die Kinobearbeitung seines Schauspiels »Liebelei«. Darin muss sich der frisch verliebte Leutnant Fritz in einem Duell für eine längst vergangene Liebschaft mit einer verheirateten Ehefrau verantworten. Auch der gehörnte Ehemann liebt seine Frau nicht mehr, aber es geht schließlich um die Ehre. Fritz stirbt. Die Ehre ist wiederhergestellt. Und doch vollkommen sinnlos geworden. So die Diagnose von Dr. med. Arthur Schnitzler für seinen schwierigsten Patienten, die Gegenwart.
Am 3. Januar endet die Ära des Stummfilms. Thomas Edison veranstaltet an diesem Abend die erste Vorführung seines Kinetophons in seiner Werkstatt in New Orange in West Jersey. Erstmals können gleichzeitig Bilder mit Tönen gezeigt werden. Es geht also los.
Am 4. Januar stirbt Alfred von Schlieffen, der Generalstabschef des deutschen Heeres. Zeitlebens plante er den Krieg. Er war der größte Stratege seiner Zeit. Er hatte einen »Aufmarschplan 1« entwickelt, den Präventivschlag gegen den Erzfeind, den berühmten »Schlieffen-Plan«, mit dem das deutsche Heer Frankreich überrollen konnte. Doch jetzt ist er tot. Wird nun alles gut?
Ernst Zermelo formuliert im Januar 1913 auf einem Kongress der internationalen Gesellschaft für Mathematik erstmals eine Spieltheorie – mit einem Beispiel aus dem Schach. »In endlichen 2-Personen-Nullsummenspielen (wie etwa Schach) existiert entweder eine dominante Strategie für einen Spieler, dann kann dieser unabhängig von der Strategie des anderen gewinnen, oder eine solche Strategie existiert nicht.« Ein irrer Satz. Gut, dass Schlieffen, der große Stratege der Dominanz, gerade gestorben war. Und ist eigentlich nur Schach oder auch ein Duell ein 2-Personen-Nullsummenspiel? Und die Liebe?
Die junge ungarische Tänzerin Romola de Pulszky ist 23 Jahre alt, sehr blond, sehr hübsch, sie hat einen hellen Teint und sèvresblaue Augen. In Budapest verfiel sie in diesem Winter den »Ballets Russes«, vor allem dem vierundzwanzigjährigen Nijinsky in seiner Jahrhundertrolle in »Nachmittag eines Fauns«. Als die Gruppe um den großen Impresario Djagilew nach Wien weiterreiste, da reiste sie einfach mit. Schon da wusste Romola, dass ihr Interesse im Allgemeinen dem Russischen Ballett, aber im Besonderen diesem Nijinsky galt. In Wien arrangierte sie unter einem Vorwand ein Treffen mit Djagilew in einem leeren Salon des Hotel Bristol. Sie bewarb sich scheinbar um eine Stelle im Ballett. Doch eigentlich bewarb sie sich um die Rolle an der Seite Nijinskys. Das spürte Djagilew auf Anhieb und verteidigte seinen tartarischen Liebhaber, wähnte sich auch in Sicherheit wegen dessen Homosexualität, er glaubte, er und Nijinsky, das wäre ein Zweipersonen-Nullsummenspiel. Doch Romola de Pulszky gelang es trotz des Argwohns Djagilews, ab sofort offiziell zur Truppe zu gehören, sie hatte ihre Beziehungen spielen lassen. Auf ihrer Tournee machten die Tänzer nun in London Station. Und während sie abends in Covent Garden »Petruschka« tanzten und »Nachmittag eines Fauns«, begannen vormittags die Proben für eine Revolution. Für Strawinskys urwüchsiges, archaisches Urwaldweltszenario »Le sacre du printemps«, für das Nijinsky im kühlen Londoner Januarregen eine Choreographie zu entwickeln versucht. Und jeden Tag aufs Neue daran scheitert. Es war kaum zu merken, wann eine Phase bei Strawinsky aufhörte und eine andere begann, so gebrochen und verzahnt war alles. Nijinsky droht zu verzweifeln an der Genialität Strawinskys. Immer wieder bricht er die Proben ratlos ab und redet sich in Rage. Romola de Pulszky legt ihm dann fürsorglich eine warme Decke um die Schultern, damit er sich nicht erkältet.
Egon Schiele kann seinen Blick nicht mehr von ihr wenden. Immer und immer wieder muss er Wally malen, nackt meist oder zumindest mit entblößter Scham. Doch auch dann bleiben ihre Augen so verstörend teilnahmslos, so schamlos modern. Auch am Nachmittag des 8. Januar sitzt Egon Schiele wieder in seinem Atelier in der Hietzinger Hauptstraße 101 in Wien, es waren fast immer zwei, drei Modelle gleichzeitig da, die sich erholten von den heimischen Wirren, sich räkelten, sich die Kleider ordneten, sich selbst überlassen von Schiele, der an seiner Staffelei saß und lauerte wie ein Tiger, der zum Sprung ansetzte, wenn er ein besonderes Motiv witterte. Dann rief er plötzlich »Halt!« durch den überheizten, großen Raum, und dann musste das Modell genau so verharren, und er malte es mit schnellem Strich. Und wenn es ihm gefiel, dann tunkte er noch den Pinsel in die Aquarellfarben und er nahm noch ein bisschen Rot und ein bisschen Blau. Bei Wally liebte er es, das Strumpfband, die Lippen, die Scham in jenem irrsinnigen Leuchtorange zu malen, das er auch ihren Haaren manchmal schenkte. Wie Blut wirkt dieses jähe, helle Rot. Auch an diesem 8. Januar 1913 kann Schiele wieder nicht die Augen von Wally Neuzil lassen, er ist so vernarrt, dass er sie zwingt (oder sie sich selbst), eine eigene Unabhängigkeitserklärung zu verfassen. Und so beugt sie sich halbnackt über Egon Schiele und schreibt in sein heiliges Skizzenbuch den folgenden Satz: »Ich versichere hiermit, daß ich in niemanden auf der Welt verliebt bin. Wally.« Und er, schwer erleichtert, weiß nicht, ob er sie auf der Stelle malen oder lieben soll.
Die Zigarettenmarke »Camel« wird in Winston-Salem, North Carolina gegründet. Sie ist die erste Marke, die Zigaretten in Zwanzigerpackungen anbietet. So beginnt also 1913 das 20. Jahrhundert der Zigarettenindustrie. Auf dem Logo der »Camel«-Zigarette ist seit 1913 leider kein Kamel, sondern ein Dromedar zu sehen, und zwar Old Joe, das zum Zirkus »Barnum und Bailey« gehörte. Barnum und Bailey gastieren im Januar 1913 in Winston, als Richard Joshua Reynolds, statt ein Logo zu entwerfen, nachmittags mit seinen Kindern in den Zirkus ging. Abends auf seiner Staffelei wurde das Dromedar dann zum Kamel. Der geheime Beitrag der Elternzeit zur globalen Designgeschichte, Teil 1.
Wer sind eigentlich die zwei Mädchen auf dem Cover dieses Buches? Die so neugierig in die Welt schauen, so mutig, aber doch auch so, als ahnten sie, was kommen wird? »Noch einmal vorm Verhängnis blühn«, so dichtet Gottfried Benn in genau der Zeit, als diese Fotografie entstand. Es sind Lotte und Edeltrude, die Töchter des Fotografen Heinrich Kühn, der sie tatsächlich im Jahre 1913 so in Farbe abgelichtet hat auf einem von ihm erfundenen »Autochrom«. »Ablichten«, was für ein schönes altmodisches Wort. Im Falle von Kühn aber stimmt es, denn er experimentierte viel, mit der Kamera, mit dem Papier, um als einer der Ersten mit der Kraft des Lichtes wirklich Farbfotografien zu schaffen. Fotos mit Weichheit ohne Süßlichkeit, wie er es selbst nannte. Wie Standfotos aus Adalbert Stifters »Nachsommer«. Seine Kinder mussten immer wieder in Kleidung in Rot und Blau und Türkis vor die Kamera treten, wie eine kleine Schauspieltruppe.
Es war eine Revolution, was dem, noch so ein wunderbar altmodisches Wort, Lichtbildner Kühn da in den Hängen rund um sein Haus bei Innsbruck in der Richard-Wagner-Straße 6 gelang, weil er erstmals die natürliche Weltwahrnehmung der Menschen mit der der fotografischen Welterfassung in Deckung brachte. Denn niemand schaut die Welt schwarz und weiß an – aber alle mussten 1913 noch die Fotografie in Schwarzweißreduktion akzeptieren, die Porträts, die Zeitungsfotos, die Gemäldereproduktionen, die Kinofilme. Lotte, geboren 1904, und Edeltrude, geboren 1897, wussten nicht, dass sie Bannerträgerinnen dieser kleinen Revolution der Mentalitätsgeschichte waren (der geheime Beitrag der Elternzeit zur globalen Fotografiegeschichte, Teil 1). Sie waren einfach nur Kinder. Sie wanderten unter dem riesigen Kastanienbaum im Garten einfach weiter, die Almhänge hinterm Haus hinauf, blickten über einen Zaun hinab ins weite Tal. Sie spielten mit dem Kindermädchen Mary Warner, das zu ihnen gekommen war, als ihre Mutter starb, und sie merkten, dass irgendwann ihr Vater anfing, ihr Kindermädchen genauso oft zu fotografieren wie sie selbst. So spürten sie, wie Liebe beginnt. Auf dem Cover von »1913. Der Sommer des Jahrhunderts« übrigens ist es genau diese Mary Warner, die mit ebenjener Edeltrude durch die blühenden Tiroler Wiesen läuft, während oben eine Wolke von der drohenden Zukunft kündet. »Es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913«, als dieses Foto entstand. Mit genau diesem Satz beginnt Robert Musils Jahrhundertroman »Mann ohne Eigenschaften«. Es ist das fiktive 1913/1914, in dem Thomas Manns Roman »Zauberberg« endet – und es ist das reale Jahr 1913, in dem er damit begonnen hat, ihn zu schreiben. Der kühne Zauberberg der Fotografie also, mit seinen Hängen aus Sehnsucht und Melancholie, der lag auch in den Alpen, nicht weit von Davos.
Im Januar denkt Sigmund Freud in Wien nach über den »Vatermord«. Im Januar nennt sich der große polnische Avantgardist Stanislaw Witkiewicz junior als Protest gegen seinen Vater Stanislaw Witkiewicz senior in einer großen Geste um in »Witkacy«. Hilft aber nicht wirklich. Er bleibt dennoch weiter bei Papa wohnen im polnischen Intellektuellenort Zakopane am Fuße der Hohen Tatra, der zu allem Überfluss auch noch komplett beherrscht war von den berühmten Architekturen seines Vaters. Es ist ein polnisches Davos, von überall her kommen die Lungenkranken, die echten und die eingebildeten. Die Häuser sind gebaut in einer Mischung aus Alpenhütte und Jugendstil, aber jetzt, in diesen Wintertagen sieht man das kaum, auf den Dächern liegt meterhoch der Schnee. Es schneit in dicken Flocken, als solle die ganze Welt in Schweigen gehüllt werden. Witkacy experimentiert mit der Kamera und schafft umwerfende Porträtserien von Arthur Rubinstein, als der große Pianist ihn im Januar in Zakopane besucht. Draußen ist der Schnee so hoch, dass sie tagelang nicht vor die Tür können. Immer wieder fotografiert Witkacy sich selbst und Rubinstein, immer wieder. Witkacy sei, sagt Rubinstein später, ein hemmungsloser Melancholiker, ein glühender Anhänger Nietzsches, ein flüsternder Mephisto. Sein späteres Hauptwerk wird »Unersättlichkeit« heißen. Das passt. Jetzt aber, in diesem Winter 1913, geht es ihm wieder einmal schlecht, Rubinstein kann ihn nur kurz über seine Depressionen hinwegtrösten. Aber wenn er anfängt, Klavier zu spielen, dann fühlt sich mit einem Mal alles friedlich an und still. Witkacy steht ergriffen im Türrahmen und lauscht. Diese Töne. Diese Finger. Draußen der Schnee. Und dann diese junge Dame, die sich im Hause Witkiewicz für den Winter einquartiert hat, um ihr Lungenleiden hier oben in den hohen Bergen zu kurieren. Doch nun soll sie selbst zur Kur werden: Stanislaw Witkacy Witkiewicz malt und fotografiert die hinreißend schöne Jadwiga Janczewska. Dann verliebt er sich in sie. Dann verlobt er sich mit ihr. Sie solle ihn, so beschließt Witkiewicz, aus seinem verlorenen Leben retten. Klappt leider nicht so ganz. Sie erschießt sich einige Monate später an einem Berghang bei Zakopane mit einem Revolver – nicht ohne vorher in einer wilden modernistischen Geste an der späteren Todesstelle einen üppigen Blumenstrauß aufzustellen. In einer Vase! Damit die Blumen länger halten als sie. Eros und Thanatos also, mit Hinweisschild. Das Zeitalter der Romantik endet, zumindest in Polen, erst 1913.
Am 8. Januar hält Julius Meier-Graefe, der bedeutendste Kunstschriftsteller seiner Zeit und der größte Vermittler des französischen Impressionismus (beide Superlative sind in diesem Fall zutreffend), in den neuen Räumen der Galerie Cassirer in der Viktoriastraße 35 in Berlin seinen Vortrag »Wohin treiben wir?« (in den Abgrund, so vermutet er). Es herrschte großes Gedränge, jedoch, so der Vortragende: »Verständnis war ziemlich null.« Paul Cassirer und seine Frau Tilla Durieux wollen danach mit Meier-Graefe essen gehen, doch der hat keine Lust: »Die brave Durieux zischte, weil ich nicht mit ihnen ins Esplanade ging.« Die brave Durieux war so etwas wirklich nicht gewohnt. Und ob man nun ausgerechnet sie »brav« nennen kann? In der Tat ist es ein herrlicher Affront von Meier-Graefe, eine solche Einladung auszuschlagen, denn Paul Cassirer und Tilla Durieux, das ist 1913 das unangefochtene kulturelle Königspaar Berlins. Und die beiden hatten sich zehn Jahre zuvor ausgerechnet bei einem Abendessen im Hause Meier-Graefes kennengelernt. Aber das war ihm alles egal. Auch dass Tilla Durieux einen Papageien zu Hause hatte, der deutlich »Tilla« rief, wenn sie die Tür öffnete. Ansonsten aber brachte die große Schauspielerin Tilla Durieux auf der Bühne alle aus dem Konzept, Männer wie Frauen. Und der große Kunsthändler Paul Cassirer war 1913 nicht nur der mächtigste Galerist Deutschlands, er war auch gerade erst zum Präsidenten der Berliner Secession gewählt worden, des wichtigsten Ausstellungshauses der Stadt, und hatte nun endgültig alle künstlerischen Fäden in der Hand. Seine Gesichtszüge waren wie der ganze Mensch: eigenwillig, edel, aber auch wollüstig, zart, und zugleich leidenschaftlich, voller Machthunger und voller Berührbarkeit. Wenn er zu reden begann, dann hörte er nicht mehr auf, eng verbandelt mit Lovis Corinth und Max Liebermann war er zugleich ein Förderer der Impressionisten, 1913 etwa zeigt er die schönsten van Goghs und Manets und Cezannes, die man sich nur denken kann. Er liebte die Frauen und er liebte das Risiko. Bei Tilly Durieux kam beides zusammen.
Durieux ist mit Lou Andreas-Salomé, mit Alma Mahler, Coco Chanel, Ida Dehmel und Misia Sert eine der sechs zentralen Frauenfiguren der Zeit um 1913, sie war eine der großen Femmes fatales. Nicht eigentlich hübsch, aber von großer erotischer Ausstrahlung, zog sie alle, die sie als Schauspielerin in einem der Münchner oder Berliner Theater sahen, auf der Stelle in ihren Bann. Selbst Heinrich Mann war ihr, kaum hatte er sie auf der Bühne gesehen, ganz untertan. Er schreibt im Frühjahr 1913: »Sie ist eines der vorgeschrittensten Menschenwesen, die heute über die europäischen Bühnen gehen, ja man kennt für das, was modern heißt, keine vollkommenere Vertreterin. Sie hat alles, was modern heißt: Persönlichkeit, erarbeitet und wissend, nervöse Energie und weite Schwungkraft des Talents.« Die Professorentochter aus Wien mit ihrer seltsamen Schönheit, die eigentlich Ottilie Godeffroy hieß, sich aber glücklicherweise umbenannte, führte von Anfang an mit ihrem geliebten Cassirer ein großes, offenes Haus. Künstler, Schriftsteller, Industrielle, sie alle kamen und gingen, erst in der Wohnung in der Margarethenstraße, Ecke Matthäikirchplatz, dann in der Villa in der Viktoriastraße. Im Dachzimmer wohnte Ernst Barlach, der nur runterkam, wenn ihn die Abendgesellschaft reizte. Und wenn Oskar Kokoschka bei Tilla Durieux und Paul Cassirer zu Gast war, dann wünschte er sich immer, unter van Goghs »Eisenbahnbrücke von Arles« übernachten zu dürfen. So wurde das Gästezimmer in der Viktoriastraße 35 zum schönsten Schlafwagenabteil des alten Europas. Morgens dann wollten alle, die dort nächtigten, Tilla Durieux porträtieren. Und manche wollten auch gleich mit ihr durchbrennen. So etwa Alice Auerbach, die wunderschöne Frau des Malers Wilhelm Trübner, die von der Durieux besessen war, ihr auf ihren Tourneen nachreiste, sich in dieselben Hotels einmietete und dann die Pulsadern aufschnitt, als Tilla ihre Liebe nicht erwiderte. Bitte, so sagte damals Paul Cassirer zu ihr, mach daraus keine große Sache, ich möchte gerne auch weiterhin die Bilder ihres Mannes gut verkaufen.
Verschreckt von dem geschäftlichen Kalkül ihres eigenen Mannes wendet sich Tilla Durieux dann, wenn sie abends von ihren Aufführungen nach Hause kommt, anderen Dingen zu, der Sozialdemokratie etwa, die sie leidenschaftlich unterstützt. Paul Cassirer hatte andere Sorgen: Er wollte, dass alle großen Maler seine Frau porträtieren. Corinth, Liebermann, Barlach, sie alle hatten es schon getan, 1913 dann malt sie auch Franz von Stuck in einer Rolle als »Circe« in mehreren Varianten. Und Cassirer schreibt in diesem Frühjahr so oft an den greisen Renoir in Frankreich, bis auch dieser nicht mehr anders kann, als mit der Durieux Termine für eine Porträtsitzung auszumachen.
In Paris schreibt der Bildhauer Aristide Maillol an Misia Sert, die frühere Muse all der großen Impressionisten und jetzt, etwas älter geworden, große Förderin der zeitgenössischen Musik und Kunst, ob er sie vielleicht porträtieren dürfe. Renoir hatte sie einst, als er sie malte, noch höflich gefragt, ob sie vielleicht ihr Mieder ein klein wenig öffnen könne. Maillol nun fragt gleich, ob sie ihm ganz nackt Modell stehen könne. Sie schaut in den Spiegel, freut sich und schreibt lächelnd: »Non, merci.«
Am 9. Januar findet Kaiser Wilhelm II. den Gottesbeweis. Er spricht zum hundertsten Jubiläum des preußischen Aufstandes gegen die napoleonische Fremdherrschaft und stellt aus heiterem Himmel fest: »Wir haben die sichtbaren Beweise, dass Gott mit uns war und mit uns ist. Und aus diesen greifbaren, sichtbaren Tatsachen der Vergangenheit kann sich auch die gesamte deutsche Jugend den im Feuer bewährten Schild des Glaubens schmieden, der nie in der Waffenrüstung eines Deutschen und Preußen fehlen darf.«
Im bayerischen Sindelsdorf sitzt Franz Marc im Pelzmantel in seinem Atelier unterm Dach, friert trotzdem und malt sein Jahrhundertbild »Der Turm der blauen Pferde«. Draußen auf der Weide hinterm Haus zittert sein zahmes Reh. Seine Frau Maria bringt ihm eine Kanne Tee. Und dem Reh einen Apfel.
Zu Neujahr hat Marc eine Postkarte mit dem »Turm der blauen Pferde« nach Berlin gesandt, zu Else Lasker-Schüler, der bettelarmen Dichterin, die ziellos durch die Straßen und die Cafés zieht, seit Herwarth Walden sie verlassen hat. Doch der blutjunge Dichter Klabund, den Alfred Kerr gerade entdeckt, schreibt über sie in der ersten Ausgabe der Zeitschrift »Revolution«: »Else Lasker-Schülers Kunst ist sehr verwandt mit der ihres Freundes, des blauen Reiters Franz Marc. Fabelhaft gefärbt sind alle ihre Gedanken und schleichen wie bunte Tiere. Zuweilen treten sie aus dem Wald in die Lichtung: wie zarte rote Rehe. Sie äsen ruhig und heben verwundert die schlanken Hälse, wenn jemand durchs Dickicht bricht. Sie laufen nie davon. Sie geben sich ganz preis in ihrer Körperlichkeit.« Schauen wir mal, wer vor dieser Körperlichkeit noch alles Angst bekommen wird.
Nie war es so kalt im kalifornischen Death Valley wie am 9. Januar 1913. Das Thermometer auf der Greenland Ranch misst Minus 9,4 Grad.
In der Januarausgabe der Zeitschrift »Die Schaubühne« erscheint der erste Artikel von Kurt Tucholsky. Im Februar 1913 folgt dort das Debut von Ignaz Wrobel, im März erscheint Peter Panter zum ersten Mal und im September Theobald Tiger. Wrobel, Panter und Tiger sind die Pseudonyme von Tucholsky, denen er sein Leben lang treu bleiben wird, treuer als jeder Frau.
Josef Dschugaschwili unterscheibt am 12. Januar erstmals einen Brief mit »Stalin«. Das heißt übersetzt: Mann aus Stahl. Wenig später wird er in Wien ankommen und nachmittags durch den dicken Schnee im Schlosspark Schönbrunn stapfen, über den Marxismus nachdenken und darüber, wie die Revolution in Russland doch noch gelingen könnte. Und ja, in diesen Tagen streift auch tatsächlich der junge Adolf Hitler durch diesen verschneiten Park. Auch er hat weitreichende Pläne. Aber, nein, noch immer wissen wir nicht, ob sich die beiden hier wirklich getroffen haben.
Während Stalin also Stalin wird, eröffnet am selben Tag, dem 8. Januar, in Nizza das Hotel »Negresco«. Der rumänische Gastronom Henri Negresco, ein kleiner Mann mit großem Schnauzer, wollte das schönste Hotel der Welt bauen, und weil er sich für den schönsten Mann der Welt hielt, nannte er es gleich nach sich selbst. Die Adresse 37, promenade des Anglais wurde vom ersten Augenblick an zum Anlaufpunkt für den europäischen Blut- und des amerikanischen Geldadels: die Vanderbilts, die Rockefellers, die Singers kamen zur Eröffnung und acht gekrönte Häupter, darunter Wilhelm II. und Zar Nikolaus, allein im ersten Jahr, das erste Glas Champagner trank Königin Amelia von Portugal. Das tat sie auf dem 375 Quadratmeter großen Teppich unter dem 4,60 Meter hohen Lüster aus Baccarat-Kristall mit 16457 Einzelteilen. Und natürlich unter der imposanten und sofort legendären Kuppel. Denn diese hatte angeblich Gustave Eiffel, der Erbauer des Eiffel-Turmes, für das Negresco entworfen, und er hatte für die Kuppel die genauen Maße des Busens seiner Geliebten in Architektur umgesetzt.
F. Scott Fitzgerald, der später dem Treiben des amerikanischen Geldadels an der Cote d’Azur mit »Zärtlich ist die Nacht« ein literarisches Denkmal setzen wird, arbeitet in diesen Tagen und Nächten an seiner Bewerbung um einen Studienplatz in Harvard und in Princeton. Die Anmeldefrist läuft am 15. Januar ab.
Am 16. Januar schickt der 26-jährige Srinivasa Ramanujan aus dem indischen Madras einen sehr langen Brief an den bedeutenden englischen Mathematiker Godfrey Harold Hardy in Cambridge und erklärt ihm, dass er zwar nicht Mathematik studiert habe, aber in den letzten Wochen eventuell hundert der größten Rätsel der analytischen Mathematik gelöst habe, »siehe anbei«. Er sei ein gläubiger Hindu, deshalb dürfe Hardy auch nicht glauben, dass die Weisheit von ihm komme, sondern sie sei ihm von der Familiengottheit im Schlaf mitgeteilt worden, der offenbar naturwissenschaftlich versierten Namagiri Thayar. Hardy vertieft sich in die seitenlangen Zahlenkolonnen, dann begreift er: Srinivasa Ramanujan hat tatsächlich hundert der größten Rätsel der analytischen Mathematik gelöst, etwa eine Formel zur Berechnung der Kreiszahl Pi. Hardy sagte: »Das muss wahr sein, denn wenn es nicht wahr wäre, könnte es niemanden auf der Erde geben, der die Imaginationskraft hätte, sich das auszudenken.«
Seine Ansätze gehen schnell als Ramanujans Primzahltheorie, als Ramanujans Theta-Funktionstheorem und als Ramanujans Teilungsformel in die Geschichte ein. Er wird Mitglied der Royal Society und Fellow am Trinity College in Cambridge. Gerne arbeitet er an seinem Schreibtisch 24 oder 36 Stunden ohne Unterbrechung, wenn ihm die Familiengöttin wieder neue Formeln einflüstert. Es erscheint eine eigene Zeitschrift, das »Ramanujan Journal«, um die Überfülle seiner Resultate, Rechenmodelle und Lösungsvorschläge zu publizieren. Kurz darauf stirbt er. Nur damit hatte er nicht gerechnet.
In der »Wochenschrift für Deutschlands Jugend«, der »Jungdeutschland-Post«, schreibt Otto von Gottberg am 25. Januar allen Ernstes dies: »Still und tief im deutschen Herzen muss die Freude am Krieg und ein Sehnen nach ihm leben, weil wir der Feinde genug haben und der Sieg nur einem Volk wird, das mit Sang und Klang zum Kriege wie zum Fest geht.« Und weiter: »Solchen Stunden wollen wir entgegengehen mit dem männlichen Wissen, dass es schöner, herrlicher ist, nach ihrem Verklingen auf der Heldentafel in der Kirche ewig fortzuleben als namenlos den Strohtod im Bett zu sterben.« Otto von Gottbergs Fazit anno 1913: »Der Krieg ist schön.«