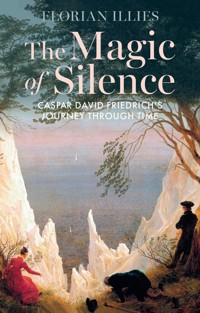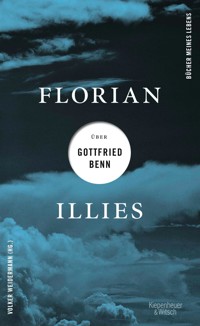12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Kunsthistoriker und vielfache Bestseller-Autor Florian Illies schreibt begeistert und begeisternd wie kaum jemand anderes über Kunst. Sein neues Buch »Gerade war der Himmel noch blau. Texte zur Kunst« versammelt seine zentralen Texte zu Kunst und Literatur aus 25 Jahren. Florian Illies porträtiert seine persönlichen Helden von Max Friedlaender über Gottfried Benn und Harry Graf Kessler bis hin zu Andy Warhol. Und er erkundet, warum die besten Maler des 19. Jahrhunderts am liebsten in den Himmel blickten und begannen, Wolken zu malen, er erzählt, was sie scharenweise in ein kleines italienisches Dörfchen namens Olevano trieb, fragt sich, ob Romantik heilbar ist — und adressiert einen glühenden Liebesbrief an Caspar David Friedrich. Vor allem faszinieren Florian Illies die Maler und die Bilder selbst, Vergangenheit wird in seinen Texten unmittelbar als Gegenwart erfahrbar, unter seinem Blick entstehen bewegte Bilder in Farbe, werden aus historischen Figuren leidenschaftlich liebende und lebende Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Florian Illies
Gerade war der Himmel noch blau
Texte zur Kunst
Über dieses Buch
Begeistert und begeisternd wie kaum jemand anderes schreibt der Kunsthistoriker und vielfache Bestsellerautor Florian Illies über Kunst und Literatur. Dabei faszinieren ihn vor allem die Maler und die Bilder, die Autoren und ihre Bücher selbst, Vergangenheit wird in seinen Texten unmittelbar als Gegenwart erfahrbar, unter seinem Blick entstehen bewegte Bilder in Farbe, werden aus historischen Figuren leidenschaftlich liebende und lebende Menschen.
In seinem neuen Buch, das zentrale Texte zu Kunst und Literatur aus 25 Jahren versammelt, porträtiert Florian Illies seine persönlichen Helden von Max Friedländer über Gottfried Benn und Harry Graf Kessler bis hin zu Andy Warhol. Und er erkundet, warum die besten Maler des 19. Jahrhunderts am liebsten in den Himmel blickten und begannen, Wolken zu malen, er erzählt, was sie scharenweise in ein kleines italienisches Dörfchen namens Olevano trieb, fragt sich, ob Romantik heilbar ist — und adressiert einen glühenden Liebesbrief an Caspar David Friedrich.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Motto
Vorbemerkung
Frühe Helden
Julius Meier-Graefe: Deutsch als Kunst
Max Friedländer: Wissen heißt, zu misstrauen
1. Mehr wissen heißt, mehr zu misstrauen
2. Mehr wissen heißt, sich der eigenen Zeitgebundenheit bewusst zu werden
3. Man muss versuchen, Ordnung zu schaffen (auch wenn es nicht geht)
4. Urteilen heißt, sich irren zu können
5. Sketch of a Self-Portrait
Harry Graf Kessler: Das Frösteln in der Moderne
Francis Haskell: Die Geschichte des Geschmacks
Karl Scheffler: Schicksal als Chance
Hans Magnus Enzensberger: Keiner von uns
Hausbesuche
Gottfried Benn: Gute Regie ist besser als Treue
Martin Walser: Sein Klassiker. Eine Ermittlung am Bodensee
Georg Baselitz: A past to come
Casa Baldi: Wo die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts neu zum Leben erweckt wurde
Erkundungen im 19. Jahrhundert
Caspar David Friedrich: Ein Liebesbrief
Die ersten Wolkenkratzer: Warum die besten Maler des 19. Jahrhunderts am liebsten in den Himmel blickten
Ferne Nähe: Die Kunst des 19.Jahrhunderts
Der Vesuv als Zentralmassiv der deutschen Romantik
Geschmackssache: Zur Lage von Corot und Friedrich im Städel und anno 1825, 1913, 2015
Adolph Menzel: Wie man über sich selbst hinauswächst
Carl Gustav Carus: Ist Romantik heilbar?
Johann Heinrich Schilbach: Präziser fühlen
Erkundungen im Jahr 1913
Die Bilder eines Jahres: 1913 – oder: Sind Künstler Propheten?
Richard Dehmel: Hamburgs Hauptfigur des Jahres 1913
Literatur
Gottfried Benn: Der Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm Oelze
Georg Trakl: Friedenssommer vor 1914
Ludwig Börne:
Jean Paul: Der deutschen Sprache die Zunge lösen
Fontane und die Kunst
Neue Helden
Andy Warhol: Wie man aus der Zukunft auf die Gegenwart als Vergangenheit blickt
Johann Liss: Johann ohne Land
Raimund Girke: Wie das Weiß durch die Bilder strömt
Peter Roehr: Der Wiederholungstäter
Johannes Grützke: Wenn die Musen Dirndl tragen
Günter Fruhtrunk: Das Ich muss ins Bild
Christoph Schlingensief: Zeige deine Wunde. Erinnerung an den außergewöhnlichen Menschen
Drucknachweis
»Warum haben Sie das getan?«, fragte der junge Mann erstaunt. Sie lächelte und sprach: »Weil der Himmel so blau ist.«
HENRY JAMES, Die Europäer
Vorbemerkung
Ein Text in diesem Buch heißt »Liebesbrief«. Aber das ist eine Untertreibung, es handelt sich im Grunde nur um Liebeserklärungen: an Maler, an Schriftsteller, an Bilder, an Bücher.
Ich hoffe nicht, dass Liebe wirklich blind macht.
In diesem Band sind Artikel und Reden aus den Jahren 1997 bis 2017 versammelt. Es geht scheinbar um Bilder und Bücher aus der Vergangenheit. Doch für mich sind sie nicht vergangen, weil wir sie eben genau heute sehen und lesen und also: erleben. Deshalb versuche ich, Vergangenheit, die mich berührt, als Gegenwart zu erzählen. Als Augenblick. Gerade war der Himmel noch blau. Jetzt ziehen Wolken auf. Gleich kommt ein Gewitter. Dann wieder: alles blau. Das scheinbar Ewige ist flüchtig, das scheinbar Flüchtige ist ewig, wie Brecht vor hundert Jahren in seiner »Erinnerung an die Marie A.« bewiesen hat: »Und auch den Kuss, ich hätt ihn längst vergessen/Wenn nicht die Wolke dagewesen wär/Die weiß ich noch und werd ich immer wissen/Sie war sehr weiß und kam von oben her.« Das ist das Wissen, von dem große Kunst erzählt. Und das ist es, was ich in meinen Texten erlebbar zu machen versuche.
Florian Illies, 4. Mai 2017
Frühe Helden
Julius Meier-Graefe
Deutsch als Kunst
Julius Meier-Graefe. Drei Worte, eine Verheißung. Mein ganzes kunsthistorisches Studium über schlich ich um seine Bücher herum wie um den heißen Brei, ich wusste, dass sich darin etwas befand, was noch immer, auch hundert Jahre nach seiner Entstehung, eine gefährliche Explosionskraft besaß. Es ist das barock Ausschweifende, das Unwissenschaftliche, das leicht Unseriöse, das ihn umweht. Seine herrliche Praxis etwa, Fußnoten nicht für überflüssige Literaturhinweise zu benutzen, sondern für Anekdoten von persönlichen Begegnungen mit den Künstlern, über die er schrieb.
Doch immer, wenn mir der Kopf brummte, weil ich versucht hatte, eine kunsthistorische Dissertation aus Bochum zu Ende zu lesen, griff ich wieder zu einem der kleinen Insel-Taschenbücher über Manet, Courbet, Delacroix, zu seiner »Entwicklungsgeschichte« und war nach ein, zwei Worten in seinem Bann. Ich wusste, es war kaum möglich, seinen Namen zu nennen in den Räumen, in denen die strengen akademischen Hygienevorschriften herrschen und das Reinheitsgebot deutscher Wissenschaft. Zugleich reizte mich genau dies. Denn wo solche Abstoßung herrscht, da herrscht Angst. Und sie ist es in Wahrheit, die den Blick auf Julius Meier-Graefe seit fast hundertfünfzig Jahren bestimmt.
Darum sollte, so mein Plan, Julius Meier-Graefe das Thema meiner kunsthistorischen Dissertation werden. Mit Hans Belting hatte ich einen angstfreien und neugierigen Doktorvater gefunden – doch dann geschah etwas Seltsames. So sehr ich es auch drehte und wendete, es wollte mir einfach nicht gelingen, dieses Universum Julius Meier-Graefe in die nüchterne Prosa eines Exposés für ein Dissertationsvorhaben zu pressen. Immer wieder verfiel ich dem eigentümlichen, mitreißenden Stakkato seiner Sätze, immer wieder war ich begeistert über seine Fähigkeit zum kennerschaftlichen Urteil – doch es war mir unmöglich, überhaupt zu umreißen, wie eine Doktorarbeit Julius Meier-Graefes Herr werden sollte. Als ich in diesen Tagen, zwanzig Jahre danach, wieder die alten Insel-Taschenbücher aus Bonn in die Hand nahm, fand ich darin Briefe der großen Meier-Graefe Entdeckerin Catherine Krahmer, in denen sie mir Hinweise gab, wie man unseren Helden vielleicht doch in die deutsche Dissertationsordnung einnorden könnte. Doch alles vergeblich. Es kam nie zur Doktorarbeit, weil ich bereits am Exposé scheiterte. Und ich begann folgerichtig kurz darauf als Kunstkritiker der FAZ zu arbeiten – um dem Idol also nicht durch Exegese, sondern durch Paraphrase nahezukommen.
Sie merken hoffentlich, dass ich nur scheinbar von mir rede. Es käme mir nie in den Sinn, Sie mit biographischen Wendungen zu langweilen, ich weiß, dass auch an diesem Punkt die akademischen Reinheitsgebote unbarmherzig sind. Es geht mir vielmehr darum, zu zeigen, welche Herausforderung es ist, sich mit der eigenen Sprache bzw. der Wissenschaft der Sprache von Julius Meier-Graefe zu nähern. Mir scheint es daran zu liegen, dass er ein Deutsch nutzte, das noch am ehesten mit dem der Bibelübersetzung eines Martin Luther zu vergleichen ist. Und dabei ist es nicht nur die Sprache an sich, die so barock wie klar ist, sondern auch das Apodiktische, das Alttestamentarische, das aus den Werturteilen Meier-Graefes spricht. Es ist unmöglich, darüber eine Doktorarbeit zu schreiben – vielleicht sogar wäre es, um im Bild zu bleiben, eine Sünde.
Möglicherweise ist es genauso naiv, zu glauben, man könne darüber einen Festvortrag halten. Denn dabei misst man sich ausschließlich auf dem sprachlichen Niveau. Aber es hat auch einen Vorteil: Man kann Julius Meier-Graefe wörtlich zitieren – und im Zitieren seine Wortgewalt in die eigene Word-Datei integrieren. Und doch ist das Zitat immer bereits ein Gewaltakt: Denn es löst etwas heraus aus einem Gefüge, das eine Einheit ist. Denn »Einheit«, das ist nicht nur Meier-Graefes wichtigste Kategorie zur Bewertung eines Kunstwerkes (»Hier kann man lernen, was Einheit wirklich heißt«, schreibt er einmal über Menzel) – auch seine Texte sind, einmal gedruckt, wie eine feste, nicht mehr in seine Einzelteile zerlegbare Masse. Das ist sehr überraschend zunächst, denn sein Textfluss, seine Wortwahl sind ja glühend, sein Temperament explosiv – aber wenn die Lava erkaltet ist, die aus diesem Vulkan entsprang, dann ist sie wie ein unverrückbares Gebilde. Die Steine und das Feuer sind zu einer unauflöslichen Einheit verschmolzen. So ist das auch mit seinen Texten.
Sie sind, seien wir ehrlich, Literatur. Das ist der Grund, warum sie vom ersten Tag an so geliebt wurden von den Lesern und so gehasst – von den Kunsthistorikern. Es war Wolfgang Ullrich, der als Erster gezeigt hat, wie bewusst Meier-Graefe etwa in seiner »Spanischen Reise« seine Ernüchterung über Velázquez und den Tod seines Idols auf einen Karfreitag legt, um am Ostersonntag die Auferstehung des neuen Kunstgottes El Greco zu feiern. Die scheinbare Form des authentischen Reiseberichts bei Meier-Graefe ist ausgeklügelte Prosa. Er wusste, was er tat, verfügte über alle literarischen Möglichkeiten, denn man müsse – so sagte er einmal – »immer bereit sein, die Mittel, und wären es Extrakte der Weisheit, zu opfern, sobald es der Zweck verlangt«.
Julius Meier-Graefe also war der bekannteste Vertreter der Spezies des »Kunstschriftstellers« in Deutschland, die von Anfang an von den Vertretern der Wissenschaft verachtet wurde. Von einem anderen Kunstschriftsteller, nicht weniger verpönt als Meier-Graefe und nur unwesentlich weniger interessant, von Richard Muther nämlich, kommt eine Charakteristik dieses Berufes, die wie perfekt die besondere Fähigkeit unseres Helden beschreibt: Das Ideal eines lehrreichen Textes über Kunst sei, »dass das Werk gar nicht von einem Gelehrten, sondern von einem Dichter geschrieben würde«, denn nur dieser besitze »die ganze Feinfühligkeit, die dazu gehört, ein Kunstwerk in sich aufzunehmen und die nuancenreiche Schmiegsamkeit der Sprache«, um angemessen zu analysieren. Das ist Meier-Graefe.
Kein Wunder also, dass man das eigentlich nicht wirklich beschreiben kann. Eine sehr unglückliche Wahl also für ein Thema, über das man einen Festvortrag halten soll. Aber andererseits: Letztlich ist der »Festvortrag« die einzig angemessene, weil kongeniale Form, diese Sprache zu feiern, denn im Grunde hat Meier-Graefe keine Bücher über Courbet, Renoir, Delacroix, Manet und Cézanne geschrieben, sondern lauter Festvorträge. Sein Ton ist immer der einer Feierstunde – und die Sprache wirkt, als hätte er immer bereits drei Gläser von dem Champagner getrunken, den es eigentlich erst anschließend gibt.
Das macht das Lesen einzelner Passagen für den Leser selbst zu einem perlenden Fest – zwingt man sich aber, ein Buch von vorne bis hinten an einem Stück zu lesen, dann ertappt man sich dabei, wie bei einem ordentlichen Festvortrag auch, wie man die Gedanken zum Abendessen schweifen lässt, auf die Uhr blickt oder sich Gedanken über die Krawattenfarbe des Vortragenden macht. Denn so kraftvoll, so gehaltvoll, so leidenschaftlich die Sprache Meier-Graefes ist – der Dauerton seiner ekstatischen Schwärmerei piept nach dreißig Seiten etwas anstrengend im Ohr. Aber haben Sie einmal versucht, vier Stunden lang eine Dissertation zu lesen? Also: Gerechtigkeit für unseren Helden.
Es ist unhöflich, dass ich erst jetzt auf den Ort unseres heutigen Zusammentreffens zu sprechen komme. Die Französische Botschaft in Berlin – ich glaube, es gibt keinen würdigeren Ort auf der Welt, um die Bedeutung Julius Meier-Graefes zu feiern. Er hat Frankreich, Paris und die französische Kunst auf eine Weise geliebt, wie sie vom reaktionären Berlin um 1900 gehasst wurde: nämlich unbändig.
Am Gipfelpunkt seiner eigenen Entwicklungsgeschichte der Kunst standen die französischen Impressionisten. Und das Größte, was es für Julius Meier-Graefe gab, war es, ein Franzose zu sein. Goya und Constable, den jeweils einzigen Spanier und Engländer, den er duldete in seinem ästhetischen Olymp, waren für ihn Franzosen ehrenhalber, und Menzel, der Deutsche, hatte die entscheidenden malerischen Impulse in Paris erfahren. Im Grunde schreibt Meier-Graefe immer über dasselbe, aber er schreibt es immer wieder neu. Es geht ihm um die Erneuerung der Kunst durch die französischen Meister des 19. Jahrhunderts – und um die ästhetische Erziehung der Deutschen, das – verdammt noch mal – zu erkennen. Sein ganzes Schreiben ist von diesem missionarischen Eifer erfüllt – er hatte, wie Wolfgang Ullrich es nennt, ein »kunstpolitisches Wirkungsideal«. Deswegen beschreibt er nicht nur, sondern bewertet, denn er will durch seine Bewertungen die Augen öffnen und bestehende Kanonisierungen in Frage stellen.
Das sollten wir nie vergessen. Dieser Mann hatte immer eine Mission. Egal, ob er, wie meist, den dummen Deutschen die Delikatesse der Franzosen anschaulich machen wollte. Oder ob er der dummen Welt die Weltklasse eines Hans von Marées mit einem zweibändigen Monumentalwerk einzuhämmern versuchte. Oder aber – einer seiner nachhaltigsten Triumphe – ob er El Greco in den Kanon der Kunstgeschichte aufnahm bzw. mit der »Jahrhundertausstellung von 1906« den Deutschen nicht weniger als ein ganzes vergessenes Jahrhundert, das 19. nämlich, erstmals ins Bewusstsein zurückholte. Er vermochte dies alles dank der Kraft seiner Sprache.
Dass er in seiner Missionsarbeit bei den Heiden manche Donareiche fällte, die eigentlich gar nicht im Wege stand, haben ihm seine Zeitgenossen übel genommen. Aus dem Rückblick aber erkennt man, dass es darum natürlich überhaupt nicht geht. Sondern darum, dass er die französischen Impressionisten zu einem Zeitpunkt in Deutschland als ästhetisches Ideal etablierte, als ihr Heimatland als Erzfeind galt, und dass er die Größe des deutschen 19. Jahrhunderts erkannte und Caspar David Friedrich nach fünfzig Jahren des Vergessens wieder ans Licht rückte, als parallel um ihn herum sich die Expressionisten und Kubisten zu den Ufern der Abstraktion aufmachten.
Man sollte deshalb nicht fragen, ob Julius Meier-Graefe in allen seinen Bewertungen recht hat. Das hat er natürlich nicht. Man sollte auch nicht fragen, ob sein Urteil heutigen wissenschaftlichen Vorstellungen entspricht oder sein Pendeln zwischen Publizistik, Handel und Museum dem deutschen Reinheitsgebot. Das verstellt den Blick auf das Wichtigste, was er zu geben hat. Denn das ist etwas sehr Singuläres: eine aus der Leidenschaft erwachsene Präzision. Eine aus der tiefen Empfindung gewonnene höhere Erkenntnis.
Er selbst sah in dieser Seherfahrung den größten Unterschied zu der akademischen Kunstgeschichte. Denn natürlich war Meier-Graefe zeitlebens unter Beschuss – aber er schoss auch zurück. So in seinem Buch über Hans von Marées. Da schreibt er so klar wie bissig: »Man hat bei uns immer formuliert, bevor geeignete Erfahrungen da waren. Dem Denker genügte auch das mangelhafte Kunstwerk zur Auslösung bewundernswerter Gedankengänge. Wir dachten stets über die Blume nach, anstatt zu riechen.« Dagegen also Julius Meier-Graefe: Er atmet Kunst ein, um sie als Sprache wieder auszuatmen.
Die Blume ist ein schönes Symbol für Meier-Graefes Art zu riechen und zu schauen. Denn sie kann blühen, und sie kann welken. Und passt deshalb präzise zu seiner Leitidee einer evolutionären Entwicklungsgeschichte der Kunst. Auch das ist natürlich verpönt, weil doch eigentlich, so Martin Warnke über Meier-Graefe, »alle Kunstepochen unmittelbar zu Gott« seien, also alle Werturteile unangebracht sind. Meier-Graefe aber braucht diesen Glauben an die Entwicklungsgeschichte – denn nur so kann er die Kunst als einen stetig rauschenden Fluss beschreiben, als etwas Dynamisches. Durch die Einordnung in eine Entwicklung gibt er der jeweiligen Kunst eine Dringlichkeit und Gegenwärtigkeit – und nur das kann er in seiner von Dringlichkeit und Gegenwärtigkeit durchdrungenen Sprache kongenial ausdrücken. Auch deshalb muss er sich immer wieder den Franzosen zuwenden. Denn die Deutschen, so weiß er, sind die Meister der Zeitlupe. »Alle besingen sie die Ruhe«, schreibt Meier-Graefe, auch sein geliebter Hans von Marées. »Darin war er ein echter Deutscher, wie Feuerbach, Böcklin, wie Leibl und Thoma, wie Holbein und Cranach. Wenn sie bewegte Motive bringen, fallen sie aus der Art.«
In diesen zwei Sätzen haben wir den ganzen Meier-Graefe: Aus einem ungeheuren Einfühlungsvermögen, aus einem unermesslichen Schatz an Seherfahrung erwächst ein Fazit, wie es außer ihm niemand zu ziehen – und ich würde ergänzen: niemand zu denken wagt. Doch ist es erst einmal gedacht, dann schnurren bei Meier-Graefe die Jahrhunderte zu Sekunden zusammen, und es scheint vollkommen plausibel, Böcklin und Cranach in einem Atemzug zu nennen. Und schließlich, das ist das Wichtigste: Hat man dieses Fazit, oder sagen wir zurückhaltender, diese These einmal im Kopf, dann wird man auf »deutsche Kunst« künftig anders schauen, und man wird, das sei Ihnen prophezeit, sehr oft merken, wie weise diese lapidare Bemerkung ist. Die Deutschen sind Meister des ruhenden Balls.
Ohnehin scheint Meier-Graefe in seinem ästhetischen Urteil eine seltene Ausnahmebegabung zu besitzen. Es gelingt ihm immer wieder, auf seine Zeitgenossen mit einem retrospektiven Blick zu schauen – also das eigene Werturteil kurzzuschließen mit dem, was er als das Werturteil der Zukunft vermutet. So zum Beispiel über Manet: »Wenn in hundert Jahren« – also heute – »der Geschichtsschreiber nach den entscheidenden Dokumenten unserer Kunst suchen wird, wird er von Manet die beiden Frühwerke ›Olympia‹ und ›Déjeuner sur l’herbe‹ nennen.«
Diese Worte über Manet finden sich übrigens in einem Buch über Renoir. In dem Buch über Renoir finden sich auch unzählige Bewertungen von Delacroix. In dem Buch über Manet liest man sehr viel über Courbet. Und wenn er über Corot schreibt, dann erfährt man Tiefsinniges über Cézanne. Es ist bei Meier-Graefe, als sei er mit einer Rakete im Weltall unterwegs – all die Zentralgestirne und Planeten dort kreisen um sich, und Meier-Graefe setzt sie permanent zueinander in Beziehung. Wo also Corot seinen Schatten auf Cézanne wirft und wo die Sonne Delacroix’ noch auf dem Planeten Renoir zu sehen ist. Wie alle im Grunde sich um Delacroix drehen. Und so weiter. Und in fernen Milchstraßen sieht Meier-Graefe dann auch noch Giotto, Rubens oder Cranach leuchten.
Zwei Jahre später, im nächsten Buch, schaut Meier-Graefe dann aus einer anderen Perspektive, und die Abfolge vom Zentralgestirn zu seinen Monden sieht etwas anders aus. Man mag das Opportunismus nennen, weil sich die Reihenfolge im Olymp manchmal, je nach Blickwechsel und Argumentationskette, durchaus verschieben kann. Aber wenn man sich fest anschnallt, dann ist der Lerneffekt immens: Sichtbarmachen durch rapide Perspektivwechsel also, per Anhalter durch die Galaxis, auf dem Rücksitz von Meier-Graefe.
So rauscht einem immer wieder der Kopf, weil Meier-Graefe sich unermüdlich bemüht, die Wechselwirkungen, die Abhängigkeiten, die Magnetwirkungen, die Verschattungen und die Beleuchtungen der Größten untereinander aus immer wieder neuen Perspektiven zu beschreiben. Doch auch in diesem Fall gilt: Selten wurde Kunst so präzise gefühlt wie hier, selten so genau in Worte gefasst.
Noch ein Beispiel, zwei Sätze aus dem Vorwort zu seinem Buch über Renoir. Ganz aus dem Nichts fragt Julius Meier-Graefe dort plötzlich: »Wer schreibt die Geschichte des Barocks im 19. Jahrhundert?« Und bevor man sich fragen konnte, was das nun wieder sein könnte, hat Meier-Graefe die Geschichte des Barocks im 19. Jahrhundert schon selbst geschrieben. Er braucht dafür einen Satz. Hier kommt er – er steht für das, was ich meine, wenn ich diesem Vortrag den Titel »Deutsch als Kunst« gegeben habe. Erst, wie zum Schwungholen für den Autor, die rhetorische Frage: »Wer schreibt die Geschichte des Barocks im 19. Jahrhundert?« Und dann: »Jenes wenig greifbaren Barocks, das Delacroix’ ganzes Œuvre wie eine gewaltige Woge bewegt, das dem Naturalismus Courbets widerstand und von Manet vergeblich bekämpft wurde, das Rodin in Höhen und Untiefen trieb, in Monets besten Bildern die Pinselstriche kräuselte, in Cézanne zu dem phantastischen Bau seiner Mystik wurde, van Gogh zu inbrünstigen Visionen hinriss und noch in den verhaltenen Empfindungen der Jüngeren, eines Bonnard etwa, spielt wie die flachen Lachen des Meeres auf sandigen Dünen.«
Das ist der ganze Meier-Graefe – er schaut auf die Kunst seiner Gegenwart durch die Scheibe seiner Rakete, mit der er durch das Kunstuniversum fliegt, und in seinem Blick fügen sich die Planeten in immer neue Ordnungen, er hat den Mut zum großen Bogen und natürlich auch zum Looping, und er setzt die Adjektive und die Verben mit einer Präzision ein wie ein Weltraummechaniker. Und noch etwas – und das ist – so denke ich, das Wichtigste. Er sieht etwas, was wir nicht sehen.
Max Friedländer
Wissen heißt, zu misstrauen
Das ist das Schwerste: Worte zu finden für das, was man sieht. Kaum jemand wusste so genau wie Max Friedländer, wie hart der Kampf um den richtigen Begriff ist, wie unmöglich letztlich die Suche nach der vollkommenen sprachlichen Entsprechung für eine sinnliche Wahrnehmung. »In meinen Aufsätzen«, so schreibt er einmal, »stößt der Leser auf die Bemühung, das Eigentümliche dieses oder jenes Malers in Worte zu fassen.« Man merkt diesem Satz an, dass das Formulieren für Friedländer zeitlebens eine körperliche Arbeit gewesen ist, ein Kraftakt. Die Sätze flossen nicht einfach aus ihm heraus wie aus seinem Zeitgenossen Julius Meier-Graefe etwa, dessen Worte perlten wie Champagner. Bei Friedländer hat man das Gefühl, jeder Buchstabe sei uralten Weinstöcken auf einer unzugänglichen Steillage abgetrotzt. Umso größer das Wunder, wenn man die Zahl seiner Veröffentlichungen sieht: 595 Texte hat er in seinem über 90-jährigen Leben verfasst, im Zentrum natürlich das Monument der 14 Bände seiner »Altniederländischen Malerei«, daneben die Unzahl von Katalogen, Aufsätzen, Rezensionen, die Bibliothek der Künstlermonographien von Altdorfer angefangen, Cranach, Lucas van Leyden, Dürer, und dazwischen immer wieder auch Zusammenfassungen wie »Die Niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts«, »Essays über die Landschaftsmalerei« oder, zuletzt, »Von Kunst und Kennerschaft«. Es ist, als würde sich Friedländer immer wieder ein anderes Objektiv auf seine Kamera schrauben: mal das Teleobjektiv für Detailstudien von mikroskopischer Präzision, dann wieder das Weitwinkelobjektiv für Aufnahmen, auf denen man die Wolken sieht und die Erdkugel sich krümmen.
Es ist ein Verdienst der Biographie von Simon Elson, dass er sich weder vom Umfang des Werkes Friedländers hat einschüchtern lassen noch von dessen Skrupelhaftigkeit in Bezug auf die Sprache. Dass nun erstmals eine so umfassende Würdigung des Lebens und Werks dieser singulären Persönlichkeit vorliegt, ist eine verdienstvolle Tat. Die Leistung des Biographen liegt vor allem darin, dass er das Leben eines Menschen erzählen musste, der nur für sein Werk gelebt hat. So wie Friedländer selbst zeitlebens auf der Suche danach war, »Lücken« in der Kenntnis bestimmter Maler zu schließen, so musste auch Elson sich nun aus den Lücken dieses schweigsamen, zurückhaltenden, genügsamen Gelehrten doch ein »Bild« von einem Leben machen. Elson kennt seinen Friedländer und weiß darum, wo die Tücken liegen, wenn man ein solches Bild zu zeichnen versucht: »Die spärlichen Fragmente, die der Zufall uns bewahrt hat, zu lückenloser Kette schmieden, heißt der fixen Idee des Historikers zu Liebe die Beobachtungen zu fälschen.« So heißt es bei Friedländer. Und es ist Simon Elson gelungen, aus der Frische seiner Lektüre und der Neugier seiner nachgeborenen Anschauung keine Fälschung, sondern ein Original zu schaffen, das vor unseren Augen zu leben beginnt. Schon zu Lebzeiten scheint sich Friedländer jeder Form der Fixierung seiner Persönlichkeit entzogen zu haben, er genoss das Leben im Schatten des großen Wilhelm von Bode, weil er sich nur im Halbdunkel ganz seiner Forschungsarbeit hingeben konnte. Obwohl er fast vierzig Jahre lang eine bedeutende Stelle im bedeutendsten deutschen Museum bekleidete, gibt es keine repräsentative Fotografie von ihm, er entzieht sich dem Blick des Fotografen, blickt weg oder nach unten. Ihm muss das Posieren ein Gräuel gewesen sein, er will höchstens zufällig zu sehen sein. Es gibt dieses eine berühmte Foto von 1904 – links die bräsige Zille-Gestalt des Restaurators Hauser, rechts der Generaldirektor Bode, mit parvenühafter Körperhaltung, den Zylinder in der Hand, eine einzige Pose der Selbstgewissheit. Und dazwischen ein junger Mann, in den Händen die Lupe haltend, fein gekleidet, aber wie in Trance aus dem Foto herausblickend: also aus dem Jahre 1904 direkt zurück in die Niederlande des 15. Jahrhunderts. Irritiert schauen die beiden Herren rechts und links auf den jungen Mann in ihrer Mitte, sie versuchen, ihn durch ihre Blicke zu bannen, doch er schaut durch sie und uns hindurch. So jemanden muss man erst einmal einfangen. Dieser Biographie ist es gelungen.
Mein Text soll nur ein kleines Schlaglicht werfen – und zwar auf die Eigentümlichkeiten von Friedländers Weise, über Kunst zu schreiben.
1. Mehr wissen heißt, mehr zu misstrauen
Friedländer macht es einem als Leser nicht leicht. Er bezirzt nicht durch flotte Formulierungen, wenn er einmal Beispiele aus dem Alltag zum Einstieg sucht, dann wirkt das gesucht. Ganz bei sich ist er, wenn er Bilder beschreibt, Eigenarten eines Malers vergleicht, urteilt. Man muss sich auf ihn einlassen, stundenlang, muss Aufsatz um Aufsatz lesen, Buch um Buch – und dann plötzlich geschieht es: Man spürt den Zauber dieser spröden Prosa. Es gab und gibt wohl niemanden, der größere Sachkenntnis hatte über die altniederländische Malerei als er. Aber – und das ist das erste Charakteristikum seiner Einzigartigkeit – sein Wissen macht ihn nicht hochmütig, sondern demütig. Immer wieder liest man ein »vermutlich« oder ein »wohl«. Niemals ein »auf jeden Fall« oder ein »ausgeschlossen«. Dem Wissenden ist alle Gewissheit suspekt – das ist das geheime Credo von Friedländers Kennerschaft. Man muss sich die Tiefe und die Untiefe dieser Haltung vergegenwärtigen, um ihre Bedeutung ermessen zu können: Dieser Kunsthistoriker, der wie kaum einer seiner Zeitgenossen um das präzise Wort gerungen hat, dieser Kenner, der mehr um die Geschichte der Malerei wusste als fast alle seiner Kollegen, dieser Max Friedländer wurde mit jedem Jahrzehnt an zusätzlicher Kennerschaft und Detailkenntnis skeptischer. Er wurde klüger. Denn Klugheit heißt, zu wissen, dass man sich trauen kann und zugleich immer misstrauen muss.
2. Mehr wissen heißt, sich der eigenen Zeitgebundenheit bewusst zu werden
Das zweite zentrale Geheimnis seiner Kennerschaft ist sein Wissen um seine Zeitgebundenheit. Auch hier wieder dasselbe Phänomen: Je mehr Friedländer sieht und weiß und durchschaut, umso klarer wird ihm deutlich: Es ist immer nur das Urteil auf der Basis des Wissens des Jahres 1910, 1920, 1930. Jedes Urteil ist relativ – weil der Kenner immer auf einem Auge blind ist, durch seine eigene Verankerung in seiner Gegenwart: »Man stelle sich vor, wie Menzel über van Gogh geurteilt hätte. Von seinem Standpunkte könnte er nichts als Fehler erblicken. Aber gerade das in seinen Augen Fehlerhafte macht den Stil van Goghs aus.« Was an dieser Beobachtung so außerordentlich ist: Hier spricht nicht der Journalist oder der Kunstschriftsteller, der sich qua Amt der teilnehmenden Beobachtung verschrieben hat, für den die Wahrnehmung vom eigenen, flackernden Standpunkt her die richtige, weil ihm einzig mögliche Form der Betrachtung ist. Hier spricht Max J. Friedländer, stellvertretender Direktor der Berliner Museen, Direktor des Kupferstichkabinettes, Autor unzähliger Aufsätze, Expertisen und Bücher, ein Mann also, der permanent die Aufgabe hat, »objektive« Urteile zu fällen. Es spricht für die Souveränität dieses Mannes, dass er öffentlich macht, um die Relativität seiner Einschätzungen zu wissen. Dass er dennoch täglich urteilt, spricht für seine Fähigkeit, die großen Widersprüche ästhetischer Urteilskraft auszuhalten und sich ihnen zu stellen. Denn liest man etwa kritische Passagen von Friedländer über Courbet, bei dem er den Eindruck hat, dessen Bedeutung hätte sich längst überholt, dann fällt sich der Autor plötzlich selbst ins Wort: »Wenn mir ein Gemälde Courbets, das um 1870 Malern und Kunstfreunden frappant naturwahr erschien, minder naturwahr vorkommt, so urteile ich als ein Schüler Manets. Unsere Enkel werden wieder anders messen und wägen. Es bleibt aber keine Wahl, als auf unserm Standpunkte zu beharren, auch nachdem wir eingesehen haben, anstatt auf festem Boden auf einer treibenden Eisscholle zu fußen.« Oder an anderer Stelle: »Wir haben nicht nur bei van Eyck und Bruegel, sondern auch bei Manet und Cézanne sehen gelernt und können keine Erfahrung ausschalten.« Das ist eine große Wahrheit: Wer Cézanne gesehen hat, schaut anders auf van Eyck als die Zeitgenossen eines Watteau und Boucher. Wer Picasso gesehen hat, schaut anders auf Memling als ein Zeitgenosse El Grecos. Das ist die Conditio sine qua non der Kunstbetrachtung. Die eigene Abhängigkeit von der Zeit, die einen immer klüger, aber auch abhängiger macht.
Auch heute wird ja Friedländer verehrt, selbst wenn kaum jemand eine Zeile von ihm gelesen hat. Und es gibt ja in der Tat verschiedene Gründe zur Verehrung. Neben seiner kunsthistorischen Gesamtleistung halte ich aber diese so nüchterne wie poetische Beschreibung der Grenzen jedes ästhetischen Werturteils für Friedländers wichtiges Legat für die Nachwelt. Wir alle, die wir über Kunst reden, stehen nur auf treibenden Eisschollen. Viele haben dies geahnt – dann aber irgendwann doch kalte Füße bekommen. Friedländer aber stellt sich der Tatsache und macht die Demut damit zu einem Fundament jeder ästhetischen Äußerung.
3. Man muss versuchen, Ordnung zu schaffen (auch wenn es nicht geht)
Der erste Teil der Überschrift könnte von Friedländer stammen. Die Klammer natürlich nicht. Aber natürlich wüsste er, dass sie stimmt. Friedländer war ein Mensch von großer Ordnungsliebe und Akkuratesse, das schlägt immer wieder durch, wenn er, an seinem Schreibtisch sitzend, versucht, sich einen Überblick über eine bestimmte Zeit zu verschaffen – und dann merkt, dass dies eigentlich nicht möglich ist. Dann tut er nicht so, wie es Kunstwissenschaftler gerne tun, als gebe es eine klare Ordnung. Sondern er benennt die Unordnung: »Das 19. Jahrhundert bietet ein besonders verwirrendes Bild«, schreibt er etwa, oder: »Die Antwerpener Produktion zur Zeit, als Patenier starb, bietet einen reichen und wirren Anblick.« Dann begibt sich Friedländer, seinem Naturell gemäß, natürlich doch daran, zu ordnen, aber er weiß dabei immer, dass es ein Versuch bleiben muss. Weil wir ja nur noch ordnen können, was übriggeblieben ist aus vergangenen Zeiten, und wir nicht wissen, wo überall Lücken klaffen. Und weil Friedländer letztlich auch immer wieder durchscheinen lässt, dass der Wunsch nach Ordnung oft falsche Eindeutigkeiten erzeugt. So schreibt er einmal über den Kupferstich »Mohammed und der getötete Mönch« des offenbar erst 14-jährigen Lucas van Leyden: »Wie entschieden auch alle Erfahrungen der Vorstellung widerstreben, wir müssen wohl oder übel an dem Geburtsdatum festhalten und die Abnormität in das Bild einfügen, das wir von dem Maler schaffen.«
Ja, da steht tatsächlich »schaffen«. Und nicht »haben«. Eine winzige Sollbruchstelle, an der aus dem bescheidenen Museumsbeamten doch der Anspruch durchbricht, ein Werk zu »schaffen«. Aber auch hier bleibt natürlich eine demütige Einschränkung – es ist das Bild, »das wir von dem Maler schaffen«. Also in dem Wissen, dass frühere Zeiten und spätere Zeiten sich wieder ein ganz anderes Bild von Lucas van Leyden machen werden als »wir«. Gerade weil er so viel wusste, war er umso skeptischer gegenüber allen, die glaubten, im Besitz der Weisheit zu sein. Sich selbst immer in Frage zu stellen: welche Größe. Aber natürlich versucht er dennoch überall, Ordnung zu gewinnen: Er weiß wie ein Klingenschärfer ganz genau, wo die Grenzlinie zwischen Holländisch und Flämisch »scharf« ist (im 17. Jahrhundert) und wo sie »nicht ebenso scharf« ist (im 15. Jahrhundert). Und bei dem neuen Museumsführer für das Kaiser-Friedrich-Museum fügt er einen strengen Pfeil ein, der zeigt, wie die Leute sich durch das Museum bewegen sollen. Ordnung muss sein, nur so, so lehrt er, kann man die Zusammenhänge verstehen. Aber man darf eben die Liebe zur Ordnung nicht mit einem Glauben an Objektivität verwechseln: »Überzeugt, dass wirkliche Objektivität unter keinen Umständen erreichbar ist, möchte ich die Schädigung vermeiden, die mit dem Streben danach unausweichlich verbunden ist.« Aber man ist nicht nur in seiner Zeit gefangen, sondern auch in seinem Naturell. Es geht von Friedländer eine ungeheure Ruhe aus – auch von ihm als Mensch, wie die Zeitgenossen berichten. Und von seinem Stil. Er steht still – und schaut auf die Welt der Malerei, die sich bewegt. Nur aus dieser absoluten Ruhe heraus kann man wahrnehmen (und Worte dafür finden), dass Jan Gossaert »originalitätslüstern« ist. Und natürlich meint das Friedländer auch ein wenig tadelnd. Denn er sieht es als eine große Aufgabe der großen Meister an, dass sie sich – demütig – immer als Teil einer großen Entwicklung begreifen. Oder aber, wenn er von seinem Schreibtisch 1904 wieder zurückblickt in die Vergangenheit: »Die turbulente Gestaltungsweise, die in Antwerpen plötzlich einzusetzen scheint, gleicht einem Wirbel, der beim Zusammentreffen gegeneinander gerichteter Strömungen entsteht.« Die Frauen haben ein »etwas freches Aussehen«, und bei den Antwerpener Manieristen gibt es »wilde und maßlose Gestaltungen«. Er ist ein strenger Wahrnehmer und Zuchtmeister. Ein preußischer Jude. Ein Musterbeamter. Er tadelt. Er sieht, wo jemand aus dem Glied tritt. Doch wenn er dies auf beeindruckende Weise tut, dann ist ihm das Lob des Meisters Friedländer gewiss.
4. Urteilen heißt, sich irren zu können
Wenn Friedländer schreibt, urteilt er. Er ist sich dieser Tatsache bewusst. »Es hat nur einen Kunstkenner gegeben, der sich nie blamiert hat, und der war stumm und konnte nicht schreiben.« Anders also Friedländer: Er war nicht stumm und konnte schreiben. Und zwar »in das knappste nur denkbare sprachliche Gewand gekleidet«, wie Günter Busch einmal sagte. Es gibt meist Hauptsätze, Adjektive sind, vor allem im Spätwerk, selten. Er ringt lieber stundenlang um das richtige Verb, als dem Leser ein paar schmackhafte Worthülsen anzubieten. »Man sollte so gut schreiben, dass niemand merkt, dass es gut geschrieben ist« – was für ein herrliches Credo. Das Sehen ist für Friedländer eine körperliche Handlung. Und das Schreiben auch. In diesen beiden geistig-seelischen Aktionen erschöpfte sich sein Leben. Er erblickt und erfasst. Auf unnachahmliche Weise. Mit einem höchsten Maß an Sprachbewusstsein, das Fremdwörter vermeidet und jede »verzwickte Terminologie, die das Lesen kunstgeschichtlicher Bücher zu einer Qual macht«. Er hat alle, auch seine Zeitgenossen, überfordert, wenn sie nach Kategorien für die Singularität seines Stils suchten. Denn er hat zwar die Wissenschaftler gegen die Kenner ausgespielt, war aber letzlich doch als Kenner so wissenschaftlich wie die meisten Wissenschaftler nicht. Er hatte nur eine Abneigung gegen Gedankenkonstruktionen, die sich von den Bildern lösen. Er schrieb nicht über Probleme, sondern über Phänomene – so hat der weise Erwin Panofsky 1957 über ihn geschrieben. Vielleicht ist dies die präziseste Unterscheidung zwischen dem »Kenner«, der von Friedländer verkörpert wird, und dem Wissenschaftler, dem reinen Akademiker, der ihm fremd war.
5. Sketch of a Self-Portrait
Friedländers großer Antipode war Bernard Berenson. Doch so wie sich der eine, seinem Naturell gemäß, den Nordländern zuwandte, galt Berensons Passion den Malern Italiens. Während Friedländer seine Studierstube und sein Museum nie verließ, wohnte Berenson als kleiner Medici-Fürst oberhalb von Florenz in seiner Villa I Tatti inmitten eigener Kunstschätze. Beide haben Geschmacksgeschichte geschrieben. Aber nur Berenson eine Autobiographie. »Sketch for a Self-Portrait« lautet deren kongenialer Titel. Friedländer wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, über sich selbst zu schreiben, seine Selbstdarstellung passt auf eine halbe Seite, am wichtigsten war ihm, dass er nur 200 Meter von der Museumsinsel entfernt geboren wurde und dass er diese Insel der Seligen quasi nie verlassen hat – bevor ihn 1933 die Deutschen ins Exil vertrieben. Aber wenn man sehr lange sucht, findet man auch in Friedländers Schaffen einen winzigen »sketch for a self-portrait«- und zwar in seiner Charakterisierung von Paul Cézanne: »Nicht ohne Opfer zu bringen, hat Cézanne seine gesamte seelische Energie in das Schauen verlegt.« Er vermeidet alles »Laute, Vage, Verschwommene«. Und dann: »Er setzt linienhaft kantige Grenzen, aus dem Bedürfnisse, die flutenden Farben zu fassen, wie man Edelsteine fasst.« Drei Sätze – und man hat den ganzen Friedländer vor sich. Und hier, bei den Edelsteinen, schließt sich der Kreis: Friedländer, aus einer großen Dynastie der Juwelenhändler stammend, findet im Unbewussten für einen der großen stillen Meister der Kunstgeschichte Worte, an denen klar wird, dass sich die Präzision seiner Anschauung und seiner Sprache auch aus alten familiären Quellen speist: dem Erkennen von Karatzahlen mit dem bloßen Auge. Aber er hat diese Technik auf einzigartige Weise fortentwickelt: Er schleift unbehandelte Diamanten mit der harten Präzision des richtigen Wortes, bis sie funkeln.
Harry Graf Kessler
Das Frösteln in der Moderne
Wer 1868 als Harry Kessler geboren, mit elf Jahren geadelt und mit 13 Jahren zum Grafen wird, der hat zeitlebens ein ganz besonderes Sensorium für die Klassenunterschiede. Harry Graf Kesslers jahrzehntelanges Ringen darum, Begriffe für Schönheit und Ästhetik zu finden, ist immer mitbestimmt von seiner Aufmerksamkeit für Distinktionsgewinne und Klassenbewusstsein. Die Schärfe seines Blickes für soziale und gesellschaftliche Hierarchien wird in den Tagebüchern bei den Umwälzungen am Ende des Ersten Weltkrieges frappant. So besucht er am 18. November 1917 den Maler George Grosz in dessen Atelier – und es geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Harry Graf Kessler, der große Geschmacksinnovator, der ganz aufzugehen scheint in den fließenden internationalen Jugendstil-Linien eines Ludwig von Hofmann, van de Velde und Maillol, erkennt in Sekundenschnelle die Größe der Kunst von Grosz. Er schreibt abends in sein Tagebuch: »Überhaupt diese neuberlinische Kunst, Grosz, Becher, Benn, Wieland Herzfelde, höchst merkwürdig; Großstadtkunst, von hochgespannter Dichtigkeit der Eindrücke, die bis zur Simultanität steigt; brutal realistisch und gleichgültig märchenhaft wie die Großstadt selbst, die Dinge wie mit Scheinwerfern roh beleuchtet und entstellt und dann in einem Glanz verschwindend.« Das ist deshalb ein so bedeutendes Zitat, weil wir Nachgeborene hundert Jahre später in Berlin zwei große Ausstellungen »Zeitenwende« und »Tanz auf dem Vulkan« mit sehr vielen Exponaten und dicken Katalogen brauchen, um in etwa das einzufangen, wofür Kessler nur einen Satz braucht. Es sind diese Verdichtungen, die ihn groß machen – denn dies ist die seltenste Kunst, als Zeitzeuge erspüren und ausdrücken zu können, was als Essenz der eigenen Kultur bleiben wird. Jeder, der seine Abende mit den dicken roten Bänden der Klett-Cotta-Tagebuchausgabe verbracht hat, weiß, dass Kessler immer wieder versucht hat, seine Eindrücke zu solchen Diagnosen zu verdichten – und dass es ihm meist misslingt. Weil er zu viel will, weil er theoretisch werden will, obwohl er – zum Glück – so gar nicht denken und empfinden kann, weil er aus spontaner Begeisterung die falschen Kronzeugen aufruft. Es könnte sogar sein – so meine These –, dass Kessler dann besonders klar sieht, wenn ihn das Gesehene eigentlich abschreckt und verstört. Wenn es ihm fremd ist. Wenn er es sich nicht als mögliche Illustration für seine Cranach-Presse vorstellen kann. Kessler scheint ein sehr feines Sensorium dafür zu haben, wenn etwas gänzlich Neues entsteht – gerade auch, weil er gerne an der Ästhetik der Jahrhundertwende festhalten möchte und er seinen persönlichen Kanon nach 1905 nie mehr erweitern wird. So verstört ihn im Mai 1913 die Uraufführung von »Le Sacre du Printemps« in Paris, er liebt es, mit den Protagonisten, also Nijinsky, Ravel, Gide, Djagilew, Strawinsky, zu speisen und zu plaudern. Doch was er abends am 29. Mai auf der Bühne sieht, bricht hinein in die fein ziselierte Cranachstraßenästhetik des Grafen Kessler: »Eine ganz neue Choreographie und Musik. Eine durchaus neue Vision, etwas Niegesehenes, Packendes, Überzeugendes ist plötzlich da; eine neue Art von Wildheit in Unkunst und zugleich in Kunst: alle Form verwüstet, neue plötzlich aus dem Chaos auftauchend.« Was Kessler da nachts um drei Uhr atemlos seinem Tagebuch anvertraut, das ist wohl eine der prägnantesten und bis heute tragfähigsten Formulierungen für den Modernitätsschub, der die Welt in der Zeit um 1913 erfasste. Das ist genauso zeitlos und hellsichtig wie seine Augenzeugen-Analyse der Berliner Simultankunst rund um Grosz im Jahre 1917.
Denn wenn ihm in seltenen Momenten diese Verdichtung gelingt, dann finden genaue Beobachtung und tiefe Empfindung glücklich zusammen. Es kann sein, dass es jenes grandiose Bild »Hommage an Oskar Panizza« von George Grosz war, das Kessler im November 1917 im Atelier entstehen sah, er schreibt von »einer Großstadtstraße«, und was sich bei Grosz durch Berlin walzt in einem verstörenden, großartigen Zug an feisten, verlorenen, verzückten Gestalten, das ist vielleicht nie besser auf den Punkt gebracht worden als mit jenem spontanen »brutal realistisch und gleichgültig märchenhaft«. Denn die Brillanz von Grosz ergibt sich genau daraus, dass er die Fratzen der Gesellschaft, ihre Dickbäuchigkeit und geistige Leere in einer Kunst erzählt, die etwas von Kinderbuchillustrationen hat, von Märchen. Und ja, »märchenhaft«, so ist auch der Singsang von Gottfried Benns Gedichten aus der »Krebsbaracke«, die Kessler hier mit Grosz in den kulturellen Zusammenhang stellt.