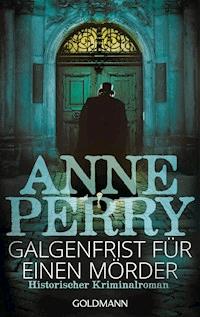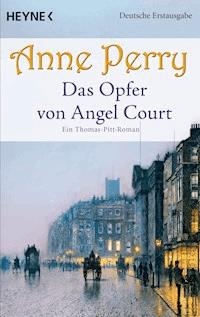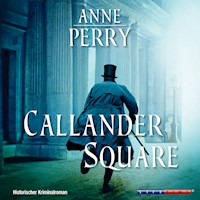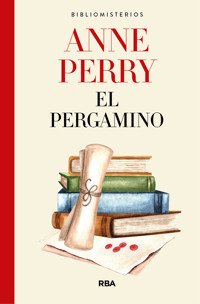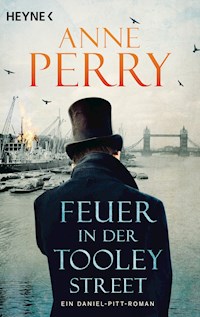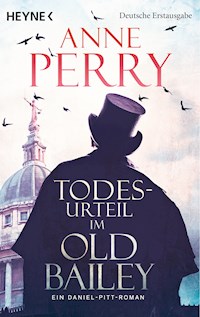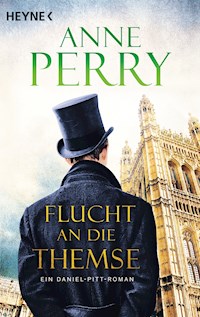
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Daniel-Pitt-Serie
- Sprache: Deutsch
Daniel Pitt, Sohn des berühmten Ermittlers Sir Thomas Pitt, gerät als Anwalt in einen zweiten gefährlichen Fall. Sein Schwager fleht ihn an, gegen den Botschaftsangestellten Philip Sidney vorzugehen. Dieser habe in den USA eine Frau überfallen und sei dann unter dem Schutz diplomatischer Immunität an die Themse geflohen. Als ein wichtiger Tatzeuge ermordet aufgefunden wird, wird Sidney auch wirklich der Prozess gemacht – doch ausgerechnet Daniel Pitt wird als sein Verteidiger bestellt. Allerdings entdeckt Daniel bald, dass hinter dem Verbrechen tatsächlich jemand ganz anderes stecken könnte. Jemand, der einen gewaltigen Umsturz plant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Daniel Pitt, Sohn des berühmten Ermittlers Sir Thomas Pitt, gerät als Anwalt in einen zweiten gefährlichen Fall. Sein Schwager fleht ihn an, gegen den Botschaftsangestellten Philip Sidney vorzugehen. Dieser habe in den USA eine Frau überfallen und sei dann unter dem Schutz diplomatischer Immunität an die Themse geflohen. Als ein wichtiger Tatzeuge ermordet aufgefunden wird, wird Sidney auch wirklich der Prozess gemacht – doch ausgerechnet Daniel Pitt wird als sein Verteidiger bestellt. Allerdings entdeckt Daniel bald, dass hinter dem Verbrechen tatsächlich jemand ganz anderes stecken könnte. Jemand, der einen gewaltigen Umsturz plant.
Die Autorin
Die Engländerin Anne Perry, 1938 in London geboren, verbrachte einen Teil ihrer Jugend in Neuseeland und auf den Bahamas. Schon früh begann sie zu schreiben. Ihre historischen Kriminalromane, in denen sie das England des späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts wiederauferstehen lässt, begeistern ein Millionenpublikum. Anne Perry lebt und schreibt in Schottland.
Flucht an die Themse ist der zweite Roman um den jungen Anwalt Daniel Pitt. Sein erster Fall Todesurteil im Old Bailey erschien 2019. In der Reihe um seinen Vater Thomas Pitt, Leiter des Staatsschutzes, sind zahlreiche Bücher im Heyne Verlag lieferbar.
ANNE PERRY
FLUCHT AN DIE THEMSE
Ein Daniel-Pitt-Roman
Aus dem Englischenvon K. Schatzhauser
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe
TRIPLE JEOPARDY
erschien 2018 bei Headline Publishing Group, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 04/2020
Copyright © 2018 by Anne Perry
Copyright © 2020 der deutschen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Uta Dahnke
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Fotos von © Lyn Randle / Trevillion Images
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-24221-3V002
www.heyne.de
Für Victoria Zackheimzum Dank für ihre Freundschaftund unermessliche Hilfe
KAPITEL 1
Daniel läutete an der Haustür und trat dann einen Schritt zurück. Erstaunt merkte er, dass er mit einem Mal nervös war. Warum nur? Es war das Haus seiner Eltern, in dem er aufgewachsen war. Obwohl er inzwischen fünfundzwanzig Jahre alt war, kehrte er immer wieder dorthin zurück, um mit seinen Eltern zu Abend zu essen, sich mit ihnen behaglich zu unterhalten, Gedankenaustausch zu pflegen oder ihnen etwas mitzuteilen, was ihm wichtig erschien. Was mochte diesmal anders sein?
Der Unterschied bestand darin, dass seine Schwester Jemima mit ihrem Mann und ihren kleinen Töchtern Cassie und Sophie zu einem mehrwöchigen Aufenthalt aus Amerika gekommen war. Er hatte sie vier Jahre lang nicht gesehen und kannte weder ihren Mann, Patrick Flannery, noch seine beiden Nichten. Sowohl in Jemimas als auch in seinem eigenen Leben war es im Verlauf dieser Jahre zu bedeutenden Veränderungen gekommen. Er hatte sein Jurastudium in Cambridge abgeschlossen, die darauf folgenden juristischen Examina abgelegt und übte jetzt den Beruf eines Anwalts aus, wovon er so lange geträumt hatte. Jemima hatte nach New York geheiratet und lebte inzwischen in Washington. Früher hatte sie ihn als ›naiven Idealisten‹ verspottet. Natürlich hatte er sich verändert, und das galt wohl auch für sie. Stets hatte er seine Beziehung zu ihr als ganz natürlich empfunden; sie hatten über wichtige ebenso wie über unerhebliche, wenn nicht gar lächerliche Dinge streiten können, ohne dass es zu einem dauerhaften Zerwürfnis kam, weil ihnen beiden bewusst war, dass es zwischen ihnen ein unauflösliches Band gab. Sie war drei Jahre älter als er und vom Tag seiner Geburt an da gewesen.
Ärgerte es ihn, dass sie einen Amerikaner geheiratet hatte und ihm in seine Heimat gefolgt war? Eigentlich nicht, solange sie damit glücklich war. Irgendwann hätte sie so oder so jemanden geheiratet, und es war völlig natürlich, dass Menschen im Laufe des Lebens unterschiedliche Beziehungen eingingen und neue an die Stelle der alten traten oder sie ergänzten. Mit neun Jahren hatte sie ihn, den Sechsjährigen, herumkommandiert. Jetzt würde er sich das nicht mehr gefallen lassen, auch wenn sie das wahrscheinlich aus alter Gewohnheit versuchen würde. Sicher würde sie dann ohne Weiteres klein beigeben, oder etwa nicht?
Sie hatte ihm gefehlt. Sie war ihm wichtig – immerhin waren sie miteinander aufgewachsen, mit allen angenehmen und, wichtiger noch, auch allen unangenehmen Erlebnissen. Er konnte sich noch gut an den Tag erinnern, an dem ihr Vater, wie jedes Jahr, ihr Größenwachstum am Türrahmen verzeichnet hatte und er selbst dabei zum ersten Mal größer gewesen war als sie. Damit hatten sich die Rollen umgekehrt. Zwölf Jahre lang hatte sie ihn beschützt, oder jedenfalls war ihm das so vorgekommen, doch fortan würde er diese Rolle übernehmen müssen, wie ihm der Vater erklärt hatte. Allerdings war das nicht immer nötig gewesen. Ihre Mutter brauchte ohnehin niemanden zu ihrem Schutz. Sie hatte vor niemandem Angst, und wenn sie wütend war, nahm sie es mit jedem auf! Und manchmal hatte sich Jemima ähnlich verhalten oder es zumindest versucht.
Zwar dauerte – man schrieb inzwischen das Jahr 1910 – eine Atlantiküberquerung nur noch fünf Tage, aber fünf hin, fünf zurück und der Aufenthalt dort summierten sich doch zu einer ziemlich langen Zeit. Während des Studiums und den darauf folgenden Prüfungsmonaten hätte sich Daniel eine so extravagante Abwesenheit nicht leisten können, weder zeitlich noch finanziell.
Besorgt fragte er sich, ob sich Jemima verändert hatte oder zwischen ihnen nach wie vor die frühere selbstverständliche Herzlichkeit bestand.
Gerade als er den Glockenzug ein zweites Mal betätigen wollte, öffnete sich die Tür, doch statt eines Dienstboten trat seine Mutter heraus. Charlotte Pitt war eine gut aussehende hochgewachsene Frau, deren kastanienbraunes Haar hier und da graue Fäden durchzogen. Obwohl sie die fünfzig überschritten hatte, wirkte sie energisch wie eh und je. Sie jemals anders zu erleben würde ihn tief schmerzen, aber das lag weit in der Zukunft, wenn es überhaupt dazu kam.
»Daniel!« Sie umarmte ihn, drückte ihn eine Weile fest an sich und trat dann einen Schritt zurück. »Komm rein! Jemima kann es gar nicht erwarten, dich zu sehen, und selbstverständlich musst du auch Patrick kennenlernen. Außerdem Cassie und Sophie. Du wirst sehen, sie sind allerliebst!«
Er trug keinen Mantel, denn es war ein milder Augustabend – schon das Jackett war ihm zu warm –, und so konnte er seiner Mutter sogleich ins Wohnzimmer folgen, dessen zum Garten führende Fenstertüren offenstanden. Man sah, wie sich das letzte Licht des Tages auf den Blättern der Pappeln brach. Alles war ihm so vertraut, als habe er das Haus erst am Vormittag verlassen. Sein Vater stand neben Jemima und einem Fremden, vermutlich ihrem Mann.
Jemima trat auf ihn zu. Obwohl auch sie ihm vertraut war wie eh und je, hatte sie sich in mancherlei Hinsicht verändert. Sie hatte dunklere Haare als er, und sie waren gewellt wie die ihres Vaters. Obwohl sie ein schlichtes blassgrünes Tageskleid trug, sah sie großartig aus, weil sie ein Glück ausstrahlte, das sie besonders anmutig erscheinen ließ. Er fragte sich, ob er sich in ihren Augen verändert hatte und, wenn ja, auf welche Weise. Sicherlich nicht von seinem Äußeren her – er war nach wie vor schlank, und sein rötlich braunes Haar widerspenstig wie eh und je.
Er öffnete die Arme zu einer brüderlichen Umarmung, die sie kräftig erwiderte. Dann trat sie rasch beiseite und sagte: »Das ist mein Mann Patrick. Patrick, das hier ist mein Bruder Daniel.«
Patrick Flannery war fast ebenso groß wie Daniel, doch damit endete jede Ähnlichkeit. Er hatte schwarze Haare und leuchtend blaue Augen. Seine Gesichtszüge waren weniger regelmäßig und ließen nicht auf den ersten Blick erkennen, ob er einfühlsam war, aber offensichtlich besaß er Humor und wirkte damit anziehend. »Ich habe durch Jemima schon viel von dir gehört und freue mich, dich endlich kennenzulernen.« Der Wohlklang der Stimme, der sicherlich auf seine irische Abstammung zurückging, überlagerte den amerikanischen Akzent.
»Willkommen in London«, sagte Daniel und ergriff Patricks Hand.
»Vielen Dank«, gab dieser zurück. »Ich hatte New York immer für groß gehalten, aber das hier ist … einfach gewaltig.« Er sagte es mit einem Lächeln, damit es nicht kränkend klang.
»Ach was – London ist nichts anderes als eine Ansammlung zusammengewachsener Dörfer«, gab Daniel zurück. »Wir müssen dich gelegentlich einmal herumführen. Vielleicht eine Fahrt auf der Themse?« Er warf einen Blick zu Jemima hinüber, um zu sehen, ob sie den Vorschlag billigte.
»Die habe ich schon geplant«, sagte sie lächelnd. »Aber vor dem Abendessen musst du noch zwei kleine Mädchen kennenlernen. Sophie schläft zwar tief, und Cassie ist auch nicht mehr ganz wach, aber sie wollte unbedingt aufbleiben, um ihrem Onkel Daniel Guten Abend zu sagen. Komm mit …« Sie hielt ihm die Hand hin. Auf ihrem vor Freude und Stolz leuchtenden Gesicht lag eine gewisse Unruhe.
»Entschuldigt bitte«, sagte Daniel, an seine Eltern gewandt, insbesondere den Vater, mit dem er noch kein Wort gewechselt hatte, und folgte gehorsam der Schwester nach oben.
Dort zeigte ihm Jemima die kleine Sophie, deren Bettchen im von ihr und Patrick bewohnten Zimmer stand. Das Kind schlief tief und fest, das flaumige Haar hob sich dunkel vom Kissen ab. Stumm sahen die Geschwister auf die Kleine, lächelten einander zu und gingen auf Zehenspitzen über den Korridor zum Kinderzimmer. Es war der erste Raum, den Daniel als kleiner Junge bewusst wahrgenommen hatte.
Jemima wies auf das Bett. Das Mädchen darin war eingeschlafen und dabei seitlich auf das Kissen gesunken. Die Haare der Kleinen waren fast schwarz, die Haut makellos. Daniel hätte sie auch dann auf etwa drei Jahre geschätzt, wenn er ihr Alter nicht gewusst hätte.
Jemima kniete sich neben das Bett und weckte das Kind sanft auf, bevor Daniel sie auffordern konnte, es nicht zu stören.
Langsam setzte sich die Kleine auf und sah dann an ihrer Mutter vorbei zu Daniel. Ihre Augen waren nicht blau wie die ihres Vaters, sondern schimmerten grau wie die Jemimas und ihres Großvaters Thomas Pitt.
»Hallo, Cassie«, sagte Daniel und trat näher. »Ich bin Daniel. Es war sehr lieb von dir, so lange aufzubleiben, damit ich dich kennenlernen konnte.« Er wusste nicht, ob er ihr die Hand hinhalten sollte oder nicht.
Sie blinzelte einige Male. »Fein«, gab sie zur Antwort. »Wir sind von ganz weit gekommen. Mit einem großen Schiff.«
»Bestimmt war das richtig aufregend«, sagte er. »Ich war noch nie auf einem großen Schiff.«
Langsam trat ein Lächeln auf ihr Gesicht, dann wandte sie sich verlegen ab und rückte ein klein wenig näher an ihre Mutter heran.
»Erzählst du mir bitte gelegentlich etwas darüber?«, fragte Daniel.
Sie nickte. »Mein Papa ist bei der Polizei …«
»Wie lustig, meiner auch«, gab er zur Antwort.
Erneut sah sie zu Jemima hin. »Ist das auch dein Papa?«
»Ja. Wir sind alle eine Familie. Deine Familie«, gab Jemima zurück.
Cassie stieß einen tiefen Seufzer aus und lächelte dann zufrieden.
»Ich denke, dass für dich jetzt Schlafenszeit ist, mein kleines Fräulein.« Ohne auf eine Antwort zu warten, deckte Jemima ihr Töchterchen zu, wobei sie über Cassies Kopf hinweg zu Daniel sah. »Sag Mutter, dass ich in etwa zehn Minuten unten bin. Wartet nicht mit dem Essen auf mich. Und … danke …«
»Sie ist richtig süß. Alle beide sind hinreißend.«
Jemima drückte die Kleine, die wieder eingeschlafen war, an sich. »Danke«, flüsterte sie, und in ihren Augen mischte sich Stolz mit Erleichterung. Hatte sie wirklich angenommen, Daniel könnte etwas anderes als völlig begeistert und vielleicht sogar ein wenig neidisch sein?
Er trat auf den Treppenabsatz hinaus und ging wieder nach unten. Jemima hatte sich verändert, aber nicht sehr. Als kleines Mädchen hatte sie zwar nie Puppen haben wollen, aber ihre Stofftiere mit der gleichen Zärtlichkeit an sich gedrückt wie eben ihre Tochter. Sonderbar, wie unauslöschlich manche Erinnerungen waren.
Daniel richtete Jemimas Bitte aus, dass man nicht mit dem Essen auf sie warten solle, aber natürlich taten sie es doch. Das gab ihm die Gelegenheit, mit seinem Vater zu sprechen. Pitt war inzwischen Anfang sechzig und hatte graue Schläfen, die ihm ausgesprochen gut zu Gesicht standen. Er leitete nach wie vor die Abteilung Staatsschutz, deren Aufgabe es war, terroristische Umtriebe im Lande zu unterbinden. Gegründet hatte man sie, um etwas gegen die Bombenanschläge der als Fenier bekannten irischen Freiheitskämpfer unternehmen zu können. Seit er vor vielen Jahren aus dem Polizeidienst ausgeschieden und in diese Abteilung eingetreten war, unterlag ein großer Teil seiner Arbeit strikter Geheimhaltung. Königin Victoria hatte ihn in ihrem letzten Regierungsjahr für Verdienste um die Krone in den persönlichen Adelsstand erhoben, doch nicht einmal seine Angehörigen wussten genau, welcher Art diese Verdienste gewesen waren. Trotz seines offenen Wesens behielt er seine Dienstgeheimnisse stets für sich. Auf Fragen antwortete er mit Schweigen und einem Lächeln, und Daniel bemühte sich, das in seinem Beruf ebenso zu halten, wo es erforderlich war.
»Wie stehen die Dinge bei fford Croft?«, fragte ihn sein Vater. Damit bezog er sich auf den Leiter der Kanzlei, in der Daniel als mehr oder weniger frischgebackener und noch weit unten auf der Karriereleiter stehender Anwalt tätig war.
Daniel konnte seinen Vorgesetzten gut leiden, mochte seine exzentrische Persönlichkeit – das Wort ›verschroben‹ war fast zu schwach dafür –, hatte aber nur wenig unmittelbaren Kontakt mit ihm. Die meisten Fälle, die man ihm anvertraute, waren ziemlich trocken und langweilig. Das allerdings konnte er seinem Vater gegenüber nicht zugeben, der ihm diese Anstellung verschafft hatte. Wenn er sich seiner Arbeit mit Hingabe und dem nötigen Fachwissen widmete, bestand durchaus die Möglichkeit, in eine angesehene und einträgliche Position aufzusteigen, in der er dann damit rechnen durfte, dass man ihm auch interessante und anspruchsvolle Aufgaben übertrug.
Daniel lächelte. »Nichts, was so spannend wäre wie der Fall Graves«, sagte er mit leichter Selbstironie und zugleich mit einem Anflug von Bedauern in der Stimme. Damit bezog er sich auf die Angelegenheit, die ihn im Laufe des Frühsommers stark in Anspruch genommen hatte. Noch hatte er die mit diesem Fall verbundene große Angst nicht vergessen, das Bewusstsein aller Beteiligten, wie viel auf dem Spiel stand. Sogar sein Vater, Sir Thomas Pitt, wäre mit in den Abgrund gerissen worden, wenn sie nicht verhindert hätten, dass Russell Graves seine ebenso brillant formulierten wie unwahren Anschuldigungen veröffentlichte. »Aber ehrlich gesagt, bin ich auch nicht besonders scharf darauf.«
»Auch in meiner Dienststelle sind die meisten Fälle ziemlich alltäglich«, erklärte Pitt. »Vergiss aber nie, dass sie für die betroffenen Menschen von größter Wichtigkeit sind. Je mehr du deine Fähigkeiten entwickelst, desto kniffliger und bedeutender werden deine Fälle – und das ganz von allein. Eine Aufgabe, die dich überfordert, würde dir nur schaden.«
Daniel zögerte einen Augenblick. War das, was er in den Augen seines Vaters sah, eine Erinnerung an das Grauen, das mit dem Fall Graves verbunden gewesen war? Pitt hatte sich damals kaum dazu geäußert, aber bestimmt hatte er den Untergang seiner Welt befürchtet. Daniel hatte sich durch die Erleichterung darüber, dass alles gut ausgegangen war, wie von einer Woge tragen lassen und nichts von all dem Schmerz gespürt. Womöglich hatte sein Vater das alles anders empfunden? Er würde sich das für die Zukunft merken müssen. Wenn ein Fall den falschen Ausgang nahm, traf das viele Menschen, und jeder von ihnen hatte es verdient, dass man an ihn dachte.
Als Jemima herunterkam, gingen alle ins Esszimmer und nahmen am Tisch Platz. Während der Mahlzeit wandte sich die Unterhaltung allgemeinen Themen zu, die niemanden belasteten. Jemima berichtete von ihrer Wohnung in Washington, der Nachbarschaft und dem Klima dort. Patrick sagte nur wenig über seine Arbeit und dafür umso mehr, und das mit unüberhörbarer Zuneigung, über seine Geschwister, seine warmherzige Mutter, seinen, wie es schien, etwas wunderlichen Vater sowie zahlreiche Onkel und Tanten.
Daniel hörte aufmerksam zu, und das keineswegs nur deshalb, weil Patrick amüsant und anschaulich erzählte, sondern auch, weil die von ihm so liebevoll geschilderten Menschen Jemimas neue Familie bildeten, welche sich deutlich von der unterschied, die sie in England zurückgelassen hatte. Pitt selbst hatte keine Angehörigen – er war ein Einzelkind, und seine Eltern waren gestorben, bevor er Charlotte geheiratet hatte. Darüber wurde nicht gesprochen.
Charlotte hatte zwei Schwestern, von denen eine noch lebte, Emily Radley. Sie spielte, wie auch ihre Kinder, in ihrer aller Leben eine bedeutende Rolle. Ob sie Jemima wohl fehlten?
Obwohl sie ausschließlich über angenehme Dinge sprachen, hatte Daniel den unbestimmten Eindruck, dass irgendetwas Patrick belastete.
Was das war, erfuhr er, als er sich mit seinem Schwager allein in der von Rosenduft erfüllten Dunkelheit des Gartens die Füße vertrat.
Während Daniel noch überlegte, wie er das Thema unauffällig anschneiden könnte, kam Patrick von selbst darauf zu sprechen.
»Es gibt außer dem Familienbesuch noch einen weiteren Grund dafür, dass ich nach England gekommen bin«, sagte er nach kurzem Zögern, als sei ihm bewusst, dass er nicht viel Zeit haben würde, um Daniel mitzuteilen, was ihm äußerst wichtig zu sein schien.
»Ach? Hat das etwas mit mir zu tun? Oder soll ich mit jemandem darüber reden?«, erkundigte sich Daniel, bemüht, seine Stimme unverbindlich und zugleich freundschaftlich klingen zu lassen.
»Es wäre mir lieb, wenn ich dich da mit einbeziehen könnte«, gab Patrick mit einer Stimme zurück, der anzumerken war, wie sehr ihn die Sache beschäftigte. »Ich muss dir die Geschichte von Anfang an berichten, weil sie sonst keinen Sinn ergibt.«
»Und wenn jetzt Jemima herauskommt …«
»Sie kommt nicht. Ihr ist klar, dass ich mit dir über die bewusste Angelegenheit rede.«
»Sie hat mir noch gar nichts davon gesagt …«
»Das würde sie auch auf keinen Fall tun«, gab Patrick zurück. »Aber ich glaube, dass ihr die Sache ebenso am Herzen liegt wie mir.«
Daniel lehnte sich an eine der Birken und wartete. Patrick räusperte sich. »Die Thorwoods sind eine der ältesten und in der Gesellschaft Washingtons bedeutendsten Familien. In der Politik spielen sie keine Rolle, sind aber hoch angesehen, unter anderem wegen ihrer Wohltätigkeit. Sie spenden für verschiedene gute Zwecke – insbesondere bedenken sie die Sozialkasse der Polizei.« Er zögerte kurz, vielleicht, um sich zu vergewissern, dass Daniel die Bedeutung dieser Menschen erfasste.
»Ich verstehe.« Daniel nickte. »Und worum geht es bei diesen Leuten?«
»Sie haben nur ein Kind, eine Tochter namens Rebecca«, fuhr Patrick fort. Da es inzwischen fast vollständig dunkel war, konnte Daniel sein Gesicht kaum noch erkennen, aber die Eindringlichkeit, mit der er sprach, war unüberhörbar. »Sie ist zwanzig Jahre alt, hat eine angesehene gesellschaftliche Stellung, reichlich Geld und sieht auf unspektakuläre Weise gut aus.«
Am liebsten wäre ihm Daniel mit der Aufforderung ins Wort gefallen, er möge zur Sache kommen, doch nahm er sich zusammen, so schwer es ihm fiel. Schließlich hatte Patrick gleich zu Anfang darauf hingewiesen, dass es eine lange Geschichte sein würde.
Während er weitersprach, wurde seine Stimme immer angespannter. »Vor etwa einem Monat ist sie mitten in der Nacht davon aufgewacht, dass ein Fremder in ihr Schlafzimmer eingedrungen war. Er hat sie angegriffen, ihr das Nachthemd zerfetzt und eine Halskette mit einem Diamantanhänger vom Hals gerissen. Man kann immer noch die Narbe davon an ihrem Nacken sehen.«
Daniel hörte entsetzt zu.
Mit belegter Stimme fuhr Patrick fort: »Sie hat sich zu wehren versucht und laut um Hilfe geschrien. Er hat mehrfach heftig auf sie eingeschlagen und dann die Flucht ergriffen. Rebeccas Vater hat ihn zwar auf dem Flur gesehen, ihn aber nicht zu fassen bekommen. Mr. Thorwood hat daraufhin das Zimmer seiner Tochter aufgesucht, wo er sie völlig verzweifelt vorfand. Sie wies eine Reihe von blauen Flecken auf und war in Tränen aufgelöst. Ich … ich weiß nicht, was ihr der Mann sonst noch angetan hat …«
Daniel konnte sich gut in die Situation einfühlen. Das Ganze musste für die junge Frau furchtbar und traumatisch gewesen sein.
»Aber was könnte ich in dieser Angelegenheit unternehmen?«, fragte er verwirrt.
»Mr. Thorwood hat den Flüchtenden erkannt«, gab Patrick zurück. Sogar in der Dunkelheit war seine starre Haltung zu erkennen.
»Dann hast du ihn also festgenommen? Oder deine Kollegen?«
»Das war leider nicht möglich. Der Mann, ein gewisser Philip Sidney, hat sich in die britische Botschaft geflüchtet, deren Mitarbeiter er ist. Dort haben wir keinen Zutritt, weil sie exterritorial ist, also sozusagen britischer Boden. Danach ist er im Schutz seiner diplomatischen Immunität nach England zurückgekehrt.«
»Ich verstehe …«
»Und hier in London kann man ihn wegen der in Washington begangenen Straftat nicht belangen.« Die unverhohlene Wut in Patricks Stimme war unüberhörbar.
Daniel erfasste die Situation und teilte die Empfindungen seines Schwagers. Die Tat war unbestreitbar abscheulich und widerwärtig. Ihm waren alle Gründe geläufig, die dafür sprachen, dass Diplomaten im Ausland strafrechtliche Immunität genossen, doch durfte dieses Privileg keinesfalls verhindern, dass ein solches Verbrechen gesühnt wurde. Es berührte ihn peinlich, dass ein Landsmann so etwas getan hatte, und es war ihm zutiefst unangenehm, über seinen Schwager davon zu erfahren, ohne dass er etwas dagegen unternehmen konnte. »Wie entsetzlich«, war alles, was er herausbrachte.
»Das finde ich auch«, sagte Patrick. »Ich wusste, dass du es verstehen würdest. Ich möchte unbedingt etwas unternehmen, aber ich weiß nicht, was. Falls man ihn vor Gericht bringen könnte, ließen sich allerlei Fragen stellen. Wieso hat man einem solchen Mann überhaupt diese Position in Washington anvertraut? Warum hätte er das Land Hals über Kopf verlassen sollen, ohne zumindest sein Mietverhältnis aufzulösen, wenn er nicht der Täter war? Er hat sich offenbar im Bestreben, dem Zugriff der Polizei zu entgehen, im Schutz der Dunkelheit aus der Botschaft geschlichen, um das Nötigste, was er brauchte, aus der Wohnung zu holen. Dann ist er nach New York gefahren und hat das nächste Schiff nach Southampton genommen. Sieht das nicht eindeutig nach einem Schuldeingeständnis aus? Da fragt man sich doch, warum er sich so verhalten hat.« Patricks Stimme war voll Mitgefühl. »Falls er wegen einer in England begangenen Straftat vor Gericht gestellt würde, kämen doch sicherlich auch dieser tätliche Angriff und der Diebstahl zur Sprache? Wir müssen unbedingt erreichen, dass man Anklage gegen ihn erheben kann.« Auch wenn er Daniel nicht ausdrücklich um Unterstützung bat, schwang diese Aufforderung in seinen Worten unüberhörbar mit.
Daniel überlegte. Er hatte volles Verständnis für Patricks Empörung. Er selbst hätte nicht anders empfunden, wenn ein Amerikaner in London eine solch widerwärtige Tat begangen hätte, um dann im Schutz diplomatischer Immunität in seine Heimat zurückzukehren. »Wofür könnte man ihn vor Gericht bringen?«, fragte er. »Er hat sich ja wohl schon seit einigen Jahren in Amerika aufgehalten?«
»Ja, aber eine Botschaft gilt doch in allen Ländern der Welt als Territorium des Entsendelandes«, gab Patrick zurück. »Also hat er sich in Washington auf englischem Boden befunden. Sofern er sich dort etwas hätte zuschulden kommen lassen …« Er hielt inne und sah Daniel fragend an.
»Ja, in dem Fall …« Daniel erwog die Frage. Auf diesem Gebiet besaß er nicht die geringste Erfahrung, doch er empfand die gleiche Wut und Empörung, das gleiche Mitleid wie sein Schwager.
»Würdest du mich unterstützen?«, fragte Patrick, »wenn es dazu eine Möglichkeit gibt?«
»Gewiss, selbstverständlich.«
Patrick wandte sich dem Licht zu, das aus dem Wohnzimmer in den Garten fiel, und Daniel erkannte auf seinen Zügen ein zufriedenes Lächeln. Er brauchte nichts weiter zu sagen.
KAPITEL 2
Daniel verabschiedete sich ziemlich spät, um in sein möbliertes Zimmer zurückzukehren, und Jemima bemerkte, wie viel entspannter ihr Mann nun wirkte. Es war der zweite Abend, den Jemima in ihrem Elternhaus verbrachte, und von Anfang an hatte sich bei ihr die einstige Vertrautheit wieder eingestellt. Patricks Entspannung zeigte ihr, dass auch er sich allmählich wohlzufühlen begann. Bisher war ihr noch gar nicht zu Bewusstsein gekommen, wie wichtig ihr das war. Hatte sie sich eigentlich überlegt, wie unbehaglich er sich gefühlt haben musste, als sie ihn mit dem einzigen ihrer Angehörigen zusammengebracht hatte, der nicht zu ihrer Hochzeit nach New York gekommen war? Selbstverständlich war das nicht Daniels Schuld gewesen – er hatte wegen seiner Prüfungen in Cambridge bleiben müssen –, doch obwohl sie Patrick viel über ihren Bruder berichtet hatte, war ihm Daniel bis dato fremd geblieben.
Jetzt waren Jemima und Patrick oben in ihrem Schlafzimmer. Sie hatten die Tür hinter sich geschlossen, und alles im Haus war still geworden. Jemima hatte nach Cassie gesehen und sie tief schlafend mit der Puppe im Arm vorgefunden. Auch Sophie schlief, ein braves Kind.
Patrick stand vor den geschlossenen Fenstervorhängen, während sich Jemima zum Schlafengehen zurechtmachte und sich das Haar löste. Sie hatte sich Sorgen um ihn gemacht. Bevor sie in New York lebte, hatte sie nicht gewusst, dass es dort gegen Iren gewisse Vorbehalte gab. Das war ihr erst allmählich aufgefallen: ein kleiner Vorfall hier und da, ein Zettel im Fenster einer Pension, dass Iren und Juden dort unerwünscht seien. Vorurteile anderer fallen uns ja mehr auf als die eigenen, und sie empfand es wie eine Ohrfeige, dass manche Menschen einfach deshalb etwas gegen ihren reizenden, fröhlichen und tapferen Mann hatten, weil er aus einer irischen Einwandererfamilie stammte. Er würde seine Herkunft nie verleugnen, und die Ablehnung durch andere stärkte sein Zugehörigkeitsgefühl umso mehr. Wer wegen seiner Herkunft angegriffen wurde, hatte nur zwei Möglichkeiten: Er sagte sich von ihr los oder fühlte sich ihr gegenüber zu doppelter Loyalität verpflichtet. Patrick tat Letzteres. Jemima wollte das auch gar nicht anders; sie wäre enttäuscht gewesen, wenn er sich nicht so verhalten hätte.
Auch sie empfand ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl, das ihr nach der Rückkehr in das Haus, in dem sie aufgewachsen war, mehr denn je bewusst wurde. Auch wenn sie es möglicherweise aus dem Gedächtnis nicht vollständig hätte beschreiben können, war ihr mit einem Schlag alles wieder vertraut, als sie es erneut sah: die Aquarelle mit englischen Landschaftsmotiven; die nicht nach Größe, sondern nach Sachgebieten eingeordneten Bücher des Vaters; die von ihrer Mutter hergerichteten Arrangements von Blumen aus dem eigenen Garten – all das übte auf Jemima denselben Reiz aus wie früher. Insgeheim schämte sie sich, dass ausgerechnet ein junger Engländer aus der britischen Botschaft in Washington Rebecca Thorwood so schändlich behandelt hatte. Es kam ihr wie ein Verrat an all dem vor, was Menschen wie ihren Angehörigen am Herzen lag. Zugegebenermaßen konnte sich Jemima nicht mehr daran erinnern, wie ihr Bruder Daniel als Neugeborener ausgesehen hatte, auf jeden Fall aber daran, wie er in Cassies Alter gewesen war. Verblüfft merkte sie, welch ein Gefühl der Fürsorglichkeit sie für ihn nach wie vor empfand. Natürlich würde sie ihm das nie sagen, denn das wäre ihm ausgesprochen peinlich und ihr selbst wohl ebenfalls. Das würde nicht nur die Selbstverständlichkeit ihres Umgangs miteinander gefährden, sondern auch das Gleichgewicht der Kräfte stören. Als Mann empfand Daniel ein gewisses Gefühl der Überlegenheit, das sie ihm als die Ältere keinesfalls zugestehen würde, auch wenn der Altersunterschied im Laufe der Jahre immer unerheblicher geworden war.
»Hast du es ihm gesagt?«, fragte sie.
»Was?«, fragte Patrick zurück, weil er offenbar nicht sicher war, was sie meinte.
»Die Sache mit Rebecca … die Handgreiflichkeit.«
Er legte sich ins Bett. »Ja, natürlich. Es kann dauern, bis wir eine Möglichkeit bekommen, etwas zu unternehmen. Ich kann aber höchstens einen Monat hierbleiben – wahrscheinlich habe ich damit schon meinen Urlaub für dieses und gleich auch noch für das nächste Jahr verbraucht.« Er beugte sich über sie und berührte sie zärtlich. »Es tut mir leid, Liebste, aber die Sache ist wirklich wichtig. Hast du Rebecca in jüngster Zeit gesehen?«
»Ja …«, gab Jemima zurück. Niemand, der dieser jungen Frau nach jenem Vorfall erneut begegnet war, konnte die Veränderung übersehen, die mit ihr vorgegangen war. Sie war bleich, wirkte ängstlich, sprach kaum hörbar und auch nur dann, wenn man das Wort an sie richtete. Jemima wusste, dass sie wenig schlief und an Appetitlosigkeit litt. »Ich denke auch, dass es wichtig ist«, sagte sie. »Vermutlich nimmt sie an, dass sich außer ihren Angehörigen niemand für den Vorfall interessiert. Was hat Daniel denn gesagt?«
»Er wird mich unterstützen.« Patrick lächelte. In seinen Augen mischten sich Belustigung und Freude. »Er ist ausgesprochen anständig. Ein frischgebackener Anwalt, geht ganz vorsichtig an die Dinge heran. Sehr englisch!«
»Natürlich ist er das!« Patrick mochte Vater und Sohn für typische Vertreter der auf die Erhaltung des Status quo bedachten bürgerlichen Gesellschaft halten, aber Jemima kannte den alles andere als konventionellen Werdegang ihres Vaters, Sir Thomas Pitt, des Leiters der Abteilung Staatsschutz.
Sie war in ihren Empfindungen eins mit ihm, seit sie sich erinnern konnte. Allerdings war er damals auch nur ein ganz gewöhnlicher Polizeibeamter gewesen. Ein hochgewachsener liebenswürdiger Mann mit widerspenstigem, stets ein wenig zu langem Haar, dessen Anzug nie richtig saß, dessen Hemdkragen immer zerknittert war und dessen Jackett-Taschen von allerlei Gegenständen überquollen, die er möglicherweise einmal brauchen könnte: Bleistifte, Päckchen mit runden Pfefferminzbonbons, Notizzettel und Bindfaden. Im Winter hatte er stets einen Wollschal getragen.
Doch das waren bloße Äußerlichkeiten. Seinem Wesen nach war er ein Gentleman, der sich nicht nur stets wie ein solcher verhielt, sondern auch wie einer sprach. Zwar war sein Vater ein einfacher Wildhüter auf einem großen Landgut gewesen, auf dem die Mutter ebenfalls Dienst tat, aber der Gutsherr hatte den jungen Thomas zusammen mit seinem eigenen Sohn unterrichten lassen, um diesen beim Lernen anzuspornen, und dabei hatte Pitt ihn bald überflügelt.
Von all dem wusste Patrick nichts, und es war wohl auch besser, wenn er nicht erfuhr, dass man Pitts Vater wegen angeblicher Wilderei nach Australien deportiert hatte. Pitt war nach wie vor von der Schuldlosigkeit seines Vaters überzeugt, hatte aber keine Möglichkeit gehabt, sie zu beweisen. Jemima wusste nicht, wann er aufgehört hatte, es zu versuchen.
Vielleicht sollte sie Patrick eines Tages doch in dieses Familiengeheimnis einweihen, aber dafür war die Zeit noch nicht reif. Die Loyalität dem Vater gegenüber verschloss ihr den Mund. Einmal, das war schon lange her, hatte sie die tiefe Trauer auf seinen Zügen gesehen, und ihr war bewusst geworden, dass er unter einer Kränkung litt, die er nie würde vergessen können.
Sie schob diese Gedanken beiseite. »Und was wollt ihr unternehmen?«, fragte sie Patrick.
»Du meinst wegen Philip Sidney?«
»Ja. So ein ruhmreicher Name! Er hat ihn nicht verdient«, stieß sie aufgebracht hervor.
Er sah sie verständnislos an.
»Vor einigen Hundert Jahren, ich glaube, zur Zeit von Königin Elisabeth, lebte in England ein Mann, der so hieß«, erläuterte sie. »Sir Philip Sidney. Als junges Mädchen habe ich ihn sehr verehrt. Nach einer Schlacht waren viele Männer schwer verwundet. Die Leute hatten nur wenig Wasser. Als ihm jemand eine Feldflasche hinhielt, hat er ihn aufgefordert, sie einem anderen in seiner Nähe zu geben, damit der weiterleben konnte, denn ihm war bewusst, dass seine eigene Verwundung tödlich war.«
Patrick sah sie aufmerksam an; die Zärtlichkeit auf seinen Zügen erstaunte sie. Sie wandte sich mit Tränen in den Augen ab, hielt ihm aber die Hand hin, die er so fest ergriff, dass sie sie nicht hätte zurückziehen können. Allerdings wollte sie das auch gar nicht – ganz im Gegenteil.
»Du hast recht«, sagte er. »Dieser Name ist viel zu gut für ihn. Ich nehme es ihm richtig übel, dass er ihn in den Schmutz zieht. Es tut mir leid, die Sache öffentlich machen zu müssen, aber ich werde es tun.«
»Das verstehe ich. Aber wie?«
»Es wird sich eine Möglichkeit finden. Weißt du übrigens, dass die Familie Thorwood ebenfalls hier in England ist?«
Sie sah ihn fragend an. »Du hast ihnen aber doch keine Hoffnungen gemacht …? Das kannst du nicht. Sie werden ein Ergebnis erwarten, und du hast doch nichts, was du … oder doch?«
»Bringst du eigentlich auch mal einen Satz zu Ende?«, fragte er leicht spöttisch.
»Lenk nicht ab! Was hast du den Leuten gesagt?«
»Nichts.« Trotz des gewaltigen Unterschiedes in Einkommen und gesellschaftlicher Stellung kannten sie beide die Familie Thorwood recht gut. Patrick hatte einige Male Gelegenheit gehabt, Mr. Thorwood einen Gefallen zu tun, und Jemima hatte Rebecca bei einer Ausstellung englischer Porträtmalerei in der britischen Botschaft kennengelernt. Sie hatte sie angesprochen, als sie sie, offenbar ratlos, allein vor einem Bildnis der Anne Boleyn hatte stehen sehen, und ihr die Zusammenhänge erläutert: Heinrich VIII., seine sechs Gemahlinnen, seine drei Kinder, die eins nach dem anderen die Krone geerbt hatten, als Letzte die herausragende Königin Elisabeth, die so alt geworden war, dass sie volle fünfundvierzig Jahre herrschen konnte, länger noch als ihr Vater.
Den Rest der Ausstellung hatten sie gemeinsam besichtigt und sich im Laufe der Zeit miteinander angefreundet.
»Dass die Thorwoods hier sind, hat weder mit mir noch mit Philip Sidney etwas zu tun.«
»Womit dann?«
»Mit Tante May Trelawny.«
»Tante May …«
»Trelawny«, wiederholte er. »Rebeccas Patentante. Sie hat auf einer der Kanalinseln gelebt und ist kürzlich verstorben.«
»Nicht in Cornwall?«, fragte Jemima zweifelnd. »Der Name Trelawny kommt dorther. Und wieso ist Rebecca gerade jetzt hier, während du hinter Sidney her bist?« Jemima war misstrauisch, und ihr war bewusst, dass er das ihren Worten anhören konnte.
Mit einem schiefen Lächeln räumte Patrick ein, es könne auch in Cornwall gewesen sein. »Jedenfalls ist Rebecca hergekommen, um ihr Erbe anzutreten.«
»Wie traurig für sie«, sagte Jemima. »Ganz gleich, wie bedeutend der Nachlass ist, es wäre ihr bestimmt lieber, wenn ihre Patentante noch lebte. Ein weiterer harter Schlag für die Ärmste.«
»Im Augenblick halten sich die Thorwoods in London auf, und ich weiß auch, wo. Du könntest Rebecca besuchen – natürlich nur, wenn du nichts über Sidney sagst. Ich hoffe, dass er es nicht wagt, sich zu zeigen.«
»Keine Sorge. London ist groß. Da ist es schon nicht einfach, jemanden zu finden, den man treffen möchte, ohne zu wissen, wo er lebt, welche Gesellschaften er besucht oder welchem Club er angehört. Und man kann sich leicht vorstellen, wie unwahrscheinlich eine Begegnung erst sein muss, wenn man keinen Wert darauf legt, jemandem über den Weg zu laufen.«
»Ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass Rebecca an irgendwelchen Gesellschaften teilnehmen möchte. Sobald ich etwas finde, wofür ich Sidney vor Gericht bringen kann …«
»Bist du sicher, dass das richtig ist?«, fragte sie in freundlichem Ton, bemüht, ihre Besorgnis nicht zu zeigen.
»Ob das richtig ist?«, gab er überrascht zurück. »Bist du etwa der Ansicht, dass der Bursche ungeschoren davonkommen sollte, Jem? Er ist mitten in der Nacht in ihr Zimmer eingedrungen, hat sich in ihrem eigenen Bett auf sie gestürzt, ihr das Nachthemd zerfetzt und ihr die Kette mit dem wertvollen Anhänger vom Hals gerissen. Für sie bestand deren Wert nicht so sehr in dem Diamanten, sondern darin, dass es ein Geschenk von ihrer Patentante war. Man kann die Narbe an ihrem Hals noch sehen. Der Himmel allein weiß, wie es weitergegangen wäre, wenn sie nicht geschrien hätte. Daraufhin ist er davongerannt, wobei ihn Mr. Thorwood gesehen und erkannt hat. An seiner Täterschaft besteht nicht der geringste Zweifel.«
»Das weiß ich doch selbst! Ich meinte etwas anderes.« So entsetzlich das Ganze auch war, bemühte sie sich, ihre Stimme nicht zu erheben. Sie konnte sich kaum vorstellen, was Rebecca in diesen Minuten durchgemacht hatte und wohl nach wie vor durchmachte. Vermutlich wurde sie von Albträumen heimgesucht. Immer wieder musste Jemima an Rebeccas Hilfsbereitschaft in der Zeit denken, als sie neu in Washington waren. Kaum hatte sie sich in New York einigermaßen eingelebt, war Patrick eine Beförderung angeboten worden, für die er nach Washington hatte ziehen müssen. Jemima war nicht nur stolz auf ihn, sondern auch ausgesprochen froh über die damit verbundene Gehaltserhöhung, denn sie war es nicht gewohnt, mit wenig Geld hauszuhalten. Sie hatte sich große Mühe gegeben, ihn das nicht merken zu lassen, hatte aber immer wieder Geldsorgen.
Die veränderte Situation hatte sich als schwierig erwiesen, zumal sie sich um ein mitunter anstrengendes Kleinkind kümmern musste. Nach jenem Besuch der Kunstausstellung hatte sich Rebecca stets hilfsbereit gezeigt, Geduld bewiesen, wenn sich Jemima ausweinen musste, und ihr zugehört, wenn sie von Zeit zu Zeit unter Heimweh litt.
Zwar lag Jemima daran, dass Rebecca Gerechtigkeit widerfuhr, doch noch wichtiger erschien es ihr, dafür zu sorgen, dass ihre seelischen Wunden heilten – unabhängig von einer Bestrafung Philip Sidneys.
Patrick fragte mit einer gewissen Ungeduld: »Und was meinst du also?«
Sie schloss die Augen, um ihn nicht ansehen zu müssen und sich dadurch ablenken zu lassen. Auch wenn sie ihn von Tag zu Tag besser kennenlernte, liebte sie ihn nach wie vor. Sie kannte seine Eigenarten und sah sie nicht als Fehler an. Noch immer lag ein gewisser Zauber darin, ihn abends heimkommen zu sehen, ihn lachen zu hören und morgens an seiner Seite aufzuwachen.
Sie wählte ihre Worte sorgfältig. »Bist du sicher, dass es für Rebecca das Beste ist, den Vorfall vor Gericht auszubreiten? Jeder Angeklagte darf sich dort verteidigen. Der einzige Mensch außer ihm, der die Vorfälle jener Nacht kennt, ist Rebecca …«
»Worauf willst du hinaus?«
»Was glaubst du, was er sagen wird? Immerhin waren die beiden miteinander bekannt, Patrick!«
»Du willst ja wohl nicht andeuten, dass sie ihn selbst ins Haus gelassen hätte?« Seine Stimme klang ungläubig.
»Natürlich nicht. Aber vielleicht wird sein Verteidiger das als Möglichkeit ins Spiel bringen. Wenn es um die Frage geht, auf welche Weise Sidney ins Haus gelangt ist, wird er den Vorwurf, dort eingedrungen zu sein, keinesfalls schweigend hinnehmen. Er könnte vielmehr behaupten, sie habe sich mit ihm dort verabredet, es sich dann aber anders überlegt und losgeschrien.«
Er hob die Brauen. »Und dann hat er ihr die Kette vom Hals gerissen und ist davongelaufen? Das taugt nun wirklich nicht als Verteidigung, Jem.«
»Nein, aber es wäre ein Gegenangriff. Bist du bereit, das zu riskieren – oder, besser gesagt, denkst du, dass Rebecca dazu bereit ist?«
Er sah sie verblüfft an, hub an zu sprechen, sagte dann aber nichts, als habe er begriffen, dass sie an etwas dachte, worüber sie beide sich noch keine Rechenschaft abgelegt hatten.
»Ich verstehe, dass Mr. Thorwood Gerechtigkeit für seine Tochter will«, nahm Jemima einen neuen Anlauf. »Aber um jeden Preis? Hat er sich überhaupt klargemacht, was sie empfinden muss? Ich habe mir das vorzustellen versucht, aber es gelingt mir nicht.«
»Würdest du nicht auch wollen, dass man den Mann bestraft, wenn er dir das angetan hätte?«, gab er zu bedenken.
»Ich weiß nicht. Vielleicht würde ich das denken, aber nur bis zu dem Augenblick, in dem man von mir verlangte, aller Welt davon zu berichten.«
»Aber sie hat sich nicht das Geringste zuschulden kommen lassen!«, rief er entrüstet aus. »Sie ist doch in jeder Hinsicht schuldlos.«
»Sie hat in ihrem Nachthemd hilflos im Bett gelegen …«
»Eben! Sie könnte gar nicht unschuldiger sein.«
»Ja, man könnte auch sagen: verletzlicher, hilfloser, passiver.«
Er sah sie aufmerksam an. »Worauf willst du hinaus? Dass sie in irgendeiner Weise doch schuldig sein könnte? Hätte sie irgendwelche … Vorsichtsmaßnahmen treffen sollen? Welche zum Beispiel? Vollständig angekleidet zu Bett gehen? Das ist doch widersinnig, Jem.«
»Aber nein! Oder vielleicht doch. Ich versuche nur, mich an ihre Stelle zu versetzen und zu überlegen, was ich mir in dieser Situation wünschen würde«, erläuterte sie. »Ich bin sicher, dass ich im Gerichtssaal keinesfalls als eine Frau gelten möchte, die teilnahmslos im Bett liegen bleibt, wenn ein Mann in ihr Zimmer eindringt, ihr das Nachtgewand zerfetzt und die Kette vom Hals reißt. Ich müsste ständig daran denken, wie sich die Zuschauer genüsslich ihren Fantasien hingeben … Es wäre mir zuwider, als Opfer angesehen zu werden!« Sie spürte, wie Zorn über seine Verständnislosigkeit in ihr aufstieg und immer stärker wurde. »Ich finde die bloße Vorstellung abscheulich, dass sich die Leute insgeheim fragen würden, ob ich die Wahrheit sagte oder den Mann in Wirklichkeit nicht sogar selbst eingelassen hätte.«
»Das hat sie aber doch nicht getan! Der bloße Gedanke ist absurd!«
»Und was ist mit den Fantasien der anderen – sind die nicht absurd?«, gab sie zurück. »Wir nehmen immer an, dass niemand weiß, was wir denken, und dass es deshalb geheim ist.«
»Das stimmt doch auch!«
»Ich bitte dich! Die meiste Zeit steht es einem ins Gesicht geschrieben. Und es entschlüpft uns in kleinen Bemerkungen, von denen wir fälschlich annehmen, dass niemand sie versteht, wenn ausschließlich Männer im Raum sind.«
»Du warst doch noch nie irgendwo, wo sich ausschließlich Männer aufgehalten haben.«
»Aber an Orten, an denen sich ausschließlich Frauen befanden!« Sie sah, wie sein Lächeln verschwand, erst dem Ausdruck von Verstehen und schließlich dem von Selbstironie wich. »Das gilt auch für Rebecca«, schloss sie.
Er schwieg.
»Mit Sicherheit ist ihr Vater überzeugt, dass es ihr besser gehen wird, wenn man Sidney bestraft, und vielleicht stimmt das sogar. Aber was ist, wenn man ihn nicht verurteilt?«
»Zweifelst du etwa daran?«
»Ich weiß nicht. Wenn die Sache vor Gericht kommt, wird er alles bestreiten.«
»Das kann er nicht. Mr. Thorwood hat ihn doch gesehen, und der ist eine wichtige Persönlichkeit, die von allen respektiert wird.«
»In Washington. Hier respektiert man Sidney.«
»Bestimmt nicht, wenn bekannt wird, was er getan hat!«, stieß Patrick voll Geringschätzung hervor.
»Patrick … mein Liebling … hier in London sind die Menschen genauso wie überall: Sie glauben nur, was sie glauben wollen.«
»Soll das bedeuten, dass man wichtige Persönlichkeiten nicht unter Anklage stellt, weil die Leute ihnen eher glauben würden als dir? Da ist es natürlich kein Wunder, wenn sie sich darauf verlassen, dass sie sich alles herausnehmen dürfen. Vermutlich wird das sogar in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen so gehandhabt, und daran dürfte sich wohl kaum etwas ändern!«
Sie erkannte das Missfallen in seinen Augen, und das schmerzte sie. Sie wusste, mit welchen Vorurteilen man ihm im Laufe seines Lebens immer wieder begegnet war. Da auch sie jetzt den – unübersehbar irischen – Nachnamen Flannery trug, war sie in Amerika gelegentlich selbst auf Ablehnung gestoßen. Nach dem ersten Ärger war sie stolz darauf gewesen, seine Frau zu sein, seiner Familie und seiner Sippe anzugehören, zwar nicht durch Geburt, aber immerhin durch die Ehe. Schließlich hatte es sie wütend gemacht, dass man Menschen so behandelte. Falls eines Tages auch Cassie und Sophie darunter leiden mussten, würde sie die Halunken in Stücke reißen, die so etwas taten.
Ihr war klar, dass Patrick das alles mit einer Mischung aus Stolz und Schmerz beobachtete. Noch war er nicht sicher, ob sie das ertragen und sich darein fügen würde.
Ihr Vater war Sohn eines Wildhüters, den man wegen einer unbedeutenden – und nicht einmal bewiesenen – Dieberei schwer bestraft hatte. Hatte auch er unter dieser Demütigung gelitten? Hatte es jemanden gegeben, der ihn beschützte? Ja, seine Mutter und später Jemimas Mutter Charlotte. Wehe jedem, der zu jener Zeit Thomas Pitt etwas angetan hätte! Jemima streichelte zärtlich Patricks Wange. »Ich hoffe, dass ich an ihrer Stelle versuchen würde, bei meiner Entscheidung abzuwägen, ob mir alle Konsequenzen bewusst sind und wie ich damit zurechtkäme, wenn er nicht den Preis für sein Verhalten zahlen müsste. Ich weiß nicht, ob Rebecca das zu Ende gedacht hat.«
»Du glaubst ihr aber doch?«, ließ er nicht locker. »Oder nimmst du etwa an, dass sie ihn selbst eingelassen hat?«
»Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß, dass sie ihn kannte und gut leiden konnte. Gerade deshalb schmerzt das ja so sehr.«
Patrick beugte sich vor und gab ihr einen Kuss, und zumindest einstweilen dachte sie nicht mehr an Rebecca, obwohl ihr bewusst war, dass er genau das hatte erreichen wollen. Sie verschob es auf den nächsten Tag, sich wieder Sorgen über den Ausgang der Sache zu machen.
KAPITEL 3
Am folgenden Vormittag betrat Daniel die Kanzlei fford Croft & Gibson in dem Bewusstsein, dass er unbedingt etwas tun musste. Nach dem im Elternhaus verbrachten Abend hatte er schlecht geschlafen, obwohl er beim Wiedersehen mit seiner Schwester erfreut festgestellt hatte, dass sich zwischen ihnen so gut wie nichts geändert hatte. Unter der Oberfläche der Ehefrau und Mutter, die verständlicherweise allerlei Verantwortung zu tragen hatte, war die Jemima von früher unverkennbar: ihre Fröhlichkeit, die Bereitschaft, über unsinnige Dinge zu lachen, ihre Wissbegier und ihr Unternehmungsgeist, lauter Wesensmerkmale, die er gut kannte.
Doch an diesem Vormittag lastete das Gewicht dessen, was ihm Patrick über Sidney berichtet hatte, schwer auf ihm. Das abstoßende Verhalten des jungen Botschaftsangehörigen war schlimm genug. Noch schwerer aber wog, dass er sich der Verantwortung dafür feige zu entziehen versuchte, indem er sich auf seine diplomatische Immunität berief. Das erschien Daniel unerträglich, doch gab es zu seinem Bedauern keine juristische Handhabe gegen dieses widerwärtige Verhalten.
Es ließen sich gute Gründe für eine solche Immunität anführen, ohne die Diplomaten in fernen Ländern gefährdet wären. Ohne diesen Schutz könnte man ihnen Taten zur Last legen, die sie nicht begangen hatten, und sie dafür zur Rechenschaft ziehen, sie damit erpressen. Es oblag ihnen dennoch, sich so zu verhalten, dass sie jederzeit über jeglichen Verdacht erhaben waren. Kein Land konnte sich als Diplomaten schwarze Schafe leisten, die ihre Rechnungen nicht bezahlten, Straftaten begingen oder sich korrumpieren ließen – ganz zu schweigen von einem so gewalttätigen und widerwärtigen wie diesem Sidney.
Nicht nur Rebecca Thorwoods Ehrenrettung lag Daniel am Herzen; er wollte vor allem, dass Philip Sidney bestraft wurde, weil er Schande über sein Land und alle anderen Diplomaten gebracht hatte, die es in der Welt vertraten, ob in Amerika oder wo auch immer. Das Verhalten des Mannes machte ihn rasend, und er hatte keinen anderen Wunsch, als dafür zu sorgen, dass man ihn dafür zur Rechenschaft zog, und wenn es nicht anders ging, auch auf Umwegen.
»’n Morgen, Impney«, begrüßte er den Bürovorsteher.
»Guten Morgen, Sir«, gab dieser mit einem kaum merklichen Nicken zurück. »Mr. fford Croft ist noch nicht im Hause. Wünschen Sie Tee? Es dauert nur fünf Minuten.«
Daniel brauchte nicht lange zu überlegen. »Nein, vielen Dank, Impney. Ist Mr. Kitteridge da?«
»Ja, Sir. Wenn Sie mir gestatten, das zu sagen – er ist noch allein. Sein nächster Mandant kommt erst in einer halben Stunde.«
Daniel lächelte ihm freundlich zu. »Danke, Impney. Sie sind ein Goldstück.«
»Vielen Dank, Sir«, gab Impney steif zurück, aber seine Augen leuchteten.
Da Kitteridge juristisch unendlich viel erfahrener war als er selbst, ging Daniel auf kürzestem Weg zu dessen Büro und klopfte an. Da er von ihm einen Rat haben wollte, empfahl es sich zu warten, bis dieser ihn aufforderte einzutreten. Er klopfte erneut.
»Bringen Sie es einfach rein, Impney«, sagte Kitteridge.
Daniel ging hinein und schloss die Tür hinter sich. »Guten Morgen.«
Überrascht hob Kitteridge den Kopf. Mit etwas über Mitte dreißig war er ein gutes Stück älter als Daniel. Er war noch größer als Daniel mit seinen über eins achtzig, sah nicht sonderlich gut aus, war aber ein brillanter Kopf. Er wirkte bisweilen ungelenk, schien dann ausschließlich aus Ellbogen und Knien zu bestehen.
»Ach, Sie sind es, Pitt. Entschuldigung. Ich hatte angenommen, dass Impney die Post bringen würde. Was gibt es? Sie sehen aus, als hätten Sie … Schießen Sie schon los.«
Daniel trat an den Schreibtisch und setzte sich Kitteridge gegenüber. »Ich stecke gewissermaßen in einer Zwickmühle.«
Kitteridge lächelte, eher amüsiert als herablassend. Seit dem Fall Graves, bei dem er den Kollegen besser kennengelernt hatte, konnte Daniel das unterscheiden. »Und jetzt soll ich Ihnen da heraushelfen?«, fragte Kitteridge.
Noch vor einigen Monaten hätte sich Daniel dadurch vor den Kopf gestoßen gefühlt, aber inzwischen wusste er, dass Kitteridge sein durchaus umgängliches Wesen hinter solchen spöttischen Äußerungen verbarg. »Ja«, bestätigte er. »Ich brauche Ihren Rat.«
»In Fragen des Rechts?«
»Ja, aber auch in solchen der Moral, obwohl ich da die Antwort zu kennen glaube«, gab Daniel zurück.
Ein flüchtiger Ausdruck von Spott trat auf Kitteridges Züge. »Ich verstehe – Sie haben keinen blauen Dunst. Sie glauben sicher zu sein, dass Sie die Antwort auf der moralischen Ebene kennen, haben aber nicht die geringste Vorstellung davon, wie Sie der Sache juristisch beikommen können.«
Daniel holte tief Luft. »So ist es«, gab er zu. Er beschloss weiterzusprechen, bevor ihm der andere ins Wort fallen konnte. Er wollte feststellen, ob auch Kitteridge den Fall so empörend fand wie er selbst, bevor er auf die juristischen Probleme zu sprechen kam. »Einem britischen Diplomaten in Washington wird zur Last gelegt, ins Schlafzimmer der Tochter einer hoch angesehenen Familie eingedrungen zu sein, ihr eine Kette mit einem kostbaren Diamantanhänger vom Hals gerissen und die Flucht ergriffen zu haben, als der Vater auf ihre Schreie hin herbeikam. Der sagt, er habe den Eindringling erkannt – sie waren einander bereits gesellschaftlich begegnet.«
Kitteridge wirkte jetzt deutlich interessierter, ließ ihn aber weitersprechen.
»Der Täter heißt Philip Sidney und …«
»Philip Sidney?«, fragte Kitteridge verblüfft. »Allen Ernstes?«
»Ja. Kennen Sie ihn etwa?«
»Nicht persönlich. Zu solch erlauchten Kreisen habe ich keinen Zutritt.« Auf Kitteridges Zügen mischten sich Amüsement und Bedauern.
»Sie scheinen viel von ihm zu halten«, schloss Daniel – voreilig, wie sich herausstellte.
»Jetzt nicht mehr«, erklärte Kitteridge. »Falls, was Sie mir da vorgetragen haben, den Tatsachen entspricht, ist der Mann für mich erledigt. Schade.«
»Mr. Thorwood, der Vater der jungen Frau, sagt, er könne beschwören, dass Sidney der Eindringling war, und sie selbst bekräftigt das. Sie können sich vorstellen, wie sehr das Ganze sie mitgenommen haben muss. Übrigens hat er ihr die Halskette so brutal entrissen, dass man immer noch deutliche Hautabschürfungen an ihrem Hals sehen kann. Er hat sich unter Berufung auf seine diplomatische Immunität in die britische Botschaft geflüchtet und kurz darauf heimlich das Land verlassen.«
»Schrecklich«, sagte Kitteridge. Ein Ausdruck von Abscheu und Betrübnis trat auf seine Züge. Ganz offensichtlich setzte es ihm zu, Philip Sidney falsch eingeschätzt zu haben.
»Es tut mir leid«, sagte Daniel, der das begriff.
»Und was wollen Sie jetzt wissen?«, fragte Kitteridge in sachlichem Ton. »Er hat sich im Schutz der diplomatischen Immunität davongemacht, und da ihn niemand angeklagt hat, ist er auch nicht schuldig befunden worden. Wer etwas gegen ihn sagt, was er nicht beweisen kann, macht sich der Verleumdung schuldig, speziell hier bei uns in England. Tut mir leid, Pitt, aber falls er das wirklich war und sich auf diese Weise mit Schande bedeckt hat, ist es ihm gelungen, sich der gerechten Strafe zu entziehen, sosehr uns das gegen den Strich gehen mag.«
»Und wenn er auf britischem Boden eine Straftat begangen hätte und man ihn dafür beschuldigte?«, erkundigte sich Daniel.
Kitteridge kniff die Augen zusammen. »Sie meinen nach seiner Ankunft hier im Lande? Wie lange liegt das denn überhaupt zurück? Der Mann muss verrückt sein!«
»Nein, nicht hier, aber auf britischem Boden, beispielsweise in der Botschaft von Washington.«
»Ist das denn wahrscheinlich?« Es war klar, dass Kitteridge nicht an eine solche Möglichkeit glaubte.
Daniel ging es nicht anders. »Ich weiß. Aber nehmen wir es einfach mal an«, ließ er nicht locker.
»Im Zusammenhang mit dem Überfall und dem Diebstahl des Anhängers? Hat er ihn überhaupt? Hat er versucht, ihn zu verhökern? Damit könnte man ihn packen.«
»Darüber ist mir nichts bekannt«, gab Daniel zu. »Ich weiß, dass er den Schmuck an sich gebracht hat, glaube aber nicht, dass jemand weiß, was er damit angestellt hat.«
»Wissen Sie genau, dass er es war?«, fragte Kitteridge und hob die Brauen, »oder hat Mr. Thorwood Ihnen das gesagt?«
Kleinlaut gab Daniel zurück: »Mein Schwager hat mir gesagt, Mr. Thorwood habe ihm mitgeteilt, dass Sidney ihn geraubt hat.«
Kitteridge sah ihn scharf an. »Ihr Schwager? Was haben Sie mir noch vorenthalten? Raus mit der Sprache – was wird hier eigentlich gespielt?«
Daniel begriff, dass er im Versuch, Kitteridge für den Fall zu interessieren, die Schwachpunkte der Angelegenheit instinktiv, wenn auch nicht mit Absicht, ausgelassen hatte. Jetzt ärgerte er sich über seine Ungeschicklichkeit. »Tut mir leid«, sagte er aufrichtig. Damit bezog er sich in erster Linie auf sein unprofessionelles Vorgehen. »Meine Schwester und ihr Mann Patrick sind zu Besuch hier. Er ist irischer Abstammung und ist Polizist in Washington.«
»Aha. Jetzt wird mir die Sache schon etwas klarer«, sagte Kitteridge kopfschüttelnd. »Und Ihr Schwager ist über den Fall empört.«
»Sind Sie es etwa nicht?«, fragte Daniel in herausforderndem Ton.
»Doch, falls es sich so verhält, wie Sie gesagt haben. Und äußerst peinlich berührt.«
»Müssen wir denn da nichts unternehmen?«
»Meiner Ansicht nach nicht. Ich wüsste nicht, was man da tun könnte«, gab Kitteridge in aufrichtig bedauerndem Ton zurück. »Es wäre mir recht, wenn ihn der diplomatische Dienst in die Wüste schickte und dafür sorgte, dass der Grund dafür öffentlich bekannt wird.«
»Mir auch«, pflichtete ihm Daniel mit Nachdruck bei. »Aber Mr. Thorwood kann ihn ohne Beweise nicht offen beschuldigen, weil ihn Sidney dann wegen Verleumdung verklagen könnte – ganz davon zu schweigen, was er der Öffentlichkeit über Rebecca mitteilen würde. Solange die Sache nicht vor Gericht kommt, wird sich die Presse hüten, darüber zu berichten.«
»Stimmt.« Kitteridge nickte. »Was wollen Sie jetzt noch von mir wissen? Mir scheint, dass Sie sich die Sache gründlich überlegt haben. Der Fall ist verzwickt. Es gibt keine Möglichkeit, den Mann hier wegen einer Straftat vor Gericht zu bringen, die er in Washington vielleicht begangen und nach der er sich der amerikanischen Justiz unter dem Deckmantel der diplomatischen Immunität entzogen hat. Vermutlich kostet ihn das aber nicht nur seine Anstellung, sondern er dürfte auch von keiner anderen Dienststelle mehr beschäftigt werden, und ganz davon abgesehen, hat er damit sein Ansehen in der Gesellschaft verspielt.«
»Von all dem wird niemand etwas erfahren, es sei denn, jemand in seiner Dienststelle hat ihm geraten, das Land zu verlassen, und unterstützt ihn weiter. Und selbst dann ist keineswegs sicher, dass er weiß, was Sidney getan hat. Womöglich hält er ihn sogar für schuldlos.«
»Diese Möglichkeit dürfen wir keinesfalls ausschließen, Pitt! Ohne handfeste Beweise kann man niemanden einer Straftat bezichtigen. So ist die Rechtslage. Nach allem, was Sie bisher gesagt haben, gibt es außer dem, was Thorwood – wenn er klug ist, nicht öffentlich – behauptet hat, keine Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten.«
Daniel, der von Kitteridge hatte wissen wollen, was er zu Patricks Plan zu sagen hatte, war jetzt unsicher. Stand er im Begriff, Verrat an Patricks Vorhaben zu begehen? Mit einem Mal erschien ihm der Gedanke, man könne Sidney wegen einer anderen Angelegenheit vor Gericht bringen und ihm dann den in Washington begangenen tätlichen Angriff und Diebstahl vorhalten, an den Haaren herbeigezogen und befremdlich.
»Pitt!«, sagte Kitteridge in scharfem Ton. »Haben Sie etwa vor, in der Sache, komme, was wolle, etwas zu unternehmen? Seien Sie kein Narr. In Ihrem Idealismus stützen Sie sich ausschließlich auf das, was Ihnen Ihr Schwager – Patrick, nicht wahr? – gesagt hat. Gibt es an dieser Geschichte überhaupt irgendetwas, was Sie genau wissen?«
»Jemima weiß Genaues. Sie ist mit Rebecca gut bekannt.«
Kitteridge wirkte jetzt etwas interessierter. »Ihre Schwester?«
»Ja. Tut mir leid, das hätte ich gleich sagen müssen.« Daniel merkte, dass er seine Sache schlecht vertrat. Es gelang ihm nicht, seine Gefühle auszuschalten. Er kannte das von Mandanten und hätte von sich selbst mehr erwartet.
Kitteridge ließ sich gegen die Rückenlehne zurücksinken. »Und Sie fürchten, Patrick könnte ebenso idealistisch sein wie Sie und … ein bisschen … nachhelfen, damit es zu einer Anklage reicht?«
Kitteridge hatte ihn durchschaut. Genau das befürchtete Daniel, war aber nicht bereit, das dem Kollegen gegenüber einzugestehen. Ebenso gut hätte er einem Wildfremden ein Familiengeheimnis anvertrauen können. Dabei hatte er in einer ganzen Reihe von Fällen mit Kitteridge zusammengearbeitet, in deren Verlauf sie Zeugen entsetzlicher Tragödien geworden und dem Bösen in vielerlei Abstufungen begegnet waren. Sie hatten Beweise für so manche Fähigkeit, für Mut und Liebe gesehen und waren durch Wechselbäder der Gefühle gegangen. Trotz allem, und obwohl er Patrick gerade erst kennengelernt hatte, fühlte er sich in dieser Angelegenheit Kitteridge gegenüber nicht wohl. »Ich glaube …«, setzte er an und verstummte sogleich.
Kitteridges Zügen war anzusehen, dass er zwischen verschiedenen Empfindungen schwankte.
»Na schön«, sagte Daniel schließlich. »Es stimmt, ich kenne ihn nicht gut. Jemima kenne ich von klein auf, aber die Menschen ändern sich, vor allem junge Frauen, wenn sie sich verlieben. Doch ganz gleich, ob Sie Patrick Glauben schenken oder nicht, kann kein Zweifel daran bestehen, dass es sich hier um ein schweres Verbrechen und eine feige Flucht vor der Verantwortung handelt.«
»Es sieht mir ganz danach aus, als ob …«, setzte Kitteridge an.
»Himmelherrgott noch mal!«, brach es ungestüm aus Daniel hervor. »Was der Mann getan hat, war in jeder Hinsicht widerlich! Er hat die junge Frau in Angst und Schrecken versetzt, ihren Vater aufgebracht und ihrer Mutter Seelenschmerz bereitet. Und für den Fall, dass Ihnen das entgangen sein sollte: Er hat auch uns – genauer gesagt, unserem Land – Schande gemacht, uns vor den Amerikanern bloßgestellt. Alle Welt wird wegen dieses Verhaltens mit Fingern auf uns zeigen.«
Kitteridge sah ihn verblüfft an und lachte dann leise in sich hinein.
Mit eisiger Stimme fragte Daniel: »Was finden Sie daran so lustig?«
»Sofern Ihre Schwester Ihnen vom Wesen her ähnlich sein sollte, würde ich sie gern kennenlernen.« Dann ließ er den Spott beiseite und erklärte kühl: »Bedauerlicherweise lässt sich nichts von alldem juristisch verwerten. Das müsste Ihnen ebenso bewusst sein wie mir. Gehen Sie also zu ihr, und machen Sie ihr das klar. Hat ihr Mann, dieser Patrick, das als Polizeibeamter etwa nicht gewusst? Washington liegt doch nicht im Wilden Westen. Soweit mir bekannt ist, geht es da für eine junge Nation sogar ziemlich zivilisiert zu.« Kitteridge machte nach wie vor eine finstere Miene.
»Schon«, räumte Daniel ein, »aber die Unterwelt von Großstädten ist nun einmal gewalttätig. London bildet da keine Ausnahme.«
»Das klingt ja furchterregend«, sagte Kitteridge. »Aber Ihrer Beschreibung nach kann man die Familie des Opfers kaum zur Unterwelt rechnen und die Angehörigen der britischen Botschaft auch nicht.«
»Sie versuchen dem Problem auszuweichen«, hielt ihm Daniel vor.
Kitteridge holte tief Luft und fragte: »Was befürchten Sie – dass Sidney, sofern er straflos davonkommt, dem Ruf unseres Landes in Washington und überall dort schadet, wo man von seiner Untat weiß, oder dass Ihr Schwager versuchen könnte, unter Umgehung des Rechtsweges zu erreichen, dass man ihn mithilfe falschen Beweismaterials hier vor Gericht zerrt, damit Sie sein Verbrechen anprangern können?«
Daniel biss sich auf die Lippe. Er fühlte sich durchschaut. »Ja, vermutlich Letzteres. Aber ich kann die Sache keinesfalls auf sich beruhen lassen.«
»Womit Sie meinen, dass Patrick das nicht kann?«
»Könnten Sie das denn?«
»Mir bleibt keine Wahl. Ich muss die Dinge hinnehmen, wie sie sind.«
Daniel stand auf. Er fühlte sich von Kitteridge, den er im Laufe der Zeit schätzen gelernt hatte und für den er beinahe freundschaftliche Gefühle empfand, enttäuscht, wenn nicht gar gekränkt. Da er nicht wusste, wie er Patrick helfen konnte, war er auf die Hilfe des Kollegen angewiesen. »Das hinzunehmen scheint Ihnen ja leichtzufallen«, sagte er kalt und verließ den Raum. Dabei wäre er fast mit Impney zusammengestoßen, der mit einem Teetablett hereinkam.
»Entschuldigung, Sir«, sagte der Kanzleivorsteher, obwohl er sich in keiner Weise etwas hatte zuschulden kommen lassen.
Das war Daniel unangenehm. Junge Anwälte, frisch aus der Ausbildung, schienen sich oft für etwas Besseres zu halten als der einfache Angestellte Impney, der, ohne Jurist zu sein, wahrscheinlich deutlich mehr von der Sache verstand als die meisten von ihnen – und mehr Anstand hatte. Zudem war er die Ergebenheit in Person.
»Es war meine Schuld«, sagte Daniel rasch. »Ich habe nicht aufgepasst. Ich war wohl in Gedanken …«
»Ein schwieriger Fall, Sir?«, erkundigte sich Impney mitfühlend. »Möchten Sie Ihren Tee vielleicht in der Bibliothek einnehmen, Sir? Möglicherweise könnte ich Sie dort auf den einen oder anderen Titel hinweisen, der Ihnen weiterhilft.« Mit einem feinen wissenden Lächeln fügte er hinzu: »Mr. Kitteridge kennt sich dort natürlich bestens aus, aber ich bin noch länger im Hause als er.« Er konnte Kitteridge gut leiden, kannte aber auch dessen mitunter kauziges Wesen – ja, zweifellos kannte er die Eigenheiten von jedem in der Kanzlei.
»Ja, vielen Dank. Ich weiß noch gar nicht, wo ich anfangen soll«, gab Daniel zurück.
»Sehr wohl, Sir.«
Zehn Minuten später saß Daniel in der großen behaglichen Bibliothek, an deren Wänden Regale mit Gerichtsentscheidungen standen, die mindestens ein Jahrhundert umfassten. Die Stille, die dort herrschte, war friedvoll und angenehm. Darüber hinaus aber hatte die Bibliothek Daniel, wie ihm schien, nichts zu bieten. Er begriff, dass er sich ziemlich schlecht benommen hatte oder zumindest plan- und ziellos vorgegangen war, was mehr oder weniger auf dasselbe hinauslief.
Die Tür öffnete sich. Kitteridge kam herein und schloss sie hinter sich. Er wirkte noch größer als sonst, ungefähr wie eine Vogelscheuche ohne das Stroh an Kopf und Armen. Seine Haare standen ihm, wie so oft, wirr um den Kopf.
»Erwartet er, dass Sie auf jeden Fall etwas unternehmen?«, fragte er unvermittelt. »Außer, dass Sie ihm aus der Patsche helfen, wenn er Schwierigkeiten bekommt?«
»Wovon reden Sie?«