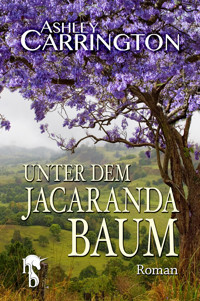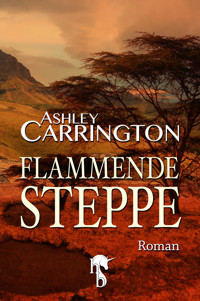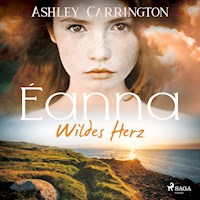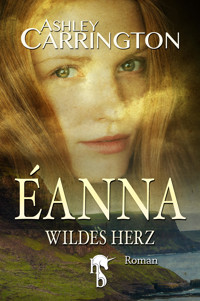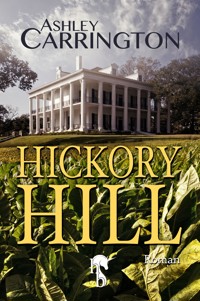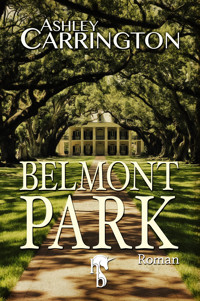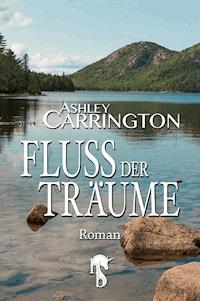
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großer Roman voll Liebe, Hass und Intrigen aus der Feder von Ashley Carrington. Daphne Davenport liegen im Boston des 19. Jahrhunderts die Söhne der vermögendsten Geschäftsleute zu Füßen, ihre Familie lebt im Wohlstand, die Zukunft scheint sorgenfrei. Bis ein heimtückischer Geschäftspartner ihres Vater die Familie in den Ruin treibt. In der Provinzstadt Bath am Kennebec Ricer versucht ihr Vater eine neue Existenz für die Familie aufzubauen. Wo ihre Mutter und ihre Schwester den vergangenen Tagen nachtrauern, nimmt Daphne ihr Leben selbst in die Hände. Sie findet neue Freunde und neue Aufgaben, doch die Vergangenheit holt sie ein und fordert unerbittlich ihren Tribut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 834
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ashley Carrington
Fluss der Träume
Roman
»Die Welt zerbricht jeden, und nachher sind die zerbrochenen Stellen stark. Aber die, die nicht zerbrechen wollen, die tötet sie.«In einem anderen LandErnest Hemingway
Teil 1: Die Debütantin
1
Es sollte die letzte warme Nacht des Jahres sein – eine Spätsommernacht, die im Buch der Erinnerungen nie zu einer unscharfen Seite verblassen, sondern für Daphne Davenport bis ans Ende aller Tage ihren einzigartigen Zauber bewahren würde.
Noch einmal hatte der scheidende Sommer über den herandrängenden Herbst obsiegt, der voll Ungeduld darauf wartete, das grüne Blätterkleid der Bäume einzufärben, die Blumen der letzten Blüten zu berauben und die Wege der Parks mit Laub zu bedecken, damit der Wind die letzten Zeugen der warmen Jahreszeit in alle Himmelsrichtungen davontrug. Ein letztes Mal wölbte sich auch ein sternenklarer, samtener Nachthimmel über Boston, ohne dass die ablandige Brise, die vom Charles River herüberwehte, den Wunsch nach einem prasselnden Kaminfeuer und daunenwarmen Bettdecken geweckt hätte.
Daphne Davenport empfand diese Nacht wie ein ganz persönliches Geschenk der Natur an sie. Ein verträumtes Lächeln lag auf ihrem Gesicht, während die Kutsche von der Tremont Hall zurück zu ihrem Elternhaus am Beacon Hill ratterte. Die Straßen waren zu dieser späten Stunde wie ausgestorben, und höchstens einmal eine Katze huschte durch den gelblichen Lichtkegel der Laternen, die dem Kutscher in den besseren Wohnvierteln der Stadt den Weg wiesen. Als sie die Beaver Street kreuzten, schaute Daphne rechter Hand aus dem Fenster. Sie erhaschte einen kurzen Blick auf den Charles River, der wie ein Strom aus flüssigem Silber den offenen Armen des Meeres entgegenfloss. Aus diesem Glitzern erhob sich die West Boston Bridge, die nach East Cambridge hinüberführte, mit ihren unzähligen stählernen Bögen und Streben wie ein filigranes Kunstwerk aus schwarzer Jade.
Eine zauberhafte Nacht, wie geschaffen, um als Debütantin beim ersten Ball in die elegante Bostoner Gesellschaft eingeführt zu werden, im Ballsaal unter funkelnden Kandelabern zu berauschenden Orchesterklängen über das Parkett zu schweben, Fruchtpunsch zu trinken, sich auf der mondbeschienenen Terrasse kokett mit dem Fächer Luft zuzufächeln, errötend die Komplimente der Verehrer entgegenzunehmen, die sich um einen scharen und sich gegenseitig in Witz und charmanter Konversation auszustechen versuchen – und um sich zu verlieben.
Alles kam ihr verzaubert vor. Hatte sie diese atemberaubend festliche, rauschende Ballnacht nicht bloß geträumt? Hatte sie wirklich mit John Singleton drei Walzer getanzt und mit David Chase auf der Terrasse geflirtet? Und war es tatsächlich Charles Parkham gewesen, der Charles Parkham, der eifersüchtig darüber gewacht hatte, dass nur er sie mit Fruchtpunsch versorgen durfte?
Daphne blickte auf die langstielige Rose in ihrer Hand. Charles Parkham hatte sie mit der Nonchalance und Selbstverständlichkeit des Sohnes schwerreicher Eltern aus einem der kunstvollen Blumengestecke in den Wandnischen der Eingangshalle zur Tremont Hall gezogen und ihr zum Abschied mit einem nicht minder blumigen Kompliment überreicht.
Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als Debütantin zu sein!, dachte Daphne selig verwirrt und hatte das Gefühl, mit ihren sechzehn Jahren ein Wunder erlebt zu haben. War das Erwachsenwerden immer solch ein atemnehmendes Wunder? Heather zumindest hatte darüber kein Wort verloren. Oder hatte sie es anders erlebt?
Außer dem gleichmäßigen Hufschlag und dem Rattern der eisenbeschlagenen Wagenräder auf dem Kopfsteinpflaster war in der Kutsche nichts zu hören. Daphnes Eltern hingen ihren eigenen Gedanken nach. Ihr Vater, William Davenport, fühlte sich auf der Tanzfläche so fehl am Platze wie ein Schmied am Tisch eines Uhrmachers. Jeder Ball kostete ihn große Überwindung und stellte geradezu ein Opfer dar. In dieser Nacht hatte er das Opfer seiner Tochter zuliebe gebracht. Jetzt machte er einen erlösten Eindruck und überließ sich willig der wohlverdienten Müdigkeit. Die Augen ihrer Mutter Sophie dagegen blickten klar und hellwach; sie waren voll unverhohlener Selbstzufriedenheit. Das Lächeln auf ihrem Gesicht zeugte vom Stolz, ja Triumph einer Frau, der die Anerkennung durch die vornehme Gesellschaft seit Jahrzehnten das höchste Lebensziel war. An diesem Abend hatte sie erleben dürfen, wie ihre Tochter in diesen Kreisen von altem Geld und uraltem Bostoner Namensadel mit einem einzigen Lächeln das erreicht hatte, was sie selbst sich nur schwerlich mit Geld erkaufen konnte – nämlich mit offenen Armen aufgenommen und als zugehörig betrachtet zu werden. Ihre Tochter Daphne hatte es auf ihrem Debütantinnenball geschafft! Sie hatte die Herzen der jungen ledigen Männer aus den besten Familien der Stadt im Sturm erobert und gleichzeitig das Wohlwollen derer Eltern gewonnen, was fast noch wichtiger war. Und das bedeutete, dass auch die zwei Jahre ältere Schwester Heather endlich Zugang zu diesen Kreisen erhalten würde. Es wurde auch Zeit. Immerhin wurde Sophies Älteste im nächsten Frühling schon neunzehn. In dem Alter war sie selbst schon ein gutes Jahr verheiratet gewesen. Ja, es war an der Zeit, dass Heather unter die Haube kam – natürlich unter eine, die ihr in Boston Rang und Namen garantierte. Aber das würde jetzt nicht mehr so viele Schwierigkeiten bereiten wie noch vor ein paar Jahren, als ihnen diese Kreise gesellschaftlich verschlossen gewesen waren. Wenn die Söhne der Parkhams und Singletons bei ihnen verkehrten, würde man auch sie und ihren Mann endlich mit dem gebührenden Respekt zur Kenntnis nehmen und bei Einladungen berücksichtigen, wie es ihnen ihrer Meinung nach schon lange zustand – und wie sie es sich immer erträumt hatte. Es war ein langer, beschwerlicher Weg gewesen, von der schäbigen London Street in East Boston über Charlestown und Dorchester Hights in die Byron Street auf der vornehmen Südseite des Beacon Hill. Doch nun hatten sie es geschafft, sie alle. Von nun an würde der Name Davenport in Boston einen neuen, gewichtigen Klang haben.
2
Edward hatte die Rückkehr seiner Lieblingsschwester von ihrem Debütantinnenball, einem Ereignis, das den Haushalt in der Byron Street schon seit Wochen in Atem hielt, auf keinen Fall verschlafen wollen. Deshalb hatte er das Fenster seines kleinen Zimmers, das zur Straße hinausging, weit offen stehen lassen und versucht, wach zu bleiben. Tapfer, aber vergeblich hatte er gegen die Schläfrigkeit angekämpft. Lange vor Mitternacht waren dem Elfjährigen die Lider zugefallen und der Abenteuerroman aus den Händen gerutscht. Doch wenn er im Traum auch an einer gefährlichen Tigerjagd in Indien teilnahm, so wachte sein Unterbewusstsein dennoch darüber, dass er Daphnes Rückkehr nicht verpasste.
Als in der nächtlichen Stille Hufschlag und Kutschengeratter laut wurden, wachte Edward augenblicklich auf. Verschlafen und noch halb in der Welt seines Traumes, richtete er sich auf. Daphnes Kutsche!, schoss es ihm durch den Kopf.
Plötzlich war er gar nicht mehr schläfrig. Er schleuderte die Decke zur Seite, sprang aus dem Bett und war mit einem Satz am Fenster, wo sich die Gardinen im Wind bewegten. Weit beugte er sich in die milde Septembernacht hinaus und sah, wie eine Kutsche oben an der Ecke bei Eddie Burdicks Mietstall in die Byron Street einbog. Das konnte nur die Kutsche mit Daphne und seinen Eltern sein! Die dunkelgrün lackierte Droschke mit den beiden brennenden Kutscherlampen machte auch tatsächlich vor dem Portal von Byron Street Nummer vierzehn halt.
Edward machte sich erst gar nicht die Mühe, nach seinen Hausschuhen zu suchen. Barfuß stürzte er hinaus auf den Flur des Obergeschosses, rannte an der mit kunstvollen Blumeneinlegearbeiten verzierten Ebsworth-Standuhr vorbei, deren Zeiger auf zehn nach eins standen, und riss die Tür zu Heathers Zimmer auf, stürmisch und ohne vorher angeklopft zu haben. Unten in der Halle hörte man Stimmen und die hohen, bewundernden Ausrufe von Fanny Dunn, dem pummeligen Hausmädchen, das so alt war wie Daphne, aber viel jünger aussah und ständig rot anlief.
»Heather …! Daphne ist zurück …! Heather! Wach auf!«, rief Edward aufgeregt.
»Was ist denn?«, kam es schläfrig und reichlich unwillig aus der Dunkelheit des Zimmers.
»Daphne ist zurück!«
»Na und?«, fragte Heather mürrisch, setzte sich jedoch geräuschvoll im Bett auf.
»Mein Gott, sie kommt von ihrem Debütantinnenball! Sie wird eine Menge zu erzählen haben.«
»Nichts, was nicht auch noch bis morgen früh warten könnte«, murrte seine Schwester.
»Heather, das ist gemein. Als du deinen Ball hattest, haben wir auch auf dich gewartet, weißt du noch?«
»Ich hatte überhaupt keinen richtigen Debütantinnenball«, erwiderte Heather verdrossen.
»Na klar hattest du den!«
»Aber nicht in der Tremont Hall. Und nicht in einem Seidenkleid von Madame Fortescue.«
Edward verstand nicht, was das für einen Unterschied machte. »Wo man als Mädchen seinen ersten großen Ball hat und in was für einem Seidenkleid, ist doch ganz egal.«
»Von wegen!« Es klang ernstlich ärgerlich. »Aber was verstehst du Dreikäsehoch schon davon!«
Edward wollte sich nicht ausgerechnet jetzt mit ihr zanken, deshalb nahm er den Dreikäsehoch widerspruchslos hin. »Kommst du nun, oder schläfst du weiter?«
»Mach die Tür zu, ich komm’ schon, Waddy – wo ich nun schon mal wach bin«, seufzte Heather.
Edward zog die Tür hinter sich zu und lief zum Treppenabsatz. Dort blieb er stehen, kauerte sich vor das handgeschnitzte Geländer und blickte zwischen den Stäben in die Halle hinunter. Während sein Vater offenbar noch den Kutscher entlohnte, legten seine Mutter und Daphne ihren Umhang ab. Neben ihnen sah Fanny in ihrem schlichten taubengrauen Kleid und der schneeweißen Schürze absolut unscheinbar aus. Vor Aufregung und Bewunderung war sie im Gesicht so rot wie eine reife Tomate angelaufen. Edward interessierte sich gewöhnlich nicht für Mode, Frisuren und all den anderen, in seinen Augen lächerlichen Schnickschnack, den seine Mutter, seine Schwestern und auch die weiblichen Hausangestellten für so wichtig und unverzichtbar hielten. Es überstieg sein Begriffsvermögen, dass man sich wochenlang die Köpfe darüber heiß reden konnte, welcher Stoff und welcher Schnitt für ein Ballkleid zu wählen waren, und er glaubte auch nicht, als erwachsener Mann einmal mehr Verständnis dafür aufbringen zu können, dass offenbar ganze Stöße von Modemagazinen vonnöten waren, um aus den kolorierten Abbildungen von Godey’s Lady’s Book, Peterson’s Magazine oder Frank Leslie’s Lady’s Magazine and Gazette of Fashion die zu diesem Kleid passende Frisur zu finden. Seine Welt war die der Bücher, die der Entdeckungen, Erforschungen und Abenteuerreisen eines Odysseus, Marco Polo oder James Cook.
Wenn er auch nichts um derlei Weiberkram gab, so war er doch sehr wohl in der Lage, das Ergebnis wochenlanger modischer Beratungen mit kritischem Blick zu würdigen. Als Bruder von zwei älteren Schwestern war er in dieser Hinsicht durch eine langjährige harte Schule gegangen, und bei allem prinzipiellen Desinteresse hatte er in dieser Zeit zwangsläufig doch genug mitbekommen, um ein für sein Alter recht sicheres Urteil abgeben zu können. Und diesmal war die Garderobe seiner Mutter und seiner Schwester auch einer ganz besonderen Würdigung wert.
Mit einem stolzen Lächeln hockte er vor dem Treppengeländer und fand, dass seine Mom in dem Kleid aus dunkelrotem Atlas wirklich etwas hermachte. Es kaschierte sehr geschickt ihre korpulente Figur, und der tiefe Ausschnitt, der für ihr Alter vielleicht eine Spur weniger offenherzig hätte sein können, betonte den üppigen Busen, über dem ein Rubinkollier prangte. Nur für den vielen Puder und die Schminke hatte er nichts übrig. Aber diese Kritik wagte er sich seiner Mutter gegenüber nur in Gedanken herauszunehmen.
Was nun Daphne betraf, so war seine Brust von geradezu grenzenloser Bruderliebe und Bewunderung erfüllt. Er hing an seiner Mutter, hegte großen Respekt für seinen kräftigen, bärtigen Vater und wollte Heather bestimmt nicht missen, auch wenn sie ihn oft wie eine Gouvernante herumkommandierte und einen unangenehmen Hang zur Launenhaftigkeit besaß – doch Daphne war der strahlende Stern seines Lebens, der in seinen Augen alles und jeden in der Welt, die er kannte, überstrahlte.
Wie eine Prinzessin sah sie in dem perlweißen Seidenkleid mit den fliederfarbenen Paspelierungen und den gerüschten Puffärmeln aus. Ihre schlanke, makellos proportionierte Figur bedurfte keines enggeschnürten Korsetts, um dem geltenden Schönheitsideal zu entsprechen. Die Natur hatte sie zudem mit einem Gesicht beschenkt, in dem die rauchblauen Augen unter langen schwarzen Wimpern, ein schöner voller Mund und zarte, liebliche Züge besonders auffielen, aber auch eine energische Kinnpartie, die zweifellos das Erbe ihres Vaters war. Es war jedoch die einzigartige schwarze Haarpracht, die Edward an seiner Schwester mehr als alles andere bewunderte. Je nachdem, wie sich das Licht in ihrem Haar fing, schimmerte es in einem schwarzblauen Ton, wie er ihn bisher noch bei niemandem gesehen hatte, ein Ton, als würde man den sternenübersäten Nachthimmel zu einer unvergleichlich schwarzen Farbe einkochen – so hatte er es sich immer vorgestellt, als er noch ein kleines Kind gewesen war und sie an seinem Bett gesessen und ihm beim Licht der Nachttischlampe etwas vorgelesen hatte.
Daphne trug an diesem Abend ihr Haar bis auf einige kleine Locken über der Stirn und an den Schläfen nach hinten gekämmt und im Nacken zu drei Zöpfen geflochten, die dort eine Herzform bildeten und von einer fliederfarbenen Samtschleife zusammengehalten wurden. Zarte Fliederschleifen mit zugeschnittenen Bänderenden, die aus der Entfernung echten Blüten ähnelten, schmückten am Hinterkopf, vorn und über den Ohren ihr volles Haar. Eine einzelne dicke Haarsträhne, zu einer langen Korkenzieherlocke gedreht, fiel ihr seitlich vom Zopfherz her über die nackte linke Schulter.
Edwina Ferguson, die langjährige, altjüngferliche Zofe ihrer Mutter, hatte ihr für den Debütantinnenball die Haare aufgedreht und gesteckt, obwohl das die Aufgabe von Prudence gewesen wäre. Doch wie geschickt und lernfähig Pru auch mit Kamm und Brennschere sein mochte, so verblassten ihre Künste doch gegen die von Edwina, die seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr als Zofe arbeitete, und das waren immerhin schon über siebzehn Jahre, davon zehn im Hause Davenport.
Daphne und Heather teilten sich Prudence Willard, eine hagere, blassgesichtige Neunzehnjährige, als Zofe. Sie stand erst seit dem Umzug in die Byron Street vor nicht ganz einem Jahr in den Diensten der Davenports und hatte auch noch andere Aufgaben im Haushalt zu erledigen. Nur zu gern hatte sie Edwina die Verantwortung für die Ballfrisur der jungen Miss überlassen, und sie war bescheiden genug gewesen, neidlos anzuerkennen, dass Edwina mit traumwandlerischer Fingerfertigkeit ein kleines Kunstwerk vollbracht hatte.
Edward achtete nicht auf die Stimmen, die aus der Halle zu ihm hochdrangen. Sein Blick ruhte voll unschuldiger Bewunderung auf seiner Schwester, die auf eine Bemerkung ihrer Mutter hin hell auflachte und dann mit einem leisen Jauchzer um ihre eigene Achse wirbelte, die Rose an ihre Brust gepresst. Die Seide ihres Kleides raschelte, und die vielen gestärkten Unterröcke blitzten unter dem Saum hervor. Wenn sie so ausgelassen war, dann musste der Ball ein voller Erfolg gewesen sein, ging es ihm durch den Sinn, und er freute sich für sie. Ihr Vater trat durch die Tür, die hinter ihm zufiel, während sich die Kutsche vor dem Haus wieder in Bewegung setzte. Er war ein breitschultriger Mann von mittelgroßer, fast kantiger Statur, die jedem noch so guten Maßschneider Schwierigkeiten bereitet hätte, sie selbst im teuersten Abendanzug halbwegs elegant erscheinen zu lassen. Der Frack saß tadellos, was auch auf die weiße Hemdbrust zutraf. Und dennoch machte er den Eindruck, als trüge er eine teure Zwangsjacke, deren er sich nicht schnell genug entledigen konnte – was auch genau seinem Empfinden entsprach.
William Davenport war zum Leidwesen seiner Frau kein Mann für elegante Abendgesellschaften, und er wusste das sehr wohl, ohne dass er es als einen bedauerlichen Umstand gewertet hätte. Er hielt lieber einen schweren Bierkrug in seiner großen, muskulösen Hand als den Stiel eines kristallenen Champagnerkelches. Er konnte und wollte seine Herkunft nicht verleugnen und war, was er war: ein Mann wie ein massiver Klotz; solide, beständig und trotz tadelloser Umgangsformen eben doch mit harten Ecken und Kanten. Allein das Grau, das Haupthaar und gepflegten Backenbart des Achtundvierzigjährigen erstaunlich dicht durchzog, verlieh seinem kräftigen, markanten Gesicht eine Spur jenes weltmännischen Aussehens und jener geschäftsmännisch seriösen Ausstrahlung, die seine Frau an anderen Männern so sehr bewunderte.
»Ich denke, es wird Zeit, dass du nach oben und allmählich ins Bett kommst, mein Schatz«, sagte William Davenport zu seiner Tochter, schlüpfte aus der Frackjacke und lockerte die Hosenträger. Seine Frau warf ihm einen missbilligenden Blick zu, unterließ aber jeden Kommentar. Dabei verabscheute sie diese Hemdsärmeligkeiten ihres Mannes, ganz besonders vor dem Personal, dessen große Leidenschaft der Klatsch über die Herrschaft war, wie doch jedermann wusste.
William gab nichts auf den ungehaltenen Blick seiner Frau. Der Teufel sollte ihn holen, wenn er auch noch in seinem eigenen Haus Theater spielen musste! »Es war für uns alle eine aufregende und anstrengende Nacht. Du wirst müde sein«, sagte er und konnte es nicht erwarten, aus den engen, schwarzen Lackschuhen zu kommen. Was tat sich der Mensch nicht alles selber an!
Daphne lachte. »Müde? Ich fühle mich frisch wie Morgentau, Dad«, übertrieb sie.
»Warum trinken wir nicht noch ein Glas Champagner zusammen und feiern Daphnes Erfolg?«, schlug Sophie vor, die den erregenden Geschmack des Triumphes möglichst lange auskosten wollte.
»O ja!«, rief Daphne begeistert. Der Fruchtpunsch war sehr gut gewesen, aber wohl nichts gegen ein Glas perlenden Champagners.
William schien von dem Vorschlag seiner Frau wenig angetan. Er runzelte die schwarzen, buschigen Augenbrauen, in die sich ebenfalls schon das erste Grau schlich. »Ich hab’ diese Nacht genug von diesem süßen, klebrigen Sprudelwasser getrunken, um für die ganze Woche aufstoßen zu können«, wehrte er ab.
Sophie wand sich förmlich unter seinen Worten, die so gar nicht zu der feinen Lebensart passten, die sie in ihrem Haus um jeden Preis gewahrt wissen wollte. »William, bitte!«, ermahnte sie ihn zu einer weniger derben Ausdrucksweise.
»Du weißt«, erwiderte er unbeeindruckt, »dass ich mir aus dem angeblich so noblen Getränk wenig mache. Ich wünschte vielmehr, sie hätten heute Abend zumindest einen anständigen Whiskey angeboten. Die Männer, die ihren eigenen Flachmann in der Tasche hatten, waren wirklich zu beneiden«, sagte er ehrlich und zwinkerte dabei der pummeligen Fanny zu, der das Blut sofort wieder ins Gesicht schoss.
»Aber zur Feier des Tages«, setzte Sophie wieder an.
William verzog das Gesicht. »Ich wüsste nicht, was es da zu feiern gäbe«, brummte er.
Daphne machte ein betroffenes Gesicht.
»Sie war der Erfolg des Balls!«, protestierte Sophie, in ihrem Stolz verletzt.
Er lächelte. »Sicher war sie das! Ich habe auch nicht einen Moment daran gezweifelt, dass sie alle diese blasierten und blutarmen Geschöpfe in den Schatten stellen würde.«
Daphnes Gesicht hellte sich wieder auf. Eigentlich hätte sie sich denken können, dass seine scheinbar abwertende Bemerkung in Wirklichkeit das genaue Gegenteil bedeutete.
William legte seinen Arm um ihre Schulter und drückte sie an sich. Es war eine etwas unbeholfene Geste, doch es lagen tiefe, vorbehaltlose Zärtlichkeit und Vaterliebe in ihr, die Daphne fast die Tränen in die Augen trieben. »Dass ein paar Dutzend junge Gecken und herausgeputzte Stutzer aus den besseren Kreisen meine Tochter wie Motten das Licht umschwärmt und sich zum Narren gemacht haben, ist für mich nicht Grund genug zum Feiern. Diese jungen Burschen haben nur bestätigt, was wir schon lange wissen – dass mein Augapfel hier nämlich etwas ganz Besonderes ist.«
»Dad!« Es machte Daphne verlegen, wenn ihr Vater so etwas sagte, weil sie das Gefühl hatte, es nicht verdient zu haben und dass er Edward und Heather damit unrecht tat.
»Und daran hätte sich auch nichts geändert«, fuhr William ungerührt fort, »wenn diese eleganten jungen Herren mit Blindheit geschlagen gewesen wären und Daphne heute kein Erfolg gewesen wäre, wie du es nennst.« Er betonte das Wort »Erfolg« und verdrehte dabei die Augen, um zu unterstreichen, wie sehr ihm diese Art der Einschätzung gegen den Strich ging.
»Du weißt schon, wie ich es gemeint habe«, erwiderte Sophie säuerlich. Er wusste in der Tat sehr gut, was sie hatte feiern wollen – nämlich den gesellschaftlichen Erfolg, die Anerkennung und das spürbare Wohlwollen. Gut, das alles mochte ihnen nützlich sein und in Zukunft beachtliche Vorteile bringen: für ihn selbst geschäftlich, für Daphne als angehende Ehekandidatin und für Sophie gesellschaftlich. Aber stärker als diese Genugtuung empfand er den alten Groll auf diese feinen Ladies und Gentlemen, deren freundliche Zuwendung seiner Frau so viel bedeutete. Denn tief in seinem Herzen sah er in der Tatsache, dass man sich nun gnädig dazu herabließ, ihn und seine Familie in diesen elitären Zirkeln nicht mehr wie einen Fremdkörper zu behandeln, eine andere Form der Beleidigung: Man ließ sie spüren, dass sie, die Emporkömmlinge, keinen wirklichen Anspruch auf solche Gunst besaßen, sondern dass diese nur gnädigerweise wie ein Ritterschlag erteilt wurde. Doch er hatte noch nie in seinem Leben vor jemandem gekniet, nicht einmal in Gedanken. Nein, einen Grund zum Feiern sah er wirklich nicht. Schon aus Prinzip würde er darauf keine Flasche Champagner öffnen!
»Und ich meine, dass es für das Kind Zeit ist, ins Bett zu gehen«, sagte er nun in einem Tonfall, der keinen Widerspruch zuließ. Er war müde und wollte nach der Strapaze des lärmenden Festes, das ihm stundenlanges Lächeln und unentwegt nichtssagendes Geplauder abverlangt hatte, allein sein. »Sie ist Debütantin, gewiss die schönste von ganz Boston, aber noch längst keine erwachsene Frau, die die Nächte bei Champagner durchfeiern kann.«
Daphne strahlte. »Danke, Dad … für alles!« Sie musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um ihm einen Kuss auf die Wange zu geben.
Er verbarg seine Rührung. »Nun mach schon, dass du nach oben kommst! Ich schätze, ich habe mich heute lange genug gequält, um mir nun einen ordentlichen Brandy als Schlummertrunk genehmigen zu dürfen«, brummte er, halb an seine Frau gewandt, und verschwand in Richtung Arbeitszimmer.
Sophie seufzte. Aber sie durfte nicht ungerecht sein. William hatte sich auf dem Ball wahrlich nicht vor seiner Pflicht gedrückt. Kein einziges Mal hatte er sich anmerken lassen, dass ihm dieses glanzvolle gesellschaftliche Ereignis ein Graus und eine Qual war, ja, er hatte sich sogar zu manch geistreicher Bemerkung aufgeschwungen. Es bestand also kein Grund, sich zu beklagen.
»Mach die Lampen hier unten aus, und geh dann zu Bett!«, sagte sie zu Fanny und machte sich auf den Weg in ihr Zimmer, wo Edwina auf sie warten würde, um ihr beim Entkleiden und Ausbürsten ihrer Haare zur Hand zu gehen.
Daphne hatte indessen ihr Kleid gerafft und war schon die Treppe hochgeeilt. Als sie ihren kleinen Bruder sah, lachte sie über das ganze Gesicht. Er war ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten und hatte genau wie Heather auch ihr dunkelbraunes Haar geerbt. Im langen, bunten Karonachthemd und mit erwartungsvoller Miene wartete er auf sie.
»Waddy!« Das war sein Kosenamen, den aber nur sie und Heather benutzen durften – und auch nur dann, wenn sie unter sich waren. »Sag bloß, du bist bis jetzt aufgeblieben!«
Er griente. »Na ja, nicht ganz. Bin zwischendurch schon mal eingeschlafen. Aber ich habe gesehen, wie die Kutsche vorgefahren ist. Und ich habe gehört, was Mom und Dad gerade gesagt haben. Dad hat recht. War doch klar, dass du alle anderen ausstechen würdest«, sprudelte er stolz hervor. »Hast du schon einen Heiratsantrag bekommen?«
Daphne lachte und fuhr ihm durch seinen wirren Haarschopf. »So schnell geht das nun auch wieder nicht. Und so wild bin ich auf einen Heiratsantrag gar nicht.«
»Aber es war toll, ja?«, fragte er begierig.
»Himmlisch!«, versicherte sie, und das glückliche Leuchten ihrer Augen verriet mehr als tausend Worte.
Heather lehnte am Türrahmen ihres Zimmers. Sie hatte einen malvenfarbenen Morgenmantel übergezogen und gähnte unverhohlen. Wer die beiden nicht kannte, hätte es nicht für möglich gehalten, dass sie und Daphne Schwestern waren, denn sie ähnelten einander überhaupt nicht. Das Einzige, was sie gemein hatten, war die schlanke Gestalt. Die Natur hatte über Heather nicht gerade das Füllhorn ausgeschüttet, sondern eher das Mittelmaß angelegt. Ihr Haar war von einem ansprechenden, aber nicht außergewöhnlichen Braun. Das schmale Gesicht mit den prägnanten Wangenknochen hätte ausgesprochen interessant aussehen können, wenn die Nase nicht so stark ausgeprägt und der Mund dafür ein wenig voller gewesen wären. Auch ihre Brüste, die sie mit einer Hand umschließen konnte, hätten stärker entwickelt sein können. Nicht, dass sie hässlich gewesen wäre, davon war sie weit entfernt. Ihre Haut war rein, der Wuchs der Zähne schön und die Augenform apart, so dass sie – im Ganzen gesehen – eine angenehme Erscheinung bot. Nur, was war das für ein schwacher Trost neben der bestrickenden Schönheit ihrer jüngeren Schwester?
»Na, ist dir heute der edle Ritter in der schimmernden Rüstung zu Füßen gesunken?«, fragte sie gedehnt und mit einem Blick auf die Rose.
»Ach, Heather, wenn du nur heute Abend dabei gewesen wärst! Ich bin mir am Anfang so verloren und hilflos vorgekommen.«
»Dir sind doch bestimmt mehr Männer hilfreich zur Seite geeilt, als du für eine Ballnacht auf deiner Tanzkarte unterbringen konntest«, meinte Heather spöttisch und mit einem Anflug von Neid.
Daphne war noch viel zu aufgewühlt und erfüllt von den aufregenden Erlebnissen ihres Debüts in der Gesellschaft, als dass sie den neidvollen Ton aus der Bemerkung ihrer Schwester herausgehört hätte. Sie nickte mit strahlenden Augen. »Es war unglaublich! Meine Tanzkarte war im Handumdrehen voll, ohne dass ich wusste, wer all die jungen Männer waren, denen ich einen Tanz reservieren musste.«
Prudence Willard tauchte im Flur auf, korrekt angezogen, doch sichtlich verschlafen. »Möchten Sie, dass ich Ihnen beim Auskleiden helfe, Miss Daphne?«, fragte sie höflich.
Daphne zögerte. Sie verstand sich gut mit Pru, wollte aber jetzt lieber mit ihren Geschwistern allein sein. Deshalb sah sie Heather an und fragte: »Würdest du das heute machen?«
Heather zuckte die Achseln. »Sicher, wenn es nicht zur Gewohnheit wird.«
Prudence war froh, dass sie sich wieder in ihre Kammer unter dem Dach zurückziehen und noch ein paar Stunden Schlaf finden konnte, bevor die Nacht herum war und sie kurz nach sechs aus den Federn musste. Sie deutete einen Knicks an und huschte davon. Heather und Edward folgten Daphne in ihr Zimmer, das ganz in Lindgrün und Apricot gehalten war. Während Edward eine der Porzellanlampen anzündete, trat Daphne hinter den mit Blumen bestickten Wandschirm, der neben dem Waschtisch stand, und ließ sich von ihrer Schwester das kostbare Seidenkleid im Rücken aufknöpfen. Heather wollte nun ganz genau wissen, wie es in der Tremont Hall gewesen war. Daphne musste ihr die Räumlichkeiten und die Terrasse beschreiben. Sie fragte auch nach den Dekorationen, dem Blumenschmuck und dem Orchester. Doch was sie mehr als alles andere interessierte und mit Neugier erfüllte, war, wer alles den Ball besucht, mit wem Daphne gesprochen und wer sie zum Tanz aufgefordert hatte.
»Mom meint, alles, was in Boston Rang und Namen hat, habe sich heute dort ein Stelldichein gegeben«, berichtete Daphne bereitwillig. »Du hättest die Garderoben sehen sollen, Heather! Schönere und teurere habe ich noch in keinem Journal gesehen.«
»War Lucy Winthroph auch da?«, wollte ihre Schwester wissen. »Du weißt doch, die lange Dürre aus der Chestnut Street.«
Daphne lachte. »O ja, die auch.«
»Warum lachst du?«, wollte Edward wissen, der es sich auf dem Bett bequem gemacht hatte.
»Weil sie ein schreckliches Kleid getragen hat. Bestimmt ist es sündhaft teuer gewesen, denn Ausschnitt und Armel waren mit Perlen bestickt, aber statt einen Schnitt mit hochgeschlossenem Oberteil zu wählen, hat sie ihre nackten knochigen Schultern gezeigt. Wie ein Storch hat sie darin ausgesehen – und so hoch hat sie auch den Kopf getragen.«
Heather und Edward lachten mit ihr, und das geschwisterliche Lachen gab ihr das wunderbare Gefühl, dass sie zusammengehörten und auch zukünftig so unverbrüchlich zusammenhalten würden. Wie unterschiedlich sie auch sein mochten und wie groß der Altersunterschied zwischen ihnen auch war, sie mussten zusammenhalten, auch wenn sie sich gelegentlich mal stritten. Leider hatte sie dieses Gefühl des geschwisterlichen Gleichklangs und inneren Zusammenhalts bei Heather in letzter Zeit häufig vermisst. Doch sie verdrängte diesen schmerzlichen Gedanken schnell wieder. »Die kleine, dicke Martha Rawley aus der Mount Vernon Street hat es da schon geschickter angestellt«, fuhr Daphne in ihrem fröhlichen Bericht fort, während sie aus den vielen Unterröcken stieg, bis sie nur noch in Leibchen und knielanger, spitzengesäumter Unterhose aus Batist hinter dem Paravent stand. Heather löste ihr nun die Schleifen aus dem Haar. »Sie trug einen Traum von einem Taftkleid, das sie glatt fünfzehn Pfund schlanker aussehen ließ. Und die Haare hatte sie hochgesteckt, zum schiefen Turm von Pisa, so dass sie auch gleich ein gutes Stück größer wirkte. Waddy, wirfst du mir mal mein Nachthemd rüber?«
»Klar doch!«
Sie schüttelte ihr Haar, dass sich die Zöpfe zu öffnen begannen. Auf das Ausbürsten würde sie verzichten. Das konnte Pru am Morgen nachholen.
»Martha Rawley!« Heather verzog das Gesicht. »Ich glaube, mit der könnte ich nie warm werden. Die trägt die Nase so hoch, als wäre sie etwas ganz Besonderes, nur weil irgendwelche blöden Vorfahren von ihr zu den ersten Siedlern hier in Boston gehört haben. Und dabei war dieser Urahn nur ein einfacher Zimmermann! Nein, Martha ist mir zu eingebildet, genau wie Lucy der Storch.«
Edward kicherte und fühlte sich rundum glücklich, dass seine älteren Schwestern ihn bei sich duldeten und ihn sogar in ihr vertrautes Gespräch miteinbezogen.
»Aber sie ist nicht so schlimm wie Harriet Corning«, meinte Daphne, schlüpfte aus ihrer Unterwäsche und zog das Nachthemd über den Kopf. Sie band die dunkelroten Satinbänder unter der hohen und schon sehr weiblichen Brust zu einer lockeren Schleife. »Die hat mich nicht einmal begrüßt. Wie Luft hat sie mich behandelt.«
»Die hält sich wirklich für was Besseres! Dabei ist sie eine ganz dumme Gans«, sagte Heather verächtlich.
»Aber als John Singleton immer wieder mit mir getanzt hat und Charles Parkham kaum von meiner Seite gewichen ist, kam sie auf einmal an und war ganz zuckersüß«, erzählte Daphne nicht ohne Genugtuung. »Da tat sie auf einmal so, als wären wir schon seit Langem die besten Freundinnen. Du wirst es nicht glauben, aber sie hat mich doch tatsächlich zu sich nach Hause eingeladen, die falsche Ziege.«
Heather machte große Augen. »Stimmt das?«, fragte sie ungläubig.
»Ja, ich soll am Montag kommen, aber ich habe noch nicht fest zugesagt. Eigentlich mag ich nicht. Aber andererseits könnte es schon recht lustig werden zu sehen, wie sie sich plötzlich verrenkt und auf Freundschaft …«
Heather schüttelte den Kopf und fiel ihr in die Rede. Harriet interessierte sie nur am Rande. »Nein, das meinte ich nicht. Hast du wirklich mit John Singleton und Charles Parkham getanzt? Bist du dir sicher, dass sie es waren?«
Daphne lächelte. »Und ob ich mir sicher bin. Schau doch auf meine Tanzkarte! Mit John habe ich sogar drei Walzer getanzt.«
»Und auch mit Charles Parkham?«, vergewisserte sich Heather noch einmal, als könne sie es noch immer nicht fassen. »Dem einzigen Sohn des Besitzers von Parkham Steel?«
Daphne nickte. »Ja, mit dem Parkham. Aber er tanzt ganz miserabel, das kann ich dir sagen. Es hat mich einige Mühe gekostet zu lächeln, während er mehr auf meinen Zehen als auf dem Parkett herumgetanzt ist. Ich war richtig froh, dass auf meiner Tanzkarte kein Platz mehr für eine weitere Partie mit ihm war.«
Heather stöhnte auf. »Blaue Zehen! Himmel, das hätte ich an deiner Stelle ohne mit der Wimper zu zucken in Kauf genommen – und mehr! Charles Parkham ist einer der begehrtesten Junggesellen von ganz Massachusetts«, erinnerte sie ihre jüngere Schwester, völlig verständnislos, dass man so einen kapitalen Fang freiwillig vom Haken ließ. »Für ihn hättest du jede andere Tanzreservierung getrost vergessen können! Wer sich Charles Parkham angelt, hat ausgesorgt. Ein Mann wie er ist der Schlüssel zu einer goldenen Zukunft, ach, was rede ich da: zu einer diamantenen!«
Daphne griff nach ihrem Morgenmantel, zog ihn an und kam nun hinter dem Paravent hervor. Ausgelassen sprang sie zu ihrem Bruder aufs Bett und setzte sich im Schneidersitz auf die Decke. Hätte Mom sie so gesehen, hätte sie ihr gleich eine Strafpredigt gehalten, wie unschicklich so eine Position für eine junge Dame sei.
»Das mag ja sein, aber er ist nicht halb so nett wie David Chase und John Singleton. Außerdem ist er viel zu alt, schon achtundzwanzig, glaube ich«, tat sie den Parkham-Sohn ab. »John dagegen ist fünf Jahre jünger.«
»Du hast Nerven! Ich würde ihn noch mit Kusshand nehmen, wenn er schon vierzig wäre und dazu drei Brüder hätte, mit denen er sich das Vermögen seines Vaters teilen müsste«, meinte Heather.
»Ganz schön berechnend, Schwesterherz«, warf Edward ein und stichelte: »Wo bleibt denn da die Liebe?«
»Du hältst dich da besser heraus, Waddy!«, beschied Heather ihn von oben herab und ganz die ältere Schwester. »Von solchen Dingen verstehst du nichts. Du wirst schon noch früh genug dahinterkommen, dass eine schöne Mitgift nicht gerade ein Heiratshindernis ist.« Heather wandte sich wieder Daphne zu. »Sag mal, hat Charles angedeutet, dass er dich besuchen kommen will?«
»Ja, schon …«
»Du Glückspilz! Mein Gott, wenn ich Amy davon erzähle, wird sie vor Neid zerplatzen«, rief Heather und sah selbst nicht gerade neidlos aus.
»Aber Charles interessiert mich nicht. Gut, er ist charmant und sieht auch nicht schlecht aus, doch irgendwie weiß ich nichts mit ihm zu reden. Meist führt ja auch er das Wort. Mit John und David habe ich mich dagegen richtig gut unterhalten, ganz besonders mit John.«
»John Singleton ist auch keine üble Wahl«, räumte Heather ein. »Sein Vater besitzt mehr Textilfabriken als dieses Haus Zimmer. Und er hat nur eine Schwester.« Sie neigte den Kopf ein wenig und musterte Daphne eindringlich. »Hast du dich vielleicht in ihn verliebt?«
Daphne konnte nichts dagegen tun, dass eine leichte Röte der Verlegenheit ihre Wangen überzog. »Ich weiß es nicht … es kann sein … Vielleicht ein bisschen … Ich mag ihn, aber ob ich mich verliebt habe …«, stammelte sie, von Heathers direkter Frage überrumpelt. »Wir waren ja kaum mal allein bei diesem Trubel, aber nett ist er schon … und er sieht auch gut aus. Er hat einen kleinen Schnurrbart, der ihn ganz verwegen aussehen lässt, und …« Sie brach ab, als ihr bewusst wurde, was ihr da alles über die Lippen sprudelte. Ihr brannten die Wangen vor Verlegenheit.
»Du hast dich verliebt!«, stellte Heather nachdrücklich fest.
Edward grinste und sagte: »Na, das kann ja was geben, wenn die jungen Singletons, Chases und Parkhams sich bei uns bald die Klinke in die Hand geben. Mom ist bestimmt ganz aus dem Häuschen und kann es gar nicht erwarten, dass sie ihr die Aufwartung und dir den Hof machen. Aber warum sollst du dich auch nicht verlieben? Heather hat sich doch schon ein dutzendmal verliebt. Und wenn du diesen John Singleton magst, mag ich ihn bestimmt auch, Daphne.«
Sie schenkte ihm ein warmes, dankbares Lächeln.
Heather atmete tief und laut hörbar durch. »Mein Gott, was beneide ich dich um diesen Ball«, murmelte sie, und die unbeschwerte Stimmung, die eine Zeitlang das geschwisterliche Gespräch bestimmt hatte, verflog.
»Aber warum denn? Du hast doch auch einen schönen Debütantinnenball gehabt«, wandte Daphne ein, spürte aber selbst, dass sie es doch um einiges besser angetroffen hatte. Fast fühlte sie sich schuldig, weil sie ohne alle Schwierigkeiten das erhalten hatte, wovon ihre Schwester vor zwei Jahren nur hatte träumen können. Seit Heathers Debüt war einfach zu viel geschehen. Das neue Haus hier am Beacon Hill war das sichtbarste Zeichen – und eben ihre Einführung in die vornehme Bostoner Gesellschaft in der Tremont Hall. Heather machte eine verdrossene Miene. »Ja, in Dorchester Hights, wo der Ballsaal eine bessere Turnhalle war und das Orchester sich nicht immer auf einen Takt und einen Ton einigen konnte«, giftete sie. »Männer vom Schlag eines John Singleton oder gar Charles Parkham haben sich dort selbstverständlich nicht blicken lassen, wenn sie von der Existenz eines Debütantinnenballs in Dorchester Hights überhaupt etwas geahnt haben. Bestenfalls der Sohn des Parkham-Butlers hätte unsereinem dort die zweifelhafte Ehre gegeben.« Sie hatte Mühe, den Neid nicht allzu deutlich in ihrer erregten Stimme zutage treten zu lassen. Daphne schämte sich jetzt, dass sie mit ihren Erlebnissen und kleinen Flirts vor ihrer Schwester geprahlt hatte.
»Nun ja, es war einfach eine andere Zeit, aber in Dorchester Hights war es doch auch ganz schön.« Die Antwort klang sogar in ihren eigenen Ohren lahm, obwohl es ihre ehrliche Meinung war.
»Und ob es eine andere Zeit war!«, bekräftigte Heather voller Bitterkeit. »Dorchester Hights – und dann auch noch dieser idiotische Bürgerkrieg! Von den wenigen passablen Männern, die es bei uns gab, hatten sich doch die meisten den Offiziersrock angezogen, um gegen die Südstaatler ins Feld zu ziehen. Und der Rest …« Sie ließ den Satz offen und machte nur eine wegwerfende Handbewegung.
Daphne musste ihr insgeheim recht geben. Heathers Debüt hatte mitten im Krieg stattgefunden, im Frühjahr 1863. Da hatte der erbitterte Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd schon im dritten Jahr getobt. Die anfängliche Kriegsbegeisterung war längst einer blutigen Ernüchterung gewichen. Hunderttausende hatten ihr Leben auf den Schlachtfeldern gelassen, und die unpersönlichen Kriegsberichte aus den Zeitungen hatten plötzlich eine völlig neue, erschreckende Bedeutung erhalten, als der Kummer in die Häuser ihrer damaligen Nachbarn und Freunde einzog. In der Straße, in der sie wohnten, hatte der Tod auf dem Schlachtfeld gleich drei Familien den Sohn genommen, und Henry Slade, der sommersprossige achtzehnjährige Bruder ihrer gemeinsamen Freundin Amanda, war ohne sein linkes Bein von der Schlacht bei Fredericksburg im Dezember 1862 nach Hause zurückgekehrt, nicht nur als Krüppel, sondern auch verbittert und um viele Jahre gealtert. Der Krieg war nun seit knapp einem halben Jahr vorbei – für Hunderttausende Opfer um viele Jahre zu spät. Mit General Lees Kapitulation vor General Grants Unionstruppen im April 1865 in Appomattox Court House hatte die Rebellion der Konföderierten nach fast fünfjährigem Krieg ihr Ende gefunden. Ja, es war schon eine andere, schwere Zeit gewesen, auch wenn sie selbst nur wenig davon mitbekommen hatten. »Es tut mir leid, Heather, dass du deinen Debütantinnenball nicht auch in der Tremont Hall haben konntest«, sagte sie betrübt. »Ich hätte es dir wirklich von Herzen gewünscht.«
»Ich mir auch, weiß Gott!«
»Aber du musst doch zugeben, dass du auch in Dorchester Hights einige nette junge Männer für dich gewinnen konntest«, versuchte Daphne sie zu trösten. »George McColl zum Beispiel, und Patrick Broady macht dir doch immer noch den Hof. Den wickelst du doch um den kleinen Finger.«
Edward nickte. »Bei dem brauchst du bloß einen Schmollmund zu machen, und schon zerfließt er vor deinen Füßen«, pflichtete er bei.
»George McColl!« Heather war geradezu entrüstet. »Wer ist schon George McColl! Glaubt ihr vielleicht, ich heirate einen Mann, der Kohlen ausfährt?«
»George ist nett und fährt keine Kohlen aus«, korrigierte Daphne sie. »Sein Vater hat eine große Kohlenhandlung, und er arbeitet dort im Büro, das weißt du ganz genau.«
Heather ging erst gar nicht darauf ein. »Mom würde es nie zulassen, dass ich mich an einen kleinen Kohlenhändler verschenke«, erklärte sie kategorisch. »Und Patrick ist nicht viel besser. Er langweilt mich mit seinem ewigen Gerede darüber, was er mal aus dem schäbigen Sägewerk seines Vaters machen wird. Dabei ist der kerngesund und denkt nicht im Traum daran, die nächsten zwanzig Jahre die Zügel aus der Hand zu geben. Bei dem hat Patrick kein Wort zu sagen. Höchstens das Ausfegen der Sägespäne kann er da neu organisieren. Außerdem hat Patrick schweißige Hände, und das kann ich auf den Tod nicht ausstehen.«
»Gegen Handschweiß kann man was tun«, bemerkte Edward keck. »Dreimal am Tag die Hände mit Kreide oder Sand einreiben. Zumindest schwört Mister Townbridge Stein und Bein darauf, dass das funktioniert.«
Lewis Townbridge war der kahlköpfige Privatlehrer, der ihn seit ihrem Einzug in das Haus Byron Street Nummer vierzehn fünfmal die Woche von acht bis zwölf unterrichtete, eine der vielen Neuerungen, die William Davenports Geschick an der Börse und der Umzug mit sich gebracht hatten.
Bestürzung über Heathers harsches, herzloses Urteil trat in Daphnes graublaue Augen. »Wie kannst du nur so über ihn reden! Ihr seid doch schon über ein Jahr … liiert und so gut wie verlobt!«
Heather schnaubte verächtlich und warf den Kopf auf eine Art zurück, die Daphne unwillkürlich an Harriet Comings arrogante Kopfhaltung erinnerte – zu Beginn des Balls. »Verlobt?«, wiederholte sie fast empört, als hätte Daphne ihr etwas Anstößiges unterstellt. »Wie kommst du denn auf diese absurde Idee? Das hätte er vielleicht ganz gerne, aber so dumm werde ich nicht sein. Für einen Mann wie Patrick bin ich mir wirklich zu schade, wo wir nun dazugehören.« Der letzte Satz war ihr gedankenlos herausgerutscht.
Daphne furchte leicht die Stirn. Sie mochte diese berechnende Seite ihrer Schwester gar nicht. Früher war Heather nicht so gewesen. Launisch und in vielen Dingen merkwürdig eigensinnig, das ja, aber doch nicht so kaltherzig kalkulierend und allein nur auf den eigenen materiellen Vorteil bedacht. »Was meinst du mit ›dazugehören‹?«
Heather warf ihr einen wütenden Blick zu. Sie fühlte sich ertappt. »Ach, das weißt du doch ganz genau. Tu nicht so, als ob ich es dir erst noch erklären müsste. Wer hat denn mit Charles Parkham getanzt und ein Auge auf John Singleton geworfen?«, fragte sie spitz zurück. »Also tu jetzt bloß nicht so scheinheilig!«
Daphne nahm die gehässige Bemerkung unwidersprochen hin, obwohl es ihr wehtat, so etwas ausgerechnet von ihrer eigenen Schwester vorgeworfen zu bekommen. »Du meinst also mit ›dazugehören‹ das Haus hier in der Byron Street und …«
Heather fiel ihr gereizt ins Wort. »Ja, Beacon Hill, Waddys Privatlehrer, Pru, die Kutsche, die sich Dad bestellt hat, Moms neuen Schmuck und deinen Ball in der Tremont Hall«, rasselte sie herunter. »All das und noch einiges mehr meine ich damit. Und ich will Pru oder Edwina heißen, wenn ich mich mit einem Mann begnügen werde, der mir weniger bieten kann als mein eigener Vater. Wir sind jetzt wer. Endlich! Und wir können Ansprüche stellen.«
Die letzten Sätze klangen sehr vertraut in Daphnes Ohren. Seit ihr Vater das Haus am Beacon Hill gekauft hatte, bekamen sie von ihrer Mutter häufig derartige Äußerungen zu hören. War ihr Vater zugegen, fielen sie ein bisschen weniger krass aus als gewöhnlich. Oft waren es Bemerkungen mit mahnendem Charakter, als wären sie plötzlich andere Menschen geworden, die nun an sich und an alle anderen völlig neue Maßstäbe anlegen müssten. Das gefiel ihr nicht. Nicht, dass sie selber frei von Stolz, Eigensucht und Geltungsdrang gewesen wäre. Mein Gott, sie war sechzehn! Sie genoss sehr wohl das neue, komfortable Leben einer nicht nur hübschen, sondern nun auch reichen Tochter, deren Vater eine glückliche Hand an der Börse bewiesen hatte und in die vornehmsten Clubs aufgenommen worden war. Und selbstverständlich schmeichelte es ihr, dass sie bei dem Debütantinnenball von Boston in die Gesellschaft eingeführt worden war. Aber das hieß doch noch längst nicht, sich seinen Umgang nun einzig und allein unter dem Gesichtspunkt des sozialen Standes auszusuchen. Bestimmt würde sie mit Harriet keine Freundschaft eingehen oder gar Charles Parkham ermutigen, ihr den Hof zu machen, und mochte er eines Tages auch noch so viele Millionen erben.
All das hätte sie ihrer Schwester am liebsten geantwortet, doch sie wollte nicht ausgerechnet jetzt mit ihr streiten, und Heather machte ganz den verkniffenen Eindruck, als warte sie nur darauf, sich mit ihr in die Wolle zu geraten. Deshalb erwiderte Daphne nur: »Ich weiß nicht, ob das richtig ist, wie du denkst, aber das musst du ja wohl selber wissen.«
»Danke für die Großzügigkeit, Prinzessin«, gab ihre Schwester sarkastisch zurück und erhob sich. »So, ich bin müde und geh’ jetzt zu Bett.«
Edward hatte schon mehrfach herzhaft gegähnt, machte jedoch keine Anstalten, seinen Platz auf dem Bett zu räumen.
»Danke für deine Hilfe, Heather!«, sagte Daphne, als Heather schon den Türknauf in der Hand hatte.
»Das war heute dein großer Tag, Schwester«, erwiderte diese maliziös. »Und wenn du klug bist, ziehst du daraus auch die richtigen Lehren. Gute Nacht!«
Edward zog die Augenbrauen hoch. »Mann o Mann, Heather ist ja mal wieder ganz schön in Fahrt geraten«, meinte er spöttisch.
Daphne seufzte. »Ja, das ist sie wohl.«
»Ich glaube, sie ist ganz schön neidisch auf diesen Charles und deinen John Singleton.«
»Obwohl dazu überhaupt kein Anlass besteht. Wir haben nur zusammen getanzt und uns ein wenig unterhalten – was ich auch mit vielen anderen getan habe, wie das nun mal auf einem Ball so ist«, dämpfte sie übertriebene Erwartungen, eine Mahnung, die auch an ihre eigene Adresse gerichtet war.
»Patrick tut mir leid. Ich mag ihn. Er hat mich nie wie ein kleines Kind behandelt«, sagte Edward ein wenig traurig. »Ob sie ihn jetzt wirklich fallenlässt?«
»Ich fürchte ja.«
»Ich finde ein Sägewerk ganz toll.«
Daphne lächelte nur. Die Anstrengung des langen, aufregenden Tages machte sich nun bei ihr bemerkbar. Müdigkeit breitete sich wie eine warme, schwere Woge in ihrem Körper aus, erfüllte sie von den Zehenspitzen bis in die Augenlider. »Daphne?«
»Mhm?«
»Sind wir jetzt wirklich wer, wie Heather gesagt hat, weil wir statt in Dorchester Hights nun hier am Beacon Hill wohnen?«, wollte er wissen.
»Na ja, in den Augen der anderen wohl schon«, gab sie zögernd zu. »Vor allem, wenn man ein Haus südlich der Pickney Street hat.«
Interessiert sah er sie an. »Du meinst, die nördliche Seite ist nicht so gut?«
»So heißt es zumindest. Die schönsten und teuersten Häuser stehen nun mal auf dieser Seite, und je höher man am Beacon Hill wohnt, desto größer ist auch das Ansehen«, erklärte sie ihm. »Du kennst doch die Herrenhäuser oben in der Mount Vernon Street und am Louisburg Square.«
Er nickte. »In solchen Häusern wohnen die ganz Reichen wie Charles Parkhams und Harriet Comings Eltern.«
»Aber dann gehören wir ja doch noch nicht dazu, wie Heather meint, wo wir doch noch ziemlich unten am Hügel wohnen«, wandte er ein.
Sie schmunzelte. »Ich weiß nicht so recht, wie sie das gemeint hat, Waddy. Es gibt eben auch unter den Reichen noch himmelweite Unterschiede. Für einen Parkham sind wir bestimmt noch arme Schlucker, während unsere alten Nachbarn aus Dorchester Hights Dad bestimmt schon für einen Krösus halten.«
»Ich glaube, Dad macht sich gar nicht viel daraus.«
»Das glaube ich auch«, pflichtete sie ihm bei. Es war ihre Mutter gewesen, die darauf gedrängt hatte, dass ihr Vater ein schönes Haus am Beacon Hill erwarb.
»Wenn Dad so weitermacht, wohnen wir vielleicht bald auch weiter oben.«
»Ja, kann schon sein«, murmelte Daphne müde. Er merkte, dass sie darauf wartete, sich schlafen legen zu können, und rutschte vom Bett. »Ich geh’ dann mal. Schlaf schön!«
»Ja, du auch.«
»Und grüß mir deinen verwegenen John Singleton.«
Fragend blickte sie ihren Bruder an.
»Na, du wirst doch bestimmt von ihm träumen«, erklärte er mit einem gutmütigen Grinsen und huschte dann hinüber in sein Zimmer.
Mit einem wohligen Seufzer streckte sich Daphne unter der Decke aus, kuschelte sich in das Kopfkissen und kehrte in Gedanken zum Ball in die Tremont Hall zurück. In bunten, eindringlichen Bildern traten die schönsten Momente des Abends noch einmal vor ihr geistiges Auge, und in fast allen stand John Singleton im Mittelpunkt: groß, stattlich, dunkelblond, mit attraktiven männlichen Zügen und einem Lächeln auf dem Gesicht, das wie eine zärtliche Verheißung war. Sie lächelte mit geschlossenen Augen und presste das kühle Kissen fester an ihre Wange, während in einem der Gärten in der Nachbarschaft eine Katze miaute und einen Hund aus dem Schlaf holte, der sofort in die Nacht hinausbellte. »Ach, John«, murmelte sie schon halb im Schlaf. Wie sehr freute sie sich auf den morgigen Kirchgang! Diesmal konnte Reverend Egbert Campbell noch so lange und einschläfernd predigen, es würde ihr nicht das Geringste ausmachen. Denn John hatte versichert, dass er den Gottesdienst an diesem Sonntag um nichts auf der Welt versäumen wolle, wo er nun wisse, dass sie zugegen sein werde. Der Schatten eines Zweifels fiel über ihre Vorfreude. Waren seine Worte auch so gemeint gewesen, wie sie sie verstanden hatte? Oder gehörten sie nur zu jenen galanten Schmeicheleien, die auf einem Ball so zahlreich blühten wie Wildblumen auf einer Frühsommerwiese? Wird er wirklich kommen? Diese bange Frage nahm sie mit in den Schlaf. Doch ihr Traum wurde von keinem Zweifel und keiner bangen Ungewissheit getrübt, sondern entführte sie in eine Welt unbeschwerter zärtlicher Freude.
3
Wie zürnender himmlischer Donner brandete die Musik durch das Kirchenschiff. Der Organist, der verwitwete Bruder von Reverend Campbell und sonst ein stiller Mann von unscheinbarer Erscheinung, stieg mit Vehemenz in die Pedale. Er zog die Register, als hänge die Rettung ihrer aller Seelen davon ab, und griff in die Tasten, als gelte es, schon vor der Predigt die selbstsüchtige und hoffärtige Gemeinde von Beacon Hill mit der reinigenden Kraft seines donnernden Orgelspiels aus ihrem sündigen, gottlosen Leben zu reißen und zu gläubiger Einkehr zu bewegen.
Nathan Campbells wuchtiges Orgelspiel war beinahe so gefürchtet wie die monotone Langatmigkeit seines predigenden Bruders. Dieser ließ sich zwar mit Vorliebe über das Jüngste Gericht und das ewige Höllenfeuer aus, das den Gottlosen drohe, doch im Gegensatz zu Nathan Campbell gelang es ihm nie, seine Zuhörer aufzurütteln. Seiner Sprache fehlte die plastische Darstellungskraft, die sein Bruder der Orgel entriss. Aus seinem Mund nahm sich das Höllenfeuer wie ein gemütliches Kaminfeuer an einem kühlen Herbsttag aus.
Daphne hatte es so eingerichtet, dass sie ganz außen in der Bank saß, direkt am Mittelgang vorne rechts. Jede Familie hatte in der Kirche ihre eigene Reihe oder zumindest einen Teil einer ganz bestimmten Bank, und niemand anders nahm dort Platz, auch wenn die Familie einmal nicht erschien. Früher hatte hier Mister Galloway mit seiner Familie den Gottesdienst der Gebrüder Campbell über sich ergehen lassen. William hatte von dem schwergewichtigen Tuchhändler, der mit seiner Frau und vier Kindern nach New York übergesiedelt war, nicht nur das Haus Nummer vierzehn in der Byron Street erworben, sondern damit auch gleichzeitig das Recht auf die ersten Plätze in dieser Reihe, auch wenn dies nirgendwo niedergeschrieben stand. Was diese Festlegung betraf, so wurde darüber auch nicht gesprochen, es handelte sich dabei um eine stillschweigende, allseits akzeptierte Übereinkunft in der Gemeinde. Daran hielten sich auch die weniger begüterten Kirchgänger, die nicht das Privileg eines stets reservierten Stammplatzes genossen und sich im hinteren Drittel jeden Sonntag einen freien Platz wählen konnten.
Daphne trug ein züchtig hochgeschlossenes Kleid aus dunkelrotem Taft. Es war schlicht im Schnitt, unterstrich aber gerade dadurch ihre schlanke, anmutige Gestalt und die außergewöhnliche Schönheit ihrer vollendeten Gesichtszüge, weil nichts von ihnen ablenkte. Der burgunderrote Taft bot einen herrlichen Kontrast zu ihrem blauschwarzen Haar, das Pru ihr an diesem Morgen ausnehmend hübsch frisiert hatte. Es schaute unter einem verspielten Bonnet hervor, das mit demselben Taft wie ihr Kleid überzogen war. O ja, sie hatte sich auf diesen Kirchgang fast so gründlich vorbereitet wie auf den gestrigen Ball und bot den berückenden Anblick eines bildhübschen Mädchens, das an der Schwelle zur Frau stand. Die knospende Weiblichkeit versprach schon jetzt eine berauschende Blüte.
Doch John war nicht gekommen!
Keiner der Singletons saß in der Bank in der vierten Reihe auf der anderen Seite des Mittelgangs, wo Johns Familie gewöhnlich dem Gottesdienst beiwohnte. Die verwaiste Bank war wie eine stumme, aber dennoch beredte Zurückweisung.
Galantes Ballgeplauder. Nichts weiter!
Die Enttäuschung traf Daphne tief, und sie hatte Mühe, sich ihre verletzten Gefühle nicht anmerken zu lassen. Steif und mit beherrschtem Gesicht saß sie neben ihrer Schwester, um deren Mundwinkel ein spöttisches Lächeln spielte. Starr blickte sie auf das Kreuz, das Symbol des Leidens.
Nathan Campbell schwang sich an der Orgel zu neuen Höhen und zu noch voluminöseren Klängen auf, ließ die Luft wie Sturmwind durch die Pfeifen brausen und stürzte sich in das Finale der Introduktion, als wolle er die Mauern von Jericho zum Einsturz bringen.
Genau in dem Moment, da der letzte bassdröhnende Akkord durch das Kirchenschiff hallte und die Gemeinde benommen von dem furiosen Spiel in den Bänken verharrte, hörte man die Eingangstür knarren. Dann kamen Schritte, die in der plötzlichen Stille überlaut klangen, den Mittelgang entlang. Nicht eilig und nicht zögernd, sondern selbstbewusst, als mache es dem Nachzügler nichts aus, vor aller Augen zu spät zum Gottesdienst zu erscheinen.
Unwillkürlich hielt Daphne den Atem an. Ihre Hände, die in dünnen weißen Handschuhen steckten, umklammerten das Gesangbuch, als wolle sie es zerquetschen.
Es waren eindeutig die Schritte eines Mannes. John?
Sie wagte nicht, den Kopf auch nur um einen Inch nach links zu drehen, als die Schritte näher kamen und der Mann auf ihrer Höhe stehenblieb. Nur ihre Augen bewegten sich.
Er war es! Gekleidet in einen dunkelbraunen Anzug aus feinstem Tuch, einen Spazierstock mit geschnitztem Elfenbeinknauf lässig unter dem Arm und sein Gesangbuch in der anderen Hand, nahm er drüben in der Familienbank der Singletons Platz.
Daphne jubilierte innerlich. Er war also doch gekommen! Was immer ihn aufgehalten hatte, er stand zu seinem Wort. Und am liebsten hätte sie sich zu Heather umgedreht, um zu sehen, welches Gesicht sie jetzt machte.
Von Reverend Campbells weitschweifiger Predigt nahm Daphne an diesem Sonntag nicht einmal das Thema wahr. Für sie gab es nur John. Würde er sich nach ihr umblicken? Sie brauchte nicht lange zu warten. Kaum hatte er sich gesetzt und der Reverend das Wort an die Gemeinde gerichtet, zog er ein Schnupftuch aus der Rocktasche und tat so, als wende er sich höflich ab, um sich dezent die Nase zu schnäuzen. Doch seine Augen suchten Daphne und blieben auf ihr ruhen, als er sie entdeckt hatte. Er nickte ihr kaum merklich zu und lächelte sie über den Mittelgang hinweg an.
Es war ein Lächeln, das ihr ein herrliches Gefühl der Schwäche durch den Körper jagte. Ihre Knie wurden weich, und sie war froh, dass sie saß und eine feste Lehne in ihrem Rücken spürte.
Bevor er sich wieder nach vorne wandte, erwiderte sie sein Nicken und Lächeln und kam sich dabei vor, als habe sie etwas besonders Mutiges gewagt.
»Pass bloß auf, dass du keinen starren Blick kriegst!«, raunte Heather ihr zu.
Daphne senkte schuldbewusst den Kopf, weil sie im Hause Gottes solche Blicke mit einem Mann tauschte. Doch nichts konnte das glückliche Lächeln von ihrem Gesicht vertreiben, zu groß waren die Freude und die Erregung, die sie beherrschten.
John Singleton schien über Nacht ein ausgewachsener Schnupfen befallen zu haben, der ihn immer wieder dazu zwang, zu seinem Taschentuch zu greifen – und sich diskret abzuwenden. Ungewöhnlich für einen aufmerksamen Beobachter war daran nur, dass er sich stets nach rechts umdrehte und sein Blick dabei immer nur zu Daphne Davenport wanderte.
Heather konnte sich dazu eine spitzzüngige Bemerkung nicht verkneifen, worauf Sophie ihren Töchtern pflichtgemäß einen mahnenden Blick zuwarf, damit sie mit dem Flüstern aufhörten. Doch dabei zwinkerte sie Daphne zu und gab ihr zu verstehen, dass ihr die besondere Aufmerksamkeit, die der junge Singleton ihrer jüngeren Tochter schenkte, nicht entgangen und auch nicht unwillkommen war.
Daphne konnte es nicht erwarten, dass Reverend Campbell beim Gottesdienst ein Ende fand. Dann demonstrierte ihnen sein Bruder zum Abschluss noch einmal, dass eine Orgel mehr als nur ein Instrument zur gefälligen Begleitung von kirchlichen Gesängen sein konnte. Endlich durften sie mit Gottes Segen hinaus in den sonnigen Tag!
Während ihr Vater sich noch der leidigen Pflicht unterzog, ein paar höfliche Worte mit dem Reverend zu wechseln, und Edward bei ihm blieb, wartete Daphne mit wild klopfendem Herzen auf John und hoffte inständig, zumindest ein paar Minuten mit ihm allein sein zu können.
John wusste, was die Etikette von ihm verlangte, und begrüßte erst Daphnes Mutter. Sein Handkuss war formvollendet und zauberte ein huldvolles Lächeln auf Sophies fülliges Gesicht.
»Ich bedaure sehr, Sie und alle anderen mit meinem verspäteten Eintreffen in der Andacht gestört zu haben, Madam«, entschuldigte er sich mit entwaffnendem Charme, und die Worte flossen ihm glatt und weich und wohlklingend über die Lippen.
»Oh, so etwas passiert einem jeden von uns dann und wann einmal, Mister Singleton«, erwiderte Sophie, ganz hingerissen von seiner liebenswürdigen Art, aus der bei allem Selbstbewusstsein doch auch Ehrerbietung sprach.
»Nein, nein, es ist ganz unverzeihlich«, widersprach er mit Nachdruck, doch sein fröhlicher Blick nahm seinen Worten den Ernst, »zumal der Grund meiner Verspätung ein überaus profaner ist: Ich kann zu meiner Entschuldigung nichts weiter anführen, als dass meine ganze Familie verschlafen hat. Eine bedauerliche, missverständliche Weisung an das Personal, von der ich mich auszuschließen vergessen habe. Ich hätte es mir nie verziehen, wenn ich den heutigen Gottesdienst verpasst hätte.« Dabei blickte er kurz zu Daphne hinüber, als nehme er sie erst jetzt zum ersten Mal an diesem Morgen zur Kenntnis.
Sie errötete bis über die Ohren.
Sophie schmunzelte. »Ja, ja, das Spiel unseres begnadeten Organisten war in der Tat die Predigt seines Bruders wert.« Scherzhaft tat sie so, als wisse sie nicht, wie er das gemeint hatte. »Der Gute hat sich heute mal wieder übertroffen.«
John erwiderte das Schmunzeln. »Manchmal könnte man direkt Angst um die Grundfesten unserer Kirche bekommen, wenn Mister Campbell sich so von seinem musikalischen Genie mitreißen lässt«, pflichtete er ihr bei.
»Da ist etwas Wahres dran. Doch heute hat mir eher Ihre Gesundheit Angst gemacht, Mister Singleton«, meldete sich nun Heather zu Wort.
»Miss Davenport«, er neigte zur Begrüßung höflich den Kopf, »wie schön, dass ich das Vergnügen habe, nun auch Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen. Doch würden Sie mir gnädigerweise verraten, womit ich Ihre Sorge geweckt habe?«
»Sie schienen mir sehr verschnupft zu sein, als säße Ihnen eine ernsthafte Erkrankung im Blut«, sagte Heather spöttisch, und Daphne hätte sie dafür erwürgen können.
Auch Sophie hatte sich unwillkürlich ein wenig versteift, und sie überlegte, wie sie die Situation mit einer scherzhaften Bemerkung retten könnte.
Das war jedoch nicht nötig. John wusste sich ohne Zögern geschickt und mit Sinn für Humor aus der Affäre zu ziehen. »Ihre Besorgnis schmeichelt mir, Miss Davenport, obgleich ich sie ganz sicherlich nicht verdient habe, hätte doch eigentlich Ihre Aufmerksamkeit einzig und allein der stets unvergleichlichen Predigt von Reverend Campbell gelten müssen …«
Da hast du es, Heather!, frohlockte Daphne im Stillen über den eleganten Seitenhieb, den John ihrer Schwester damit versetzt hatte. Heather lächelte etwas gekünstelt. Aber sie hatte die charmant verpackte Zurechtweisung verstanden.
Sophie reagierte mit einem amüsierten, dezenten Lachen auf die hintersinnige Antwort. John Singleton hatte ihr allein schon deshalb gefallen, weil er Kenneth Singletons einziger Sohn und damit Alleinerbe der Singleton-Textilfabriken war. Doch nun erwärmte sie sich auch für den jungen Mann, der für sie hinter diesem Namen zum Vorschein kam. Was für eine Schlagfertigkeit und Eleganz in der Wortwahl! Wenn doch William nur eine Spur dieses Charmes besäße! Und was Heather betraf, nun, die hatte diesen verbalen Nasenstüber sehr wohl verdient. Solche Bemerkungen standen ihr nicht zu, auch wenn sie die ältere Schwester war und schon eine verheiratete Frau hätte sein können. Aber sie war es eben nicht. Noch nicht!
»Dieser Reiz, der mich in der Kirche befallen hat«, fuhr John lächelnd fort, »ist aber gewiss kein Grund zu ernsthafter Sorge. Er hat sich ja hier im Freien sogleich wieder verflüchtigt, wie Sie zweifellos bemerkt haben«, erwiderte er doppeldeutig und wollte sich nun Daphne zuwenden, die schon voller Ungeduld darauf wartete, ihm in die Augen schauen und ein paar Worte mit ihm reden zu können. Es war ihr egal, wenn Heather und ihre Mutter sie dabei nicht eine Sekunde aus den Augen lassen und nicht ein Wort überhören würden, das sie wechselten.
Ihre Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt, denn in dem Moment gesellten sich William und Edward zu ihnen, und die Höflichkeit verlangte es, dass John ihren Vater begrüßte und ihm seinen Respekt bezeugte.
Daphnes Vater war gut gelaunt und die Freundlichkeit in Person. Das lag jedoch weniger an seiner Sympathie für John Singleton als an der Erleichterung, den Gottesdienst der Gebrüder Campbell einmal mehr überstanden zu haben. Trat er aus der Kirche und auch noch in ein so sonniges Licht, dann überkam ihn jedes Mal eine tiefe Dankbarkeit, dass er sich nur einmal die Woche dieses Kreuz auferlegen musste. Wie beglückend war jedes Mal aufs Neue das Wissen, dass es noch sieben lange Tage dauern würde, bis er wieder auf der harten Kirchenbank Platz nehmen musste, um seinen wöchentlichen Bußgang abzuleisten. Denn er hegte die feste Überzeugung, dass es einen Akt tätiger Buße für vermeintliche oder tatsächliche Sünden darstellte, Nathan und Egbert Campbell freiwillig über sich ergehen zu lassen.
»Einen schönen guten Tag, Mister Davenport!«
»Ah, der junge Singleton!«, grüßte William lebhaft und mit dem unbeschwerten Lächeln eines Mannes, der den angenehmen Teil des Tages noch vor sich wusste. »Ja, ja, der Tag könnte jetzt gar nicht prächtiger sein. Ich sehe, meine Frauen haben Sie schon gleich mit Beschlag belegt.«
»Um der Wahrheit die Ehre zu geben, war ich es, der sich diese Freiheit herausgenommen hat, Mister Davenport«, erwiderte John artig. Daphne bemerkte, dass ihr Bruder ihn mit großen aufmerksamen Augen musterte, und sie wusste, dass Waddy ihn mögen würde – und umgekehrt. Alle würden sie John mögen, es konnte gar nicht anders sein, so charmant und attraktiv, wie er war!
»Eine Freiheit, die ich Ihnen jederzeit gern einräume, Mister Singleton«, versicherte Sophie huldvoll und sonnte sich in der Aufmerksamkeit der anderen Mütter heiratsfähiger Töchter. Nicht wenige blickten mit kaum verhohlenem Neid zu ihnen herüber und tuschelten. Dass der junge Singleton ihrer Daphne den Hof machte, war bestimmt das Gesprächsthema des Tages und würde in Windeseile auch bei denen die Runde machen, die weder am gestrigen Ball noch am heutigen Gottesdienst teilgenommen hatten. Gut so! Das war genau die Art Gerede, die sie liebte und genoss, weil sie ihre gesellschaftliche Stellung festigte.