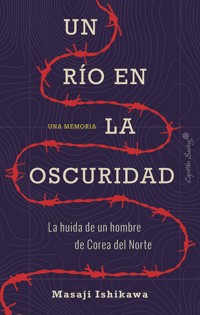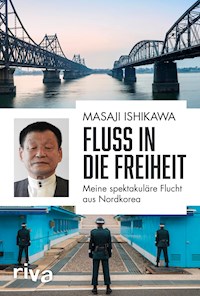
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Jetzt oder nie. Ich stürzte mich in den Fluss und fing an zu schwimmen. Aber dann knallte ich mit dem Kopf gegen irgendetwas. Einen Felsen? Ich weiß es nicht. Wasser strömte in meinen Mund, und vage bemerkte ich noch, stromabwärts getrieben zu werden. Dann verlor ich das Bewusstsein.« Anfang der 1960er-Jahre machen sich die Eltern des 13-jährigen Masaji Ishikawa von Japan auf den Weg in das wirtschaftlich prosperierende Nordkorea. Doch der Traum von einem besseren Leben entpuppt sich schnell als Albtraum: Unter der Führung Kim Il-sungs entwickelt sich das Land zu einem Terrorstaat, der das Volk kontrolliert und unterdrückt. 36 Jahre lang erduldet Masaji den Hunger, die Willkür und die Gewalt. Dann ist die Not so groß, dass er nur noch einen Ausweg sieht: zu fliehen. Er springt in das kalte Wasser des Yalu-Flusses und es beginnt eine nervenaufreibende Odyssee, die ihm fast das Leben gekostet hätte. Bis heute weiß er nicht, was aus seiner Familie geworden ist, ob seine Frau und seine Kinder noch leben. Er weiß nur: Er ist jetzt zwar in Sicherheit, aber eine Heimat wird er trotzdem nie finden. Er ist und bleibt allein. Der Bericht von Masaji Ishikawa ist das schockierende Zeugnis der Grausamkeiten der Kim-Diktatur und ein Beispiel für die unbändige Kraft und Widerstandsfähigkeit des Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
MASAJI ISHIKAWA
FLUSS IN DIE FREIHEIT
MASAJI ISHIKAWA
FLUSS IN DIE FREIHEIT
Meine spektakuläre Flucht aus Nordkorea
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buchs in Japan änderte Ishikawa einige Namen und hielt manche Details zurück, um seine Familie und seine Freunde in Nordkorea zu schützen. Zudem benutzte er das Pseudonym Shunsuke Miyazaki (in japanischer Wortfolge Miyazaki Shunsuke). Ansonsten hat er alle Ereignisse, die in diesem Buch beschrieben werden, so niedergeschrieben, wie sie ihm in Erinnerung geblieben sind oder wie er es von anderen erfahren hat.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2020
© 2020 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die japanische Originalausgabe erschien 2000 bei 新潮社 unter dem Titel 北朝鮮大脱出 地獄か らの生還. Die deutsche Übersetzung basiert auf der englischen Erstausgabe, die 2017 bei Amazon Crossing, Seattle, erschienen ist. © 2017 by Amazon Crossing, Seattle. All rights reserved.
This edition is made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing, www.apub.com, in collaboration with Literarische Agentur Hoffman GmbH.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Egbert Baqué
Redaktion: Sabine Franke
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: ©2016 Hisanori Niizuma, aphotostory/Shutterstock, Joshua Davenport/ Shutterstock
Satz: Carsten Klein, Torgau
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-7423-1567-0
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-1242-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-1243-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Epilog
Über den Autor
PROLOG
Was ich von jener Nacht in Erinnerung habe? Der Nacht, in der ich aus Nordkorea floh? Da gibt es so viele Dinge, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, die ich für immer aus meinem Gedächtnis verdrängt habe … Aber ich erzähle Ihnen, woran ich mich erinnere.
Es nieselt. Doch bald schon wird aus dem Nieseln ein sintflutartiger Regen. Die Regenschauer sind so stark, dass ich bis auf die Haut durchnässt bin. Unter dem Schutz eines Buschs breche ich zusammen; ich bin völlig außerstande, das Verstreichen der Zeit einzuschätzen. Ich bin total erschöpft.
Meine Beine sind im Schlamm versunken, aber irgendwie krieche ich unter dem Busch hervor. Zwischen den Zweigen kann ich vor mir den Yalu-Fluss sehen. Doch er hat sich verändert – und ist jetzt überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Als heute Morgen Kinder darin herumwateten, war es kaum mehr als ein Strom. Aber die Regenkaskaden haben ihn in eine unpassierbare reißende Flut verwandelt.
Auf der anderen Seite des Flusses, ungefähr dreißig Meter entfernt, kann ich China sehen, von Nebel eingehüllt. Dreißig Meter – die Entfernung zwischen Leben und Tod. Ich erschauere. Ich weiß, dass vor mir schon zahllose Nordkoreaner hier gestanden haben, im Schutze der Dunkelheit nach China hinüberblickten, während in ihren Köpfen Erinnerungen an Menschen kreisten, die sie gerade zurückgelassen hatten. Diese Menschen waren wie die, die ich verlassen habe, am Verhungern. Was sonst konnten sie tun? Ich starre auf den reißenden Strom und frage mich, wie viele von ihnen es geschafft haben.
Andererseits, welchen Unterschied würde es machen? Wenn ich in Nordkorea bleibe, werde ich verhungern. So einfach ist das. Auf diese Weise habe ich wenigstens eine Chance – eine Chance, dass ich es schaffe und dann in der Lage sein werde, meine Familie zu retten oder ihr wenigstens irgendwie zu helfen. Meine Kinder waren schon immer mein Lebensinhalt. Ich nutze ihnen nichts, wenn ich tot bin. Aber ich kann noch immer nicht glauben, was ich mir da vorgenommen habe. Wie viele Tage sind vergangen seit meiner Entscheidung, über die Grenze zu fliehen und in das Land meiner Geburt zurückzukehren? Ich denke darüber nach.
Vier Tage … Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Vor vier Tagen habe ich mein Haus verlassen. Ich schaute in das Gesicht meiner Frau, in die Gesichter meiner Kinder, und mir war klar, es könnte das letzte Mal sein. Ich konnte es mir jedoch nicht erlauben, mich solchen Gedanken hinzugeben. Wenn ich eine Chance haben sollte, ihnen zu helfen, musste ich gehen, solange ich noch die Kraft zur Flucht hatte. Oder bei dem Versuch sterben.
Und was habe ich seither gegessen? Ein paar Hülsen von Zuckermais, ohne die Körner. Ein merkwürdiges Apfelkerngehäuse. Ein paar Speisereste, die ich aus dem Müll anderer geklaubt habe.
Ich schaue mich nach den Wachen um, von denen ich weiß, dass sie ungefähr alle fünfzig Meter am Flussufer lauern. Ich bin bereit, an völliger Erschöpfung zu sterben oder bei meinem Versuch, den Fluss zu überqueren, zu ertrinken. Aber ich werde es nicht zulassen, dass mich die Wachen gefangen nehmen. Alles, nur das nicht. Ich stürze mich in den Fluss.
Die letzten Worte, die ich meiner Familie sagte, klingen mir noch immer in den Ohren. Wenn mir die Flucht auf die eine oder andere Weise gelingt, dann bringe ich, um welchen Preis auch immer, auch euch hier raus.
KAPITEL 1
Man sucht es sich nicht aus, geboren zu werden. Man wird einfach geboren. Und deine Geburt ist dein Schicksal, sagen manche. Ich sage: Zur Hölle damit. Und ich sollte es wissen. Ich bin nicht nur einmal, sondern fünfmal geboren worden. Und fünfmal hab ich die gleiche Lektion gelernt. Manchmal im Leben muss man sein sogenanntes Schicksal an der Kehle packen und ihm den Hals umdrehen.
Mein japanischer Name ist Masaji Ishikawa und mein koreanischer Name lautet Do Chan-sun. Ich wurde (zum ersten Mal) im Viertel Mizonokuchi der Stadt Kawasaki, südlich von Tokio, geboren. Es war mein Pech, zwischen zwei Welten geboren zu werden – ich hatte einen koreanischen Vater und eine japanische Mutter. Mizonokuchi ist eine Gegend mit sanft abfallenden Hügeln, die heutzutage an den Wochenenden von Besuchern aus Tokio und Yokohama, die der Stadt entfliehen wollen und ein Bedürfnis nach frischer Luft haben, überfüllt ist. Doch vor sechzig Jahren, als ich ein Kind war, gab es hier kaum mehr als ein paar Bauernhöfe, zwischen denen vom Tama-Fluss gespeiste Bewässerungskanäle verliefen.
Damals wurden die Bewässerungskanäle nicht nur für die Landwirtschaft genutzt, sondern auch für Hausarbeiten wie Wäschewaschen und Geschirrspülen. Als Junge verbrachte ich lange Sommertage damit, in den Kanälen zu spielen. Ich legte mich in eine große Waschwanne und ließ mich den ganzen Nachmittag auf dem Wasser treiben, sonnte mich und beobachtete, wie die Wolken über den Himmel zogen. Für meine Kinderaugen ließ die langsame Bewegung dieser dahintreibenden Wolken den Himmel wie ein ungeheuer weites Meer erscheinen. Ich fragte mich, was geschehen würde, wenn ich meinen Körper mit den Wolken treiben ließe. Könnte ich das Meer überqueren und ein Land erreichen, von dem ich noch gar nichts wusste? Von dem ich noch nie gehört hatte? Ich dachte an endlose Möglichkeiten in meiner Zukunft. Ich wollte armen Leuten helfen – Familien wie meiner –, reicher zu werden, damit sie die Mittel hatten, ihr Leben zu genießen. Und ich wollte, dass die Welt friedvoll ist. Ich träumte davon, eines Tages Premierminister von Japan zu werden. Wie wenig ich doch wusste!
Oft kletterte ich in der Frische des frühen Morgens auf einen nahe gelegenen Hügel und fing Käfer. Zu Festzeiten lief ich dem tragbaren Schrein und den Tänzern mit den Löwenmasken hinterher. Alle meine Erinnerungen sind ganz wunderbar. Meine Familie war arm, doch meine Kindheitstage in Mizonokuchi waren die glücklichsten meines Lebens. Denke ich an meinen Heimatort, kann ich die Tränen selbst heute kaum zurückhalten. Ich würde alles dafür geben, diese glückliche Zeit noch einmal zu erleben, mich wieder so unschuldig und voller Hoffnung zu fühlen.
Am Stadtrand von Mizonokuchi gab es ein Dorf, in dem ungefähr zweihundert Koreaner lebten. Später fand ich heraus, dass die meisten von ihnen aus Korea mehr oder weniger verschleppt worden waren – sie sollten in der nahe gelegenen Munitionsfabrik arbeiten. Mein Vater, Do Samdal, war einer von ihnen. Geboren auf einem Bauernhof in Bongchon-ri, einem Dorf im heutigen Südkorea, wurde er im Alter von vierzehn Jahren abkommandiert – tatsächlich aber entführt – und nach Mizonokuchi gebracht.
Doch bis ich in die Grundschule kam, wusste ich noch nicht einmal, dass ich einen Vater hatte. Zumindest habe ich keine Erinnerungen an ihn, die weiter zurückreichen. Tatsächlich wurde mir die Existenz meines Vaters zum ersten Mal bewusst, als mich meine Mutter an einen seltsamen Ort mitnahm, der, wie ich später feststellte, ein Gefängnis war, um einen Mann zu besuchen, den ich nicht kannte. Das war der Tag, an dem meine Mutter mir sagte, wer mein Vater ist.
Schließlich erschien der Mann, den ich durch das Fenster des Besucherraums gesehen hatte, in unserem Haus. Er war in der Gegend dafür berüchtigt, ein rauer Kerl zu sein, und unsere Verwandten mieden ihn. Er war fast nie zu Hause, aber wann immer er da war, verbrachte er die meiste Zeit damit, stark riechenden Schnaps hinunterzukippen. Er konnte in kurzer Zeit ein paar Liter Sake verputzen. Was jedoch schlimmer war: Wann immer er zu Hause war, betrunken oder nicht, schlug er meine Mutter. Meine Schwestern waren so verängstigt, dass sie sich stets in einer Ecke wegduckten. Ich versuchte, ihn aufzuhalten, indem ich mich an sein Bein klammerte, aber er stieß mich immer weg.
Meine Mutter versuchte, nicht zu schreien, und ertrug die Qual mit zusammengebissenen Zähnen. Ich fühlte mich hilflos und hatte Angst um sie, konnte aber nichts machen. Mit der Zeit gab ich mir die größte Mühe, ihm einfach aus dem Weg zu gehen – was nicht so schwierig war, da er mir ohnehin nie besondere Aufmerksamkeit widmete. Aber es ging mir mehr als einmal durch den Kopf, dass ich, wenn ich erwachsen wäre, nach ihm kommen könnte.
Der Name meiner Mutter war Miyoko Ishikawa. Sie wurde 1925 geboren. Ihre Eltern betrieben einen Laden an der Ecke der alten Einkaufsstraße, in dem sie Hühner verkauften. Meine Großmutter, Hatsu, führte das Geschäft und ihre Arbeit war schwierig und schmutzig. Das Hühnerfleisch war nicht wie heute fein säuberlich geschnitten und verpackt – nichts dergleichen. Vor dem Laden standen, kreuz und quer verteilt, Käfige, und kam ein Kunde, griff sich meine Großmutter ein kreischendes Huhn aus seinem Käfig und schlachtete es auf der Stelle.
Meine Großmutter litt an Asthma, und so hatte sie häufig Hustenanfälle. Immer wenn sie mich erblickte, wenn ich aus der Schule, oder nachdem ich irgendwo spielen gewesen war, nach Hause kam, krümmte sie ihren Rücken und sagte: »Mabo, kannst du mir den Rücken rubbeln?« Dann streichelte und massierte ich ein paar Minuten lang ihren kleinen Rücken. Während dieses Beisammenseins sagte sie immer zu mir: »Du bist ein lieber Junge. Du solltest nicht wie dein Vater sein. Ich kann einfach nicht verstehen, warum deine Mutter den Fehler gemacht und ihn geheiratet hat.«
Ich konnte verstehen, warum sie das Wort »Fehler« verwendete. Die Familie Ishikawa wurde respektiert und hatte in der Gegend eine lange Tradition. In Mizonokuchi gab es viele Zweige der Familie Ishikawa. Sie und der Rest der örtlichen Bevölkerung bildeten eine eng verbundene Gemeinschaft. Mein Großvater, Shoukichi, starb, bevor ich geboren wurde, aber mir wurde immer wieder erzählt, dass er ein guter und freundlicher Mann war, der sich um seine Familie und um andere in seiner Gemeinschaft kümmerte. Er schickte meine Mutter auf eine höhere Schule für Mädchen und ermutigte sie, nähen zu lernen. Obwohl die Familie nicht gerade als reich bezeichnet werden konnte, tat er sein Bestes, seinen Kindern eine Art von Ausbildung zu ermöglichen.
Meine Mutter war eine Frau mit einem starken Charakter. Sie hatte ein ovales Gesicht, das auf seine Art schön war. Mein Vater seinerseits hatte scharfe, messerscharfe Augen, einen gut gebauten Körper und muskulöse Schultern. Ich weiß nicht, was meine Mutter an ihm fand – vielleicht fühlte sie sich von seinem Selbstvertrauen und seinen Überlebensinstinkten angezogen. Ich weiß allerdings, dass die örtliche Gemeinschaft fassungslos war, als die beiden begannen zusammenzuleben. Hinter ihrem Rücken nannten die Leute sie »die Schöne und das Biest« und fragten sich, warum meine Mutter einen so schrecklichen Mann geheiratet hatte.
Meine Großmutter sagte einmal zu mir: »Koreaner sind Barbaren.« Ich liebte sie, aber diese Bemerkung nahm ich ihr übel. Obwohl ich mich als Japaner empfand – und das aus voller Überzeugung –, war ich, wie sie genau wusste, Halbkoreaner. Die älteren Brüder meiner Mutter, Shiro und Tatsukichi, machten gelegentlich ähnliche Bemerkungen. Sie waren zum Dienst in der japanischen Armee in der Mandschurei eingezogen worden und beschrieben Koreaner stets als arm und ungepflegt, wie eine Horde Gorillas. Natürlich trauten sie sich nie, so etwas in Gegenwart meines Vaters zu sagen. Aber wenn mein Vater nicht in der Nähe war, sagte Shiro oft: »Miyoko sollte sich besser so bald wie möglich von ihm scheiden lassen. Koreaner sind einfach von Grund auf verdorben.« Obwohl ich immer ein ungutes Gefühl hatte, wenn er solche Dinge sagte, konnte ich nicht umhin, ihnen zuzustimmen. Ich hegte eine starke Abneigung gegen meinen Vater, der dem Ruf der Koreaner als Barbaren natürlich jedes Mal, wenn er meine Mutter schlug, gerecht wurde. Angesichts der Tatsache, dass wir dabei zuschauen mussten, wie er sie Tag für Tag quälte – und dabei mich und meine Schwestern zu Tode erschreckte –, war es kaum verwunderlich, dass mir die Koreaner, wie meiner Großmutter, immer mehr zuwider wurden.
Mein Vater stolzierte immer mit zwanzig oder dreißig koreanischen Mitläufern im Schlepptau durch unser Viertel. Er war einer der Platzhirsche in der koreanischen Gemeinschaft, und es machte ihm Spaß, sich mit jedem Japaner zu prügeln, der ihm auf die Nerven ging. Es war ihm egal, mit wem er es dabei zu tun hatte. Ein bestimmter Polizist? Na klar. Ein Militärpolizist? Nur her damit. Die Koreaner konnten sich auf seinen Schutz verlassen, aber die Japaner hat er zu Tode erschreckt.
Mein Vater bestand immer darauf, die Dinge auf seine Weise zu regeln. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eröffnete er mit einigen seiner Kumpane einen Schwarzmarktstand am Straßenrand. Sie verkauften Dosennahrung, die in der Munitionsfabrik, in der mein Vater früher gearbeitet hatte, produziert wurde, und Zucker, Mehl, Schiffsgebäck, Kleidung und andere Sachen, die sie sich illegal über amerikanische GIs beschafft hatten. Eines Tages gerieten mein Vater und seine Kumpel wegen der Waren, die er verkaufte, in eine riesige Schlägerei mit amerikanischen Soldaten. Er war aus gutem Grund berüchtigt.
Nicht, dass mein Vater viele Möglichkeiten gehabt hätte. Die japanische Niederlage im Zweiten Weltkrieg führte dazu, dass nun 2,4 Millionen Koreaner in Japan festsaßen. Sie gehörten weder zu den Siegern noch zu den Verlierern und wussten nicht, wohin. Einmal befreit, wurden sie einfach auf die Straße gesetzt. Verzweifelt und verarmt und ohne jede Möglichkeit, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, überfielen sie Lastwagen, die Lebensmittel transportierten, die für die Mitglieder der kaiserlichen japanischen Armee bestimmt waren, und verkauften die Beute auf dem Schwarzmarkt. Selbst diejenigen, die noch nie gewalttätig gewesen waren, hatten kaum eine andere Wahl, als sich den Gesetzlosen anzuschließen.
Auf seltsame Weise hat all diese Illegalität diese Menschen tatsächlich befreit. Während des Krieges hatten sie nur die Wahl zwischen zwei grausamen Perspektiven: Sie konnten entweder als Soldaten in der Armee ihres Feindes dienen oder als zivile Kriegsarbeiter schuften. Als Soldaten wurden sie an die Front geschickt und als menschliche Schilde gegen einen Beschuss benutzt. Die Arbeiter mussten bis zum Umfallen – und manchmal bis zum Tode – in Kohleminen oder Munitionsfabriken malochen. Da war das Leben als Bandit eine Art von Befreiung.
Irgendwann schloss sich mein Vater einer Organisation an, die damals als Allgemeine Vereinigung der Koreaner in Japan bekannt war und sich später Liga der Koreaner in Japan nannte. Diese Gemeinschaft für Koreaner in Japan verfolgte den Grundsatz der Freundschaft zwischen Japanern und Koreanern und bemühte sich, Koreanern dabei zu helfen, in Japan ein sicheres und geordnetes Leben zu führen. Doch so einfach, wie es sich anhörte, war es nicht. Schon vor dem Krieg hatten viele Koreaner, die eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Japan hatten, die Kommunistische Partei geschätzt. Die kommunistische Politik war antiimperialistisch ausgerichtet und die Partei setzte sich für die Rechte der in Japan ansässigen Koreaner ein. Nach dem Krieg, nicht lange nachdem die Vereinigung gegründet worden war, wurde ein bekannter Kommunist mit dem Namen Kim Chon-hae zusammen mit mehreren anderen Mitgliedern der Kommunistischen Partei aus dem Gefängnis entlassen. Diese Personen waren im Gefängnis widerständig geblieben und hatten sich geweigert, ihre Ansichten zu ändern. Nach ihrer Freilassung hatten sie auf die Vereinigung starken Einfluss, was natürlich dazu führte, dass sie sich stärker linksradikal ausrichtete. Doch das Grundprinzip, das damals das Verhalten meines Vaters bestimmte, hatte mit Sozialismus nichts zu tun. Für ihn war der Nationalismus entscheidend.
Aus meiner Perspektive gab es zwischen einer sozialistischen Bewegung, einer nationalistischen Bewegung und einer brutalen Schlägerei auf dem Schwarzmarkt keinen großen Unterschied. All diese Menschen hatten ein paar Dinge gemeinsam. Jeder von ihnen hatte seine eigene persönliche Geschichte in Japan – und sie waren alle arm. Sie wollten nur ihre eigene Existenz verfechten. Und das bedeutete, dass sie kämpfen mussten, wie auch immer sie konnten, um irgendeine Art von Macht zu erlangen.
Innerhalb der Vereinigung wurde mein Vater als »Tiger« bekannt. Das ist keine Überraschung. Er hatte seine »Eingreiftruppe« loyaler Straßenkämpfer, konkret eine Gruppe von Kerlen, die sich vor dem alten Laden versammelten, in einem eisernen Korb ein Feuerchen machten und sich den ganzen Tag lang Schnaps hinter die Binde gossen. Ich weiß nicht, ob sie über Probleme auf dem Schwarzmarkt diskutierten oder einfach nur darauf warteten, dass ihre Eingreiftruppe gebraucht wurde, aber wann immer etwas passierte und ihre Anwesenheit erforderlich wurde, traten sie in Aktion und eilten zum Schauplatz.
Am Ende brach für meinen Vater alles zusammen. Die Allgemeine Vereinigung der Koreaner in Japan wurde 1949 als terroristische Gruppe eingestuft und ihre Auflösung wurde angeordnet. Die Liga der Koreaner in Japan diente vielen als Ersatz, aber die Zeiten hatten sich geändert. Inzwischen war die öffentliche Ordnung wiederhergestellt worden, und jemand wie mein Vater, ein impulsiver und kaum gebildeter Straßenkämpfer, wurde einfach nicht mehr gebraucht. Was die neu gegründete Liga damals wirklich brauchte, waren qualifizierte Verwalter – für meinen Vater, der nicht einmal lesen konnte, gab es in der neuen Ordnung keinen Platz. Ich kann nicht umhin, mich heute zu fragen, ob ihn die Zurückweisung aus dieser Gruppe letztlich empfänglicher für die Versprechungen machte, die ihm nach und nach zu Ohren kamen, dass in Nordkorea ein großartiges Leben möglich sei …
Derzeit stelle ich fest, dass mir immer mehr Erinnerungen wieder in den Kopf kommen. Manchmal wünschte ich, sie würden nicht zurückkommen.
Ich hatte drei jüngere Schwestern – Eiko, Hifumi und Masako –, aber in Japan lebten wir fast nie zusammen. Weil unsere Familie so arm war, wurden wir unter unseren Verwandten aufgeteilt, damit diese sich die Aufgabe, sich um uns zu kümmern, teilen und so die Last erleichtern konnten. Das änderte sich in meinem letzten Grundschuljahr, als wir alle nach Nakano in Tokio zogen. Mein Vater hatte beschlossen, sich um einen Job in der Bauindustrie zu kümmern. Das sagte er zumindest. Ich weiß noch, dass wir in großer Eile umziehen mussten. Wir hatten noch nicht einmal die Zeit, uns von unseren Nachbarn zu verabschieden, und wir mussten unsere geliebte Großmutter zurücklassen.
Obwohl es mich zunächst bekümmerte, alles, was ich kannte, hinter mir zu lassen und an einen Ort zu ziehen, den ich noch nie gesehen hatte, war ich anfangs mit unserem neuen Leben glücklich. Wir begannen wie eine richtige Familie zusammenzuleben. Am Morgen standen wir gemeinsam auf und abends gingen wir zusammen ins Bett. Wir aßen unsere Hauptmahlzeit gemeinsam und wir hatten familiäre Abläufe. Diese Kleinigkeiten bedeuteten mir so viel. Schließlich sind es meist die kleinen Dinge, die die Familien über ein Band der familiären Liebe zusammenhalten. Doch diese glückliche Zeit wurde, kaum dass sie begonnen hatte, zerstört. Es dauerte nicht lange, bis mein Vater wieder gewalttätig wurde – schlimmer als je zuvor.
Wenige Wochen nach unserer Ankunft fing mein Vater wieder an zu trinken, kaum dass er am Ende des Tages nach Hause zurückgekehrt war. Und er trank weiter, bis sein Gesicht einen finsteren Ausdruck annahm. Wenn dies geschah, brachte meine Mutter meine Schwestern und mich in den angrenzenden Raum. Dann standen wir hilflos da und hörten, wie der unvermeidliche Ausbruch folgte. Der bösartige Klang seiner Stimme, als er unsere Mutter zusammenstauchte. Die Geräusche, als er sie schlug. Sein Ton, wenn er versuchte, ihre tränenreichen Schreie zu ersticken.
Dasselbe spielte sich Nacht für Nacht für Nacht ab. Oft konnte ich nicht verstehen, was er zu ihr sagte, aber was auch immer es war, sie schien sich nie gegen ihn zu wehren. Sie weinte nur. Einige Male versuchte ich, in das Zimmer zu platzen, um meinen Vater aufzuhalten. Einmal biss ich ihn sogar ins Bein. Aber er schmiss mich einfach zu Boden. Dann legte sich meine Mutter über mich, um mich mit ihrem Körper zu beschützen. Schließlich wurde es meinem Vater langweilig oder er war so betrunken, dass er aus dem Haus taumelte und in der Nacht verschwand. Und meine Mutter, meine Schwestern und ich saßen dann auf dem Boden, zusammengekauert und leise weinend.
Eines Nachts hörte einer unserer Nachbarn ihre Schreie und schritt ein. Einen Moment lang war mein Vater überrascht, doch kurz darauf packte er den Mann am Hals, drückte ihn gegen die Wand und schlug ihn bewusstlos. Danach kam nie wieder jemand zu uns herein.
Von nun an wurde es nur noch schlimmer. Wenn mein Vater spät in der Nacht nach Hause kam, weckte er meine Mutter auf, nur damit er sie wieder schlagen konnte. Und jede Nacht, wenn ich den Ausdruck des Wahnsinns in seinem Gesicht sah, hatte ich Angst. Es war, als würde man in das Gesicht eines Dämons blicken. Ich konnte nicht einschlafen. Mir stand nur ständig dieses Gesicht vor Augen. Und wenn ich dann einschlief, tauchte es in meinen Albträumen auf.
Dann kam die schlimmste Nacht von allen. Es war Herbst. Ich war zwölf oder dreizehn. Mein Vater kam wie immer stockbesoffen zu Hause an. Aber diesmal sagte er nichts. Er ging in die Küche und kam mit einem Küchenmesser zurück. Er drückte es meiner Mutter an den Hals und zwang sie, nach draußen mitzukommen. Mir war klar, dass ich ihnen folgen musste.
Ich versteckte mich hinter einem Busch und beobachtete, wie mein Vater meine Mutter einen steilen, von Kratern zerklüfteten Hügel hinaufzwang. Hier waren Erde und Sand für die Bauindustrie abgebaut worden. Ich folgte ihnen in der Dunkelheit, da drängte mein Vater meine Mutter an den Rand eines steilen Gefälles. Beim Anblick des in der dunklen Nacht schimmernden Messers zitterte ich vor Angst. Er stieß einen lauten Schrei aus, dann verpasste er ihr einen harten Stoß. Sie heulte auf, als sie rückwärtsstolperte und dann über die Kante kippte. Mein Vater stand einen Moment lang einfach nur da, und während er von oben hinabblickte, schimmerte das Messer noch immer in seiner Hand. Dann stapfte er in Richtung unseres Hauses zurück.
Ich rannte den Hügel hinauf, bis zum Rand und zu der Stelle, von der ich meine Mutter hatte hinabstürzen sehen. Ich konnte nicht erkennen, wie hoch es war, trotzdem sprang ich über den Rand. Glücklicherweise war der Boden weich und ich verletzte mich nicht. Meine Mutter lag da wie eine zerbrochene Puppe, ihre Bluse war von Blut durchtränkt. Ich zog sie hoch, hielt sie fest und schrie: »Du darfst nicht sterben! Stirb mir nicht weg! Du darfst jetzt nicht gehen und in meinen Armen sterben!« Endlich erlangte sie ihr Bewusstsein wieder. Während ich sie umarmte, sagte sie: »Masaji, ich muss fortgehen. Wenn ich das nicht tue, wird er mich töten. Du musst jetzt stark sein.« Ich hielt mich an ihr fest und fühlte mich hilflos und beraubt. Sie war alles für mich – der einzige liebenswürdige Mensch in meinem Leben –, aber ich wusste, sie hatte keine andere Wahl.
Ich half ihr, durch die Dunkelheit zu humpeln. Ich platzte durch die Tür in das Krankenhaus in der Nähe des Bahnhofs und weckte den Arzt. Er war ein netter Mann, der ihre Verletzungen, ohne zu zögern, behandelte. Wundersamerweise brauchte keine ihrer Wunden genäht zu werden.
Später saßen wir still zusammen auf einer Bank in der Nähe des Bahnhofs und warteten auf den ersten Zug des Tages. Plötzlich sprach meine Mutter.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte sie. »Ich werde hart arbeiten und etwas Geld sparen. Und dann komme ich zurück zu dir und deinen Schwestern, also warte solange auf mich.«
Und dann weinte sie nur ganz still vor sich hin. Ihr Gesicht war schmaler und blasser, als ich es jemals gesehen hatte. Sie wirkte leer. Ich wollte stark sein. Aber da saß sie nun, hatte überall Schnitte und Blutergüsse, und ich konnte nichts dagegen tun. So fing auch ich an zu weinen, aus reiner Frustration und Verzweiflung. Warum musste sie eine so schreckliche Tortur ertragen? Warum hasste mein Vater sie so sehr? Sie war so freundlich und lieb. Es ergab für mich keinen Sinn.
Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, stand meine Mutter auf, umarmte mich schnell und ging davon. Sie drehte sich um und winkte mir von der Fahrkartensperre aus zu. Dann trottete ich zu unserem Haus zurück. Ich fühlte mich wie betäubt, verwirrt und sehr allein.
Mein Vater tat so, als wäre nichts passiert. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, zog, kurz nachdem meine Mutter gegangen war, seine Geliebte bei uns ein. Ihr Name war Kanehara und sie stammte wie mein Vater aus Korea. Sie war boshaft und grausam, vor allem gegenüber meinen jüngeren Schwestern, doch mein Vater schlug Kanehara nie. Nicht ein einziges Mal. Tatsächlich schienen sie zu meiner Überraschung ziemlich ineinander vernarrt. Ständig lachten sie und lächelten einander an. Ihr Verhalten machte mich krank. Ich versuchte stark zu sein, doch meine Schwestern vermissten unsere Mutter so sehr, dass sie jede Nacht weinten. Wenn sie weinten, bekamen sie von Kanehara eine Ohrfeige und wurden von ihr beschimpft, was nur dazu führte, dass sie meine Mutter noch mehr vermissten.
Ich ging nicht mehr zur Schule und streifte stattdessen jeden Tag durch Tokio, auf der Suche nach meiner Mutter. Jeden Morgen stieg ich in den Zug und lief stundenlang durch die Straßen. So ging es mindestens ein halbes Jahr lang. Penibel und entschlossen, nicht aufzugeben, suchte ich jedes Restaurant in der Gegend ab, und schließlich wurde meine Mühe belohnt. Eines Nachmittags erblickte ich sie durch das Fenster eines Restaurants. Unfähig, mich zu bewegen, schaute ich ihr zu, wie sie einen Tisch abschrubbte. Dann begann ich zu weinen. Für den Restaurantbesitzer muss ich ziemlich verdächtig gewirkt haben, doch er winkte mich hinein. Ich rannte schnurstracks auf meine Mutter zu und umarmte sie.
Der Restaurantbesitzer gab mir freundlicherweise etwas zu essen. Und plötzlich sprudelten die Worte nur so aus mir hervor. Ich konnte nicht aufhören zu reden. Ich erzählte meiner Mutter alles über Kanehara – wie sie mit uns zusammenlebte und wie sie meine Schwestern behandelte, wie sehr sie sie vermissten und so weiter und so weiter. Sie lächelte sanft. »Hab noch ein wenig Geduld«, sagte sie. Dann gab sie mir ihre Halskette und einen goldenen Ring. »Wenn du irgendwelche Probleme hast«, sagte sie, »dann bring das zu einem Pfandleiher. Aber erzähle deinem Vater nichts von mir, okay? Sag ihm nicht, dass du mich gesehen hast. Erzähle ihm nicht, wo ich bin.«
Jetzt, da ich meine Mutter gefunden hatte, ging ich wieder zur Schule und besuchte sie, sobald der Unterricht zu Ende war, fast jeden Nachmittag. Manchmal, am Wochenende oder an Feiertagen, nahm ich meine jüngeren Schwestern mit. Der Restaurantbesitzer war sehr nett zu uns. Ich vermute, er kannte unsere Geschichte. Was Kanehara betraf, so konnte sie mich schlagen, so viel sie wollte, denn ich glaubte fest daran, dass meine Mutter eines Tages, und schon bald, zurückkommen und uns retten würde.
Blicke ich heute auf alles zurück, kann ich mir die damalige Gemütsverfassung meines Vaters vorstellen. Aber das, was er getan hat, kann ich ihm nicht vergeben.
In seiner Glanzzeit hatte er zwanzig oder dreißig Mitläufer. Und er war der Boss. Der Hauptdarsteller. Der Gottvater. Für den Schwarzmarkt bedeuteten Herkunft und Hintergrund gar nichts. Man konnte ein Ex-Soldat sein. Man konnte zu einer Adelsfamilie gehören. Japaner … Koreaner … Es spielte keine Rolle. Herkunft und Hintergrund waren egal. Alles, worauf es ankam, war die körperliche Stärke, und mein Vater wusste, wie er sich mit Gewalt durchsetzen konnte. Doch später, als der Krieg zu Ende war und überall wieder Normalität einkehrte, hatte seine körperliche Stärke keinen Wert mehr. Mit einem Mal waren Nationalität und Hintergrund das Entscheidende. Und in dieser neuen Hierarchie war mein Vater ein Nichts. Er hatte über seine Herkunft keine familiären Verbindungen. Schlimmer noch, er war Koreaner. Das machte es schwer, eine Arbeit zu finden. Als die Allgemeine Vereinigung der Koreaner in Japan verboten wurde, war seine Führungsrolle in seiner Eingreiftruppe dahin. Während seine Ex-Kameraden in der Liga der Koreaner in Japan in luftige Höhen aufstiegen, kroch er ohne Perspektive weiterhin im Dreck herum. So ließ er alles an meiner Mutter aus. Ihre Familie besaß immerhin etwas Eigentum und sie selbst hatte eine vernünftige Ausbildung – Dinge, nach denen er hungerte, die er selbst jedoch nie erlangen konnte. So trug sie die Hauptlast seines ganzen Zorns gegenüber der Welt. Anfangs fragte ich mich, warum er Kanehara nie schlug. Ich vermute, das hatte den Grund, dass sie Koreanerin war und für ihn nicht eine ständige Erinnerung an all das verkörperte, was er nicht haben konnte.
Eine Sache, die ich in dieser Zeit gelernt habe, war, dass manche Menschen – Leute wie mein Vater – zwar gerne ihre körperliche Stärke zur Schau stellen, andere aber einen besonderen Grund haben, gewalttätig zu sein.
In meinem letzten Grundschuljahr entschied mein Vater, dass ich, obwohl ich kein Koreanisch sprach, auf eine koreanische Mittelschule gehen sollte. Das wollte ich nicht, doch ich hatte zu viel Angst, mich seinen Wünschen zu widersetzen, also tat ich das.
Die meisten an unserer Schule kamen aus armen Familien. Unsere Armut hatte schlicht und einfach mit rassistischer Diskriminierung zu tun. Die meisten Schüler ließen ihrer Frustration darüber nie aktiv freien Lauf – sie waren einfach zu sehr damit beschäftigt, über die Runden zu kommen –, doch das hieß nicht, dass sie alles hinnahmen. Wenn sie draußen spielten oder auf ihrem Weg von der Schule nach Hause waren, hatten meine Schulfreunde oft Auseinandersetzungen mit Japanern. Mit der Zeit lernten sie alle, Rassendiskriminierung mit Gewalt in Verbindung zu bringen. Und die Logik war einfach. Wenn dich jemand schlug, hieltst du ihm nicht die andere Wange hin. Du schlugst zurück. Doppelt so hart.
Schaute ich mir meine Klassenkameraden an, hatte ich zwiespältige Gefühle. Nun, da ich seit einer Weile einen Klassenraum mit ihnen teilte, fühlte ich mich ihnen zunehmend zugehörig. Mir wurde langsam deutlich, dass meine Großeltern und andere Verwandte falschlagen. Koreaner waren keineswegs wie die Monster, die sie beschrieben hatten. Oh, natürlich, sie waren ruppig – wie auch nicht –, aber sie waren auch herzlich und freundlich. Obwohl ich zu den meisten immer noch auf Abstand blieb, fing ich an, mich mit einem Jungen namens Kan Te-son zu unterhalten, der in der Klasse neben mir saß. Wir alle hatten kurz geschorene Haare, aber Sons Haare waren trotz der Schulregeln irgendwie wild und struppig. Seine Haare ähnelten einer Mähne, die ihm den Spitznamen »Löwe« einbrachte.
Nachdem Löwe über meine familiäre Situation Bescheid wusste, lud er mich eines Tages zu sich nach Hause ein. Wir gingen durch das Gewirr der Straßen eines koreanischen Viertels in der Nähe einer Konfektfabrik und in der Luft lag ein wunderbarer Duft nach Süßigkeiten. Als wir bei ihm zu Hause ankamen, fragte mich seine Mutter sofort, ob ich hungrig sei. Einen Augenblick später eilte sie in die Küche und kam mit Reis, koreanischen Gurken und einigen anderen Gerichten zurück. Schnell war der Tisch mit Speisen vollgedeckt.
Immer wieder sagte sie: »Iss mehr!«, auch wenn mein Mund gerade voll war und ich an dem Reis, den ich verschlang, praktisch schon erstickte. Löwe und seine Mutter beobachteten mich, und ich konnte nicht umhin, ihr Lächeln zu bemerken. Ich hatte mütterliche Liebe erfahren und natürlich liebte ich meine Schwestern sehr, doch dies war das erste Mal, dass ich echte Zuneigung von Menschen spürte, die nicht mit mir verwandt waren. Ihre Herzlichkeit und ihr Mitgefühl waren greifbar. Um die Wahrheit zu sagen, ich war so verblüfft, dass ich kaum schlucken konnte. Seither war Löwes Haus der einzige Ort, an dem ich mich entspannen konnte. Selbst als mein Leben seine Windungen und Wendungen nahm, vergaß ich nie die Freundlichkeit seiner Familie.
Nun, da Löwe und ich Freunde geworden waren, fühlte ich mich eher in der Lage, mit meinen Klassenkameraden zu reden. Doch der größte Teil meines Unterrichts blieb mir noch immer total unverständlich, denn er wurde auf Koreanisch abgehalten. Mit Mathe ging das, mit den Naturwissenschaften bis zu einem gewissen Grade auch. Aber der Rest war einfach Kauderwelsch. Doch es gab noch andere wie mich, die überhaupt kein Koreanisch konnten. Und wissen Sie was? Manche Lehrer brachen die Regeln und erklärten uns Dinge auf Japanisch. Dissidenten!
Uns wurde beigebracht, dass Kim Il-sung »der König« war, »der Korea vom Kolonialismus befreite«. Er hatte einen Krieg gegen die US-Imperialisten und ihre südkoreanischen Lakaien geführt – und hatte gewonnen. Uns wurde gründlich eingetrichtert, dass Kim Il-sung ein unbesiegbarer Feldherr aus Stahl war. Ich konnte feststellen, dass die Lehrer stolz auf seine Rolle des Großen Führers einer aufstrebenden Nation waren.